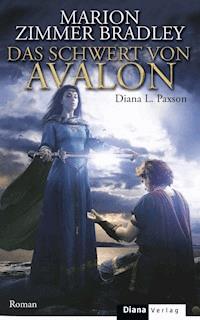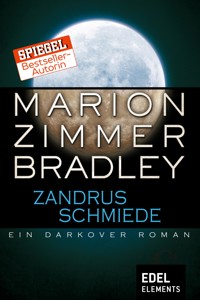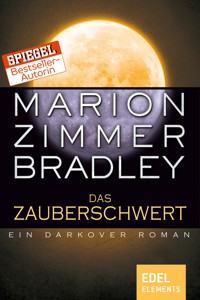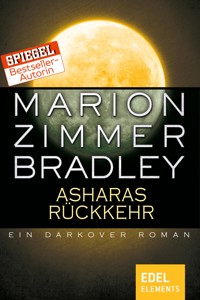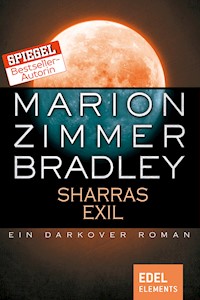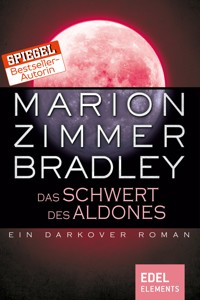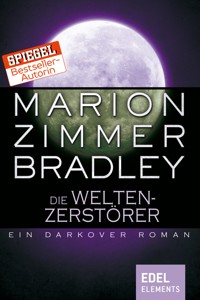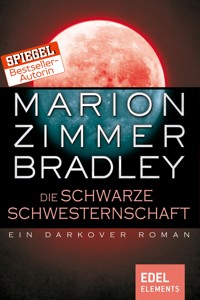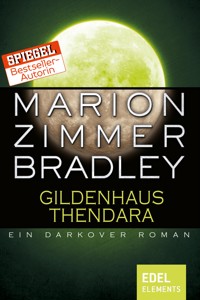
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Darkover-Zyklus
- Sprache: Deutsch
Bestsellerautorin Marion Zimmer Bradley ("Die Nebel von Avalon") hat mit dem opulenten Darkover-Zyklus eine einzigartige Romanreihe geschaffen: Die fesselnde Geschichte einer geheimnisvollen fremden Welt und ihrer Bewohner ist Kult! Die "Entsagenden" – so nennen sich die Freien Amazonen, die einen Eid geschworen haben, sich nie wieder von einem Mann beherrschen zu lassen. Ihre Heimstatt sind die Gildenhäuser. Hier treffen sich die starken und unerschrockenen Frauen, um die geheimnisvolle Vergangenheit einer der ihren aufzudecken...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 886
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marion Zimmer Bradley – Der “Darkover”-Romanzyklus bei EdeleBooks:
Marion Zimmer Bradley
Ins Deutsche übertragen von Rosemarie Hundertmarck
Copyright dieser Ausgabe © 2014 by Edel eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg. Copyright © 1983 by Marion Zimmer Bradley Copyright First german Edition © 2000 by Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München. Die Originalausgabe erschien 1983 unter dem Titel "Thendara House" Ins Deutsche übertragen von Rosemarie Hundertmarck Trotz intensiver Recherche war es dem Verlag nicht möglich, den Rechteinhaber der Übersetzung zu identifizieren bzw. einen Kontakt herzustellen. Wie bitten den Übersetzer bzw. seinen Nachfolger, sich ggf. beim Verlag zu melden.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-603-8
edel.com
Der Eid der Freien Amazonen
Von diesem Tag an entsage ich dem Recht zu heiraten, außer als Freipartnerin. Kein Mann soll mich di catenas binden, und ich werde in keines Mannes Haushalt als barragana leben.
Ich schwöre, dass ich bereit bin, mich mit Gewalt zu verteidigen, wenn man mich mit Gewalt angreift.
Ich schwöre, dass ich von diesem Tag an nie mehr den Namen eines Mannes führen will, sei er Vater, Vormund, Liebhaber oder Gatte, sondern einzig und allein als die Tochter meiner Mutter bekannt sein werde.
Ich schwöre, dass ich mich von diesem Tag an einem Mann nur hingebe, wenn ich den Zeitpunkt bestimmen kann und es mein eigener freier Wille ist.
Ich schwöre, dass ich ein Kind nur dann gebären will, wenn es mein Wunsch ist, das Kind von diesem Mann und zu diesem Zeitpunkt zu empfangen. Weder die Familie noch der Clan des Mannes, weder Fragen der Erbfolge noch sein Stolz oder sein Wunsch nach Nachkommenschaft sollen dabei Einfluss auf mich haben.
Von diesem Tag an enden für mich alle Verpflichtungen, die ich gegenüber Familie, Clan, Haushalt, Regent oder Lehnsherr hatte. Achtung schulde ich wie jeder freie Bürger nur den Gesetzen des Landes, dem Königtum, der Krone und den Göttern.
Ich werde an keinen Mann Rechtsansprüche stellen, dass er mich beschütze, mich ernähre oder mir helfe. Eine Treuepflicht habe ich nur gegenüber meiner Eidesmutter, meinen Schwestern in der Gilde und meinem Arbeitgeber, solange ich bei ihm beschäftigt bin.
Und weiter schwöre ich, dass jedes einzelne Mitglied der Gilde freier Amazonen für mich sein soll wie meine Mutter, meine Schwester oder meine Tochter, geboren aus einem Blut mit mir. Ich schwöre, dass ich von diesem Augenblick an den Gesetzen der Gilde Freier Amazonen und jedem rechtmäßigen Befehl meiner Eidesmutter, der Gildenmutter und meiner gewählten Anführerin gehorchen werde. Und wenn ich ein Geheimnis der Gilde verrate oder meinen Eid breche, dann werde ich mich der Strafe unterwerfen, die die Gildenmütter über mich verhängen, und wenn ich das nicht tue, dann möge sich die Hand jeder Frau gegen mich erheben, sie sollen mich erschlagen dürfen wie ein Tier und meinen Körper unbeerdigt der Verwesung und meine Seele der Gnade der Göttin überlassen.
I Sich widersprechende Eide
1Magdalen Lorne
Es fiel leichter Schnee, aber nach Osten zu sah die blutige Sonne Darkovers – von den Terranern Cottman IV genannt – wie ein großes, blutdurchschossenes Auge durch eine Wolkenlücke.
Fröstelnd ging Magdalen Lorne die Straße zum Terranischen HQ hinunter. Sie trug darkovanische Kleidung, deshalb zeigte sie den Raumsoldaten am Tor ihren Ausweis. Einer von ihnen kannte sie jedoch vom Sehen.
»Ist schon gut, Miss Lorne. Aber Sie müssen zu dem neuen Gebäude hinübergehen.«
»Dann sind die Räume für den Nachrichtendienst endlich fertig?«
Der Uniformierte nickte.
»So ist es. Die neue Leiterin ist vor ein paar Tagen von Alpha Centauri gekommen – haben Sie sie schon kennen gelernt?«
Für Magda waren das echte Neuigkeiten. Darkover war ein geschlossener Planet der Klasse B, und das bedeutete, dass Terraner – zumindest offiziell – auf bestimmte vertraglich festgelegte Zonen und Handelsstädte beschränkt waren. Einen Nachrichtendienst gab es eigentlich gar nicht, abgesehen von einem kleinen Büro in der Abteilung Archiv und Kommunikation, das vom Personal des Koordinators verwaltet wurde.
Es ist auch Zeit, dass hier endlich eine Dienststelle eröffnet wird. Eine Abteilung für Fremd-Anthropologie könnte ebenso wenig schaden. Dann überlegte Magda, was es für ihren eigenen ziemlich irregulären Status bedeuten mochte. Sie war auf Darkover geboren, in Caer Donn. Dort hatten die Terraner ihren ersten Raumhafen errichtet, bevor sie das neue Imperiumshauptquartier hier nach Thendara verlegten. Magda war unter Darkovanern aufgewachsen. Damals galt die Vorschrift noch nicht, dass Raumhafengebäude mit erdnormalem Licht beleuchtet werden mussten – eine Vorschrift, die die rote Sonne Darkovers und das grimmig kalte Klima ignorierte. Es war eine vernünftige Politik im Hinblick auf Personal, das auf normalen Imperiumsplaneten selten länger als ein Jahr Dienst tat und sich nicht zu akklimatisieren brauchte. Aber die Bedingungen auf Darkover waren, um das Mindeste zu sagen, für einen Imperiumsplaneten nicht normal.
Magdas Eltern waren Linguisten gewesen und hatten einen Großteil ihres Lebens in Caer Donn verbracht. Ihre Tochter war eher Darkovanerin als Terranerin, eine der nur drei oder vier Personen, die die Sprache wie Eingeborene beherrschten und im Stande waren, in Verkleidung Sitten und Gebräuche zu erforschen. Magda hatte Darkover nur einmal verlassen, als sie drei Jahre zur Ausbildung an der Akademie des Nachrichtendienstes auf Alpha verbrachte. Es ergab sich von selbst, dass sie danach eine Stellung in der Abteilung Kommunikation annahm. Aber was für ihre Vorgesetzten nichts als eine passende Verkleidung gewesen war, in der sie auf dem Planeten ihrer Geburt als Undercover-Agentin arbeiten konnte, wurde für Magda zu ihrem eigentlichen Ich.
Und diesem darkovanischen Ich Margali muss ich jetzt treu bleiben, nicht der Terranerin Magda. Ich bin auch nicht einfach Margali, sondern Margali n’ha Ysabet, Entsagende von den Comhi’Letzii, die von den Terranern die Freien Amazonen genannt werden. Das ist es, was ich jetzt bin und was ich hinfort sein muss, men dia pre’zhiuro ... Erschauernd flüsterte Magda die ersten Worte des Eides der Entsagenden vor sich hin. Es würde nicht leicht sein. Aber sie würde tun, was sie geschworen hatte. Für einen Terraner war ein unter Gewaltandrohung erzwungener Eid nicht bindend. Mich als Darkovanerin bindet der Eid nun einmal. Schon der Gedanke daran, ihn zu brechen, wäre unehrenhaft.
Magda riss ihre Gedanken von diesem Endlosband in ihrem Gehirn los. Neue Räume für den Nachrichtendienst, hatte der Mann gesagt, und eine neue Leiterin. Wahrscheinlich, dachte Magda mit resigniertem Schulterzucken, eine Frau, die über ihre Aufgabe beträchtlich weniger wusste als sie selbst. Magda und ihr ehemaliger Mann Peter Haldane waren beide hier geboren, waren zweisprachig aufgewachsen, kannten und akzeptierten die darkovanischen Sitten als ihre eigenen. Doch das war nicht die Art, wie das Imperium an eine Sache heranging.
Das Büro des Nachrichtendienstes war hoch über dem Raumhafen in einem Wolkenkratzer untergebracht worden, der noch vor Neuigkeit glänzte. In dem erdnormalen Licht, zu hell für Magdas Augen, sah sie eine Frau stehen, eine Frau, die sie kannte oder doch einmal sehr gut gekannt hatte.
Cholayna Ares war größer als Magda und braunhäutig. Sie hatte weißes Haar, und Magda hatte nie herausgebracht, ob es vorzeitig ergraut oder von Natur aus immer silberweiß gewesen war, denn ihr Gesicht wirkte ungewöhnlich jung, damals wie heute. Sie lächelte und streckte in einer herzlichen Geste die Hand aus, und Magda ergriff die Hand ihrer alten Lehrerin.
»Es ist kaum zu glauben, dass du deinen Posten an der Akademie aufgegeben hast«, sagte Magda. »Bestimmt doch nicht, um hierher zu kommen ...«
»Oh, aufgegeben habe ich ihn eigentlich nicht«, lachte Cholayna Ares. »Es gab den üblichen bürokratischen Hickhack – jede Gruppe versuchte, mich auf ihre Seite zu ziehen, und deshalb wünschte ich beiden die Pest an den Hals und stellte einen Antrag auf Versetzung. So landete ich – hier. Es ist kein begehrter Posten, deshalb gab es keine Konkurrenz. Ich erinnerte mich, dass du von hier stammtest und dass du diese Welt liebtest. Nicht viele Leute bekommen die Chance, den Nachrichtendienst auf einem Planeten der Klasse B aus dem Nichts aufzubauen. Und mit dir und Peter Haldane – habe ich nicht einmal gehört, du hättest ihn geheiratet?«
»Die Ehe ist letztes Jahr in die Brüche gegangen«, antwortete Magda. »Das Übliche.« Sie wehrte die teilnahmsvolle Neugier, die aus den Augen ihrer früheren Lehrerin sprach, mit einem harten Schulterzucken ab. »Das einzige Problem, das daraus entstand, ist, dass man uns nicht länger gemeinsam zum Feldeinsatz hinausgeschickt hat.«
»Wenn es hier gar keinen Nachrichtendienst gab, was habt ihr dann im Feldeinsatz gemacht?«
»Wir gehörten zur Abteilung Kommunikation«, berichtete Magda, »und betrieben Sprachforschung. Einmal ließ man mich auf dem Marktplatz Witze und Redensarten sammeln, nur um mit der Entwicklung der Sprache beziehungsweise des Slangs Schritt zu halten, damit Leute, die tatsächlich ins Feld mussten, keine dummen Fehler machen würden.«
»Und du bist an meinem ersten Tag in der neuen Stellung hergekommen, um mich zu begrüßen und willkommen zu heißen?«, fragte Cholayna. »Setz dich – erzähl mir alles über diesen Planeten. Es ist lieb von dir, Magda. Ich habe immer gesagt, dass du im Nachrichtendienst Karriere machen würdest.«
Magda senkte den Blick. »Ich bin nicht deinetwegen hierher gekommen – wusste gar nicht, dass du hier warst.« Sie sagte sich, dass ihr nichts übrig blieb, als mit der Wahrheit herauszurücken. »Ich bin gekommen, um zu kündigen.«
Cholaynas dunkle Augen verrieten, wie bestürzt sie war.
»Magda! Du und ich, wir beide wissen doch, wie es im Zivildienst zugeht: Natürlich hätte man dir diesen Posten anbieten sollen, aber ich dachte immer, wir seien Freundinnen und du wärest bereit, zumindest für eine Weile zu bleiben!«
Das war nicht Magdas Grund, nur war das natürlich der Eindruck, den Cholayna gewinnen musste. Magda wünschte, die neue Leiterin sei eine völlige Fremde gewesen oder doch jemand, den sie nicht mochte, nicht eine Frau, die sie immer gern gehabt und respektiert hatte.
»O nein, Cholayna! Ich gebe dir mein Wort, es hat nichts mit dir zu tun! Ich wusste nicht einmal, dass du hier warst, ich war bis gestern Abend im Feld ...« In ihrem Eifer, Cholayna von der Wahrheit zu überzeugen, begann sie zu stottern. Cholayna runzelte die Stirn und winkte ihr, sich zu setzen.
»Du solltest mir vielleicht besser alles von Anfang an erzählen, Magda.«
Magda nahm Platz. Ihr war unbehaglich zu Mute. »Du warst heute Morgen nicht bei der Besprechung. Du weißt es noch nicht. Während ich draußen im Feld war – habe ich den Eid einer Entsagenden geleistet.« Auf den verständnislosen Blick ihrer Kollegin hin erläuterte sie: »In den Akten werden sie die Freien Amazonen genannt; sie lieben den Namen nicht. Ich bin verpflichtet, ein halbes Jahr zur Ausbildung im Gildenhaus von Thendara zu verbringen, und danach – danach bin ich mir nicht sicher, was ich tun werde, glaube jedoch nicht, dass es Arbeit für den Nachrichtendienst sein wird.«
»Aber, Magda, das ist doch eine wundervolle Gelegenheit!«, rief Cholayna aus. »Ich denke nicht im Traum daran, deine Kündigung anzunehmen! Wenn du möchtest, versetze ich dich für dies halbe Jahr in inaktiven Status, aber denke einmal an das wissenschaftliche Material, das du hieraus gewinnen kannst! Deine Arbeit wird bereits als beispielhaft betrachtet – das habe ich von dem Legaten gehört«, setzte sie hinzu. »Wahrscheinlich weißt du mehr über darkovanische Bräuche als sonst irgendwer, der hier arbeitet. Mir wurde auch berichtet, die Medizinische Abteilung habe zugestimmt, eine Gruppe Freier Amazonen auszubilden ...« Sie sah Magda leicht zusammenzucken und verbesserte sich: »Wie hast du sie genannt? Entsagende? Klingt wie ein Nonnenorden, welchen Dingen entsagen sie denn? Das scheint mir ein seltsamer Ort für dich zu sein.«
Magda lächelte über den Vergleich. »Ich könnte dir den Eid zitieren. Hauptsächlich entsagen sie – wir – im Ausgleich für gewisse Freiheiten dem Schutz, den die Gesellschaft den Frauen bietet.« Sogar in ihren eigenen Ohren klang das jämmerlich unzulänglich, aber wie sollte sie es erklären? »Ich tue es jedoch nicht, um eine Dissertation zu schreiben, weißt du, oder dem Terranischen Nachrichtendienst Informationen zu liefern. Aus dem Grund möchte ich kündigen.«
»Und aus dem gleichen Grund weigere ich mich, deine Kündigung anzunehmen«, sagte Cholayna.
»Glaubst du, ich werde meine Freundinnen im Gildenhaus bespitzeln? Niemals!«
»Ich bedauere, dass du es auf diese Weise ansiehst, Magda. Ich sehe es nicht so. Je mehr wir über die verschiedenen Gruppen eines Planeten wissen, desto leichter ist es für uns – und ebenso für den Planeten, auf dem wir uns befinden, weil es weniger Möglichkeiten für Missverständnisse und Ärger zwischen dem Imperium und den Einheimischen gibt ...«
»Ja, ja, das habe ich alles auf der Akademie des Nachrichtendienstes gelernt«, erklärte Magda ungeduldig. »Das ist die offizielle Politik, nicht wahr?«
»So würde ich es nicht ausdrücken.« In Cholaynas Stimme klang etwas wie sorgfältig unter Kontrolle gehaltener Ärger mit.
»Aber ich, und ich begreife allmählich, wie es missbraucht werden kann.« Jetzt geriet auch Magda in Harnisch. »Wenn du meine Kündigung nicht genehmigen willst, Cholayna, muss ich eben ohne deine Genehmigung gehen. Darkover ist meine Heimat. Und wenn ich mein Bürgerrecht im Imperium dafür aufgeben muss, eine Entsagende zu werden, dann ...«
»Nun mal langsam, Magda, bitte!« Cholayna hob die Hand und unterbrach den wütenden Wortstrom. »Und setz dich wieder, ja?« Magda merkte jetzt erst, dass sie aufgesprungen war. Langsam ließ sie sich auf ihren Stuhl niedersinken. Cholayna ging zu der Bestellautomatik an der Wand des Büros, wählte zwei Tassen Kaffee und kam, die heißen Tassen auf der Handfläche balancierend, zu Magda zurück. Sie nahm neben ihr Platz.
»Magda, vergiss einmal eine Minute lang, dass ich deine Vorgesetzte bin. Ich habe immer gedacht, wir seien Freundinnen. Ich kann nicht glauben, dass du weglaufen willst, ohne mir eine Erklärung zu geben.«
Ich habe sie auch für meine Freundin gehalten, dachte Magda und nahm einen Schluck Kaffee. Aber jetzt weiß ich, dass ich in Wirklichkeit nie Freundinnen gehabt habe; ich habe nicht einmal gewusst, was Freundschaft ist. Ich habe mich immer so sehr darum bemüht, beruflich akzeptiert zu werden, dass ich nie darauf geachtet habe, was andere Frauen taten oder unterließen. Bis ich Jaelle begegnete und erfuhr, was es bedeutet, eine Freundin zu haben, für die ich kämpfen und, wenn es sein muss, sterben würde. Cholayna ist auch gar nicht meine Freundin, sie ist meine Vorgesetzte und benutzt unsere Freundschaft dazu, mich zu zwingen, dass ich tue, was sie will. Vielleicht bildet sie sich ein, eben das sei Freundschaft, das ist die terranische Denkungsweise. Ich bin einfach keine Terranerin mehr. Vielleicht bin ich nie eine gewesen.
»Warum erzählst du mir die ganze Geschichte nicht, Magda?« Cholaynas freundlicher Blick verwirrte Magda von neuem. Vielleicht sieht sie sich tatsächlich als meine Freundin.
Sie fing ganz am Anfang an und berichtete Cholayna, wie Peter Haldane, ihr Freund und Partner und eine Zeit lang ihr Mann, von Räubern entführt worden war, die ihn irrtümlich für Kyril Ardais, den Sohn der Lady Rohana Ardais, hielten. Magda, die sich fürchtete, als Frau allein zu reisen, hatte sich von Lady Rohana überreden lassen, sich als Freie Amazone zu verkleiden. Die Täuschung wurde offenbar, als sie einer Gruppe echter Entsagender, angeführt von Jaelle n’ha Melora, begegnete.
»Die Strafe für einen Mann, der sie in Frauenkleidung infiltrierte, wäre der Tod oder die Kastrierung gewesen«, erläuterte Magda. »Bei einer Frau besteht die Strafe nur darin, dass die Lüge zur Wahrheit gemacht werden muss; sie darf die Freiheit, die der Eid ihr gewährt, nicht genießen, ohne vorher auf den Schutz verzichtet zu haben, den das Gesetz speziell den Frauen bietet.«
»Ein erzwungener Eid ...«, begann Cholayna. Magda schüttelte den Kopf.
»Nein. Mir wurde freie Wahl gelassen. Sie boten mir an, mich in ein Gildenhaus zu bringen, wo eine der Mütter entscheiden würde, ob man mich in Anbetracht der besonderen Umstände nicht einfach laufen lassen solle, wenn ich verspräche, alles Erlebte geheim zu halten.« Sie seufzte und fragte sich müde, ob es das wert gewesen sei. »Dadurch hätte ich zu viel Zeit verloren. Peter sollte zu Mittwinter getötet werden, wenn das Lösegeld bis dahin nicht gebracht war. Freiwillig entschied ich mich für den Eid, aber ich leistete ihn mit einer ganzen Menge von Vorbehalten. Ich empfand genauso wie du jetzt. Nur hat sich meine Einstellung zwischen damals und heute – geändert.«
Ihr war klar, dass das lächerlich klang. Doch als sie weitersprach, verriet sie nur wenig von den grausamen inneren Kämpfen, als sie halbwegs entschlossen gewesen war, zu fliehen und ihren Eid zu brechen, selbst wenn sie dazu Jaelle hätte töten oder sich von den Räubern hätte abschlachten lassen müssen, und wie sie sich an der Seite Jaelles kämpfend wiedergefunden und ihr das Leben gerettet hatte ...
Cholayna lauschte der Geschichte. Sie stand nur einmal auf, um die Kaffeetassen neu zu füllen. Schließlich sagte sie: »In gewissem Ausmaß kann ich verstehen, warum du dich verpflichtet fühlst.«
»Es ist nicht nur das«, erwiderte Magda. »Der Eid ist für mich sehr real geworden. Ich fühle mich in meinem Herzen als Entsagende – ich glaube, ich wäre längst eine geworden, wenn ich gewusst hätte, dass es sie gibt. Jetzt ...« Wie sollte sie es erklären? Sie trank den Rest kalten Kaffees aus und schloss hilflos: »Es ist etwas, das ich tun muss.«
Cholayna nickte. »Das sehe ich ein. Ich weiß nicht, ob es einen Präzedenzfall gibt. Von Männern, die auf einigen Imperiumsplaneten ›über die Mauer gegangen‹ sind und sich den Eingeborenen angeschlossen haben, weiß ich, doch ich glaube nicht, dass ich das jemals von einer Frau gehört habe.«
»Ich gehe nicht eigentlich »über die Mauer‹«, protestierte Magda. »In dem Fall säße ich nicht hier in deinem Büro und reichte nicht offiziell meine Kündigung ein.«
»Die ich nicht akzeptieren werde«, gab Cholayna zurück. »Nein, hör mir zu – ich habe dir auch zugehört, nicht wahr? Es gibt hier keinen Präzedenzfall; ich glaube, eine vereidigte Angestellte des Zivildienstes hat gar keine Möglichkeit, auf ihr Bürgerrecht im Imperium zu verzichten. Du hast deine Wahl getroffen, als du den Entschluss fasstest, drei Jahre lang die Akademie des Nachrichtendienstes zu besuchen ...«
»Ich habe genug gearbeitet, um dem Imperium die Kosten zurückzuzahlen ...«
Cholayna brachte sie mit einer Geste zum Schweigen. »Das stellt niemand in Frage, Magda. Ich bin gern bereit, dich in den inaktiven Status zu versetzen, wenn du deine sechs Monate – dies halbe Jahr – haben musst. Wie lang ist übrigens ein darkovanisches Jahr? Aber mir ist hier etwas auf den Schreibtisch geflattert, das eine Ergänzung zu dem, was du mir erzählt hast, darstellt.«
Sie griff nach einem Ordner mit Ausdrucken. »Zufällig habe ich hier eine Nachricht des Rates«, sagte sie. Magda warf einen Blick darauf. Vor diesem Rat war Lord Hastur gezwungen worden, den Eid einer Terranerin als gültig anzuerkennen, und gleichzeitig hatten die Gildenmütter verlangt, die Terraner sollten der Entsagenden Jaelle n’ha Melora den Posten im Hauptquartier geben, den Magda innegehabt hatte, und dazu noch ein dutzend Freie Amazonen einstellen. »Ja, ja, schon gut, ein Dutzend Entsagende«, berichtigte Cholayna sich schnell. »Sie sollen in unserer Medizinischen Abteilung zu medizinisch-technischen Assistentinnen und möglicherweise noch in anderen Wissenschaften und Berufszweigen ausgebildet werden. Wenn Jaelle bei uns arbeitet, solange du im Gildenhaus bist, solltest du dich meiner Meinung nach in diesem halben Jahr besonders dafür qualifizieren, Richtlinien für die Beschäftigung darkovanischen Personals, besonders weiblichen, festzusetzen. Wir sind bereit, dich solange zu beurlauben. Unter Darkovanerinnen lebend, kannst du herausfinden, welche Frauen mit dem Kulturschock fertig würden, wenn sie in den Dienst des Imperiums träten, du kannst uns sagen, wie wir sie behandeln müssen, um die bestmögliche Kommunikation zwischen Terranern und Darkovanern zu erreichen. Du bist der einzige Mensch, der dazu geeignet ist, wenn du tatsächlich in einem Gildenhaus lebst.«
»Also hast du das alles schon gewusst, Cholayna! Warum hast du mich dazu gebracht, es dir zu erzählen?«
»Ich wusste nur, was du gesagt und was die Gildenmütter über dich gesagt hatten«, erwiderte Cholayna. »Ich wusste nichts von deinen Gefühlen in dieser Sache. Wenn die Studentin, die ich gekannt habe, die richtige Art von Mädchen war, heißt das noch lange nicht, dass die Frau, die eine ausgebildete Agentin geworden ist, zu der Art gehört, der wir trauen dürfen.«
Cholayna fuhr fort, und irgendwie besänftigten ihre Worte Magdas Zorn: »Verstehst du das nicht? Es ist für deine Entsagenden ebenso gut wie für das Imperium, wenn sie hierher kommen und die schlimmsten Folgen des Kulturschocks gedämpft werden. Außerdem ist es von Vorteil, zu wissen, bei welchen Terranern wir uns darauf verlassen können, dass sie die Darkovanerinnen anständig behandeln. Du weißt es – und ich war mir darüber im Klaren, noch bevor ich zehn Tage hier war –, dass Russ Montray sich, sobald hier eine Botschaft errichtet wird, zum Legaten ebenso wenig eignet wie ich mich zur Pilotin eines Sternenschiffes! Ihm gefällt der Planet nicht, und er hat kein Verständnis für seine Bewohner. Du hast es, das erkenne ich an der Art, wie du von ihnen sprichst.«
Versucht sie, mir zu schmeicheln, damit sie mich dahin kriegt, wohin sie mich haben will? Natürlich wusste Magda, dass Montray weitaus weniger geeignet war als sie selbst. Aber auf einem Planeten wie Darkover mit seinen streng vorgeschriebenen traditionellen Rollen für Männer und Frauen würde Magda, das war ihr klar, niemals die Stellung eines Legaten oder einen vergleichbaren Posten erreichen, weil die Darkovaner eine Frau in einer solchen Position niemals anerkennen würden. Cholayna war nur deshalb zur Leiterin des Nachrichtendienstes ernannt worden, weil sie lediglich mit ihren Feldagenten, aber nicht mit Darkovanern in direkten Kontakt kommen würde.
»Magda, so wie du mich ansiehst, macht dir doch irgendetwas an dieser Sache Sorgen ...«
»Ich möchte nicht den Anschein erwecken, dass ich meine Schwestern im Gildenhaus ausspioniere ...«
»Es würde mir nie einfallen, das von dir zu verlangen«, versicherte Cholayna. »Du sollst nur für Terraner, die mit darkovanischen Frauen, besonders mit den Entsagenden, die für das Imperium arbeiten werden, in engen Kontakt kommen, bestimmte Verhaltensregeln ausarbeiten. Das ist zu unserm Vorteil, gewiss – aber ich könnte mir vorstellen, dass deine ... deine Gildenschwestern noch mehr Nutzen davon hätten.«
Das ließ sich unmöglich leugnen. Tatsächlich würde Magda Darkover genau den Dienst erweisen, den die Gildenmütter sich wünschten, wie sie bei jener Ratssitzung gesagt hatten. Sie erinnerte sich an die Worte Mutter Laurias:
»Deshalb sind wir heute hierher gekommen, um euch solche Dienste anzubieten, die geeignet zur Entwicklung einer sinnvollen Kommunikation zwischen unseren Welten sind: als Kartenzeichnerinnen, Führerinnen, Dolmetscherinnen und Fachkräfte in anderen Bereichen, wo die Terraner Darkovanerinnen einzusetzen wünschen. Wohl wissend, dass ihr vom Imperium uns viel zu lehren habt, verlangen wir im Ausgleich dafür, dass eine Gruppe unserer jungen Frauen als Lehrlinge in euren Gesundheitsdienst und andere wissenschaftliche Abteilungen aufgenommen wird.«
Und das war ein wirklicher Durchbruch gewesen. Vor diesem Tag hatten die Männer des Imperiums die Kultur Darkovers nur nach den Frauen einschätzen können, die sie in den Raumhafenbars und auf dem Marktplatz kennen lernten. Als sie Mutter Lauria dies sagen hörte, erkannte Magda, dass sie eine der Ersten sein würde, die kamen und gingen und Brücken zwischen ihrer neuen und der alten Welt bauten. Sie senkte den Kopf und kapitulierte. Noch immer war sie eine Agentin des Nachrichtendienstes, ganz gleich, wie sie es bedauern mochte.
»Was deine Kündigung angeht – vergiss sie. So etwas kannst du nicht machen, ohne sehr viel länger darüber nachgedacht zu haben. Lass die Türen offen. In beiden Richtungen.« Cholayna streichelte Magdas Hand. Es war eine so unerwartete Geste, und irgendwie vertrieb sie Magdas Feindseligkeit.
»Wir müssen wissen, wie wir diese Entsagenden behandeln sollen, wenn sie bei den Terranern arbeiten. Was sind ihre Kriterien für gutes Benehmen? Was mag sie unter Umständen beleidigen oder aus der Fassung bringen? Und während du im Gildenhaus bist, könntest du die endgültige Entscheidung treffen, welche Frauen sich als Lehrlinge für die Medizinische Abteilung qualifizieren, aufgeschlossene Frauen, flexibel gegenüber sich ändernden Bräuchen ...«
Magda fragte geduldig: »Glaubst du wirklich, dass die meisten von ihnen unwissende Wilde sind, Cholayna? Darf ich dich daran erinnern, dass Darkover, wenn auch eine geschlossene Welt der B-Klasse, eine sehr komplexe und entwickelte Kultur besitzt ...«
»Auf einem Niveau, das noch keine Raumfahrt und keine Industrie kennt«, stellte Cholayna trocken fest. »Ich zweifele nicht daran, dass sie große Dichter und eine beachtliche musikalische Tradition oder sonst etwas haben, was euch Kommunikationsleute dazu veranlasst, von einer hoch entwickelten Kultur zu sprechen. Die Malgamins von Beta Hydri haben ebenfalls eine hoch entwickelte Kultur, aber sie schließt rituellen Kannibalismus und Menschenopfer ein. Wenn wir diesen Leuten unsere eigene fortschrittliche Technologie geben wollen, müssen wir eine gewisse Vorstellung davon haben, was sie damit anfangen werden. Ich nehme an, du bist mit den Theorien von Malthus vertraut und weißt, was mit einer Kultur passiert, wenn man – zum Beispiel – anfängt, das Leben von Kindern zu retten oder wenn die Bevölkerung aus religiösen oder anderen Gründen nicht auf gleicher Höhe gehalten werden kann? Denke an die Kaninchen in Australien – oder bringt man in der Anthropologie dieses klassische Beispiel nicht mehr?«
Magda hatte nur noch eine ganz undeutliche Erinnerung an das klassische Beispiel, wusste aber, um was es bei der Theorie ging. Schränkte man die Verluste durch Raubtiere ein oder erhöhte man die Überlebensrate von Neugeborenen, stieg die Bevölkerung in einer Exponentialkurve, und die Folge war Chaos. Die Terraner waren oft kritisiert worden, dass sie Eingeborenen aus genau diesem Grund medizinisches Wissen vorenthielten. Magda kannte die Richtlinien und die dahinter stehende harte Notwendigkeit.
»Wenn du erst einmal Zeit gehabt hast, das alles zu überdenken, wirst du erkennen, warum du mit uns zusammenarbeiten musst, auch um der Sache deiner Schwestern in deinem ...« – sie zögerte und suchte nach dem Wort – »... Gildenhaus zu dienen.« Cholayna stand auf. Sie erklärte knapp:
»Viel Glück, Magda. Solange du detachiert bist, wirst du zwei Gehaltserhöhungen bekommen, weißt du.« Die Geste ordnete Magda wieder in den Dienst ein. Ihr schoss die Frage durch den Kopf, ob sie salutieren solle.
Und mir ist nicht gelungen, durchzusetzen, weswegen ich gekommen bin. Ich habe nicht gekündigt. Ich habe es so verzweifelt nötig, das eine oder das andere zu sein, nicht auf diese Weise zwischen zwei Welten hin- und hergerissen zu werden. Mein wirkliches Ich, mein wahres Ich ist darkovanisch. Trotzdem bin ich zu sehr Terranerin, um eine echte Darkovanerin zu sein ...
Sie hatte nie wirklich irgendwohin gehört. Vielleicht würde sie im Gildenhaus herausfinden, wo ihr Platz war – aber nur, wenn die Terraner sie in Ruhe ließen.
Sie verließ das Büro des Nachrichtendienstes und überlegte kurz, ob sie ihr altes Quartier aufsuchen und ein paar Besitztümer, an denen ihr Herz hing, holen sollte. Nein. Im Gildenhaus nutzten sie ihr nichts und würden sie nur als Terranerin kennzeichnen. Noch einmal zögerte sie. Sie dachte an Peter und Jaelle, die heute Vormittag eine Ehe als Freipartner schließen würden – die einzige Ehe, die für eine Entsagende legal war. Jaelle hätte sie bei der Trauung bestimmt gern dabei, und Peter auch, als Zeichen dafür, dass sie ihm nicht grollte, weil er jetzt Jaelle liebte und begehrte.
Ich will Peter nicht mehr. Ich bin nicht eifersüchtig auf Jaelle. Wie sie Cholayna Ares erzählt hatte, war die Ehe zerbrochen, noch bevor sie Jaelle kennen gelernt hatte. Und doch hatte sie irgendwie das Gefühl, das Glück der Jungvermählten nicht mit ansehen zu können.
So eilte sie zum Tor und ging hindurch. Draußen nahm sie ihre Identitätsplakette für das Terranische HQ ab und warf sie im Vorübergehen in einen Mülleimer.
Setzt hatte sie die Brücken hinter sich verbrannt; ohne besondere Vorkehrungen konnte sie das HQ nicht wieder betreten, denn sie war keine Angestellte mehr. Auf diesem geschlossenen Planeten gab es keinen freien Verkehr zwischen terranischem und darkovanischem Territorium. Was sie getan hatte, band sie unwiderruflich an das Gildenhaus und an Darkover.
Schnell schritt sie durch die Straßen, bis sie das feste Gebäude sah, fensterlos und blind zur Straße hin, mit einem kleinen Schild an der Tür:
THENDARA-HAUSGILDE DER ENTSAGENDEN
Sie läutete die kleine, verborgene Schelle und hörte irgendwo, von ganz weit drinnen, eine Glocke anschlagen.
2Jaelle n’ha Melora
Jaelle träumte ...Sie ritt unter einem seltsamen, unheimlichen Himmel dahin, der wie vergossenes Blut auf dem Sand des Trockenlandes war ... Fremde Gesichter umgaben sie, Frauen ohne Ketten, ungebunden, die Art von Frauen, über die ihr Vater immer spottete, zu denen ihre Mutter aber einmal gehört hatte ... Ihre Hände waren gefesselt, aber mit Bändern, die zerrissen, so dass sie nicht wusste, wohin sie gehen sollte, und irgendwo schrie ihre Mutter, und Schmerz raste durch ihr Gehirn ...
Nein. Es war ein Rasseln, ein irgendwie metallisches Geräusch, und ein gleißendes gelbes Licht schnitt durch ihre Augenlider. Dann kam ihr zu Bewusstsein, dass Peters Lippen ihre Schulter berührten, während er sich über sie beugte und den schmetternden Ton abstellte. Jetzt erinnerte sie sich; es war ein Signal, eine Weckglocke, wie sie sie bei ihrem einzigen Besuch im Gästehaus des Klosters von Nevarsin gehört hatte. Aber ein so hartes und mechanisches Geräusch konnte nicht mit den lieblich klingenden Klosterglocken verglichen werden. Der Kopf tat ihr weh. Ihr fiel die Feier im Erholungszentrum des Terranischen HQ ein, bei der sie Peters Freunde kennen gelernt hatte. In der Hoffnung, dadurch ihre Scheu vor all diesen Fremden zu verlieren, hatte sie von dem ungewohnten starken Alkohol mehr getrunken, als es ihre Absicht gewesen war. Jetzt war der ganze Abend nur noch ein Wirrwarr von Namen, die sie nicht aussprechen konnte, und von Gesichtern, mit denen sich für sie keine Namen verbanden.
»Beeile dich lieber, Schatz«, drängte Peter. »Du willst doch nicht an deinem ersten Arbeitstag zu spät kommen, und ich kann es mir nicht leisten – ich habe schon eine schwarze Marke in meiner Personalakte.«
Peter hatte die Brause angestellt gelassen. Jaelles Rücken schmerzte von dem ungewohnten Bett; sie war sich nicht sicher, ob es zu hart oder zu weich war, auf jeden Fall hatte es sich nicht richtig angefühlt. Sei nicht albern!, schalt sie sich selbst. Sie hatte schon an allen möglichen fremden Orten geschlafen. Bestimmt würde eine eiskalte Dusche sie richtig aufwecken und erfrischen. Zu ihrer Überraschung war das Wasser jedoch warm und machte eher matt als munter, und ihr wollte nicht einfallen, wie man es kälter stellte. Immerhin war sie jetzt wach und konnte sich anziehen.
Von irgendwoher hatte Peter eine HQ-Uniform für sie besorgt. Jaelle kämpfte sich hinein in die Strumpfhosen, in denen sie sich so unbehaglich fühlte, als seien ihre Beine nackt, in die albernen dünnen, nicht einmal bis zum Knöchel reichenden Schuhe und die kurze schwarze, blau paspelierte Jacke. Peters Jacke sah ebenso aus, nur dass sie rot paspeliert war. Er hatte ihr erklärt, was die verschiedenen Farben bedeuteten, aber sie hatte es vergessen. Die Jacke war so eng, dass sie sie nicht über den Kopf ziehen konnte, und sie grübelte eine ganze Zeit darüber nach, warum man den langen Verschluss im Rücken angebracht hatte, wo es ihr Schwierigkeiten machte, ihn zu erreichen, statt vorn, wie es vernünftig gewesen wäre. Überhaupt, wer wünschte sich ein so enges Kleidungsstück? Weiter geschnitten und mit den Säumen, die sich zusammendrücken ließen, vorn, wäre es ungemein praktisch für eine Frau gewesen, die ein Kind nährte. So, wie es war, stellte es eine Verschwendung von Material dar – ein paar Zentimeter loser sitzend, und es hätte sich über den Kopf ziehen lassen und überhaupt keinen Verschluss gebraucht. Es fühlte sich rau an ihrer Haut an, denn eine Unterjacke hatte sie nicht bekommen, aber wenigstens besaß das Ding einen warmen gestrickten Kragen und anliegende Ärmel. Stirnrunzelnd musterte Jaelle sich im Spiegel. Peter, bereits angekleidet, trat hinter sie, fasste sie bei den Schultern, bewunderte ihr Spiegelbild und presste sie dann eng an sich.
»Du siehst hinreißend in Uniform aus«, sagte er. »Sobald sie dich zu sehen bekommen, werden mich alle Männer im HQ um dich beneiden.«
Jaelle wand sich innerlich; ihre Ausbildung hatte darauf gezielt, genau das zu vermeiden. Der Stoff schmiegte sich unschicklich eng um die Kurven ihrer Brüste und ihrer schmalen Taille. Sie machte sich Sorgen, aber als Peter sie zu sich herumdrehte und an sich zog und sie ihr Gesicht an seiner Schulter verbarg, schien in seinen Armen die ganze Anspannung aus ihr hinauszufließen. Sie seufzte und murmelte: »Ich wünschte, du müsstest nicht gehen ...«
»Mmmmmm, das wünschte ich auch.« Er liebkoste sie, grub seine Lippen in ihren bloßen Hals – hob dann abrupt den Blick und starrte das Chronometer an der Wand an.
»Autsch! Sieh mal, wie spät es ist! Ich sagte ja schon, ich wage es nicht, an diesem ersten Tag, den ich wieder zurück bin, zu spät zu kommen.« Er wandte sich zur Tür. Jaelle wurde es trotz der warmen Dusche eiskalt, als er sagte: »Tut mir Leid, Liebling, ich bin spät dran, aber du findest doch den Weg, nicht wahr? Wir sehen uns heute Abend.« Die Tür schloss sich, und Jaelle stand allein da. Immer noch erregt von seiner Berührung und seinem Kuss, stellte sie fest, dass er nicht einmal auf die Beantwortung seiner Frage gewartet hatte. Jaelle war sich überhaupt nicht sicher, ob sie durch das erschreckende Labyrinth des Hauptquartiers in das Büro hinunterfinden würde, wo sie sich heute Morgen melden sollte.
Blind starrte sie auf das Chronometer und versuchte, die terranische Zeit in die vertrauten Stunden des Tages zu übersetzen. Wenn sie richtig rechnete, war es noch nicht einmal drei Stunden nach Sonnenaufgang. Ihr fiel eine Neckerei Magdas ein: Ich glaube nicht, dass es dir in der Terranischen Zone besonders gefallen wird. Dort wird manchmal sogar nach der Uhr geliebt.
Doch auch sie hatte heute Morgen Pflichten. Sie konnte nicht hier stehen bleiben und verlegen ihr Spiegelbild angaffen. Andererseits vermochte sie sich nicht vorzustellen, dass sie in diesem unanständig engen Gewand zwischen fremden Männern – Terranern! – herumlief. Nicht einmal eine Prostituierte würde so angezogen ausgehen! Mit zitternden Händen löste sie den Verschluss der Jacke und zog ihre normalen Kleider an. Die Uniform war außerdem für das Spätfrühlingswetter draußen nicht warm genug. Innerhalb des Gebäudes, das zu fast erstickender Wärme aufgeheizt war, mochte sie genügen, aber Jaelle musste nach draußen gehen. Sie nahm sich die kleine Karte des HQ vor, die Peter ihr dagelassen hatte, und bemühte sich, Sinn in den unvertrauten Markierungen zu finden.
Im morgendlichen Nieselregen erschauernd, suchte sie sich den Weg bis zum Hauptgebäude und zeigte dort den vorläufigen Pass, den Peter ihr gegeben hatte. Der Sicherheitsmann sagte: »Mrs. Haldane? Sie hätten bei diesem Wetter durch den unterirdischen Tunnel gehen sollen.« Jaelle sah sich um und stellte fest, dass sich tatsächlich kein Mensch auf den verwickelten Gehwegen und Rampen befand.
Es gelang ihr, die Hinweisschilder zu enträtseln. Peter hatte ihr einen Schnellkurs im Lesen der häufigsten Zeichen verpasst, und sie hatte ein bisschen Terra-Standard gelernt, das sich von Casta gar nicht so sehr unterschied – irgendjemand hatte ihr einmal erzählt, dass beides einer gemeinsamen Sprachfamilie angehört habe, bevor Darkover besiedelt worden war, und dass Casta der gebräuchlichsten terranischen Sprache ähnlich sei. Es widerstrebte ihr, jemanden von den Männern und Frauen, die in den Kaninchengehegen der Gebäude umherliefen, nach dem Weg zu fragen. Sie sahen in ihren Strumpfhosen, den Jacken in verschiedenen Farben und den ausgeschnittenen, dünnen Sandalen alle gleich aus. Jaelle fuhr zwei- oder dreimal im Aufzug hinauf und hinunter, bis sie herausgefunden hatte, wie er funktionierte. Es war gar nicht kompliziert, wenn es nur zu verstehen gewesen wäre, warum die Leute sich die Mühe machten. War eine Lähmung der Beine eine rassisch bedingte Krankheit bei den Terranern, so dass sie keine Treppen benutzen konnten? Sicher waren Aufzüge sinnvoll, wenn ein Gebäude zwanzig oder dreißig Stockwerke besaß, aber warum wurde es so hoch gebaut? Die Terraner hatten mit ihrem Raumhafengelände doch Platz genug erhalten, um vernünftig zu bauen!
Zumindest stimmte mit Peters Beinen alles, dachte sie lächelnd. Vielleicht waren die Terraner einfach gewohnheitsmäßig faul.
Vor dem Eingang zu der Abteilung, die Peter auf der Karte markiert hatte – es gab dort außerdem ein Schild, auf dem, wie sie erkannte, das terranische Wort für KOMMUNIKATION stand –, stellte sich Jaelle einem dort Wache haltenden Mann vor. Sie sagte: »Mein Name ist Jaelle n’ha Melora«, und hielt ihm ihren Pass hin.
»Treten Sie bitte vor den Bildschirm und stecken Sie den Pass in den Schlitz«, antwortete er gleichgültig. Jaelle steckte den Pass in den Schlitz, und der Glasschirm begann, mit einem merkwürdigen Piepen zu flackern.
»Was ist los?«, fragte der Mann.
Hilflos stand Jaelle vor dem blinkenden, piependen Schirm.
»Ich weiß es nicht ...«, begann sie. »Mein Pass ist wieder herausgekommen ...« Bestürzt zog sie ihn aus dem Schlitz.
Der Mann betrachtete den Pass und den Bildschirm. Stirnrunzelnd meinte er: »Sie tragen keine Uniform, und die Kamera erkennt Sie nach dem Bild nicht – verstehen Sie? Und der Name, den Sie nannten, stimmt nicht mit dem Namen auf dem Pass überein, Miss.« Jaelle nahm das letzte Wort für eine höfliche Anrede, ähnlich Damisela. Sollte sie ihn verbessern? Er zeigte geduldig auf den Namen, der im Pass stand. »Sie müssen den Namen in der Form wiederholen, wie er hier angegeben ist. Verstehen Sie? Haldane, Mrs. Peter. Versuchen Sie, es so zu sagen.«
Sie wollte protestieren, ihr Name sei Jaelle, einer Entsagenden sei es aufgrund ihres Eides verboten, den Namen eines Mannes zu tragen, aber sofort überlegte sie es sich anders. Den Wachposten ging es nichts an, und wie sollte sie es überhaupt einem Terraner erklären? Gehorsam wiederholte sie »Haldane, Mrs. Peter« vor dem Schirm, und die Tür glitt zurück und ließ sie ein. Sie erinnerte sich, dass einige von Peters Freunden – nicht die besten Freunde – sie gestern Abend Mrs. Haldane genannt hatten und sie sie hatte korrigieren müssen. Aber war das nicht auch Magdas Name?
Sie trat in einen großen, hellen Raum mit dem allgegenwärtigen gelben Licht. Entlang der Wand standen seltsame, ihr unbekannte Maschinen. Eine junge Frau erhob sich hinter einem schmalen Tisch, um sie zu begrüßen.
»Ich bin Bethany Kane«, sagte sie. »Du musst Jaelle sein.« Ihr Cahuenga, die Sprache der Handelsstadt, war so schlecht, dass Jaelle kaum ihren eigenen Namen verstand. Bethany führte sie an einen Tisch mit Glaspaneelen und merkwürdigen Ausrüstungsgegenständen. »Du kannst deine Sachen hier lassen. Dann gehen wir gleich nach oben; ich soll dich zur Verwaltung und zur Medizinischen Abteilung bringen.«
Man merkte nur zu deutlich, dass es eine vorher auswendig gelernte Ansprache war. Jaelle hatte offensichtlich keine »Sachen«, die sie hätte dalassen können, und die junge Frau machte den Eindruck, als hätte sie gern mehr gesagt, könne aber nicht. Einem Impuls folgend, erwiderte Jaelle auf Casta: »Magda erzählte mir von ihrer Freundin Bethany – bist du das?«
Bethany war eine kleine Frau mit mittelbraunem Haar und braunen Augen – wie Tieraugen, dachte Jaelle –, und sie sah in der alle Kurven nachzeichnenden terranischen Uniform verführerisch aus. Wie konnte sich die Frau in einem Büro, wo Männer und Frauen gemeinsam arbeiteten, so zur Schau stellen! Wären nur Frauen zugegen gewesen, hätte es vielleicht nicht so – Jaelle suchte nach dem Wort – so absichtlich provozierend gewirkt. Aber diese Frauen gingen ganz ungezwungen mit den Männern um, und niemand schien ihre Aufmachung zu bemerken. Während sie an einer ganzen Reihe von Türen mit den jeweiligen Wachposten entlanggingen, nahm sich Jaelle vor, später darüber nachzudenken. Ihr war, als führe Bethany, die ihren Pass an sich genommen hatte, sie unter Zuhilfenahme von Tunnels und Aufzügen durch Meilen und Meilen von Korridoren. Bis sie ihr Ziel erreicht hatten, taten Jaelle die an fest verschnürte Stiefel gewöhnten Füße in den Sandalen weh. Sie verwarf ihre Theorie, Terraner seien faul. Wenn sie so viel herumrasen mussten, brauchten sie ihre Aufzüge und Rolltreppen vielleicht wirklich.
Die nächsten Stunden waren die verwirrendsten ihres Lebens. An einer Stelle blitzten Lichter und blendeten ihre Augen, und gleich darauf rutschte aus einem Schlitz ein beschichtetes Kärtchen mit einem Bild, auf dem Jaelle sich erst gar nicht erkannte. Es zeigte eine kleine, ernst blickende rothaarige Frau mit etwas ängstlichen Augen. Bethany sah, wie sie beim Betrachten des Bildes das Gesicht verzog, und lachte.
»Oh, so sehen wir alle auf Passfotos aus, als wären wir fürs Verbrecheralbum aufgenommen worden. Das muss an der Beleuchtung und an der Pose liegen. Du müsstest mal meins sehen!« Jaelle erwartete, jetzt werde sie es ihr zeigen, aber das tat sie nicht. Also war es wohl eine bildliche Redensart gewesen, eine soziale Geste. Dann befragte sie ein älterer Herr, rund und gutmütig, der das Darkovanische ausgezeichnet beherrschte, sie lang und breit über ihren Geburtsort (»Shainsa? Wo genau liegt denn das?«, wollte er wissen und brachte Jaelle tatsächlich dazu, den Weg zwischen den Trockenstädten und Thendara zu skizzieren), ihr Alter und ihr Geburtsdatum. Er bat sie mehrmals, ihren Namen zu nennen, und fand dafür eine genaue Umschreibung. Das, so meinte er, werde anderen helfen, ihn korrekt auszusprechen. Jaelle fragte sich, warum er es den anderen nicht einfach sagte oder einen dieser überall herumstehenden Stimmaufzeichner benutzte – es hatte sie sehr erschreckt, als aus einem von ihnen plötzlich ihre eigene Stimme gekommen war. Doch sie hatte gewusst, dass es hier viele ihr fremde Dinge geben würde. Einmal redete er sie mit »Mrs. Haldane« an, und als sie ihn korrigierte, lächelte er milde und meinte: »Das ist Landesbrauch, mein liebes Mädchen.« Er benutzte den Ausdruck, der bei einem Darkovaner von beleidigender Intimität gewesen wäre, auf so väterliche Art, dass er Jaelles Sympathie gewann, statt bei ihr Anstoß zu erregen. »Vergessen Sie nicht, junge Frau, Sie befinden sich jetzt unter terranischen Barbaren, und Sie müssen uns unsere Stammesbräuche zugestehen. Es ist einfacher für die Akten. Sie teilen sich die Wohnung mit Haldane, nicht wahr? Na, da haben Sie es.«
»Ja, aber ich bin eine Entsagende, und bei uns ist es nicht Brauch, den Namen des Mannes zu tragen ...«
»Wie ich sagte, es ist unser Brauch«, antwortete der Mann. »Gibt es bei Ihnen ein Sprichwort des Sinnes: ›Wenn du in Rom bist, verhalte dich wie ein Römer‹?«
»Wer waren die Römer?«
»Gott weiß es; ich weiß es nicht. Irgendein altes territoriales Volk, könnte ich mir vorstellen. Es ließe sich übersetzen: ›Wenn du unter Barbaren lebst, folge ihren Bräuchen, so gut du kannst.‹«
Jaelle dachte darüber nach und spürte, dass sich ihr Gesicht zum Lächeln verzog. »Ja, wir sagen: ›Wenn du in Temora bist, iss Fisch.‹«
»Wie ich mich entsinne, liegt Temora am Meer«, überlegte er. Dann begann er, mit bemerkenswert flinken Fingern auf der seltsamen Tastatur zu tippen – Jaelle hoffte, man werde von ihr nicht verlangen, eine Maschine zu benutzen, die eine solche Geschicklichkeit erforderte –, und lautlose Lichter flossen über eine Glasplatte vor ihm. Ein Piepton war zu hören, und der Mann hob seinen Blick von den Signallampen.
»Das habe ich vergessen. Beth, sind Sie so nett und besorgen mir ihre Abdrücke?«
»Finger oder Retina oder beide?«
»Beide, denke ich.«
Bethany brachte Jaelle zu einer anderen Maschine und führte ihre Hand an eine flache Glasplatte, die Lichter aufflammen ließ. Dann musste Jaelle das Gesicht in eine Öffnung stecken, die eine Stütze für das Kinn hatte. Sie zuckte erschrocken zurück, als die Lichter ihren Augen wehtaten. Beth redete ihr zu: »Nein, halte den Kopf still und die Augen offen. Wir nehmen Retinaabdrücke der eindeutigen Identifikation wegen. Fingerabdrücke können manchmal gefälscht werden, Retinamuster nie.«
Es waren zwei weitere Versuche erforderlich, bis Jaelle die unwillkürliche Reaktion, zurückzuzucken und die Augen zuzukneifen, unterdrücken konnte. Schließlich steckte man ihr ein Kärtchen an die Jacke, auf dem in einer Ecke ihr Bild und ansonsten die merkwürdigen Krakel zu sehen waren, die, wie man ihr sagte, kodierte Abdrücke darstellten.
Bethany meinte: »Du musst die Uniform einfach tragen, weißt du. Du hast heute schon zweimal bei den Monitoren den Alarm für unbefugtes Eindringen ausgelöst – sie sind darauf programmiert, Leute ohne Uniform zu melden. In den Jackenkragen ist ein Kode eingelassen.« Sie führte Jaelles Finger an eine raue Stelle im Stoff. Jaelle hatte gedacht, der Kragen sei zerrissen und repariert worden, aber offenbar musste das wohl so sein.
»Glücklicherweise hat uns der Mann, der am Haupteingang deinen Pass gesehen hat, gewarnt, du trügest heute keine Uniform. Aber willst du sie bitte morgen wie ein braves Mädchen anziehen? Das macht alles so viel einfacher.«
Einfacher, ja! Alle sehen gleich aus wie lauter bemalte Spielzeugsoldaten aus einer Schachtel!
»Ich weiß, Sie arbeiten unter Lorne«, ergriff der Mann wieder das Wort. »Aber sie konnte auf ihren Dienstgrad pochen, wenn sie darkovanische Kleidung trug.« Lorne war natürlich der Name, den Magda im HQ benutzte. Der Rest war Jaelle unverständlich, ausgenommen die Anweisung, dass sie – aus irgendeinem seltsamen Grund, vielleicht eines abergläubischen Rituals wegen – die Uniform zu tragen hatte, damit sie innerhalb des Gebäudes keinen Alarm auslöste. Wahrscheinlich war es nicht wert, lange darüber zu diskutieren.
»Heute, an Ihrem ersten Tag, ist es nicht so schlimm«, setzte der Mann hinzu, »aber morgen kommen Sie in Uniform, ja? Und tragen Sie jederzeit das Abzeichen. Es identifiziert Ihre Abteilung und Ihr Gesicht.«
Jaelle fragte: »Warum muss ich die Aufzeichnung meines Gesichts tragen, wo ich doch mein Gesicht selbst mit mir führe?«
»Damit wir sehen, ob Ihr Abzeichen Ihrem Gesicht entspricht, und keine unbefugte Person in Sicherheitsgebiete gelangt«, antwortete der Mann, und Jaelle verzichtete auf die Frage, aus welchem Grund jemand den Wunsch haben sollte, einen Ort aufzusuchen, wo er nichts zu tun hatte. Es war schließlich nicht so, als gäbe es hier drinnen irgendetwas Interessantes zu sehen.
»Bringen Sie sie zur Medizinischen hinauf, Beth, wir sind fertig mit ihr«, sagte der Mann. »Viel Glück, Mrs. Haldane – Jaelle, meine ich. Wo wird sie arbeiten, Beth? Ins Büro des Chefs kann man sie nicht gut stecken, er neigt dazu ...« – der Mann zögerte – »... unhöfliche Bemerkungen über die Herkunft mancher Leute zu machen.«
Jaelle fragte sich, ob der Mann sie für taub oder schwachsinnig hielt. Sie hatte Montray kennen gelernt, und niemand mit einem Anflug von telepathischen Fähigkeiten konnte daran zweifeln, dass er Darkover und die Darkovaner nicht mochte. Immerhin hatte der Mann hier ihre Gefühle schonen wollen, und das war die erste Höflichkeit, die ihr von einem Terraner widerfuhr. Sie waren oft freundlich, selten höflich. Jedenfalls nicht in der Art, die sie als Höflichkeit verstand; anscheinend hatten sie andere Vorstellungen davon. Erst als sie wieder draußen im Flur waren, fiel Jaelle auf, dass sie zwar eine große Menge Fragen über sich selbst beantwortet hatte, doch niemand auf den Einfall gekommen war, ihn ihr vorzustellen. Seinen Namen hatte sie bis zum Schluss nicht erfahren.
»Nächste Station ist die Medizinische«, bemerkte Bethany. Jaelle kannte das terranische Wort mittlerweile nach den langen Debatten, ob es Entsagenden erlaubt werden könne, sich zu medizinisch-technischen Assistentinnen ausbilden zu lassen. Sie protestierte: »Ich bin nicht krank!«
»Vorschrift«, sagte Bethany. Diese Antwort hatte Jaelle an dem Tag schon so oft erhalten, dass sie darin, obwohl sie die eigentliche Bedeutung noch nicht herausgefunden hatte, eine rituelle Entgegnung sah, die die Diskussion abschneiden sollte. Nun, ihr war gesagt worden, es sei unhöflich, nach den religiösen Ritualen anderer zu fragen, und die Terraner mussten ein paar sehr seltsame haben.
Diesmal ging es höher hinauf als zuvor. Jaelle erhaschte zufällig einen Blick aus einem Fenster und schüttelte sich unwillkürlich. Sie mussten so hoch sein wie auf dem Scaravel-Pass. Schwindelig klammerte sie sich an das Treppengeländer. Sollte damit ihr Mut geprüft werden? Nun, eine Frau, die sich von Schneestürmen in den Hellers und Banshees auf den Gebirgspässen nicht hatte unterkriegen lassen, würde nicht wegen bloßer Höhe jammern. Merkwürdig, Bethany schien sie nichts auszumachen.
In diesem Stockwerk wurde eine andere Uniform getragen, und da Jaelle sich vorgenommen hatte, diesmal bei jedem merkwürdigen Ritual mitzumachen, widersetzte sie sich nicht, als man ihr ihre Amazonenkleidung aus Wolle und Leder auszog und sie in einen weißen Kittel aus Papier steckte. Die Leute, die hier arbeiteten, trugen alle das gleiche Abzeichen an ihren Jacken, einen Stab, um den sich so etwas wie eine Schlange ringelte. Ob das Arbeitsabzeichen bei den Terranern die Embleme von Clan und Familie ersetzt hatte? Jaelle saß auf Bänken herum und wartete, dass eigentümliche Prozeduren an ihr vorgenommen wurden. Maschinen tasteten an ihr herum und stachen sie mit Nadeln in den Finger. Davor zuckte sie zurück, und Bethany erklärte: »Sie wollen sich dein Blut unter einem ...« – Jaelle verstand das Wort nicht – »... ansehen.« Sie setzte erläuternd hinzu: »Ein spezielles Glas, mit dem man die Zellen in deinem Blut sehen – sich vergewissern kann, dass es gesundes Blut ist.« Sie schoben ihr ein Glasplättchen in den Mund, wickelten sie von der Brust bis zu den Knien in ein schweres, metallbeschichtetes Tuch und ließen sie mit der Maschine allein. Die Maschine begann zu summen, und Jaelle erschrak und riss den Kopf zurück. Die junge Technikerin, ein Mädchen etwa in Jaelles Alter mit hellem, lockigem Haar, machte eine ärgerliche Bemerkung, und wieder erklärte Bethany hastig, es solle nur ein Bild von Jaelles Zähnen gemacht werden, um festzustellen, ob sie Löcher oder beschädigte Wurzeln hätten.
»Sie hätten mich fragen können«, gab Jaelle gereizt zurück. Aber beim nächsten Versuch hielt sie den Atem an und rührte sich nicht. Die Technikerin betrachtete die Platte mit den abgebildeten Zähnen und sagte zu Bethany, so etwas habe sie noch nie gesehen.
»Sie sagt, deine Zähne seien perfekt«, übersetzte Bethany, und Jaelle, die sich irgendwie gekränkt fühlte, meinte, das hätte sie ihnen gleich sagen können.
Dann kamen sie in einen Raum voller Maschinen. Der Mann, der sich um diese Maschinen kümmerte, sprach besser Darkovanisch als alle anderen, den Mann ausgenommen, der sie in dem Zimmer, wo sie fotografiert worden war, so lange befragt hatte. Er forderte Jaelle auf: »Treten Sie hinter die Vorhänge dort und legen Sie alle Ihre Kleider ab. Ziehen Sie sich bis auf die Haut aus. Dann kommen Sie an jenem Ende heraus und gehen sofort da hinunter, an dem aufgemalten weißen Streifen entlang. Verstanden?«
Jaelle sah ihn entsetzt an. Ein gutes Drittel der Techniker an den Maschinen waren Männer!
»Ich kann nicht.« In panischer Angst umklammerte sie Bethanys Arm. »Meint er wirklich, ich soll vollständig nackt durch all diese Maschinen gehen?«
»Die Maschinen tun dir nichts«, antwortete Bethany. »Das sind die neuen computerisierten Aufnahmegeräte, keine Röntgenstrahlen, nichts, was dir oder deinen Genen schaden könnte. Ich gehe als Erste und zeige es dir, ja?« Sie steckte den Kopf hinaus, sagte etwas auf Terranisch zu den Technikern und übersetzte für Jaelle: »Ich habe ihnen gesagt, ich würde als Erste gehen, um dir zu zeigen, dass es nicht wehtut.« Sie zog sich aus, und Jaelle sah ihr interessiert zu. So also wird man mit dem Verschluss im Rücken fertig? Reißen die Strumpfhosen wirklich so leicht, dass sie so Acht gibt, nicht mit den Fingernägeln hineinzugeraten?
»Programmieren Sie den Metalldetektor auf die Füllungen in meinen Zähnen, Roy. Das letzte Mal hat er mich angepiept, und man hat mich den halben Vormittag hin- und zurückmarschieren lassen.«
»Füllungen in den Zähnen, geht in Ordnung.« Der Mann nahm irgendeine Einstellung an der Maschine vor. »Das ist noch gar nichts. Wir hatten neulich Lucy von der Kommunikation hier oben und vergaßen, in den Unterlagen nachzusehen und die Metallnadel in ihrer Hüfte zu programmieren. Da war vielleicht etwas los! Sind Sie so weit, Beth?« Während Bethany splitternackt an den aneinander gereihten Maschinen entlangging, stellte Jaelle fest, dass die Männer sie ignorierten, als sei sie ebenfalls ein Mann oder eine angezogene Frau. Dann kam Bethany zurück und wollte sie aus der Umkleidekabine schieben, aber Jaelle zögerte immer noch.
»Ich sage dir doch, die Maschinen tun dir nicht weh. Das ist nichts als Licht!«
»Aber – das sind Männer ...«
»Das sind Mediziner«, erklärte Bethany. »Du bist für sie nichts weiter als eine Ansammlung von Knochen und Organen. Eine Colles-Fraktur würde sie mehr interessieren als deine Brüste, und wenn sie die herrlichsten des Universums wären. Nun geh schon – du lässt sie warten!«
Jaelle verstand das nicht so ganz. Sie nahm an, Bethany wolle ihr klarmachen, diese Männer – Mediziner? – seien wie Mönche oder Heiler-Priester und an nichts als ihrer Arbeit interessiert. Sie nahm allen Mut zusammen und trat aus der Kabine. Zu ihrer Erleichterung hob niemand, ob männlich oder weiblich, den Blick; alle blieben über die Maschinen gebeugt. Eine der Frauen fragte in fehlerhaftem Darkovanisch: »Haben Sie irgendwelches Metall an sich? Zähne, Ausrüstungsgegenstände, sonst etwas?«
Jaelle spreizte die leeren Hände. »Wo sollte ich das wohl gelassen haben?«, fragte sie, und die Frau lächelte. »Richtig. Gehen Sie dahin – diese Seite – umdrehen. Stehen bleiben. Heben Sie einen Arm. Den anderen.« Jaelle fühlte sich wie ein zahmes Chervine, das Kunststücke vorführt. »Wieder umdrehen – den Arm senken – sehen Sie wohl? Es tut nicht weh ...«
Jaelle zog sich wieder an und fragte Bethany: »Was haben diese Maschinen denn gemacht?«
»Bilder von deinem Inneren, das sagte ich doch. Es verrät ihnen, dass du gesund bist.«
»Und wie ich gesagt habe, hätten sie mich danach nur zu fragen brauchen.« Abgesehen von einer oder zwei in der Schlacht erhaltenen Wunden – während ihrer ersten Jahre in der Gilde hatte sie an Kindras Seite als Söldnerin gekämpft – und einem Bruch des Handgelenks, den sie sich mit sechzehn bei einem Sturz vom Pferd zugezogen hatte, war sie immer vollkommen gesund gewesen.
Dann drückte man sie auf eine Konturenliege und klebte ihr Plättchen an den Kopf. Sie musste eingeschlafen sein, und als sie erwachte, hatte sie tobende Kopfschmerzen, nicht unähnlich jenen, die sie im Alter von fünfzehn Jahren ausgestanden hatte, nachdem Lady Alida sie gezwungen hatte, in ein Matrix-Juwel zu sehen.
»Sie ist sehr resistent«, hörte sie einen Mann sagen, und ein anderer antwortete: »Das ist normal für die eingeborene Bevölkerung. Nicht an eine technologische Umgebung gewöhnt. Beth sagt, sie habe vor den Fluoroskopie-Maschinen zurückgescheut. He – halt den Mund, sie ist schon wach. Können Sie uns verstehen, Miss?«
»Ja, tadellos – oh, jetzt weiß ich es, das ist eine Maschine, die Sprachen lehrt.« Das war gar nichts; die Comyn hätten das mit nichts als einer Matrix und einem gut ausgebildeten Telepathen tun können.
»Kopfweh?« Ohne auf ihre Antwort zu warten, reichte der Mediziner ihr einen kleinen Pappbecher, auf dessen Boden sich etwa ein Löffel voll einer hellgrünen Flüssigkeit befand. »Trinken Sie das.«
Sie trank. Der Mann nahm ihr den Becher ab, zerdrückte ihn in der Hand und warf ihn in einen Abfallsammler. Fasziniert sah Jaelle zu, wie er sich in blassen Schleim verwandelte und im Abfluss verschwand. Eben noch war es ein Becher gewesen, gleich darauf wurde er übergangslos zu einem bisschen Schleim, absichtlich weggeworfen und zerstört. Und doch war er nicht alt oder abgenutzt gewesen, ihre Hand hatte das Gefühl von etwas Glattem, Neuem bewahrt, von etwas Wirklichem. Sie spürte das Ding noch, aber es selbst war verschwunden. Warum? Ein paar Minuten später, als sie ihre eigenen Sachen wieder anzog, sagte Bethany ihr, sie solle ihren Papierkittel in einen Abfallsammler der gleichen Art werfen. Es verwirrte sie, dass Dinge sich auflösten und wegflossen und nicht mehr existierten. Der Mann, der die Sprachenmaschine bediente – sie hatte gehört, dass man sie einen D-Alpha-Kortikator nannte, was sie nicht klüger machte – reichte ihr ein Päckchen.
»Hier sind Ihre Sprachlektionen in Standard für den Rest der Woche«, sagte er. »Bitten Sie Ihren Mann, Ihnen zu zeigen, wie Sie den Schlaflerner benutzen sollen. Dann können Sie allein weitermachen.«
Schon wieder eine Maschine! Auch dieser Mann war ihr nicht vorgestellt worden, aber inzwischen hatte sie sich an Unhöflichkeit gewöhnt und wunderte sich gar nicht mehr, als Bethany sie drängte, sich zu beeilen, da sie sonst zu spät zum Lunch kämen. Sie hatte sich den ganzen Vormittag beeilt, aber die Terraner waren immer in Eile, angetrieben von den Uhren, die sie überall sah, und vermutlich gab es gute Gründe, die Mahlzeiten zu bestimmten Zeiten zu servieren. Vielleicht wollte man die Köche nicht warten lassen. Allerdings waren keine Köche sichtbar, nur Maschinen, und es verwirrte sie, dass sie Knöpfe drücken musste, um Essen zu bekommen, doch sie tat, was Bethany tat. Das Essen war ihr sowieso fremd, dicke Breie und heiße Getränke und milde, texturierte Massen. Die Gabel in ein eigentümlich rotes Zeug steckend, erkundigte Jaelle sich, was es sei, und Bethany zuckte die Schultern.
»Die Ration des Tages; irgendein synthetisches Karbo-Protein, nehme ich an. Was es auch sein mag, es ist angeblich gut für einen.« Dessen ungeachtet aß sie ihre Portion mit Appetit auf, und Jaelle versuchte, wenigstens etwas hinunterzuwürgen.
»Das Essen in der Haupt-Cafeteria ist besser«, erzählte Bethany, »dafür geht es hier schnell. Ich weiß, das war ein langweiliger Vormittag, aber so ist es immer bei einem neuen Job.«
Langweilig? Jaelle dachte an ihre letzte Aufgabe: Mit ihrer Partnerin Rafaella hatte sie eine Handelskarawane nach Dalereuth organisiert. Einen Tag hatten sie für Gespräche mit ihrem Auftraggeber gebraucht. Sie mussten herausfinden, was für Männer und wie viele Tiere er hatte, die Packtiere inspizieren und die Lasten berechnen, die Sattelmacher besuchen und geeignetes Geschirr herstellen lassen. Jaelle hatte die Männer nach ihren Vorlieben beim Essen befragt, hatte Vorräte eingekauft und ihre Auslieferung arrangiert. Monoton vielleicht und harte Arbeit, aber gewiss nicht langweilig!
Die Speisen waren ihr zu ungewohnt, als dass sie viel davon hätte verzehren können, und wäre sie nicht heißhungrig gewesen, nachdem sie heute Morgen ohne Frühstück weggegangen war, hätte sie überhaupt nichts hinunterbekommen. Alles hatte zu wenig Biss, es war zu süß oder zu salzig, und einmal geriet ihr ein Geschmack von so feuriger Bitterkeit auf die Zunge, dass sie spucken musste. Wenigstens versuchte Bethany, freundlich zu sein.
Im Geist alle Ereignisse noch einmal durchgehend, stellte Jaelle fest, dass sie immer noch zornig über die Zumutung war, nackt zwischen zwei Reihen von Maschinen hindurchzugehen. Keiner der Männer war beleidigend gewesen, sie hatten keine Notiz davon genommen, dass sie eine Frau war. Aber sie hätten Notiz davon nehmen sollen – nicht etwa, indem sie sie unverschämt ansahen, sondern indem sie anerkannten, dass es ihr peinlich war, sich vor fremden Männern zur Schau stellen zu müssen. Vielleicht hätte man ausschließlich Frauen damit beauftragen können, die Maschinen zu bedienen, nur um zu zeigen, dass man Verständnis für ihre natürlichen Gefühle hatte. Jaelle verabscheute den Gedanken, dass man sie als ein Nichts betrachtete, als eine weitere Maschine, die zufällig lebte und atmete, eine Maschine, die niemand beachtet hätte, wäre da nicht die Tatsache gewesen, dass sie die vorgeschriebene Uniform nicht trug! Eine Ansammlung von Knochen und Organen, hatte Bethany gesagt. Jaelle fühlte sich entpersönlicht, als hätten diese Leute sie, als sie sie wie eine Maschine behandelten, zur Maschine gemacht.
»Zwinge dich nicht, das Zeug zu essen, wenn es dir nicht schmeckt.« Bethany hatte Jaelles Kampf mit den Speisen bemerkt. »Früher oder später wirst du herausfinden, was du magst und was nicht, und in deiner Wohnung kannst du Eingeborenenessen – oh, Verzeihung, ich meine natürlich gekochtes Essen – bekommen, Dinge, an die du gewöhnt bist. Manche Leute ziehen eben synthetische Nahrungsmittel vor – die Alphas, zum Beispiel, weigern sich aus religiösen Gründen, irgendetwas zu essen, das einmal lebendig gewesen ist, weshalb wir für sie eine vollständige synthetische Diät zusammenstellen müssen, und es ist einfacher und billiger, damit das gesamte Personal hier oben zu versorgen. Es schmeckt gar nicht so schlecht, wenn man sich daran gewöhnt hat«, plapperte sie weiter. Jaelle versuchte, sich eine Welt auszumalen, auf der alle Menschen dieses Zeug aßen, nicht weil es bequem oder billig war, sondern weil sie religiöse Skrupel hatten, etwas hinunterzuschlucken, das einmal mit Leben erfüllt gewesen war. Im Grunde zeugte das von einer sehr hoch entwickelten Ethik. Aber sie hatte im Augenblick andere Probleme.