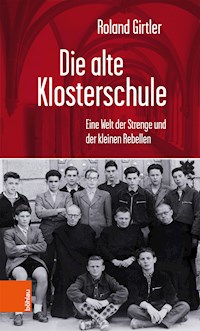Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Böhlau Verlag Wien
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was haben eine Wiener Fiakerfahrerin und ein erfolgreicher Bankmanager gemeinsam? Lesen Sie Roland Girtlers neues Buch, um es zu erfahren. Österreichs bekanntester Soziologe führt seine spannenden Personenstudien aus »Eigenwillige Karrieren« und »Allerhand Leute« weiter. Bei seinen Vorträgen, im Kaffeehaus oder in der Straßenbahn lernt er immer wieder Menschen kennen, die ihn beeindrucken. Er trifft auf originelle Charaktere und Lebenswege und erfährt einzigartige Geschichten, die doch alle von Mut, Durchsetzungskraft und Würde zeugen. Von einem israelischen Panzerfahrer, der nach Österreich auswanderte – aus Liebe zur deutschen Sprache. Von einem Leichenbestatter und leidenschaftlichen Pferdesportler, der durch seinen Beruf ein guter Menschenkenner wurde. Und von vielen anderen, die auch Sie kennenlernen sollten!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roland Girtler
Girtler unterwegs
Gespräche mit sieben Zeitgenossen
BÖHLAU VERLAG WIEN KÖLN WEIMAR
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
© 2018 by Böhlau Verlag GmbH & Co. KG, Kölblgasse 8–10, 1030 Wien Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: IStock/Getty Images
Satz: Bettina Waringer, WienEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISBN 978-3-205-20822-8
Inhalt
Einleitung
Der Bezirksrichter Gerald Habersack und seine Geschichten – Sohn eines Greißlers, Ministrant und Gerichtsvorsteher
Der israelische Panzerfahrer Zwicker Biermann
Hans Hofinger – Die Rituale der alten Klosterschule, der Bankmanager und die Regeln des heiligen Benedikt
Der alte Tierarzt und der Wandel der Bauernkultur – Dr. Eduard Thummerer
Bestatter und Pferdefreund – Bernhard Perner
P. Paulus Bergauer, Pfarrer von St. Ulrich, zu der der Spittelberg gehört – Radfahrer (wie Don Camillo) und Biologe
Magistra Martina Michelfeit, die erste akademische Fiakerfahrerin in Wien
Abschließende Gedanken zu den sieben Gesprächspartnern und mein Dank
Gewidmet meiner gütigen Frau Gemahlin Birgitt,
deren Ratschläge stets hervorragend sind,
und meiner schon in den ewigen Jagdgründen weilenden Dackeline
Hera Xanthippe, die mich zu vielen meiner Gespräche begleitet hat.
Einleitung
Mit dem vorliegenden Band biete ich den geschätzten Leserinnen und Lesern wiederum (magische) sieben Betrachtungen über Menschen an, deren Leben ich für aufzeichnungswürdig halte. Diese kulturwissenschaftlichen bzw. kultursoziologischen Darstellungen verfolgen das Ziel, spannende und aufschlussreiche Einblicke in Lebenswelten zu geben, die durch Fleiß, Witz, Großzügigkeit, List, Güte, Tierliebe, Freude, menschliche Wärme, Ausdauer, Ehre und Abenteuerlust bestimmt sind. Wilhelm Busch meint in seiner Autobiografie, dass kein Ding so aussieht, wie es ist, „am wenigsten der Mensch, dieser lederne Sack voller Kniffe und Pfiffe“. Menschen sind demnach nicht so ohne weiteres in Kästchen einzuordnen, wie es so manche Gelehrte versuchen. Auch meine sieben Gesprächspartner lassen sich nicht irgendwelchen sozialen Schichten zuordnen. Jeder ist ein Original für sich. Ihr Leben ist voll von Ritualen und Symbolen, aber auch bestimmt durch den Drang nach Ehre. Dieser Drang nach Ehre ist etwas typisch Menschliches. Genau darauf verweist Shakespeare in seinem „Richard III.“, wenn er einen gewissen Norfolk sagen lässt: „Ehre ist des Lebens einziger Gewinn.“
•Ehre zeigt der Richter, wenn er großzügig ist, um Mitmenschen zu helfen,
•Ehre zeigt der israelische Panzerfahrer, wenn er seinem politischen Gegner auf der anderen Seite des Suezkanals Fleischkonserven schickt,
•Ehre zeigt der Bestatter, wenn er einen Toten am Friedhof in geweihter Erde beisetzt, obwohl er dies eigentlich nicht dürfte,
•Ehre zeigt die Fiakerfahrerin, wenn sie Kindern eine Freude mit einer Gratis-Fiakerfahrt macht,
•Ehre zeigt der Pfarrer, wenn er Menschen entgegen strenger Regeln der Kirche hilft,
•Ehre zeigt der Mann der Wirtschaft, wenn er sich auf die Regeln des heiligen Benedikt beruft, um seinen Mitarbeitern Respekt zu zollen, und sie zu einem Glas Wein einlädt,
•und Ehre zeigt der Tierarzt, der den Hund armer Leute gratis behandelt.
Ehre hat also etwas mit Respekt vor anderen Menschen, aber auch vor Tieren zu tun.
Methodisch bediente ich mich bei meinen Gesprächen, meinen Beobachtungen und den Interpretationen des freien Gesprächs und der teilnehmenden Beobachtung. Ich befinde mich dabei in der besten kulturwissenschaftlichen bzw. kultursoziologischen Tradition (zur Rechtfertigung und zum Verständnis meines Vorgehens siehe mein Buch „Methoden der Feldforschung“, das ebenfalls im Böhlau Verlag erschienen ist).
(Es sei noch angefügt, dass ich mich bei den dargestellten Gesprächen auch selbst einbringe. Meine Textpassagen sind grundsätzlich kursiv geschrieben, wenn es nicht klar ist, dass ich am Wort bin.)
Ich wünsche viel Freude und spannende Einsichten.
Roland Girtler
Der Bezirksrichter Gerald Habersack und seine Geschichten – Sohn eines Greißlers, Ministrant und Gerichtsvorsteher
Vorbemerkungen
Hofrat Dr. Gerald Habersack, der frühere Bezirksrichter von Enns, stammt aus Windischgarsten. Hier habe ich ihn auch kennengelernt. Elmar Baumschlager, Direktor des Postamtes in Windischgarsten, den ich regelmäßig bei meinen Radtouren durch Oberweng und Mitterweng zwischen Spital am Pyhrn und Windischgarsten aufgesucht hatte, schilderte mir Gerald Habersack als einen großzügigen, gescheiten und auch heimatverbundenen Mann, der großes Interesse am Wandel der alten Bauernkultur hat, über die ich einiges geschrieben habe. Aber auch die ehrbaren Wildschützen der Gegend hatten es ihm angetan.
Mich interessiert dieser Mann, zumal er ein guter Jurist gewesen sein dürfte – ein Jurist mit Herz, der sich nicht nur an Paragrafen klammert. Ich nahm mit ihm Kontakt auf und vereinbarte ein Treffen im Café Kemetmüller in Spital am Pyhrn.
Gerald Habersack erschien nobel angezogen, er war mir gleich sympathisch und wir waren schnell per Du. Er freute sich, mit mir über sein Leben und seine Karriere als Bezirksrichter reden zu können. Er hatte sich sogar Notizen gemacht, damit er nicht spannende Sachen vergisst. Ich erzähle ihm, dass ich die Absicht habe, über ihn in meinem nächsten Buch zu schreiben. Er freut sich sichtlich. Ich lade ihn auf einen Tee und einen Kuchen ein, er ist selbstverständlich mein Gast. Johanna, die Chefin des Cafés, nimmt die Bestellung auf. Gerald trinkt Kaffee, ich trinke Tee mit Milch, dazu gibt es für jeden einen Topfenstrudel. Ich erkläre ihm, dass ich kein Interview mit ihm führe, sondern ein freies Gespräch. Als Titel seiner Erzählungen könnte ich mir vorstellen „Geschichten eines Bezirksrichters“. Gerald lächelt und beginnt zu erzählen.
(In der Klammer sind meine Fragen bzw. Gedanken zu seinen Ausführungen festgehalten.)
Sohn eines ehrbaren Greißlers
„Geboren bin ich am 3. Februar 1950 in Windischgarsten als Ältester von vier Söhnen des Ehepaares Frieda und Otto Habersack. Mein Vater war Greißler in Windischgarsten. Gegenüber von der Gemeinde, dort, wo es zum Kühberg hinaufgeht, hatte er seinen Lebensmittelladen. Sein Geschäft hat dann der Rupert Schimak übernommen und als Schuhgeschäft weitergeführt. 1956 bis 1960 habe ich die Volksschule besucht.
(Ich werfe ein, dass Greißler ein schöner alter Beruf ist, er ist leider im Aussterben.)
Ich habe natürlich die Eigenheiten von einem solchen Greißler miterlebt, es ist ein harter und mühseliger Beruf. Der Vater hat im Geschäft so ziemlich alles angeboten, wie Reißnägel, Damenbinden, offenen Zucker, offenen Rum und sonst noch vielerlei. Die meisten Lebensmittel gab es damals offen. Zigaretten durfte er nicht führen.
(Nun erzähle ich, dass es mir leid ist um die alten Greißlereien, die für mich einen Zauber hatten. Diesen habe ich noch erlebt, als ich vor ein paar Jahren an einem schönen Märztag von Stainach, wohin ich mit dem Autobus gekommen war, über Pürgg nach Bad Aussee gewandert bin. Es lag fester Schnee auf dem Forstweg nach Pürgg. Dort marschierte ich zur Kirche. Rechts vor dieser steht ein altes massives Haus, es stammt aus der Gotik und ist bereits im 15. Jahrhundert erwähnt worden, wie ich erfahren konnte. Über dem Tor ist zu lesen: „Gemischtwarenhandlung Heidi Schlömmer – vormals Adam“. Über alte Steinstufen betrat ich diese Greißlerei, die in einem Gewölbe untergebracht war. Frau Schlömmer, die eben dabei war, das Obst zu sortieren, erwiderte freundlich meinen Gruß. Solche Greißlereien, wie man in Österreich Geschäfte dieser Art zu nennen pflegt, gibt es kaum noch, sie sind den Supermärkten gewichen. Aber hier sah ich noch eine, wie ich sie als Kind erlebt hatte. In dem Wort Greißler steckt übrigens das Wort „Grieß“. Der Greißler war also jemand, der Grieß verkauft hat. Äpfel und Bananen, Semmeln und Schokolade, Milch und Eier und die vielen anderen Dinge des täglichen Bedarfs boten sich dem Eintretenden an. Ich redete mit Frau Schlömmer über alte Zeiten. Sie ist die Kusine meines Freundes Erik Adam, der als Professor in Klagenfurt Studenten und Studentinnen erfreut hat. In diesem Haus war auch einmal, so um 1900, Peter Rosegger zu Gast. Daran erinnern einige Zeilen, die dieser liebenswürdige steirische Dichter in das Gästebuch des Hauses Adam geschrieben hat:
„Der ADAM hot d’ Liab aufbracht, der Noah den Wein, der David das Zitherschlagn, sie müaßn Steirer gwesen sein.“ Der Adam, der hier einmal gewohnt hat, soll also die Liebe erfunden haben und nicht der Adam aus der Bibel. Ich erzählte Frau Schlömmer noch von meiner Tour auf den Grimming, die ich vor langer Zeit unternommen hatte. Sie freute sich, wie es typisch für die klassischen Greißler ist, mit mir zu plaudern. Ich kaufte eine Käsesemmel und eine Banane. Heidi Schlömmer erzählte dabei, dass ihr Vater, Toni Adam, ein großartiger Bergsteiger gewesen sei, der die Idee zu der Biwakschachtel am Grimming hatte. Die neue Biwakschachtel ist nach ihm benannt. 1989, im Alter von 74 Jahren, ist Toni Adam bei einer Bergwanderung am sogenannten Rantenstein tödlich verunglückt, er blieb auf einem Felsvorsprung tot liegen. Seine Frau Dorli Adam, eine ebenso bekannte Bergsteigerin, schrieb ihm ein Gedicht, das so endet: „Bei dieser Himmelsleiter – war heut der Weg dein Ziel – da unten ist ein Felsband – auf das dein Körper fiel.“ Ich verabschiedete mich dankbar für dieses Gespräch mit Frau Schlömmer und wanderte auf festem Schnee in Richtung Bad Aussee durch den Wald weiter. Inzwischen ist auch Frau Schlömmer in Pension gegangen, ihre Greißlerei dürfte heute leer stehen. Gerald Habersack ist in diese Kultur der Greißler hineingewachsen. Er weint ihr allerdings keine Träne nach, denn die Arbeit seines Vaters im Geschäft war hart. Er erzählt weiter.)
Mein Vater stammt aus der Steiermark, er ist in Altaussee geboren, dort war der Großvater Kommandant der Gendarmerie und dann in St. Margarethen an der Raab. Ich bin also ein halber Gendarm und halber Steirer. (Er lacht.) Der Bruder meines Vaters war zuletzt Waffenmeister beim Landesgendarmeriekommando Steiermark.
Nach der Volksschule ging ich in die Hauptschule Windischgarsten. Mein mütterlicher Großvater Matthäus Renhardt war 50 Jahre Mesner der Pfarre Windischgarsten. Dadurch war die Familie dauernd mit der Kirche verbunden. Der Onkel, Josef Renhardt, war Pfarrer vom Seeschloss Ort, er traute auch den Sohn des früheren Bundespräsidenten Dr. Rudolf Kirchschläger in Gmunden. Dadurch hatte ich direkten Kontakt zum Bundespräsidenten. Im Winter 1975, nur wenige Monate nach seiner Wahl im Juni 1974, hat er in Windischgarsten für uns – wir waren nicht mehr als sechs Personen – einen Jux-Langlaufstart auf der Schleiferwiese eröffnet, indem er auf einem von einem Freund gelenkten Schi-doo vorgefahren ist. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Die Fotos habe ich noch heute, auch einige persönliche Schreiben des Bundespräsidenten, der ja selber viele Jahre Richter gewesen ist.
Durch den Onkel hatten wir also eine innige Beziehung zur Kirche. Ich war als Bub der für den Pfarrer immer verfügbare Ministrant, weil ich ja unmittelbar neben der Kirche wohnte. Ich war sehr gerne und lange Ministrant und habe dabei viel erlebt. So mussten am Weihnachtsabend drei stämmige Bauernburschen die große Glocke mehrmals bis Mitternacht läuten. Dazwischen warteten sie im Mesnerhaus in der Küche der Großmutter, die ihnen Tee mit reichlich Schnaps einschenkte. Manchmal wurden sie dabei „rauschig“ und vergaßen das Läuten. Der Großvater musste sie dann wutentbrannt vor der Mette holen, sodass auch der Pfarrer warten musste. Das fiel niemandem auf, aber der Großvater machte der Großmutter Vorwürfe und trug ihr auf, beim nächsten Mal den „Läutern zur Ehre Gottes“ mehr Tee als Schnaps einzuschenken. Mir fällt dazu ein Gedicht von Heinrich Heine ein, der schrieb:
Die Göttin hat mir Tee gekocht und Rum hineingegossen,
sie selber hat den Rum ganz ohne Tee genossen.
(Ich erzähle von unserer Greißlerei in Spital am Pyhrn, von Herrn Huemer. In so einer Greißlerei kamen alle zusammen, da ist getratscht worden.) Mein Vater schwindelte öfters seine Kunden an, vor allem die alten Frauen. Wenn etwa die Sterbeglocke läutete, fragten die Leute zuerst ihn, wer gestorben sei. Mein Vater sagte darauf immer: der alte Wurbauer. Das stimmte wohl, war aber schon vor Jahren gewesen.
Ich kann mich noch an den alten Bestatter Ratzesberger erinnern, finanziell ging es ihm nie gut. Wenn er im Bräuhaus saß und ein Achterl Wein bestellte, wussten die Eingeweihten, dass jemand gestorben war. Eine Viertelstunde später bekam mein Großvater als Mesner die Mitteilung, das Sterbeglöckerl zu läuten. Auch ich musste dieses „Zinglöckerl“ öfters läuten, und zwar für die Dauer eines „Vaterunsers“. Manchmal läutete auch mein seliger Vater, aber er schaute dabei immer auf die Uhr. Ich glaube, dass er das „Vaterunser“ nicht zur Gänze konnte.
Wenn die Sirene heulte, sagte mein Vater, der Lift zum Wurbauer sei stecken geblieben, der Gleinkersee oder das Schwimmbad seien übergegangen. Solche Sachen sagte er aus Spaß. Eines Tages heulte wieder die Sirene und der Vater sagte, zwei Züge seien zusammengestoßen. Sie waren aber wirklich zusammengestoßen. Der Fössner Franz hat sogar ein Foto von diesem Zusammenstoß gemacht. Das habe ich heute noch.
Der Mesner als Lateinlehrer – im Petrinum
Der Bischof Dr. Franz Zauner aus Linz kam öfters auf Pfarrvisitation nach Windischgarsten, anfänglich noch mit seinem Motorrad. Das bewunderten wir. Nach Ende der Visitation ging er immer zu meinen Großeltern in die Wohnung und wir Buben mussten uns beim Segen, den er uns gab, vor ihm niederknien. Mein Vater war allerdings kein Freund des Klerus, er war seinerzeit vermutlich Parteigenosse gewesen und „verflüchtigte“ sich immer, wenn der Bischof oder ein anderer Gottesmann uns besuchte. 1962 kamen wir drei, der Thallinger Harald, mein Bruder Christian und ich, nach Linz in das Petrinum, das Bischöfliche Gymnasium. Diese katholische Privatschule ist die Vorstufe des Priesterseminars. Ich durfte die erste Klasse überspringen, da ich bereits zwei Klassen Hauptschule in Windischgarsten hinter mir hatte. Aber ich musste Latein nachlernen, um den Stoff der ersten Gymnasialklasse einigermaßen zu beherrschen. Wir hatten ja im Gymnasium acht Jahre Latein, sechs Jahre Altgriechisch und vier Jahre Englisch.
Mein Großvater mütterlicherseits hat mir geholfen und mich sogar geprüft, obwohl er selbst nie Latein gelernt hatte. Aber als Mesner hatte er stets damit zu tun, denn die Messen wurden damals noch auf Latein gehalten.
(Ich weise darauf hin, dass wir als Ministranten auch in Latein beteten, obwohl wir nichts verstanden. So sprachen wir am Beginn der Messe „… ad Deum qui laetificat …“. Ähnlich ging es mit dem „Suscipiat“ in der Mitte der Messe, das leierte ich bloß herunter.)
Mir ging es ähnlich mit meinem Ministrantenlatein. Aber in der Schule war Latein für mich kein Problem, ich war ein sehr guter Schüler.
Nach der vierten Klasse verließ ich das Petrinum, denn ich begann mich allmählich für das weibliche Geschlecht zu interessieren. Bis dahin wollte ich Priester werden, nun aber nicht mehr. Im Petrinum durften wir genauso wie in Kremsmünster nur vier Mal im Jahr heimfahren, zu Allerheiligen, Weihnachten, Ostern und Pfingsten. Zu Hause in Windischgarsten musste ich während der Ferien bei jedem Hochamt und bei jeder Sonntagsmesse ministrieren. Als Ministrant war man etwas im Ort. Ich kann mich an die großen Fronleichnamsprozessionen mit dem anschließenden Hochamt erinnern, bei denen drei hochwürdigste Priester teilnahmen. Damals hatte Windischgarsten ständig drei Geistliche, den Pfarrer und zwei Kapläne.
(Ich erzähle von einem Vorwurf in Kremsmünster, weil ich bei einer feierlichen Messe einen Kerzenleuchter wie ein Maschinengewehr trug. Das kränkte mich.)
Wir tranken manchmal etwas vom Messwein, wie jeder Ministrant.
(Ich füge ein, dass es in Kremsmünster Tage gab, an denen ich zwei Mal hintereinander ministrierte.)
Wir ministrierten im Petrinum meistens drei oder vier Mal am Tag. Dort waren so viele Geistliche, dass ich an manchen Tagen sogar bei fünf Messen ministrierte. Bei einer Fronleichnamsprozession musste ich das Rauchfass rückwärtsgehend gegen den Priester mit der Monstranz schwingen. Wir gingen dabei auch auf Feldwegen. Einmal stolperte ich über eine Wurzel und fiel mit dem Rauchfass hin. Niemand lachte oder machte mir später Vorwürfe.
Die Predigten des Onkels – als Arbeiter in der VÖEST
Während der Sommerferien war ich damals beim Onkel Josef Renhardt in Gmunden, dem Pfarrer im Seeschloss Ort. Auch bei ihm habe ich sehr oft ministriert. Es kam sogar vor, dass bis zu zehn Hochzeiten an einem Samstag gefeiert wurden. Das war sehr lukrativ für uns Ministranten, da wir bei jeder Hochzeit etwas Trinkgeld bekamen.
Ungefähr vier Wochen war ich bei meinem Onkel. Dadurch habe ich viele Hochzeiten erlebt und seine Predigten gehört. Diese konnte ich bald auswendig, denn er hat immer dasselbe erzählt. Heute gebe ich zu, dass ich wahrscheinlich wegen des Trinkgeldes in den Ferien nach Gmunden gefahren bin, da die Eltern uns nie Geld geben konnten.
Ministrant war ich schon im Alter von acht oder neun Jahren. Als Fackelträger fängt man an. Später wurde man Oberministrant und durfte einen Talar tragen. Wir waren zwei Oberministranten und hatten schwarze Talare. Diese dürften von früheren Kaplänen gewesen sein, den Mitarbeitern des Pfarrers. Wenn der Bischof da war, durften wir den Bischofsstab tragen.
Da ich kein Priester werden wollte und man dies auch im Petrinum merkte, wechselte ich in das Akademische Gymnasium in Linz auf der Spittelwiese. Nun musste ich mir ein Privatzimmer nehmen. Das kostete Geld! Da der Vater wenig Geld hatte, trug ich Zeitungen aus, so die Oberösterreichischen Nachrichten ab fünf Uhr in der Früh, und zwar in den vier Straßen rund um die Zentrale an der Promenade. Ich hatte vier Schlüsselbünde – wie ein Kerkermeister –, da ja die Hauseingänge abgeschlossen waren. Ich lernte dabei noble und einflussreiche Menschen kennen. In den Sommerferien arbeitete ich sechs Wochen in der VÖEST. Es war nicht leicht, so eine Arbeit als Schüler zu bekommen. Aber ich hatte einen Schulfreund, dessen Onkel Ingenieur bei der VÖEST war. Tagsüber war ich dort in der Erzvorbereitung tätig, am Abend arbeitete ich als Schankbursch im „Stadtkeller Linz“. Ich konnte es dabei nicht über mich bringen, „überschüssiges“ Bier wegzuschütten, also trank ich es. Der Heimweg zu Fuß war dann etwas schwierig.
Bei der VÖEST verdiente ich viel Geld. Davon konnte ich bis ins folgende Frühjahr leben. Im April, als das Geld zu Ende war, machte ich den Jahresausgleich beim Finanzamt. So bekam ich noch ein bisserl Geld, das bis zu den nächsten Ferien reichte.
1969 habe ich maturiert. Professor Sulzbacher war mein Geschichtslehrer. Bei dem hatte ich einen guten Stand, weil er ein Studienkollege meines Onkels, des Pfarrers, war. Ich hatte die große Ehre, für den Professor die Manuskripte zu schreiben – für Philosophie und Geschichte. Geprüft wurde ich nie, den Stoff kannte ich von den Manuskripten. Geschichte war immer mein Lieblingsfach.
Bei den Funkern im Bundesheer
Ich bin froh, das Bundesheer gemacht zu haben. Zwei Wochen nach der Matura bekam ich den Einberufungsbefehl nach Allentsteig im oberen Waldviertel, da war ich 19 Jahre alt. Über Kasernen im Waldviertel gibt es viele Sprüche wie diesen:
Allentsteig und Horn,
schuf der Herr in seinem Zorn.
Allentsteig war für uns das Ende der Welt, auch Berufssoldaten, die Alkoholprobleme hatten, wurden dorthin strafversetzt. Bei einer Angelobung war der diensthabende Hauptmann betrunken. Er gab ein falsches Kommando, doch wir von der Ehrenkompanie reagierten nicht und wurden dann sogar dafür belobigt.
Mein seliger Vater, Otto Habersack, war ein guter Freund des Nationalratsabgeordneten Franz Mayr in Windischgarsten. Er war der einzige „Nationalrat“ – so wurde er genannt – weit und breit in dieser Gegend. Mit seiner Intervention beim damaligen Verteidigungsminister Dr. Georg Prader kam ich zum Bundesheer in Ebelsberg, Gott sei Dank zu den Funkern! Ich war Funkfernschreiber, war daher bei Manövern immer in einem VW-Bus oder in einem Schützenpanzer.
Eine Nachwirkung der Tschechenkrise war, dass die Russen und die Tschechen unsere Funkfrequenzen derart überlagert hatten, dass wir nicht funken konnten. Im Winter 1970 hatten wir Manöver in Allentsteig, da ließen die Russen das Requiem von Verdi durch, um unseren Funk zu stören. Das werde ich nicht vergessen.
Im Juni 1970 rüstete ich ab. Vorher hatte ich noch ein schönes Erlebnis. Ich hatte insgesamt etwa 30 Wachdienste zu absolvieren und stand anlässlich eines solchen an der Pforte. Vollkommen überraschend kontrollierte ein General die Wache und prüfte die Wachvorschrift. Ich konnte diese „heruntersagen“, ich kann sie heute noch, daher bekam ich einen Tag dienstfrei.
Jetzt stand ich vor der Wahl: Was studiere ich?
Jusstudium – der Bierdeckel als Urkunde
Ich hatte ab 1954 den Kindergarten in Windischgarsten besucht. Auf dem Heimweg kamen wir immer am sogenannten Gerichtskotter vorbei. Dort konnte man durch ein Loch im Gartentor schauen und vor allem um die Mittagszeit Verurteilte sitzen sehen. Damals war Hans Rumplmayr der letzte Kerkermeister und seine Frau kochte für die Insassen. Vielleicht waren diese Erlebnisse für meine Berufswahl mitausschlaggebend.
In meiner Volksschulzeit ab 1956 trieb ein Brandstifter in Windischgarsten sein Unwesen. Die Bevölkerung war in Furcht und Unruhe versetzt, da es beinahe alle zwei bis drei Wochen brannte. Es wurde so mancher verdächtigt.
Ein Maurer, der zugleich Feuerwehrmann war, stand zwar schon länger unter Verdacht, aber überführt wurde er im Zusammenhang mit der Verrichtung seiner Notdurft. Er hatte nämlich zumindest bei einem Brandplatz einen „Haufen“ hinterlassen, der eindeutig von ihm stammte. Bei den Erhebungen machte er falsche Angaben und wurde überführt. Ich ging als Volksschüler oft beim Kaufhaus Lechner vorbei, wo er als Maurer arbeitete. Ich kannte ihn, weil ich ihm oft bei der Arbeit zugeschaut hatte. Das Mauerbauen interessierte mich. Als ich einmal um die Mittagszeit von der Volksschule heimging, sah ich zwei VW-Busse voll mit Gendarmen. Da hatte man den Maurer als Brandstifter verhaftet. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis, es war 1958.
Der damalige leitende Staatsanwalt des Kreisgerichtes Steyr hat gegen das an sich „geschmalzene“ Urteil wegen zu geringer Strafe erfolgreich Berufung eingelegt. Damals wurde Brandstiftung noch streng bestraft. Ich las diese Berufung während meiner Tätigkeit am Kreisgericht Steyr und kann mich noch sinngemäß an die Wortfolge erinnern: „Der Angeklagte hat ein Alpendorf durch lange Zeit hindurch in Furcht und Unruhe versetzt.“
Einmal entdeckte ich beim Spielen einen Toten. Es war der Lois H., ein Arbeiter, der sich hinter dem Gasthaus Kemmetmüller in einem Schuppen erhängt hatte. Der ist schon neun Tage dort so gehangen. Tagelang hatte man nach ihm gesucht. Wir Buben haben damals die Holzhütten unsicher gemacht und so den Toten gefunden.
Einmal erschoss sich ein Kaufmann. Wir glaubten lange Zeit, dass wir an seiner Verzweiflungstat schuld wären, weil wir in unserem jugendlichen Leichtsinn bei seiner Regentonne immer das Wasser abgelassen hatten. Er hatte sich darüber geärgert, uns aber nie erwischt. Als Buben unternahmen wir in den Fünfzigerjahren viel, sogar „schwarz“ fischen gingen wir. Nur angezündet haben wir nichts. Damals gab es ja keinen Fernseher, Kinobesuche waren mangels Geld nur selten möglich. Gelernt haben wir nur in der Schule, aber nie danach.
Solche Erlebnisse waren wohl ausschlaggebend dafür, dass ich mich für die Justiz zu interessieren begann.
Schon während meiner Gymnasialzeit hatte ich regen Kontakt mit dem seinerzeitigen Bezirksrichter Dr. Wilhelm Schmid, einem richtigen Sir. Ich hatte zu ihm ein recht gutes Verhältnis und war ab und zu bei ihm im Gericht. In seiner Tischlade lag seine Pistole, das konnte ich einmal sehen. Er erzählte mir, dass er während des Krieges „Marinerichter“ gewesen war, als Beisitzer. Sie fällten auch Todesurteile.
(Ich erzähle die Geschichte von meinem Vater, der einen wegen Fahnenflucht zum Tode Verurteilten an der Front retten konnte, weil er als Arzt sagte, dieser sei unzurechnungsfähig. Der Vorsitzende des Standgerichtes hatte einen Schmiss, mein Vater hatte fünf. Der Richter sah diese und nickte, das hat dem Burschen das Leben gerettet.)
Nach dem Krieg war Dr. Schmid ein paar Jahre gesperrt, wurde aber wieder als Richter eingesetzt. Er erzählte mir viel. Das war auch maßgeblich dafür, dass ich Richter wurde.
Ich musste schnell studieren und mit dem Studium fertig werden, denn der Vater hatte wenig Geld. So entschloss ich mich, Jus in Linz zu studieren. Beim feierlichen Spatenstich für die Uni in Linz am 3. Juli 1964 durch Bundespräsident Adolf Schärf war ich dabei gewesen. Von jeder Schule wurden zwei Schüler zu dieser Aktion hingeschickt, darunter ich von unserer Schule.
An ein Erlebnis an der Uni erinnere ich mich besonders deutlich. Der seinerzeitige Strafrechtsprofessor Dr. Diethelm Kienapfel schilderte als kuriosen Fall eine Begebenheit aus Windischgarsten: Ein verheirateter Mann hatte eine Freundin und zeugte mit ihr ein Kind. Seine Ehefrau, von der er schon längst getrennt war, erstattete Privatklage wegen Ehebruchs gegen ihn und seine Freundin, die Kindesmutter. Ehebruch ist heute strafrechtlich nicht mehr verfolgbar. Dr. Schmid hat beide freigesprochen, und zwar aufgrund seiner Überzeugung, dass die gebrochene Ehe in Wirklichkeit keine richtige Ehe mehr war. Das war sehr gescheit vom Richter. Das Urteil wurde rechtskräftig. Die Privatklägerin brachte keine Berufung ein und es kam zur Scheidung. Scheidungsgrund war das „nachweislich außer der Ehe gezeugte Kind“. Der Staatsanwalt des damaligen Kreisgerichtes Steyr erfuhr davon und brachte eine erfolgreiche Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes ein.
So kam diese Windischgarstner Geschichte zum Obersten Gerichtshof, und der schrieb sinngemäß: Der Richter in Windischgarsten hat ein bisserl einen Vogel. Das konnte man herauslesen. Als Professor Kienapfel diesen Fall, den ich ja kannte, vortrug, sagte er sinngemäß: Die dort in Windischgarsten sind ohnehin hinter den Bergen.
Man kann sich ausmalen, wie mich meine Studienkollegen angeschaut haben, sie wussten ja, dass ich aus Windischgarsten stamme. So eine Entscheidung wie in diesem Ehebruchsfall ist nur in Windischgarsten möglich.
Professor Kienapfel war seinerzeit berühmt als „Bierdeckelprofessor“. Er hatte eine Abhandlung darüber geschrieben, ob der Bierdeckel eine Urkunde sei. Die Kellner im Klosterhof in Linz, den wir schon während der Gymnasialzeit manchmal anstatt der Teilnahme an den Turnstunden aufgesucht hatten, brachten auf den Bierdeckeln „Stricherl“ für jedes Bier an, das sie auf den Tisch stellten. Wir schwindelten als Studenten und tauschten ab und zu den Bierdeckel aus. Statt sechs „Stricherl“ hatten wir dann nur mehr zwei. Das gebe ich zu, nach 45 Jahren. (Ist der Bierdeckel nun eine Urkunde oder nicht?) Ja, er ist eine Urkunde. Der Professor vertrat die Meinung, der Bierdeckel sei eine Urkunde, denn der Aussteller, der Kellner oder die Kellnerin, sei ja eruierbar. Ein Schwindel mit dem Bierdeckel sei also ein Urkundenbetrug.
Ich schloss nach acht Semestern 1974 das Jusstudium mit dem Doktorat ab und begann unverzüglich meine Berufslaufbahn bei Gericht. Zuerst war ich Praktikant am Bezirksgericht Windischgarsten, das war allerdings nicht ständig mit einem Richter besetzt. Der damals zuständige Richter Dr. Bittermann betreute auch noch das Bezirksgericht Grünburg.
Die Lebendigkeit der ruhenden Erbschaft
(Wir reden über das Romanum, das früher beim Jusstudium das letzte Rigorosum für das Doktorat war, damals gab es drei Studienabschnitte, nämlich drei Staatsprüfungen und drei Rigorosen.)
Im Römischen Recht musste ich eine 60-seitige Abhandlung über die „hereditas iacens“ abfassen, die „ruhende Erbschaft“. Geprüft wurde ich von der damals bekannten Professorin Dr. Marianne Meinhart, diese Prüfung hat mich lange verfolgt.
Später habe ich dieses Wissen einige Male gebraucht. Es gibt nichts Lebendigeres als die „ruhende Erbschaft“, denn bevor die Erbschaft eingeantwortet werden kann, ist einiges zu tun. Stirbt zum Beispiel ein Unternehmer und hinterlässt minderjährige Kinder, muss der Richter als Pflegschaftsrichter einen Geschäftsführer für das Unternehmen einsetzen, damit der Betrieb weitergeht, die Rechnungen bezahlt werden usw. Der Richter auf dem Land ist zugleich Pflegschaftsrichter und Abhandlungsrichter. Solche Verfahren dauern meistens länger. Ich war damals Richter in Kirchdorf und hatte als Pflegschaftsrichter dafür zu sorgen, dass nach dem Tode eines Fleischermeisters aus dem Sprengel des Bezirksgerichtes Kirchdorf der Betrieb weitergeführt wurde, Dienstverträge abgeschlossen und Steuererklärungen erstattet wurden, dies alles im Interesse der minderjährigen Kinder des Verstorbenen.
Als Praktikant in Windischgarsten
Am Bezirksgericht Windischgarsten war ich neun Monate. Das war ein Teil des Gerichtsjahres. Nach neun Monaten musste man ein Übernahmekolloquium machen, das war der früheste Termin.
Ich hatte an diesem Gericht einige interessante Fälle. Einmal gab es einen Mord im Salzatal hinter dem Kalvarienberg in Windischgarsten. Da brachte ein Mann seinen Bruder um. Ein anderes Mal hatten wir einen Doppelselbstmord in der Vogelgesang-Klamm. Ein altes Ehepaar stürzte sich über die Felswand.
Solche Geschichten erlebte ich als Praktikant hautnah. Der zuständige Bezirksrichter war damals in Steyr und Grünburg tätig, er kam nur einmal in der Woche. Ich war schon Doktor, aber Praktikant. (Hat man Herr Rat zu dir gesagt?) Nein, die Leute kannten mich ja schon von Kindheit an. Ich hatte auch ein Hintergrundwissen von den Menschen hier, ich wusste relativ viel von ihnen. Wenn ich mich einmal nicht auskannte (mit den gesetzlichen Bestimmungen und den Menschen und ihren Beziehungen usw.), fragte ich den Grundbuchführer am Gericht, Ernst Haunschmidt. Ich ging öfter während der Vorsprachen der „Rechtsuchenden“ aus dem Raum hinaus und fragte den Ernstl, wie ich mit den Leuten umgehen soll, mit denen ich zu tun hatte.
Zu den betreffenden Personen sagte ich, ich hätte in den Büchern nachgeschaut.
Heute kann ich es ja zugeben, ich hielt oft auch Rücksprache mit dem Richter, der mein Ausbildungsrichter war und für den ich Strafverfügungen vorbereitete, wenn er nicht da war. So zum Beispiel, als ein Deutscher „schwarz“ gefischt hatte. Die Ausfertigung gab ich dem Beschuldigten, der fuhr ja wieder nach Deutschland. Der wäre nie mehr zum Gericht gekommen. Der Richter hat nachträglich unterschrieben.
Dann wurde ich dem Landesgericht in Linz und nicht dem damaligen Kreisgericht Steyr zugeteilt, weil ich kein Fahrzeug hatte und nicht in Steyr wohnen wollte – ich hätte mir das nie leisten können. Eine Fahrt von Windischgarsten nach Steyr mit öffentlichen Verkehrsmitteln war nicht vorstellbar. Ein Rechtspraktikant erhielt damals monatlich rund 2.700,– Schilling, das sind weniger als 200,– Euro.
Am Landesgericht Linz wurde ich zuerst einem Handelsrichter zugeteilt. Es gab damals noch die sogenannten ersten Tagsatzungen. Wir mussten vor dem Termin die Klagekosten ausrechnen und den zustehenden Betrag im Akt mit Bleistift vermerken, damit der Richter beim Termin sofort feststellen konnte, ob die Kosten richtig verzeichnet wurden.
Solche Termine waren immer angenehm, weil nicht die Anwälte erschienen, sondern deren weibliche Kanzleikräfte, wobei manche wirklich eine Augenweide waren.
Im Anschluss daran wurde ich dem Strafrichter Adolf Walter Koppauer zugeteilt, er hieß immer nur der „AWK“. Er war ein strenger Richter und auch Ausbilder. Allerdings war er immer darauf bedacht, die Urteile „seitenlang“ auszufertigen, sodass man schon einige Übung brauchte, den Sinn eines solchen Urteils zu verstehen. Dies ist mir in weiterer Folge zur Belastung geworden, weil es bei der nächsten Zuteilung, nämlich bei der Staatsanwaltschaft Linz, oberstes Gebot war, sich kurz zu fassen und die entsprechenden Einträge im sogenannten Tagebuch prägnant abzufassen.
In dieser Zeit – etwa 1975 – kam es zur Verhandlung der „Essiggurkerl-Geschichte“.
Das Essiggurkerlurteil
Als Richteramtsanwärter wurde ich damals auch als Schriftführer in Schwurgerichtssachen eingesetzt. Drei „Morde“ hatte ich bereits hinter mir und musste die entsprechenden Urteile konzipieren. Die Ausfertigungen selbst waren nicht schwer, schwer war in diesem Zusammenhang das Formulieren der an die Geschworenen zu stellenden Hauptund Eventualfragen.
Das seinerzeit bekannte Essiggurkerlurteil musste ich – gegen meinen Willen – ausfertigen und entsprechend begründen, ich weiß heute noch genau den Sachverhalt. Folgendes hatte sich abgespielt: In den Siebzigerjahren gab es in Linz noch Wohnungen, die mit Kohle geheizt wurden. Die Säcke wurden von Kohlenausträgern in den Keller gebracht. Einmal sahen zwei von diesen im Keller einer Frau Gläser mit eingelegten Essiggurkerln auf einer Ablage. Da übermannte sie die Lust und jeder nahm ein Gurkerl aus einem Glas heraus. Die Frau kam darauf, dass Gurkerl fehlten, sie konnte aber nicht sagen, wer von beiden die Gurkerl gestohlen hatte.
Im nächsten Jahr kamen wieder dieselben Kohlenausträger. Die Frau lag auf der Lauer und sah, wie die zwei ein ganzes Gurkenglas mitnahmen. Sie verständigte die Polizei, die zu der Kohlenfirma fuhr und in einem Spind das angebrochene Gurkenglas fand. Beide Kohlenausträger wurden wegen Gesellschaftsdiebstahl angeklagt. Unvorstellbar, denn die beiden waren unbescholten, sie gaben die Sache zu. Der Richter – mein Ausbildungsrichter – verurteilte sie zu einer Geldstrafe, sie nahmen das Urteil an, doch der junge Staatsanwalt – später wechselte er dann die Seiten und wurde schließlich Vizepräsident des Oberlandesgerichtes Linz – meldete volle Berufung zugunsten der Angeklagten an.
Das ist die einzige Berufung eines Staatsanwaltes in dieser Art, die ich in meiner Laufbahn erlebt habe. Beim Ausfertigen des Urteils fiel mir lange nichts zur Schuld der Angeklagten ein, mühsam versuchte ich, darzulegen, dass die Angeklagten schon ein Jahr zuvor an derselben Stelle Gurkerl gestohlen und sofort an Ort und Stelle gegessen hätten, um nicht mit der Diebsbeute ertappt zu werden, auch dass sie dasselbe Opfer – nämlich die alte Frau – bestohlen und sogar die Beute weggeschafft hätten, um in den Genuss derselben bei der nächsten Jause zu kommen.
Dieses Urteil samt Berufung des Staatsanwaltes wurde dem Oberlandesgericht Linz zur Entscheidung vorgelegt. Dort mussten drei Richter darüber beraten, auch der Oberstaatsanwalt war bei der Berufungsverhandlung zugegen. Letztendlich sprach das Berufungsgericht die beiden in zweiter Instanz wegen Geringfügigkeit frei.
Die Hendlgeschichte
Dann wurde ich der Staatsanwaltschaft Linz zugeteilt, wo ich die berühmte Hendlgeschichte erlebt habe. Ein Mann aus dem hintersten Mühlviertel ging in Linz in einen Supermarkt und sah ein kleines, tiefgekühltes Hendl. Er nahm es, verbarg es unter seinem Hut, stülpte diesen über den Kopf und wollte das Hendl ohne Bezahlen an der Kasse vorbeischwindeln. Seine Frau war dabei, sie sollte die Kassiererin ablenken. An der Kasse standen viele Leute, sodass sie länger warten mussten. Durch das kalte Huhn unter dem Hut wurde der Mann bewusstlos und fiel um. Der Hut fiel vom Kopf und das Hendl rollte davon, es war ja noch gefroren.
So schilderte der Kaufhausdetektiv als Zeuge in der Hauptverhandlung die Situation. Er hatte diesen Mann schon länger beobachtet, musste aber so lange warten, bis er die Kasse passiert hatte, damit zumindest der Versuch des Diebstahls „hielt“. Der Mann und die Frau wurden wegen Gesellschaftsdiebstahls angeklagt, damals war noch das Landesgericht dafür zuständig. Beide wurden verurteilt. Ich werde diese wahre Geschichte nicht vergessen.
Die Besprechung am Klosett, die „drei Könige“, Herr Dr. Paradeiser und die Richteramtsprüfung
Nun kam ich nach der Zuteilung zur Staatsanwaltschaft an das Oberlandesgericht Linz zur weiteren Ausbildung. Die richterliche Ausbildung dauerte insgesamt drei Jahre. Heute, glaube ich, sind es vier Jahre. Dann erst konnte man die Richteramtsprüfung ablegen.
Beim Oberlandesgericht Linz hatte ich auch bemerkenswerte Erlebnisse. Eines Tages saß ich am Klosett, es gab damals dort am Gericht mehrere Kabinen. Auf einmal hörte ich, wie am „Häusl“ – um die Worte des Bundeskanzlers Dr. Kreisky zu verwenden – ein Senatsmitglied aus einer Kabine mit einem Senatspräsidenten, der in einer benachbarten Kabine saß, die bevorstehende Sitzung besprach. Das war tatsächlich eine richtige „Sitzung“, denn der eine fragte: „Du, Präsident, wie sollen wir da entscheiden?“ Ich schaute dazu, mich schnell und leise aus dem Klosett zu entfernen. Damals wurde also am Klosett eine Rechtsangelegenheit geregelt.
Aus dieser Zeit gibt es noch eine interessante Geschichte. Das Oberlandesgericht Linz ist das übergeordnete Gericht für die Bundesländer Oberösterreich und Salzburg. In Berufungssachen gegen Urteile des Landesgerichtes Salzburg war es damals üblich, dass die Parteien nicht zum Oberlandesgericht Linz kommen mussten, sondern dass die Richter des Oberlandesgerichtes samt Schriftführer zum Landesgericht Salzburg fuhren. In Salzburg haben wir zwei Tage verhandelt, unter anderem auch eine Disziplinarsache gegen den Rechtsanwalt Dr. Paradeiser, den Namen werde ich nie vergessen. Er wurde disziplinarrechtlich beschuldigt, er habe die Ehre des Gerichtes missachtet, weil er Folgendes getan habe: Als der Vorsitzende in einem Zivilprozess zu Beginn zu Dr. Paradeiser sagte „Herr Doktor, tragen Sie die Klage vor!“, da nahm dieser die Klage in die Hand und trug sie nach vorne zum Pult des Richters. Er nahm das Wort „vortragen“ wörtlich. Der Verhandlungsrichter zeigte ihn wegen Beleidigung des Gerichtes an. Dr. Paradeiser wurde dann freigesprochen. Dabei war ich Schriftführer.
Anlässlich dieser Aufenthalte in Salzburg haben wir im Hotel Österreichischer Hof – heute das Hotel Sacher – exquisit genächtigt. Das hat alles die Republik Österreich gezahlt. Zwei Tage waren wir dort. Am ersten Tag nach den zahlreichen Verhandlungen fuhren die drei Richter und meine Wenigkeit zu einem Heurigen. Dort hat jeweils einer der Richter eine Flasche Wein für vier Personen bezahlt. Die Reihenfolge war exakt bestimmt. Als ich bei einem solchen Vergnügen mit dabei war, stritten die Senatsmitglieder, wer mit dem Zahlen an der Reihe sei. Letztendlich zahlte der Senatspräsident.
Bei einem ähnlichen „Nacharbeitsbesuch“, bei dem ich nicht dabei war, stritten die Richter wiederum wegen des Zahlens. Mein Kollege – er wurde schließlich Vorsteher eines Bezirksgerichtes – zahlte dann die Zeche, weil sich die Richter nicht einigen konnten oder wollten.
Ich war damals der einzige Richteramtsanwärter am Obergericht. Das half mir, denn ich war immer bei den Sitzungen dabei. Jetzt kannten mich alle Richter am Oberlandesgericht Linz.
Später wurde ich wieder einem Bezirksgericht am Land zugeteilt.
Dann hatte ich die Richteramtsprüfung zu absolvieren, eine gewaltige Prüfung über drei Tage, die es in sich hatte. Obwohl man als Richteramtsanwärter keine Funktion hat und sich noch in Ausbildung befindet, kam während der schriftlichen Prüfung – wir mussten jeweils an einem Tag ein Strafurteil und ein Zivilurteil konzipieren – der Oberlandesgerichtspräsident zu mir ins Zimmer.
Er fragte mich: „Gehen Sie eh nach Grünburg, das Bezirksgericht ist noch unbesetzt.“ Ich sagte natürlich zu, ich hätte es nie gewagt, zu widersprechen oder einen Wunsch zu äußern.
Allerdings bekam ich dadurch mit, dass man mich bei der mündlichen Prüfung gar nicht hätte durchfallen lassen können, da mich der Oberlandesgerichtspräsident bereits fix für Grünburg eingeteilt hatte.
So wurde ich also Richter am Bezirksgericht Grünburg und Beisitzer beim Schöffengericht und Berufungsgericht in Steyr. Während meiner Zuteilung zum Landesgericht in Linz lernte ich meine Gattin kennen. Sie war beim Präsidenten des Landesgerichtes in der Kanzlei tätig. Zu ihm musste ich öfters hingehen, dabei sah ich sie und verliebte mich. 1977 haben wir geheiratet, und wir sind noch immer zusammen. Zwei Söhne haben wir, Enkelkinder noch keine.
Die Feststellung der nicht ehelichen Vaterschaft von fünf Kindern
Nach meiner Zuteilung zum Bezirksgericht Grünburg und zum Kreisgericht Steyr hat die Justiz die Möglichkeit einer sogenannten Doppelplanstelle erfunden, das heißt, man konnte gesetzeskonform zum Richter für zwei verschiedene Gerichte ernannt werden. In meinem Fall waren dies ab 1978 das Bezirksgericht Enns und das Bezirksgericht Kirchdorf an der Krems.
Drei Mal in der Woche fuhr ich von Enns nach Kirchdorf. Zwei Mal in der Woche war ich am Bezirksgericht Enns. An beiden Gerichten waren Gerichtsvorsteher tätig, ich war jeweils der zweite Richter.
Ich war in allen Sparten tätig, vor allem als Scheidungs-, Straf- und Pflegschaftsrichter. So erlebte ich, wie ein lang verheiratetes Ehepaar mit offiziell fünf Kindern einmal stritt und die Frau im Zorn zum Mann sagte: „Weißt du eh, ein Kind ist nicht von dir, aber ich sage dir nicht, welches.“ Nun ging der Mann vor Gericht und fragte: „Was soll ich tun, ich will wissen, welches Kind nicht von mir ist?“ Nach reiflicher Überlegung – einen solchen Fall hatte ich bislang nicht – sagte ich zu ihm: „Es gibt nur eines, Sie müssen alle fünf Kinder auf Feststellung der nicht ehelichen Abstammung klagen, zumal sich die Kindesmutter weiterhin weigert, zu sagen, bei welchem Kind Sie nicht der Vater sind.“
Die Verführung im LKW
Eine zweite Geschichte war die: Ein sexuell bereits erfahrenes Mädchen fuhr per Autostopp, ließ sich mit einem LKW-Fahrer ein und bekam ein Kind. Sie konnte sich nur erinnern, dass das Zusammensein auf einem Autobahnparkplatz stattgefunden hatte, in einer LKW-Kabine, und dass es finster war. Die Aufschrift auf dem LKW wusste sie nur bruchstückhaft und auch nur ungefähr, wie der LKW ausgesehen hatte. Es war eine schnelle Partie, die sich zwischen Fahrer und Autostopperin ergab. Das Mädchen hatte jedenfalls nichts dagegen, mit dem Mann intim zu werden.
Die Bezirkshauptmannschaft als Jugendwohlfahrtsträger suchte nun nach dem Vater des Kindes. Man ermittelte, dass es sich um ein großes Speditionsunternehmen handeln musste und schließlich nur ein LKW mit einem bestimmten Fahrer in Frage kam. Dieser wurde auf Feststellung der Vaterschaft geklagt. Der als Vater angegebene Chauffeur regte sich im Prozess furchtbar auf und jammerte: „Ich war es nicht, ich war es nicht!“
Die Kindesmutter konnte dazu nicht viel sagen, denn sie erinnerte sich nicht gut an den Mann im LKW. Der Beklagte beteuerte weiter, er habe mit dem Mädchen nichts zu tun gehabt, schließlich äußerte er verzweifelt; „Ich häng mich auf, ich bin nicht der Kindesvater!“ Ich musste nun ein Vaterschaftsgutachten einholen. In diesem hieß es, es sei nicht auszuschließen, dass der Fahrer der Vater des Kindes ist. Ich musste ihm das Gutachten und die Kostennote des Sachverständigen – damals rund 30.000 Schilling – zustellen. Im weiteren Verfahren hat sich Folgendes ergeben: