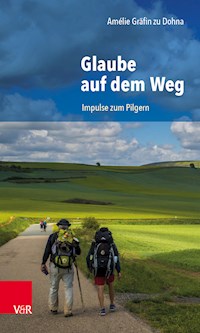
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Pilgern ist im Trend – die einen wollen ihrem Alltag entfliehen, die anderen möchten auf ihrer Reise Gott begegnen. Wer pilgern möchte, muss sich nicht erst auf den Jakobsweg in Richtung Santiago de Compostela begeben. Pilgern ist auch direkt vor Ort möglich. Das Buch ist ein wertvoller Begleiter für jede Pilgerreise. Es richtet sich an all diejenigen, die sich allein oder in der Gruppe "auf den Weg" machen, die andere auf einem geistlichen Weg begleiten oder selbst geistlich unterwegs sind. Pilgerinnen und Pilger erhalten Anregungen, ob sie sich zu Fuß oder in Gedanken auf die Reise begeben. Neben einer allgemeinen Einführung zum Pilgern enthält das Buch meditative Anleitungen, Segen und Gebete, Impulsfragen und vielfältig einsetzbare Methoden, mit denen biblische Texte und Themen schrittweise in das eigene Leben übertragen werden können. So erschließen sich Lebensthemen für unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen – für die Jugendlichen im Konfirmandenunterricht ebenso wie für den Kirchenvorstand. Das Buch kann evangelischen wie katholischen Pilgernden und Pilgergruppen zum Wegbegleiter werden. Im praktischen kleinen Format passt es in jedes Gepäck!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 184
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Amélie Gräfin zu Dohna
Glaube auf dem Weg
Impulse zum Pilgern
Vandenhoeck & Ruprecht
Mit 2 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagabbildung: © maqzet – Fotolia
Alle Bibeltexte nach: Lutherbibel, revidiert 2017,© 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
ISBN 978-3-647-90072-8
© 2018, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,Theaterstraße 13, D-37073 GöttingenVandenhoeck & Ruprecht Verlagewww.vandenhoeck-ruprecht-verlage.comAlle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datametics, Griesheim
Inhalt
Wer geht pilgern? Wer nicht?! – Einführung
1 Pilgern – Wie geht das? Grundsätzliches
1.1 Mit Abraham und Jesus auf dem Weg
1.2 Der wahre Jakob
Jakobus
Jodokus
Rochus
1.3 Evangelisch und ökumenisch
1.4 Weg und Ziel
1.5 Pilgern und Wandern
1.6 Innerer und äußerer Weg
1.7 Verklagt und begnadigt
1.8 Sinn und Verstand
1.9 Schweigen
1.10 Gesundheit
1.11 Pelerine und Proviant
1.12 Einsam und gemeinsam
1.13 Rast und Einkehr
1.14 Fragen und Antworten
2 Geh mit Gott! Biblische Impulse
2.1 EvanGEHlisch
Wüste | Psalm 63
Tischgemeinschaft | Psalm 23
Aufrecht | Lukas 13,10–17
Dankbarkeit und Erntedank | Lukas 17,11–19
Neue Sicht – Gottesdienst auf dem Weg (mit Abendmahl) | Markus 10,46–52
Große Stille | Matthäus 8,23–27
Höhenunterschiede | Lukas 19,1–9
Das Leben ein Wandern | 5. Mose 2,7
Gehhilfe – Ein Weg durch die Stadt | Markus 2,1–12
Gefunden | Lukas 15,8–10
Traumweg – Predigt im Pilgergottesdienst | 1. Mose 28,10–22
2.2 Kirchenjahr
Passionsandacht zum Pilgern (mit Abendmahl) | Lukas 24,13–34
Fußwaschung – Gründonnerstag
Karfreitag – Was ist hässlich? | Jesaja 52–53
Emmausweg in der Osternacht
Pfingsten – Turmbau zu Babel | 1. Mose 11,1–9
Pfingsten – Psalm 118
Reformationstag – Das schöne Confitemini | Psalm 118
Pilgerpredigt für den Altjahrsabend | Psalm 121
2.3 Anlässe
Taufe
Geburtstagspilgern | Matthäus 28,20b
Pilgern mit einem Gremium (Kirchenvorstand | Mitarbeitende in der Seniorenarbeit)
Abendspaziergang
Pilgern mit den Pilgerattributen
Pilgerweg in der Kirche
Impulse aus der Landschaft
Stadtpilgern
Kleine Liturgie für eine Pilger*innensegnung
Anleitung für Alleinpilgernde (an einem Frühlingstag)
3 Da geht noch was! – Bausteine
3.1 Vorbereitungen für mehrtägige Touren
Organisation
Probepilgern
Packen
Pilgertagebuch
Rückkehr
3.2 Methoden
Um zu zweit zusammenzufinden
Singen
Körperübungen
3.3 Biblische Wegworte, Gebete und Pilgersegen
Biblische Wegworte zur Meditation
Gebete zum Aufbruch
Körpergebet
Pilgersegen am Anfang
Pilgergebete für unterwegs
Gebet am Ende des Pilgertages
Literatur
Wer geht pilgern? Wer nicht?! – Einführung
Pilgern ist und bleibt ein Trend. Viele hatten zunächst vermutet, der Pilgerboom flaue bald wieder ab. Doch das Gegenteil ist der Fall. Nach wie vor steigt die Zahl der Pilger*innen. Aus dem Trend ist ein anhaltendes Phänomen geworden. Es hat auch Einzug in das gemeindliche Leben gehalten.
Der Tourismus ist ein Seismograph für gesellschaftliche Trends. Spirituelle Reisen und Pilgern gelten als touristische »Megatrends«, die nicht nur kurzfristige Modeerscheinungen sind, sondern mindestens die nächsten zehn Jahre überdauern werden. »Megatrends« erfreuen sich einer Beliebtheit, die über jeden Trend erhaben ist. Pilgern ist eine nachhaltige Urlaubsform – ein weiterer »Megatrend«. »Spiritueller Tourismus« ist ein Werbe- und Wirtschaftsfaktor. Schon immer siedelten sich um Pilgerzentren Wirts- und Gasthäuser an, ebenso Handwerksbetriebe wie Schuster oder Kerzenzieher sowie Händler für Pilgerbedarf. Dazu zählten von Beginn an Souvenirs wie Pilgerabzeichen und Heiligendarstellungen, die auch als Nachweis der vollbrachten Pilgerreise galten. Für den Tourismus sind die Marketingaspekte des Pilgerns von Interesse. Für die Inhalte ist er nicht zuständig. Die inhaltliche Füllung bleibt vor allem den Kirchen überlassen.
Untersucht und statistisch erfasst wird in erster Linie der Jakobsweg in Spanien. Hier zeigen sich wegen der großen Pilgerzahlen die Entwicklungen besonders deutlich. Sie gelten – mit Abstrichen in den absoluten Zahlen – auch für Pilgerwege in Deutschland.
Im Jahr 2016 wurden in Santiago de Compostela 278.232 Pilgerurkunden ausgestellt. Diese Zahl wurde bereits im Oktober 2017 überschritten.1 1977 waren es lediglich 31. Für das Heilige Jahr 2021 wird mit einer halben Millionen Pilger*innen gerechnet.2 Dies sind allein die offiziellen Zahlen derer, die sich eine Pilgerurkunde, eine »Compostela«, ausstellen lassen. Die »Dunkelziffer« der Pilger*innen auf den Jakobswegen in Spanien ist noch höher. Allmählich gerät die Infrastruktur an diesem Weg an ihre Grenzen. Es werden zunehmend Ausweichwege gesucht – auch in Deutschland. Dabei geraten nicht nur Jakobswege ins Blickfeld, sondern auch neu ausgewiesene Wege.3
Pilger*innen – Was sind das für Typen?
Menschen, die auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela pilgern, sind ein beliebter Forschungsgegenstand. Soziolog*innen, Religionswissenschaftler*innen, auch Kulturgeograph*innen und Mediziner*innen nehmen die Pilger*innen wissenschaftlich unter die Lupe und entwickeln unterschiedliche Kategorisierungen.4
Die Soziologen Patrick Heiser und Christian Kurrat (2012, S. 166–179; Kurrat 2015, S. 131 ff.) betrachten die biografischen Anlässe, die Menschen dazu bringen, sich auf einen Pilgerweg zu begeben. Danach unterscheiden sie fünf Typen.
Typ 1: Biografische Bilanzierung
Dieser Typus umfasst Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Sie halten Rückschau auf ihr Leben und ziehen Bilanz. Sie wollen für sich klären, wofür sie um Vergebung zu bitten haben. Die Anstrengungen des Weges verstehen sie möglicherweise als Buße. Was sie als wertvoll in ihrem Leben erachten, wollen sie zusammenfassen, auch schriftlich, und als Vermächtnis an ihre Nachkommen weitergeben. Ihr sozialer Bezugspunkt ist die Familie zu Hause, nicht die anderen Pilger*innen auf dem Weg.
Typ 2: Biografische Krise
Eine akute Krise veranlasst viele, sich als Pilger*innen auf den Weg zu machen: Krankheit, Scheidung, Verlust der Arbeit, Tod eines Angehörigen. Diese häufig anzutreffenden Pilger*innen brauchen Zeit und Ruhe, um das Erlebte zu verarbeiten und sich langsam wieder dem Leben zuzuwenden. Ihr Ziel ist Heilung für Körper und Seele. Sie suchen den Austausch mit anderen, die eventuell Ähnliches erlebt haben.
Typ 3: Biografische Auszeit
Gestresste Berufstätige – nach einem Burnout oder bevor es dazu kommt – erhoffen sich vom Pilgern Abstand, Entschleunigung und fragen nach dem Sinn ihres Lebens. Viele nehmen sich eine Auszeit ohne konkreten Auslöser, einfach weil viele es tun. Ihnen sind Kontakte und Gemeinschaftserfahrungen unterwegs willkommen. Sie wollen ihr seelisches Gleichgewicht und Gelassenheit finden.
Typ 4: Biografischer Übergang
Diese Pilgernden befinden sich an einem natürlichen Wendepunkt in ihrem Lebenslauf: Abitur, Berufsbeginn, wenn die Kinder aus dem Haus sind, Ruhestand. Sie brauchen Zeit, um sich von dem vergangenen Lebensabschnitt zu verabschieden und sich für das zu öffnen, was als Nächstes kommt. Der Weg hat für sie initiatorische Funktion. Sie suchen im Austausch mit anderen Pilgern Anregungen und neue Ideen für die kommende Lebensphase.
Typ 5: Biografischer Neustart
Immer mehr Menschen beschließen nach einer längeren Phase des Leidens an ihrer aktuellen Lebenssituation, ein neues Leben zu beginnen. Sie kündigen ihre Wohnung oder Arbeitsstelle, ohne eine Perspektive auf etwas Neues. Sie warten ab, was sich auf dem Weg für sie zeigt. Manche wollen z. B. ihre Beziehung zum Partner oder zur Partnerin klären oder sie trennen sich und begeben sich mit dem Weg auf Partnersuche.
Die Charakterisierungen dieser fünf Typen helfen, die eigene Motivation für eine Pilgerreise zu klären: Welchem Typus komme ich am nächsten? Welcher ist mir am fernsten? Als Anbieter einer Pilgertour kann ich vorab bedenken, ob ich eine dieser Kategorien gezielt ansprechen möchte. Daran werden sich Streckenführung und Impulse ausrichten.
Über die beschriebene Pilgertypologie hinaus werden weitaus mehr Menschen von Pilgerangeboten angesprochen. Die Leidenschaft für das Pilgern scheint beinahe so verbreitet zu sein wie im hohen Mittelalter, nahezu unabhängig von Herkunft und Bildung, Besitz, Geschlecht, Alter, Nähe und Distanz zur Kirche.
Gut begleitet
Für Menschen in den beschriebenen biografischen (Passage-) Situationen werden gottesdienstliche Begleitung und Seelsorge von kirchlicher Seite angeboten. Viele nehmen solche Angebote in ihren Gemeinden heute aber nicht mehr wahr. Eine Pilgertour kann kirchliche Kompetenz in der Lebensbegleitung neu ins Bewusstsein heben, etwa bei einem Pilgertag mit Trauernden. Im Leid und der damit verbundenen Ohnmachtserfahrung kann allein eine gemäßigte Aktivität, wie das Gehen eines Pilgerweges, therapeutische Wirkung entfalten. Seelsorge ergibt sich beim Gehen zwanglos. Zwei Menschen, die nebeneinander gehen, müssen sich nicht anschauen. In einer Pilgergruppe kann jede*r anonym bleiben und sieht die anderen aller Voraussicht nach nie wieder. Das erleichtert es vielen Menschen, sich zu öffnen. Pilger*innen finden sich auch ohne professionelle Begleitung leicht zusammen – wie eine Selbsthilfegruppe, die sich gegenseitig berät, stärkt und motiviert.
Ein Artikel bei Spiegel Online ist überschrieben mit: »Warum Pilgern nicht peinlich ist« (Heimann 2013). Pilgern ist derzeit alles andere als peinlich. Kirche und Gottesdienst dagegen werden oft als peinlich erlebt.5
Diejenigen Menschen, die sich eine individuelle religiöse Mischung aus Buddhismus, Esoterik, Yoga, Meditation, Engel, Gregorianik und vielem mehr zusammenstellen, werden als »spirituelle Wanderer« bezeichnet (Gebhardt, Engelbrecht u. Bochinger 2005, S. 133–151; vgl. Lüddeckens u. Walthert 2010).6 Sie nehmen teilweise auch für sie nützliche oder interessante kirchliche und kirchengemeindliche Angebote wahr. Pilgerwege, besonders der spanische Jakobsweg, sind voll von ihnen.
Die von Heiser und Kurrat beschriebenen Pilgertypen neigen dazu, mit ihren Bedürfnissen im wahrsten Sinne des Wortes aus der Kirche auszuwandern. Gemeinden können ihnen mit Pilgerangeboten entgegenkommen und so zu verhindern versuchen, dass die Suchbewegung vieler Menschen auf esoterische »Abwege« führt. Stattdessen kann die Suche, der jeweiligen biografischen Situation entsprechend, seelsorgerlich und geistlich begleitend aufgenommen werden.
Pilgern hatte von Anfang an institutionenkritisches Potenzial. Die Beliebtheit der Santiagowallfahrt im Mittelalter lässt sich auch damit erklären, dass sie sich der päpstlichen Kontrolle entzog – anders als die Pilgerfahrt nach Rom. Die implizite Kirchenkritik der Pilgerbewegung lohnt eine Betrachtung. Sie kann eine gemeinde-, ja kirchenentwickelnde Wirkung entfalten.
Methodisch liegt der Charme darin, dass Pilgern keine Frontalveranstaltung ist. Es ermöglicht den Teilnehmer*innen einen hohen Grad an innerer Beteiligung und den Austausch untereinander. In unterschiedlichen geistlichen und seelsorgerlichen Aus- und Fortbildungsformaten bewähren sich Pilgereinheiten.
Pilgern ist ein vielseitiges Feld auch für ehrenamtliches Engagement, besonders in der Herbergsbetreuung, Pilgerbegleitung und Wegpflege. Meist sind es Ehrenamtliche, die selbst mit dem Pilgern bedeutende Erfahrungen gemacht haben oder sich dies wünschen. Pilgern erreicht Zielgruppen, die sich sonst wenig in kirchlichen Zusammenhängen engagieren: Kirchenfernere, aber spirituell Aufgeschlossene und Suchende.
Viele Menschen erleben sich in der Komplexität ihres Alltags als überfordert und fremdbestimmt. Die gewohnten Lebensvollzüge werden durch Technisierung, Digitalisierung, Virtualisierung und Beschleunigung immer komplexer. Dagegen ermöglicht das Pilgern, sich selbst und die Umgebung unmittelbar zu erleben, sich auf die elementaren Lebensvollzüge zu beschränken. Mehr als Gehen, Trinken, Essen, Waschen und Schlafen ist nicht nötig und für viel mehr bleibt oft genug auch keine Kraft. Das entlastet und befreit dazu, sich ungewohnten Aspekten des Lebens zuzuwenden. Andererseits dürfen die Ansprüche an die inhaltliche Beschäftigung unterwegs nicht zu hoch angesetzt werden. Auch dafür ist manchmal keine Kraft vorhanden.
Ein neuer Trend im Therapie- und Coachingbereich verbindet Gesprächseinheiten mit Bewegung und Naturerleben, z. B. »Walk and Talk«, »Empathy Walk« oder »Waldbaden«. Mindstyle-Magazine, wie der pilger, flow und slow, nehmen das Bedürfnis auf, der komplexen Welt zu entrinnen. Sie sind jedoch meist voller Tipps und Anleitungen, was wiederum Stress auslösen kann, wenn man meint, all das befolgen zu müssen.
__________________
1 Mehr Informationen auf www.jakobus-info.de/jakobuspilger/statik.htm
2 In einem Heiligen Jahr fällt der Jakobustag, der 25. Juli, auf einen Sonntag. In Santiago de Compostela wird dann ein besonderer Ablass gewährt.
3 Pilgerweg Loccum–Volkenroda, Elisabethpfad, Lutherweg (www.loccum-volkenroda.de; www.elisabethpfad.de;www.lutherweg.de), in Österreich der Weg des Buches (www.wegdesbuches.eu).
4 Die Sozialwissenschaftler Markus Gamper und Julia Reuter (2012, S. 30–47) betrachten das Phänomen eher unter touristischen Aspekten und beschreiben fünf Kategorien: Spirituelle Pilger, religiöse Pilger, Sportpilger, Spaß- und Abenteuerpilger, Urlaubspilger. Der Theologe Detlef Lienau (2012, S. 195) unterscheidet zwischen dem passivischen und dem aktivischen Typus des Pilgers und untersucht ihren jeweiligen Selbstbezug, Sozialbezug, Naturbezug, Transzendenzbezug.
5 Vgl. Fechtner 2015, S. 27: Es wäre »peinlich, wenn ich mit denen verwechselt würde, die ihre Religiosität kirchlich so exponiert leben wie die kleine Schar derjenigen, die sonntags zum Gottesdienst kommen.« Aber: Distanz »ist zugleich als innere Distanzierung ein Akt, sich selbst zu identifizieren, indem man sich abgrenzt.« Im Zusammenhang des Pilgerns lässt sich diese Paradoxie häufig beobachten.
6 Auch innerhalb der kirchlichen Räume tritt zunehmend der soziale Typus des »Wanderers« auf, die Sozialform individualisierter, selbstermächtigter Spiritualität. Die »›Wanderer‹ gehen von einer Pluralität gleichwertiger spiritueller Wege aus, die [...] alle experimentierend erforschbar und frei kombinierbar sind. [...] ›Wanderer‹ verstehen sich selbst als die ausschließlichen Herren ihrer Religion. In ihrer Haltung der Kirche gegenüber verbindet sich mit großer Souveränität eine selektive Nutzung ihnen brauchbar erscheinender Angebote mit einer Ablehnung der von ihnen als ›eng‹, ›angstmachend‹ und ›tot‹ gedeuteten traditionellen Kirchlichkeit. Workshops und Seminare bilden die flüchtigen Vergemeinschaftungsformen dieses Typs spätmoderner Spiritualität, der zwischen der Zielstrebigkeit des modernen ›Pilgers‹ und der Beliebigkeit des postmodernen ›Flaneurs‹ steht.« (Gebhardt, Engelbrecht u. Bochinger 2005, S. 133 f.)
1Pilgern – Wie geht das? Grundsätzliches
1.1Mit Abraham und Jesus auf dem Weg
Bibeltexte gehen Wege. Von Abraham bis zu Jesus und seinen Aposteln sind fast alle biblischen Personen zu Fuß unterwegs. Menschliches Leben ist seit der Vertreibung aus dem Paradies unstet und vollzieht sich in der Grundspannung zwischen Fernweh und Heimweh, zwischen dem Wunsch nach Geborgenheit und nach Ungebundenheit, Beheimatet- und Fremdsein in der Welt. Kain und Abel repräsentieren als nomadischer Viehhirte und sesshafter Ackerbauer biblisch zwei Urtypen des Menschseins. Die Wallfahrtspsalmen (120–134) spiegeln die religiöse Praxis anlässlich der großen Festen wider und bieten liturgische Texte für die Menschen, die unterwegs sind. Im Alltag halten sie die Sehnsucht nach dem Heiligtum wach, nach der großen Gemeinde, nach dem Ort der Gottesbegegnung.
Die biblischen Gestalten – Abraham ist hier der Prototyp – verlassen ihre Wohlfühlzone. Sie erleben unterwegs Begegnungen, Gefahren, Wandlungen, Entdeckungen. Ihre Wege können Bibelleser*innen gedanklich mitgehen und als Deutungshilfe für die Erlebnisse auf den eigenen Wegen heranziehen.
»Folge mir nach«, sagt Jesus vielfach. Wer das tut, ist ein*e Pilger*in, noch nicht am Ziel des Weges oder des Lebens, aber auf das heilvolle Ziel ausgerichtet, orientiert. Orientierung ist die Ausrichtung nach Osten (Orient), wo die Sonne aufgeht, von wo die Wiederkunft Christi erwartet wird. In der Nachfolge Jesu sind Pilger*innen ausgerichtet auf die Himmelsrichtung des neuen, jüngsten Tages, des neuen Lebens in der unzerstörbaren Gemeinschaft mit Gott.
Mit Jesus waren zuerst seine Jünger*innen auf dem Weg. Der Theologe Gerd Theißen (1997) hat den Begriff »Wanderradikale« geprägt. Das Unterwegssein ist ein Grundmerkmal der frühen Jesusbewegung. Nach seinem Tod machen zwei Jünger Jesu auf dem Weg nach Emmaus (Lukas 24) die Erfahrung, auch weiterhin mit ihm auf dem Weg zu sein. Sie gehören nicht zum engsten Kreis der Zwölf – Kleopas und ein Namenloser, ein möglicher Platzhalter für jede*n Christ*in. Sie gehen mit dem Auferstandenen, er geht mit ihnen und bleibt zunächst unerkannt. Die beiden fragen ihn: »Bist du der einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist?« (Lukas 24,18). Für »Fremder« steht in der Vulgata, der lateinischen Übersetzung der Bibel, peregrinus (»Tu solus peregrinus es in Jerusalem«). So wird zunächst Jesus Christus selbst als »Peregrinus« verstanden, als Fremder. Er ist den Jüngern als Auferstandener fremd, in ihrer Welt nicht mehr zu Hause, unbekannt wie ein Pilger.
In der Nachfolge Jesu ist ein Mensch sein Leben lang Pilger – fremd auf der Erde, unterwegs zur himmlischen Heimat. Zu dieser ist Christus selbst der Weg (Johannes 14,6). Der Weg hat geradezu sakramentalen Charakter. Nachfolge ist mehr, als nur hinterher zu gehen. Der Weg wird gewählt und beschritten, eröffnet und zugleich geführt.
Abb. 1: Auferstehungsteppich im Kloster Lüne, © Bildarchiv A. Karstensen/A. Roth
Les pèlerins d’Emmaüs, so wird die Emmauserzählung im Französischen überschrieben: »Die Pilger von Emmaus«. In Darstellungen der Emmausszene werden Jesus und die beiden Jünger oft als Pilger dargestellt. So findet sich auf einem Relief im Kreuzgang von Santo Domingo de Silos in Spanien eine Abbildung Jesu, wie er mit Stab und Muschelabzeichen an der Pilgertasche den beiden Jüngern vorangeht und ihnen den Weg weist.
Auf dem Auferstehungsteppich im Kloster Lüne bei Lüneburg (Abb. 1) sind Jesus und die etwas kleiner gestalteten Jünger mit Hut, Mantel und Stab ebenfalls deutlich pilgernd gekennzeichnet.
Schon in der Frühzeit pilgerten Christ*innen nach Jerusalem, zunächst heimlich. Seit dem vierten Jahrhundert mit dem Ende der Christenverfolgung im Römischen Reich können Pilgerreisen offen durchgeführt werden und sind quellenmäßig fassbar. Sie wollten die authentischen Orte des Wirkens Jesu besuchen und sich in seine Geschichte hineinfühlen: das Untertauchen im Jordan, Essen im Abendmahlssaal, Beten am Ölberg und Gehen der Via Dolorosa – in der Nachahmung, imitatio Christi. Doch schon früh gab es an dieser Festlegung auf konkrete Orte und heilige Stätten Kritik. Auch an anderen Orten sei Christus gegenwärtig und seine Nähe im Geist erfahrbar.7
Der Begriff peregrinus leitet sich etymologisch her von einem Menschen, »der über den ager Romanus hinausgeht«. Er verlässt den geschützten Raum, das umfriedete Gebiet. Er begibt sich, sprachlich, kulturell und religiös in die Fremde und öffnet sich neuen Erfahrungswelten. Er hat kein Dach über dem Kopf und ist abhängig vom Wohlwollen der Menschen, denen er begegnet.
Pilger*innen können als Grenzgänger*innen bezeichnet werden. Sie gehören auf keiner Seite ganz dazu, verbinden aber gleichzeitig auch beide Seiten. Das ist eine verheißungsvolle und riskante Existenz.
Es lauern Gefahren und bieten sich Erfahrungen, wenn ich mich auf Fahrt begebe. Im übertragenen Sinn kann das auf das menschliche Leben insgesamt bezogen werden. »Wir haben hier keine bleibende Stadt« (Hebräer 13,14). Wir sind Fremde im Leben, unbehaust in dieser Welt, nie ganz sicher geborgen. Wir wissen nicht, was uns hinter der nächsten Wegbiegung erwartet. Wir müssen darauf vertrauen, dass der Weg gut weitergeht. Das Ziel kennen wir nicht genau, orientieren uns aber darauf hin. Christ*innen sind wanderndes Gottesvolk auf dem Weg von Gott zu Gott.
1.2Der wahre Jakob
Drei Hauptpilgerziele gibt es im Mittelalter: Jerusalem, Rom und Santiago de Compostela. Letzteres etabliert sich erst im 9. Jahrhundert mit dem Jakobsweg als europaweit wichtiges Pilgerziel.
Neben Jakobus fungieren mehrere Heilige als Schutzpatrone der Pilger*innen, in erster Linie Jodokus und Rochus, aber auch Franz Xaver, Gertrud von Nivelles, Alexius, Petronilla sowie Quirinus von Neuss. Die Ikonographie ist bei allen ähnlich und von der des Jakobus abgeleitet. Daher können sie leicht verwechselt werden. Das Entstehen neuer Pilgerheiliger in Anlehnung an Jakobus zeigt, wie beliebt die Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela war. In den Legenden der pilgernden Heiligen entspringen Quellen, Krankheiten müssen überstanden werden oder sie geraten in kriminelle Zusammenhänge. All das zeigt, was zum Alltag von Pilgernden gehörte: Gefahr für Leib und Leben. Sowohl die Ortsunkundigkeit der Pilger*innen als auch die Gastfreundschaft der Herbergsleute wurden missbraucht. Das ließ die Frage aufkommen, ob unter dem Pilgermantel tatsächlich der »wahre Jakob« oder »Bruder Jakob«, also ein ehrlicher Pilger, steckte.
Jakobus
Jakobus der Ältere, der Jünger Jesu, ist auf Darstellungen leicht und eindeutig an seinem Pilgerhut, der Jakobsmuschel und dem Pilgerstab erkennbar – oft auch mit Kalebasse, Pilgermantel und Pilgertasche, manchmal mit Bibel (vgl. z. B. Keller 2010). Sein Leichnam wurde nach der im 8. Jahrhundert entstandenen Legende in einem Boot in Spanien an Land gespült und in Compostela begraben. Die angebliche Wiederentdeckung seines Grabes steht im Zusammenhang mit der Reconquista, der Vertreibung der Mauren aus Spanien. Jakobus wird zum Matamoros, zum Maurentöter, zum Helfer der Christ*innen in wichtigen Schlachten stilisiert.
Mit dem Jakobskult und den Wallfahrten zu seinem Grab wurde der christliche Zusammenhalt in Europa gegen die Araber beschworen. Ein politischer, aber unkriegerischer Zweck verbindet sich auch im 20. Jahrhundert mit dem Jakobsweg. 1987 erklärte ihn der Europarat zur europäischen Kulturstraße, wies ihn neu aus und belebte ihn neu, um Europa zu verbinden und einen kulturellen Austausch und Begegnungen zu ermöglichen. Dieses Konzept ist aufgegangen. Seit 1993 gehört der »Pilgerweg nach Santiago de Compostela« zum UNESCO-Welterbe. Pilgern überschreitet Grenzen. Es verbindet nicht nur Nationen, sondern auch Generationen, Geschlechter, Milieus, Konfessionen und Religionen.
Jodokus
Jodokus galt im Mittelalter neben Jakobus als der Patron der Pilger*innen. Häufig werden die beiden gemeinsam verehrt. Jodokus unterscheidet sich von Jakobus in den Darstellungen durch die abgelegte Krone zu seinen Füßen. Ein Prinz, der sich dem Erbe der Königsherrschaft entziehen wollte und sich Pilger*innen anschloss. In manchen Darstellungen stößt Jodokus die Krone mit einem Stab in die Erde, aus der eine Quelle entspringt. Er wird als Einsiedler, Priester oder Pilger dargestellt.
Die Verehrung des Jodokus verbreitete sich seit dem 9. Jahrhundert entlang der Jakobswege. Möglicherweise erhielt er auch seinen Namen in Anlehnung an Jakobus.
Rochus
Rochus pilgerte Anfang des 14. Jahrhunderts von Montpellier nach Rom und pflegte unterwegs Pestkranke. Auf seiner Rückreise wurde er selbst infiziert, aber von niemandem gepflegt. Er zog in eine Holzhütte im Wald, ein Hund brachte ihm Brot, eine Quelle entsprang, um ihm Wasser zu geben, ein Engel heilte ihn.
In Kriegswirren wurde er als Spion verhaftet. Obwohl sein Onkel Stadtherr im Ort seiner Gefangenschaft war, gab Rochus die Anonymität als Pilger nicht auf und bat ihn nicht um Hilfe, sondern ertrug die Gefängnishaft bis zum Tod.
Attribute des heiligen Rochus sind eine Pestbeule am Oberschenkel, die durch den zurückgeschlagenen Pilgermantel sichtbar wird, ein Hund mit Brot im Maul, Salbenbüchse, Muschelhut und Pilgerstab sowie ein Engel.
1.3Evangelisch und ökumenisch
Pilgern ist die Urform des religiösen Reisens. Es ist eine religionsphänomenologische Konstante. In nahezu allen Religionen gibt es ein Wallfahrtswesen.8 Eine Pilgerfahrt wird als religiöse Pflicht verstanden, als grundsätzliche Pflicht oder zur Erfüllung eines Gelübdes. Sie ist mit Opfern für den Einzelnen verbunden, als Bußleistung, um einen Ablass zu erlangen. Diese im Hoch- und Spätmittelalter im Christentum stark ausgebaute Praxis kommt in der Reformationszeit weitgehend zum Erliegen.
Die einschlägigen Lutherzitate zum Pilgern sind unterhaltsam. In zwei Bedeutungszusammenhängen bezieht er sich auf das Pilgern oder Wallfahren – beide Begriffe werden synonym gebraucht. Hier einige Beispiele:
»Wahr ists, die Christen essen und trinken mit in der Welt, gebrauchen dieses Leben auf Erden, gleichwie ihr König Christus in der Welt auch mit gegessen und getrunken und dieses Leben gebraucht hat. Aber solches tun die Christen alles als Pilger und Fremdlinge und als Gäste in der Herberge, gleichwie Christus auch getan hat.« (Luther 1531, WA 34, II, 34 a)
Das Pilgern dient Luther wie hier zum einen als Bild für das Leben überhaupt, für das Unbehaustsein in der Welt.
Zum anderen nutzt er es als Negativbeispiel für Werkgerechtigkeit, besonders im Zusammenhang mit der Kritik am Ablass:





























