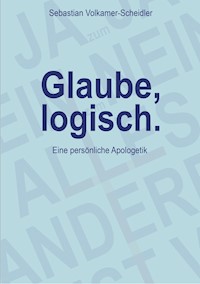
Glaube, logisch. Ein Ansatz, mit grundsätzlichen Fragen an das Christentum umzugehen, die sich jedem Glaubenden stellen (sollten). E-Book
Sebastian Volkamer-Scheidler
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Was ist am christlichen Glauben folgerichtig und logisch? Es gibt Fragen, die mancher für sich klären möchte, wenn er sich zu glauben entscheidet. Wie kann das überhaupt gehen: eine verbindliche Wahrheit für alle, verkündet durch unvollkommene Menschen? Wenn man Gott sucht, wird die Frage, worauf man sich da eigentlich einlässt, sehr relevant. Doch oft geht die Verkündigung davon aus, dass Menschen über das Gehörte nicht nachdenken, dass es genügt, ihnen zu sagen, wovon sie überzeugt sein sollen. Viele der üblichen Antworten ergeben nur Sinn, wenn man sich bereits in der Denkwelt des Glaubens befindet: allzu oft bekommt man Theologisches, wenn man Logisches sucht. Selbstverständlich ist Theologie nötig, doch auch das Richtige kann falsch sein, wenn die Antwort nicht zur Frage passt: Wer Durst hat, braucht kein Brot. Der Glaube hinterlässt so den Eindruck, als könne er nur sich selbst beschreiben, nicht aber die Fragen beantworten, die von außen an ihn gestellt werden. Hier setzt das Buch an: Themen wie Glaube, verbindliche Wahrheit, Erbsünde und Katechismus werden stets auf einer Grundlage behandelt, die selbst keinen Glauben erfordert. Auch kritische Anfragen und Zweifel werden ausgesprochen und weiter gedacht. Anhand von Bildern, Situationen aus dem täglichen Leben und Zitaten aus der Heiligen Schrift wird aufgezeigt, wie sich Gott gerade dort finden lässt, wo es im ersten Moment gedanklich schwierig wird. Erst im Erkennen der eigenen Grenzen lässt sich ahnen, was dahinter liegt: Gott ist nah, seine Botschaft ist eng mit dem Leben verflochten und vor allem: Er ist zutiefst vertrauenswürdig. Ob Leser und Leserin wie der Autor am Ende dieser Gedanken auf Gott und seine Kirche stoßen, bleibt ihnen selbst überlassen. Doch auf jeden Fall wird klar: Das Christentum kann sehr reflektiert sein.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Glaube, logisch.
Über den Autor:
Sebastian Volkamer-Scheidler, 60 Jahre alt, katholischer Christ, verheiratet, 4 erwachsene Kinder.
Arbeitet als selbständiger Architekt, als Mitarbeiter in einem Ingenieurbüro und betreibt einen Webshop.
Hobbys: Naturwissenschaften, Aquaristik, Ornithologie.
Christlicher Blogger mit ca. 500 Beiträgen.
Glaube, logisch.
Eine persönliche Apologetik
Von Sebastian Volkamer-Scheidler
© 2022 Sebastian Volkamer-Scheidler
Lektorat: Heike Sander, Claudia Sperlich, Alipius Müller
ISBN Softcover: 978-3-347-60132-1
ISBN Hardcover: 978-3-347-60133-8
ISBN E-Book: 978-3-347-60134-5
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung „Impressumservice“, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Gewidmet meiner Frau:
Johanna
und meinen Kindern:
David
Benjamin
Simon
Anna
Mit besonderem Dank an:
Heike Sander
für Ermutigung, unermüdliches Gegenlesen und Korrekturen.
Desgleichen an
Alipius Müller
Claudia Sperlich
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Grundlage: Warum diese Texte existieren.
Persönlicher Anfang: Bitte um Erlaubnis
Warum nicht einfach nicht glauben?
Warum nicht einfach glauben?
Persönliche Basis einer Glaubenslogik.
Glaube
Existenziell
Eintauchen
Wahrheit
Freiheit
Gebote
Katechismus
Etwas ist schief gelaufen.
Dualität
Erbsünde
Umpolung
Versuch eines Blicks auf die Grundlagen
Genesis
Sündenfall
Zeit
Trennung
Verbannung
Lohn
Hindernisse: die Folgen des Ja zum Nein.
Glaubenskraft
Festhalten
Werte
Niederschwelligkeit
Rückkehr zur Klarheit
Erkenntnis, Nacktheit, Scham, Outing, Beichte
Das zweifache Nein
Blickrichtung
Autorität
Überwindung des Sündenfalls
Begegnung
Fazit
Sicherheit bei Gott
Schlussgebet
Vorwort
Glaubensfragen greifen tief. Das erlebe ich in der Familie, in der Gemeinde, im Internet und nicht zuletzt in mir selbst. Standardantworten versagen, wenn man persönlich berührt wird; Gott ist existenziell, wie es die eigenen Nöte sind, oder der Glaube lohnt nicht. Wo bleibt die Freiheit angesichts göttlicher Gebote? Wie gehe ich mit meiner Neigung zur Sünde oder wirklich begründeten Zweifeln um? Wenn man sich auf Gott einlässt, verlieren diese Fragen plötzlich ihren Anschein des Theoretischen und verlangen nach Antworten. Die dürfen durchaus abstrakt sein oder unfertig (bei Themen wie der Ewigkeit geht es gar nicht anders), solange sie nur konkret auf die Frage eingehen.
Doch hier hakt es immer wieder: Die Antworten, die man bekommt, passen häufig nicht zur Frage. Viel zu oft geht die Verkündigung davon aus, dass Menschen über das Gehörte nicht nachdenken, dass es genügt, ihnen zu sagen, wovon sie überzeugt sein sollen. Häufig sogar, dass Überzeugungen überhaupt nicht notwendig sind. Hauptsache, man fühlt sich dabei wohl.
Man begegnet Regeln, Rezepten, Methoden und vorgefertigten Weisheiten. Das Spektrum ist weit; alles ist dabei, vom Rezitieren von Dogmen bis hin zum gruppendynamischen Beschriften von Papierstücken in Blattform, die man danach auf einen Papp-Baum des Lebens klebt. Je nach Standpunkt und Glaubensleben dessen, den man fragt, bekommt man dann einen Auszug aus dem Katechismus vorgelegt, abstrakte Theologie, fromme Sinnsprüche oder Wohlfühlen auf Augenhöhe. Nichts davon ist schlecht; die Lehre der Kirche und ihre gläubige theologische Durchdringung in respektvollem Umgang miteinander sind wichtig. Doch auch das Richtige kann falsch sein, wenn die Antwort nicht zur Frage passt: Wer Durst hat, braucht kein Brot.
So aber entsteht bei vielen der Verdacht, dass das Christentum nicht in der Lage ist, sich dem wirklichen Leben zu stellen, und stattdessen in erster Linie sich selbst erklärt. Viel zu oft weiß der Glaube nichts zu erwidern, wenn der Intellekt Fragen hat. Doch es gibt Fragen, die erst einmal logisch, nicht gleich sozio- oder theologisch beantwortet sein wollen, logisch und zugleich gläubig. Wer beides will, glauben und denken, steht mit seinen Themen oft im Regen – einem Regen, den ich nur zu gut kenne.
Dieses Buch ist gleichsam mein persönlicher, gläubig- intellektueller Regenschirm, meine Auseinandersetzung mit der Folgerichtigkeit des christlichen Glaubens. Ich möchte dabei Themen betrachten, die Klarheit brauchen, bevor man sich den Details einer Lehre zuwendet. Meine Erfahrung ist: Wenn ich die vorschnellen Antworten erkenne und beiseitelasse, stattdessen aber die eigenen Fragen wirklich auslote und Widersprüchlichkeiten unvoreingenommen betrachte und untersuche, entdecke ich dahinter Christus und seine Kirche, und so manches Detail ergibt sich von selbst.
Was dann folgt, kann man niemandem abnehmen; Begegnungen sind persönlich, ganz besonders die mit Gott. Deshalb ist es mein Bemühen, keine Aufforderungen zu einem bestimmten Handeln oder Denken zu geben, sondern stattdessen aufzuzeigen, wo es gedanklich weitergehen könnte. Es sind meine Schlüsse, die ich aus all dem ziehe; niemand muss zu denselben Folgerungen kommen. Doch vielleicht springt der Funke der Begeisterung über.
Denn zugleich, und das ist mir das Wichtigste, ist dies der Versuch, die Logik von Gottes Botschaft zum Thema des Nachdenkens zu machen, weil sie wirklich zu faszinieren vermag – eine Freude, die ich teilen möchte. Es ist Verkündigung, denn wo Faszination ist, da ist das Herz.
Düsseldorf, im Juni 2020
Bastian Volkamer-Scheidler
Grundlage: Warum diese Texte existieren.
Warum ich überhaupt schreibe,
warum ich diese Texte schreibe
und warum ich glaube,
dass dies ein sinnvolles Projekt ist,
obwohl ich letztlich unqualifiziert bin.
Das Problem mit dem Atheismus
und das viel größere mit dem eigenen Glauben.
Persönlicher Anfang: Bitte um Erlaubnis
Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. (Lukas 5,31)
Einem Arzt, der ständig raucht, glaubt man keine Gesundheitstipps, so wenig wie einem fetten Diätberater, obwohl beide zumindest theoretisch wissen, wovon sie reden, denn sie haben es gelernt. Was soll dann, bitte, ein Buch über Gott und seine Logik, geschrieben von einem Durchschnittsmenschen, der obendrein ohne theologische und philosophische Ausbildung ist? Haben die beiden Unglaubwürdigen einen neuen Kollegen bekommen, den sündigen, ungebildeten Prediger? Am häufigsten habe ich mir diese Frage gestellt: Darf ich mich überhaupt in dieser Art öffentlich äußern, oder ist es schlicht Anmaßung?
Im Schreiben zeigt sich für mich die Reife oder Unvollkommenheit meiner Gedanken. Verstricke ich mich und bekomme nichts Sinnvolles zustande? Dann beruhte die vermeintliche Klarheit im Kopf auf Unausgegorenem, aus unfertigen Fragmenten und Irrtümern. Wenn aber die Logik stimmt, werden die Gedanken beim Aufschreiben klarer und dichter; was vorher oft schwer greifbar war, wird zur Grundlage, auf der ich jetzt stehen und bereichert weiter denken kann. Das lohnt und macht Freude; Schreiben ist für mich eine hilfreiche Sache.
Doch reicht das für mein Thema: Gott? Selbstverständlich muss er das Beste bekommen, zu dem ich in der Lage bin, und doch – es wird niemals genügen, niemals dem Bedachten auch nur annähernd gerecht. Vor ihm ist alles Erkennen Stückwerk. Was allerdings im ersten Moment nach vergeblicher Mühe klingt, ist in Wahrheit Verheißung: Es wird kein Ende kommen. Mit jeder Erkenntnis wird sich der Horizont weiten; das große, faszinierende und reiche Land, das es im Glauben zu erobern gilt, ist grenzenlos. Angesichts dieser göttlichen Unendlichkeit ist jegliches Denken unvollkommen. Jedem Glaubenden ergeht es so. Auch wenn ich mich daran mache, mit einer Muschel das Meer auszuschöpfen, wenn ich danach suche, das Unaussprechliche mit Worten zu begreifen - Gott reicht das. Er freut sich darüber. Von ihm zu schreiben ist wenig riskant.
Darf ich nun diese Gedanken veröffentlichen, was immer heißt, mit einem gewissen Anspruch aufzutreten? Ich habe sie vorher von Theologen gegenlesen lassen; allerdings wurde auch im Namen der Theologie eine Menge entmutigender Unsinn geschrieben. Genau das aber möchte ich nicht sein: entmutigend, im Gegenteil. Mein Motiv ist der Auftrag Jesu in der Schrift: Wir sollen verkünden, und ich habe lange nach einem Weg gesucht, auf dem ich das kann. Dies ist meine Art. Es wird immer nur ein Anfang sein, ein erstes Kratzen an einer Oberfläche, unter der sich gewaltige Schätze in ungeahnten Tiefen befinden.
Und doch haben mich diese oberflächlichen Gedanken im Laufe vieler Jahre letztlich selbst besiegt: Sie führten vom Nachdenken über Gott zum Beten. Sie führten vom abstrakten „Er“ zum „Du“. Ich erkenne, oder besser: erahne ihn, nicht als Prinzip, sondern als persönliches Gegenüber. Die Verkündigung beginnt, kleine Früchte zu tragen, erst einmal bei mir selbst. Ich erlebe, wie Gottes Therapie langsam, aber sehr tief in mir zu wirken anfängt, und ich bete, dass sie erfolgreich ist.
Kurz möchte ich berichten, wie es zu diesen Gedanken gekommen ist.
Wenn man zum Grübeln neigt und mit der christlichen Lehre heranwächst, entdeckt man als junger Mensch irgendwann, dass man einen großen Vorrat an Antworten auf Fragen besitzt, die man so nicht gestellt hat. Zumindest ich war stolzer Besitzer eines Weltbildes, das durchdacht und in sich schlüssig war, doch nicht in die Realität passen wollte, ein Problem, die ich kurzerhand der Realität in die Schuhe schob. Und da ich all die Antworten, die ich hatte, sehr wichtig fand, versuchte ich, sie auch anderen zu geben, die allerdings ebenfalls nicht danach gefragt hatten. Ihre Freude darüber hielt sich in Grenzen. Sie sprachen klar aus, was ich selbst nicht zu denken wagte: Dieser ganze Glaube passt nicht zu uns. Wir wollen keine Einschränkungen und Anleitungen, sagten sie, sondern leben.Das hatte etwas für sich. Denn, logisch oder nicht, ich musste feststellen: Der Glaube trug nicht. Meine Antworten passten nicht zu den Fragen, die ich wirklich hatte, und die kamen mit Macht. Als junger Mensch bald selbst vor Gewissensentscheidungen gestellt, wählte auch ich das Steak, doch es wollte mir nicht recht schmecken. Zu oft blieb ein schlechtes Gewissen, denn meine Antworten passten zwar nicht, waren aber dominant und redeten überall herein. Wenn der Glaube, neben all seiner Theorie, auch praktisch zu etwas gut war, dann dazu, so schien es, sich darin zu verstricken, nicht weiter zu wissen und zu scheitern. Alles, was mir blieb, war so zu tun, als gäbe er mir Zuversicht und Halt. In diesem Zwiespalt warfen meine ganzen Antworten vor allem neue Fragen auf, die an meinem Weltbild zu kratzen begannen. Alle drehten sich um das Thema: Welche Rolle spielt Gott in meinem Leben, und welche spiele ich für ihn?
Die Suche nach Rat war erfolglos. Die Ungläubigen sagten mir, sie hätten schon immer gewusst, dass der Glaube mit dem Leben nichts zu tun hat, deshalb glaubten sie ja auch nicht. Das erschien wie gesunder Menschenverstand. Die meisten dieser Leute waren lebensfroh, locker und unverbohrt. Jeder sei selbst für sich verantwortlich, behaupteten sie. Diese Verantwortung könne man nicht delegieren, die letzte Instanz sei immer jeder persönlich. Doch da ich inzwischen wenigstens einen Menschen recht gut kannte, nämlich mich, wusste ich, dass ich derlei nicht gebrauchen konnte: Zumindest bei mir reicht es nicht zur letzten Instanz. Auch bei vielen der Ratgeber hat es nicht gereicht; so manche derer, die damals so locker waren, sind heute unglücklich, wofür sie interessanterweise letztinstanzlich andere verantwortlich machen.
Fragte ich Christen, sagten die im Grunde dasselbe. Sie alle hatten ihre private Grenze, hinter der die Forderungen des Christentums nicht galten. Diese Grenze lag wahlweise da, wo sie Gott nicht mehr verstanden, oder dort, wo sie ihn zwar noch verstanden, aber fanden, dass er stört. Sie redeten offen und aufgeschlossen davon, was sie vom Glauben im Leben umsetzen wollten; fragte man jedoch nach etwas, das darüber hinausging, konnten sie plötzlich sehr kurz angebunden sein. Geld, Sexualität oder schlechtes Reden über andere - jeder hatte irgendwo eine Kuh, die so heilig war, dass sie zu schlachten selbst Gott nicht die Berechtigung hatte. Er galt ihnen nicht als die letzte Instanz, sondern als ein Kriterium unter vielen. Letztlich war auch ihre Antwort: Am Ende entscheidet der Mensch, was gilt. Das hatte ich schon gehört.
Geistliche, die ich fragte, rieten mir, eine Grenze zu ziehen und mich nicht zu überfordern. Gegen die Idee eines Glaubens, der mehr forderte, als einen Teilgehorsam, wehrten sich auch sie, und erklärten es anhand der Schrift. Mir kam das unaufrichtig vor: Wieder sollte ich der Maßstab dafür sein, was von Gott gültig war, und was nicht. Offensichtlich drückten sie sich ebenfalls um Klarheit, nur dass sie im Gegensatz zu den anderen in der Lage waren, das aus theologischen Gründen zu tun und gleichsam Gottes Wort als Argument gegen den Glauben zu verwenden. Das wirkte besonders abwegig. Allerdings konnte ich nicht umhin, einzugestehen, dass auch meine eigenen Vorstellungen mich bisher nicht weiter geführt hatten. Wenn ich nicht ein hoffnungsloser Fall war, erschien die Idee der Überforderung recht naheliegend.
Vom ursprünglichen Glauben blieben allmählich nur die zweifelnden Fragen übrig. Es gab die Botschaft von Gott, die ich lange vertreten hatte, und es gab mein Leben. Doch zwischen beiden existierten nur sehr theoretische und abstrakte Brücken – letztlich hatten sie nichts miteinander zu tun. Gott und ich waren nicht kompatibel. Unter Glück verstand er etwas völlig anderes als ich, mehr noch: Ich war überhaupt nicht in der Lage, das, was ich von ihm erkannte, auch nur zu wünschen.
Ich steckte in einer Sackgasse. Sollte ich in einem spirituellen Kraftakt das Gemüt verleugnen? Das hatte ich versucht – es trägt nicht weit. Die wenigsten Hindernisse verschwinden, weil man von ihnen wegschaut; Gefühle gehören nicht dazu. Sollte ich stattdessen korrigieren, an was ich glaubte? Eine absurde Idee. Entweder handelte es sich um Fakten, die zu beachten sich lohnt – dann wären solche Korrekturen nichts als Täuschung, vergleichbar einem Steuerbescheid, in dem ich unangenehme Zahlen selbst durch nettere ersetze. Oder es waren keine Fakten – dann gehörte der ganze Glaube möglichst schnell auf den Müll. Doch Fakten waren es – das war mir klar. Dass es Gott gab, davon war ich nach wie vor fest überzeugt. Er bekam damals einiges von mir zu hören.
Nur langsam wurde mir klar (machte er mir klar?), dass es an der Zeit war, die ganzen alten Denkansätze und Interpretationen zu verwerfen. Die Denkansätze wohlgemerkt, nicht den Glauben – der war richtig, ich lag falsch. Denn das Wichtigste hatte ich in all meinen Ansichten und Grübeleien überhört, eines hatte ich bei allen Regeln und Überlegungen nie wirklich berücksichtigt: Er sagte, dass er mich liebe. Abstrakte Theorien und Prinzipien genügten nicht; es war etwas nötig, in dem ich vorkam, wollte ich ihm nicht unterstellen, dass er mich belog. Wenn es ihm aber um mich ging, waren wir auch kompatibel.
So begann ich, alles neu zu durchdenken. Nicht mehr ich mit meinen Zweifeln wollte den Rahmen vorgeben, sondern Gottes Logik zählte, und diese Logik musste Liebe sein. Ein hoher Maßstab für jemanden, der unter Glauben lange das Ringen mit Gewissensbissen verstanden hatte, und schwer auch angesichts so mancher Stellen in der Bibel, die verurteilend und durchaus nicht liebend klingen. Dennoch - ich suchte (und suche!) Gott so zu erkennen, wie er sich selbst offenbart: beileibe nicht harmlos, aber liebevoll. In diesem Licht aber, das stellte ich fest, wird vieles, was problematisch war, plötzlich hochinteressant.
Warum ich das alles erzähle? Weil das, was mein Durchdenken erbrachte, nur gesagt werden kann, wenn klar ist, woher es kommt. Es muss in meiner Fehlerhaftigkeit geerdet sein, sonst kommen Dinge heraus, die mir nicht zustehen. Ich vermag nichts Endgültiges über Gott und sein Heil auszusagen. Nur eine von ihm selbst eingesetzte und garantierte Instanz, die den Heiligen Geist persönlich zur Hilfe hat, wie immer das aussieht, kann darüber reden, ohne die eigenen Aussagen zugleich in einem gesunden Maße anzuzweifeln. Endgültiges muss von Gott selbst bezeugt werden. Diese Texte sind einfach das, was von mir kommt. Eine persönliche Krücke. Mehr nicht. Eine jedoch, mit der ich versuche, auf Gott zuzugehen. Auch weniger nicht.
Das ist der entscheidende Punkt: Ich schreibe nicht als Berater oder Doktor, sondern als Patient, der Krücken braucht. Ich gebe keine Gesundheitstipps, sondern ich mache Werbung für einen Arzt, von dem ich erlebe, dass er heilt. Dass ich dabei beschreibe, wie ich ihn wahrnehme und was ich ihn tun sehe, ist auch als Nicht-Fachmann mein gutes Recht – wie sonst sollte ich von ihm erzählen? Es ist das Zeugnis eines Kranken mit besten Heilungsaussichten, nicht weil er so robust, sondern weil er in den besten Händen ist. Darf ich nun meine Gedanken aufschreiben, um diesen Arzt bekannt zu machen?
Ich denke, ich darf.
Warum nicht einfach nicht glauben?
Too stupid for Science? Try religion! (Zu blöd für die Wissenschaft? Versuchs mit Religion!)(Atheistischer Slogan)
Nein, nicht alle Atheisten denken so. Nicht jeder bringt es derart überspitzt auf den Punkt und nennt den anderen dumm, doch es gibt viele, die aus ihrer Überzeugung keinen Hehl machen: Jemand, der glaubt, hat es ihrer Meinung nach nötig, harte Fakten durch gläubig-weiche Spekulationen zu ersetzen, und zwar spätestens dann, wenn er, warum auch immer, nicht mehr weiter weiß. Nicht zu wissen und stattdessen zu glauben scheint ihnen die Basis der Religion zu sein. Da finden sie es ehrlicher, die eigene Unwissenheit zu erkennen und an ihr zu arbeiten, statt einfach irgendetwas zu glauben.
Ich beziehe Gegenposition: Wer so denkt, sage ich, hat nicht richtig hingeschaut. Das heißt nicht, dass jeder glaubt, der die Dinge unvoreingenommen betrachtet, doch er wird nicht mehr so über den Glauben reden. Denn nicht Unwissenheit ist die Basis des Glaubens, sondern Begegnung und Verstehen.
Ich habe im Leben zwar oft gehadert, doch die Wahrhaftigkeit Gottes nie in Zweifel gezogen. Der einfache Grund dafür ist kein frommer, sondern ein intellektueller: Unglaube erschien mir schlicht nicht stichhaltig. Versuchte ich, meine Existenz ohne Gott zu denken, kam ich an Grenzen, die verschwanden, sobald ich ihn einbezog.
Atheismus konnte mich logisch nie überzeugen, im Gegenteil. Der Slogan oben bringt die Unvernunft für mich auf den Punkt.
Ich werde erklären, warum, und nehme auch mir die Freiheit, etwas scharf zu sein – der Deckel muss zum Topf passen.
_______
Der andere Boxer rennt auf mich los, wilde Entschlossenheit im Blick. Er sinnt auf Knock-Out. Ich mache mir nicht die Mühe, in Deckung zu gehen – ich weiß, was passieren wird. Er beachtet mich gar nicht weiter, läuft an mir vorbei, baut sich vor einer Ecke auf, in der er mich aus irgendeinem Grunde vermutet. Weit holt er aus und landet einen heftigen Haken in der Luft: „Nimm das!“ Dann wartet er darauf, dass sein Gegner in der Ecke, in der er nie war, angezählt wird. Ich tippe ihm auf die Schulter: „Hallo, hier bin ich!“ Er fährt herum, starrt mich an. „Hast du noch nicht genug?!“ Er läuft zurück zur Ecke, in der er mich glaubt, prügelt erneut auf die Luft ein. Wie üblich hat der Kampf kein Ergebnis, weil er nicht stattfindet: Einer der Boxer verdrischt die Luft, der andere wartet auf einen Schlagabtausch.
So kommen mir die meisten Diskussionen mit Atheisten vor. Sie verorten meinen Glauben dort, wo er nicht ist, bekämpfen mit Nachdruck Positionen, die ich nicht vertrete, und gelangen zu dem Schluss, da überlegen zu sein, wo kein Wettkampf stattgefunden hat.
Der Eingangs-Slogan zeigt es: Die Ecke, in der viele Atheisten Gläubige vermuten, ist die des fehlenden Verständnisses für Wissenschaft. Sie sind überzeugt, der Christ glaube, weil ihm das Wissen fehlt. Er versuche, mit dem Übernatürlichen die Löcher im Weltbild zu stopfen, die ihm eine bessere und tiefere Kenntnis der Natur füllen könnte, wenn er sich nur darauf einließe. Der Atheist sieht in der Idee Gottes einen verqueren Ansatz des Christen auf der persönlichen Suche nach Sinn, den er in sich selbst nicht findet und deshalb in ein Gedankenwesen projiziert. Eine Religion liefert dem Glaubenden Antworten, ohne die er nicht klar kommt, so vermutet der Atheist. Für ihn als denkenden Menschen scheidet die Idee aus, sich etwas vorzumachen; ein Hirngespinst kann ihm keine Lösung sein.
So wird der Glaube oft betrachtet, kritisch wird er betrachtet. Bei harmloser Ausprägung wird er als Krücke für Menschen akzeptiert, denen sich Ethik und Werte ohne derlei religiöse Konstrukte nicht erschließen. Ist der Glaube jedoch fanatisch oder gar missionarisch Hilflosen gegenüber, wie Kindern, Armen, Alten etc., dann ist es in dieser Logik folgerichtig, ihn zu bekämpfen: Es darf schließlich nicht das Ziel sein, Personen eine Krücke zu verpassen, die auch selbst laufen lernen könnten. Nicht Gott muss bekannt gemacht werden, sondern die Erkenntnis, die ihn überflüssig macht. Und so wird mir in den meisten Diskussionen über den Glauben Wissen angeboten, mit dem ich doch bitteschön Gott und sein Reich ersetzen soll, wenn ich mich nicht als unbelehrbar, wenn nicht gar als Fanatiker outen will.
Nur ist all das ein Scheingefecht: Was mir da geboten wird, trifft die Sache nicht. In dieser Ecke des Rings steht überhaupt kein Christ. Dort stehen bestenfalls Verschwörungstheoretiker und daneben ein paar Abergläubische. Mit ihnen zu diskutieren ist meist sinnlos, der angedachte Knock-Out hingegen erscheint hier oft hochverdient.
Der Christ nämlich sieht es genau anders herum: Nicht Wissenschaft ist Antwort auf den Glauben, sondern umgekehrt. Der Glaube ist die Dimension, in die das logische Denken einen Menschen führen kann. Jede Erkenntnis weist, wenn man sie weiter denkt, irgendwann über sich hinaus. Konsequentes Denken erschließt einen neuen Bereich: den des Absoluten, des letzten Schöpfers, evtl. gar den der Sünde und des Erlösers. Man mag das schon als Möglichkeit leugnen (was unwissenschaftlich wäre), oder man setzt sich mit diesem Gebiet auseinander und kann, so man dort Lohnendes vorfindet, versuchen, es zu erobern.
So endet im Grunde jede sinnvolle Diskussion zu diesem Thema, bevor sie überhaupt begann, und wird zum Scheingefecht: Viele Atheisten sind überzeugt, Christen glaubten, weil sie etwas ersetzen müssen, das ihnen fehlt, doch tatsächlich glauben sie, weil sie etwas Zusätzliches gefunden haben. Man redet aneinander vorbei; die Auseinandersetzung ist entsprechend geprägt von logischen Brüchen.
Grundsätzlich haben Christen und Atheisten erst einmal etwas gemeinsam: Beider Weltbild bezüglich der eigenen Existenz beruht auf einem grundlegenden Dogma. Das der Christen lautet: Es gibt einen Schöpfer. Das der Atheisten: Es gibt keinen Schöpfer. Viel wurde darüber geschrieben und diskutiert, doch einleuchtenderweise konnte weder Gottes Existenz bewiesen werden, noch seine Nicht-Existenz.
Nun ist die Idee des Schöpfers erst einmal Wasser auf die Mühlen des Atheismus: Ist da die Wissenschaft nicht längst weiter? Zum Existieren braucht man keinen Schöpfer mehr, eine Erkenntnis, die den Gläubigen offenbar fehlt. Könnte man zeigen, dass nachweislich alles auf natürliche Weise ablief, müsste dem Glauben ein wesentliches Standbein fehlen. So kommt die Evolution ins Spiel, eines der faszinierendsten Gedankengebäude, die je geschaffen wurden. Ein System, in dem sich das Leben aus sich selbst heraus entwickelt und ausdifferenziert, nachdem es unter glücklichen Umständen aus reiner Materie und der in ihr enthaltenen Information entstand. Eine Logik, die höchst zukunftsfähig ist: Verlässlich seit Jahrmilliarden ist ihre gestalterische Kraft in der Entfaltung des Lebens bis heute nicht am Ende. Im Detail betrachtet enthüllt sie Mechanismen und Formen von berückender Schönheit.
Thematisch weiß diese Theorie jeden Interessierten in Bann zu schlagen wie kaum eine andere. Die Wissenschaft zeigt hier, dass sie es alleine kann, Gott wird offensichtlich nicht gebraucht. Die atheistische Logik sagt nun: Eine Erkenntnis, die einen Schöpfer überflüssig macht, muss von Gläubigen abgelehnt werden. Tat sich die Kirche nicht schon immer schwer mit naturwissenschaftlichen Erklärungen? Forschung und Erkenntnis gegen Glaube – das scheint der Kampfschauplatz zu sein, glaubt man den Ungläubigen (und dem Eingangs-Slogan). Dort, wo die Wissenschaft behauptet, sie könne es alleine, muss der Christ zu stellen sein, wo er doch glaubt, sie könne es nicht.
Wenn danach immer noch am Glauben festhält, obwohl ihm die Erkenntnis zur Verfügung steht, offenbart zudem die Gefährlichkeit einer Glaubenslogik, die ihre Anhänger offensichtlich geistig gefangen hält.
Nun gibt es da einen sehr wichtigen Unterschied zwischen Christen und Atheisten. Der Christ nämlich hat grundsätzlich erst einmal keinerlei Probleme mit derlei wissenschaftlichen Erkenntnissen, ganz gleich, was andere denken mögen: Wie Gott das macht, wenn er schafft, das überlässt man ihm am besten selbst. Sollte er das Leben durch Evolution ausgestalten wollen, kann uns das genauso recht sein, wie jede andere Schöpfung auch.
Dem Atheisten hingegen kann es durchaus nicht genauso recht sein. Fällt die Evolutionstheorie, fehlt ihm ein äußerst wichtiges Indiz für sein Weltbild. Im Gegensatz zum Christen, der sie nur faszinierend findet, stützt er sich auf sie. Das Problem dabei ist nicht, dass sie grundsätzlich falsch sein sollte – es spricht viel für ihre Stichhaltigkeit – sondern die Rolle, die ihr zugewiesen wird: Die Erkenntnis, dass es Evolution gibt, wird zur Erklärung für alles Lebendige. Sie wird absolut und unfehlbar gemacht, indem aus ihr alle Aspekte der eigenen Existenz hergeleitet werden. Doch das verträgt die Evolutionstheorie nicht: Sie ist und bleibt eine Theorie, denn sie lässt sich nicht beweisen, weil nichts bewiesen ist, das man weder dokumentieren konnte (zu lange her), noch experimentell wiederholen kann (dauert zu lange).
Damit ist sie nicht angezweifelt. Es spricht wirklich viel dafür, dass die Evolution eine (die?) tragende Rolle bei der Entwicklung des Lebens spielt, doch letztendlich muss man es glauben, wie alles, das eine Theorie als Basis hat. Der Atheismus muss sie zudem glauben, ohne offen für Zweifel zu sein, denn plötzlich hat sich der Spieß umgedreht: Der Christ kommt damit klar, dass es die Evolutionstheorie gibt, das reicht ihm, doch der Atheist braucht sie. Der Versuch, dem Glauben das Standbein wegzuziehen, stützt sich selbst auf eines, das nur theoretisch fest steht. Wir haben daher die merkwürdige Situation, dass der Atheist einen Glaubenssatz hüten und für absolut erklären muss (Dogma). Der Christ hingegen darf diese Theorie für plausibel halten, weil er frei ist. Es ist also genau anders herum, als es für gewöhnlich dargestellt wird.
Nein, der Atheismus ist nicht ohne Glauben, weil er vernünftig ist, sondern er glaubt an die Vernunft bzw. an den Ausschnitt davon, der ihn unterstützt. Wir Christen erkennen, dass die unglaubliche Weite, die uns die Wissenschaft erschließt, eher ein Hinweis auf Gott ist als eine Widerlegung. Ein Hinweis auf einen faszinierenden Gott! Seit jeher ist die Christenheit diesen Indizien nachgegangen, in Forschung und Philosophie, und hat sich angewöhnt, jede Erkenntnis, sei sie naturwissenschaftlich oder anders gelagert, ganz im Sinne eines guten Forschers weiter zu hinterfragen: Warum ist das so und was sagt uns das, über die erkannte Tatsache selbst hinaus? Es ist kein Zufall, dass ein überaus großer Anteil wichtiger Erfindungen und wissenschaftlicher Erkenntnisse christlichen Kulturen entstammt.
Nun ist das „Warum“ eine vielschichtige Frage, die jeden Forscher einerseits motiviert, ihm andererseits aber auch Sorgen bereiten kann: Irgendwo also muss Schluss sein mit der Fragerei, denn fragt man lange genug „warum?“, gehen schließlich die Gründe aus. Das wissenschaftliche Denken beginnt dort, den Bereich, den wir „natürlich“ nennen, zu verlassen und wird zur Suche nach den letzten Dingen, denn „Warum?“ kann man immer fragen - bis man bei etwas ankommt, das sein eigener Grund ist. Deshalb muss die Wissenschaft liefern: Ein letzter Anstoß, der nicht Gott ist, wird gebraucht, etwas, das nicht mehr hinterfragbar ist. Ohne diesen grundlosen Grund wäre die Kausalkette zwangsweise endlos und damit sinnlos, weil sie sich in der Beliebigkeit verlöre, nur um zu existieren. Die Wissenschaft lebt davon, dass sie hinterfragt. Würde sie zugleich postulieren, dass sie damit niemals an einen Anfang gelangen wird, wäre sie absurd: Ich frage, weiß aber, dass es keine Antwort gibt. Wozu also fragt sie? Sie wäre dann ein Beobachter ohne jeden Wahrheitsanspruch und als Argument gegen Gott unbrauchbar.
Hier liefert die Physik Argumente. Sie zeigt, dass es im Universum Dinge gibt, die festzulegen gar nicht möglich ist, da sie ihre Eigenschaften ohne Anlass spontan erhalten. „Warum?“ ist hier sinnlos; gerade weil diese Dinge spontan sind, verbietet sich diese Frage, da man logischerweise Grundloses nicht nach seinem Grund fragen kann. Diese spontanen Eigenschaften aber sind elementar für alles Existierende; Gott, gedacht als letzter Auslöser aller Dinge, scheidet hier aus. Wird gesagt.
Doch beweist das tatsächlich, dass es keinen Gott gibt, weil damit die Unabhängigkeit der Prozesse im Universum abgesichert ist? Man schaue genauer hin, was hier gerade geschieht: Eine Wissensgrenze wird verabsolutiert, als sei sie unfehlbar. Als lege die Forschung nahe, nicht weiter zu forschen. Der heutige Wissensstand ist es, der zur Grundlage des Absoluten gemacht wird. Es braucht nur eine neue revolutionäre Theorie, und alles sieht anders aus. Ist das nicht genau das, was Atheisten Christen vorwerfen: Vorbehalte gegen wissenschaftlichen Fortschritt zu haben? Die Geschichte der Physik ist die Geschichte von Weltbildern, die über den Haufen geworfen wurden; dieses soll jetzt plötzlich absolut sein? Eine Wissenschaft, die das Hinterfragen ab irgendeinem Punkt willkürlich verbietet, wird ihren eigenen Maßstäben nicht gerecht und gibt ein trauriges Bild ab.
Der Atheist wirft dem Christen vor, zu sagen, am Ende des Wissens müsse man glauben, und geht doch selbst noch viel weiter: Er versucht zu beweisen, dass man am Ende des Wissens nicht einmal mehr fragen könne. Was er den Gläubigen vorwirft, tut tatsächlich er selbst: eine Grenze ziehen, hinter der das Forschen mangels Erklärung als sinnlos abgetan wird; ersetzt wird dieser Bereich durch eine dogmatische Weltanschauung.
Wieder zeigt sich: Der Christ ist frei; ohne Gott hingegen muss man an dem Punkt, an dem die eigene Weisheit endet, ideologisch werden. Ansätze und Zweifel, die nicht ins System passen, sind dem Christen erlaubt, nicht aber dem Atheisten. Kann er etwas nicht erklären, ist ihm auferlegt zu glauben, dass es trotzdem passt. Denn er kennt die Drohung, die über ihm schwebt: wenn auch nur ein Ding oder Naturgesetz außerhalb der wissenschaftlichen Möglichkeiten entstand, gibt es einen Schöpfer, er aber muss kapitulieren.
So ist es der Atheist, der am Ende des Wissens in Überzeugungen flüchtet. Sein Selbstbild, nicht zu glauben, schützt er durch Glaubensakte, um sich abzusichern. Es wirkt tragisch: Während er dem Christen noch zugesteht, im Glauben einen Sinn zu suchen, ist ihm selbst die Sinnlosigkeit heilig und unantastbar. Nicht die Christen beenden den forschenden Diskurs, weil sie auf eines ihrer Tabu-Themen stoßen – die Atheisten sind es, die weiteres Fragen unterbinden. So betrachtet erscheint es schleierhaft, wie man diese Haltung als Gedankenfreiheit zu verkaufen vermag, den Glauben jedoch als einengend.
Man fragt sich, woher so mancher Atheist zu wissen glaubt(!), wo ich als Christ stehe und warum er mich gerade dort verortet und bekämpft. Ich denke, er kämpft einfach, wo er selbst um eine Schwachstelle weiß oder sie zumindest erahnt: dass nicht der Gläubige vor dem Problem steht, Lücken mit Glauben schließen zu müssen, sondern er. Er ist es, der mit der Bedrohung ringt, etwas nicht erklären zu können, weil das nicht sein darf, und er klammert sich an Dogmen, die großenteils aus Hypothesen bestehen. Er lebt in einem geschlossenen System, in dem er seine eigenen strukturellen Nöte auf den Glauben projiziert und dort angreift. Der Atheismus schuf den Christen nach seinem Bilde und bekämpft nicht den wirklichen Glauben, sondern sein eigenes Spiegelbild, das er nicht erkennt. Die logische Folge, wenn man zu einer sinnvollen Option kategorisch Nein! sagt.
Die wirklichen Christen hingegen verlassen diese gedankliche Enge. Ihr Bewusstsein ist offen. Sie glauben nicht an Gott, weil sie ihn als Ersatz für fehlendes Wissen brauchen. Sie glauben an ihn, weil sie davon überzeugt sind, dass es ihn gibt. Alles andere wäre neurotisch.
Sie erkennen, dass der Glaube nicht logische Löcher stopft, sondern die Logik in ihn eingebettet ist: Der Bereich des Absoluten ist es, in dem sich jedes Denken abspielt. Er ist das Übergeordnete, innerhalb dessen jede Erkenntnis stattfindet, er ist das Ganze, nicht ein Teilsystem für spirituell Bedürftige, deren Glaube für Kluge erklärbar ist. Er schmälert keine Forschung, im Gegenteil: Er macht neugierig und spornt an. Das einzige, was er raubt, ist die Idee, am Ende angekommen zu sein, das Letzte zu wissen und Gott als falsche Hypothese entlarvt und verworfen zu haben. Doch diese Erkenntnis ist nicht unwissenschaftlich und eng, sondern folgerichtig und weit: das Entdecken einer grenzenlosen neuen Welt. Was kann ein Wissenschaftler sich Größeres wünschen?
In meinen Augen ist der Atheismus nicht tragfähig. Doch dies war der einfache Teil des Problems. Es ist immer leicht, zu beschreiben, was man beim Anderen Falsches sieht. Mehr Aufwand ist, denselben Maßstab auch an das Eigene anzulegen und standzuhalten: Warum gerade das Christentum?
Warum nicht einfach glauben?
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden gesättigt werden. (Matthäus 5,6)
Wer hat, dem wird gegeben werden; wer aber nicht hat, dem wird auch noch weggenommen, was er hat. (Lukas 19,26)
Zweimal derselbe Sprecher; nur eines von vielen Beispielen, wie Aussagen dieses Sprechers nicht zueinander passen wollen und man sie kaum übereinander bekommt, ohne Lösungen an den Haaren herbei zu ziehen. Ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt. Es ist eine Sache, im vorigen Kapitel auf logischen Brüchen des Atheismus herumzureiten, doch selbst zu liefern ist eine andere: Welche Logik soll denn bitteschön ein Glaube haben, der sich auf derartige Widersprüchlichkeiten wie die gerade zitierten gründet? Und eine tragfähige Logik braucht er, sonst gleicht er in dieser Hinsicht dem Atheismus und alle Argumente des letzten Kapitels sind belanglos und beliebig umkehrbar.
Es gibt viele logische Anfragen an den christlichen Glauben. Einige Beispiele.
- Manche Menschen empfinden sich vor der Allwissenheit Gottes als unfrei: Es steht ohnehin alles fest, wenn er jetzt schon weiß, was passieren wird.
- Andere haben Probleme mit der Idee einer endgültigen Wahrheit: Wer einmal erlebt hat, wie sehr authentische Erlebnisse und Erkenntnisse jedem Glauben widersprechen können, dem hilft der höchste Wahrheitsanspruch Gottes nicht weiter – das Leben spricht eine andere Sprache.
- Festzustellen wäre, dass Paulus fast in einem Atemzug sagen kann, nicht das Gesetz erlöse, um uns gleich danach aufzuzählen, was wir alles zu tun oder zu lassen hätten.
- Man kann sich fragen, mit welchem Recht und nach welcher Logik es einen Katechismus gibt, der mir erklären will, was ich glaube oder zu glauben habe, was ungefähr so sinnvoll erscheint, wie ein Buch, in dem steht, was mir schmeckt; es geht um ein persönliches Verhältnis – wie sollte ein Dritter das verbindlich beschreiben?
- Wie kann ich meine Sündhaftigkeit, die laut Christentum faktisch existiert, von Adam und Eva ererbt haben, die es erwiesenermaßen faktisch so nicht gegeben hat?
- Und so weiter…
Es gibt wahrlich genug Diskussionspunkte, die den Glauben mindestens ebenso angreifbar machen wie den Atheismus. Dinge, die ihn wirken lassen wie ein Regelwerk über Unbewiesenes, das von einem fragwürdigen Traditionsverein alter Männer behütet wird, die sich erdreisten, anderen in die intimsten Dinge der Lebensführung hineinzureden. Für Außenstehende ist das nicht nachzuvollziehen, oder besser: als absurd abzulehnen. Hinzu kommt: Wie sich der Atheismus in sich selbst verschließt und den Glauben ausblendet, neigen auch viele Gläubige dazu, die Auseinandersetzung mit dem zu meiden, das von außen kommt. Mit frommen, vorgefertigten Antworten wird oft abgespeist, wer kritisch fragt, wobei ich unter „kritisch“ nicht ablehnend verstehe, sondern tiefergehendes und bohrendes Nachfragen, was sicherlich zu den intellektuellen Tugenden zählt.
Ich erinnere mich an eine interessante Diskussion in einem katholischen Internetforum. Eine Teilnehmerin wusste mit ihrem Sohn nicht weiter. Er hatte sie gefragt, wie denn der Priester in der Messe mit allen Menschen das „Geheimnis des Glaubens“ sprechen könne. Das verstehe er nicht. Sie bekam einige Tipps, wie das Geheimnis des Glaubens zu erklären sei, doch das alles interessierte den Jungen nicht.
Das Stichwort „Geheimnis des Glaubens“ hatte gleichsam auf einen katholischen Knopf gedrückt, der eine bestimmte Art von Antworten auf den Plan rief, fromme nämlich, nur waren es die falschen. Niemandem schien aufzufallen, dass der Junge überhaupt keine theologische Frage gestellt hatte, sondern eine logische: Was man jede Woche vor und mit einer großen Menschenmenge verkündet, ist doch kein Geheimnis mehr! Dem Jungen fehlte es nicht an Verständnis für die Messe – sein Problem war der Umgang des Priesters samt seiner Gemeinde mit Vertraulichem.
Hilfreich war erst der Rat an die Mutter, ihrem Sohn zu erklären, dass das Wort „Geheimnis“ zweierlei bedeute: Einmal etwas, was nicht jeder wissen darf, also nur für Eingeweihte erlaubt ist, aber auch etwas, was man ohne Hilfe nicht begreift, das also nur für Eingeweihte verständlich ist. Das Beispiel war eine leckere Suppe, die nur dann richtig gut schmeckt, wenn die Gewürze erst ganz am Schluss zugefügt werden. Will man diese Suppe essen, erklärt man dem Koch: Das Geheimnis daran ist, dass die Gewürze… Ein Geheimnis kann also auch etwas sein, das man verbreiten möchte, damit man erreicht, was es bewirkt. Ein Treffer: Der Junge war zufrieden.
Fragen dieser Art gibt es zuhauf, bei mir wie bei anderen; passende Antworten aber sind eher dünn gesät. Die Gefahr ist groß, dass man Theologisches bekommt, wenn man Logisches sucht, und man abgespeist wird mit etwas, das wie ein frommes Klischee wirkt. Intellektuelles Anklopfen wird oft abgewiesen.
Bei seinem Anspruch, existenziell zu sein, sollte man vom Glauben indes erwarten, dass er mehr zu bieten hat, als dass er sich selbst erklärt. Er sollte in dem Leben verankert sein, das ich an ihm ausrichten soll, nicht nur in den eigenen Aussagen. Solange er um sich selbst kreist, ohne Antwort auf die Fragen zu sein, die von außen an ihn herangetragen werden, ist er in der Realität des Lebens nichts als eine Hypothese, eine schlechte dazu. Letztlich ist er so selbst eine Frage. Eine Frage aber ist nur solange klug, wie sie ungelöst im Raum steht. Ist sie beantwortet, wandelt sie sich. Wird sie als Ursprung gesehen, der eine Antwort erst ermöglichte, ist sie weise. Wird sie weiterhin gestellt, ist sie dumm. Im Lichte atheistischer Erwiderungen hat der Glaube in den Augen von Außenstehenden so die Wahl zwischen zwei möglichen Plätzen, die es noch einnehmen kann: den einer ehrwürdigen, aber überholten Weisheit, und den einer anhaltenden Dummheit. Beiden ist gemeinsam: Sie haben keine Gültigkeit mehr.
Will er akzeptiert werden, muss der Glaube darum mehr sein, als eine Lebenshypothese, die nur auf sich selbst zu verweisen vermag. Er muss intellektuell standhalten, und zwar nicht in erster Linie den Fragen, die er selbst aufwirft, sondern denen, die von außen kommen.
Glaube, der nicht hinterfragt wird, hat sich in die Position gebracht, in der er letztlich über Löcher definiert wird, die mit Wissen gestopft sein wollen. Das reicht zur Disqualifizierung. Unkritischer Glaube stellt sich selbst ins Abseits. Der Atheist sieht sich bestätigt: Weil das Christentum nicht zu antworten vermag und also dort stattfindet, wo man nicht weiß, ist es eine Hypothese, das Wissen aber ist ihm überlegen, denn es antwortet ihm. Folglich ist der christliche Glaube etwas, das es zu überwinden gilt – nicht aus bösem Willen und Unglauben, sondern folgerichtig: Die Antwort wandelt die Frage. Findet der Glaube unter dem Überbau des möglichen Wissens statt, löst er sich bei fortschreitender Erkenntnis immer weiter auf. So stellt es sich leider oft dar.
Ich behaupte allerdings, wie schon im letzten Kapitel, dass es anders herum ist. Dass keineswegs das Wissen die Antwort auf Glauben ist, sondern dass im Gegenteil das Wissen beim Durchdenken über sich hinaus weist und erst mit dem Überbau des Glaubens ein sinnvolles Ganzes ergibt. Dass also nicht der Glaube das Wissen, sondern das Wissen den Glauben sucht. Er stopft keine Löcher der Unkenntnis, stattdessen krönt er jede Wissenschaft und lässt sie richtig zur Geltung kommen.
Doch behaupten kann ich viel. Interessant wird es erst, wenn hinter Aussagen auch eine erkennbare Logik steht – erst dann werden sie zum Argument. Ziel muss sein, den Zirkelschluss so mancher christlichen Argumentation zu durchbrechen. Nicht nur sich selbst - Dich und mich muss der Glaube treffen. Standhalten muss er, nachvollziehbar muss sein, was wir vollziehen sollen. Interessant wird es erst, wenn seine Antworten die Fragen betreffen, die man tatsächlich hat. Gespräche, abgehoben von jedem menschlichen Fundament, die sich von einem theologischen Fachbegriff zum nächsten hangeln, erreichen hier niemanden.
Warum nicht einfach glauben? Weil es grundsätzliche Fragen gibt, die vorher geklärt sein wollen.
Persönliche Basis einer Glaubenslogik.
Wie kann eine Logik des Glaubens aussehen,
auf was baut sie auf
und was sollte sie berücksichtigen?
Überlegungen zu Begriffen und Themen,
um die man nicht herumkommt,
wenn man glauben möchte.
Sie weisen über sich hinaus und zeigen,
dass Gottes Wort erst den Zusammenhang schafft,
in dem alles Nachdenken und jedes Wissen
Sinn ergibt.
Ohne diesen Zusammenhang
werden sie zu Stolpersteinen,
die eher nahelegen, vom Glauben die Finger zu lassen,
wenn man einen gesunden Verstand hat.
Zumindest in der Theorie erscheint der Glaube
logisch und folgerichtig.
Glaube
Wer’s glaubt, wird selig!
(Volksmund)
Was ist das – entscheidende Wahrheit oder Hohn? Ein Satz, der für Christen den Glauben zusammenfasst, wird auch von ihnen gebraucht, wie vom Rest der Gesellschaft: als spottendes Urteil zu etwas, das offensichtlich falsch ist. In der Ironie verkehrt sich seine Bedeutung ins Gegenteil: Wer das glaubt, ist ein Trottel. Der Glaube als Synonym für absurden Unsinn, Naivität und Dummheit. Doch ungeachtet allen Spottes – wahr bleibt: Vor die Seligkeit hat Gott den Glauben gesetzt. Da man so bei einer Annäherung an das Christentum zugleich der Idee eines Glaubens begegnet, wäre interessant: Was glaube ich, und warum? Und, daran anschließend: Ist es wirklich naiv und dumm? Für weitere Überlegungen ist es dabei, meine ich, wichtig, vorerst von einer Grundlage auszugehen, die selbst noch keinen Glauben voraussetzt; anderenfalls wäre alles ein Zirkelschluss.
Es gibt sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was man als Glauben bezeichnen kann. Gemeinsam ist allen, dass sie auf irgendeine Weise das Verhältnis zu etwas beschreiben, das sich außerhalb der Wahrnehmung befindet. Meist ist damit eine Art Vermutung gemeint, zu der eine persönliche Komponente kommt, indem man mehr oder weniger überzeugt hinter ihr steht. Dieser minimale Konsens soll hier als Grundlage dienen. Die erste Definition für Glauben sei: Etwas für gegeben oder wahr halten, das man selbst nicht wahrnehmen kann. Um nichtige Diskussionen über Unwichtiges auszuschließen ergänze ich: Auf eine Weise für wahr halten, dass es Berücksichtigung im Handeln findet.
(Außen vor bleibt hier erst einmal die jedem gläubigen Christen vertraute Tatsache, dass es einen gewaltigen Unterschied gibt zwischen etwas glauben und an jemanden glauben. Das zweite geht nicht ohne das erste. Hier sollen die Grundlagen das Thema sein.)
Erst einmal ist es gleich, ob jemand sagt, er glaube beispielsweise an Gespenster oder nicht – in beiden Fällen bezieht er Stellung zu etwas, das er weder wahrnehmen noch beweisen kann. Er mag jede Diskussion darüber für überflüssig halten, weil er sich seiner Meinung sicher ist, doch fußt auch diese Überzeugung auf keinerlei Beweis. Über nicht Wahrgenommenes und Unbewiesenes vermag man nur im Glauben zu reden, mag die eigene Position noch so klar, sinnvoll und plausibel erscheinen. Ausführlicher lautet die Definition daher: Etwas für wahr oder gegeben zu halten – oder eben nicht – wenn eine eigene und unmittelbare Prüfung nicht möglich ist oder als unnötig erachtet wird.
Doch warum halte ich etwas für wahr, oder lehne es ab, das ich nicht prüfen kann? Was sind die Kriterien? Das Einfachste sind eigene Erfahrungen. Ich habe erlebt, dass Regen nass macht und man in richtigem Novemberwetter leicht friert und bin überzeugt, dass es auch dieses Jahr so ist, daher kleide ich mich entsprechend. Ich ziehe mir bei kaltem Schmuddelwetter den Regenmantel an, ohne erst Kälte und Nässe einer neuen Prüfung zu unterziehen, denn meine Annahme ist so plausibel, dass ich sie spontan wohl als Wissen bezeichnen würde. Ich gehe einfach davon aus, dass es nach wie vor gültig ist, was bedeutet: Ich glaube es mit sehr großer Gewissheit. Nahezu alles, was wir zu wissen meinen, glauben wir mit hoher Plausibilität, und wir tun gut daran - wir könnten anderenfalls keinen Schritt tun.
Es ist sinnvoll, den eigenen Erfahrungen zu trauen, und nicht nur denen. Ich lerne auch von anderen Menschen Dinge, die ich kurz- oder mittelfristig überhaupt nicht überprüfen kann. Warum glaube ich hier?
Eine häufige Annahme ist, dass ich eher Menschen glaube, zu denen ich eine positive Beziehung habe. Zu glauben heiße vertrauen, wird gesagt (was schon einmal ziemlich christlich klingt). Wirklich? Glaubt man einem Menschen, dem man vertraut, oder ist es nicht eher so, dass man einem Menschen vertraut, dem man glauben kann? Oder ist es noch ganz anders? Ich habe sehr nette Freunde, denen ich fest vertraue, aber nicht immer alles glaube, denn ich weiß, wo sie dazu neigen, sich die Wahrheit zurechtzulegen. Sie kennen meine Stellen ebenfalls. Wir wissen um unsere Schwächen, doch zugleich wissen, oder besser: glauben wir fest voneinander, dass Freundschaft für uns bedeutet, das niemals auszunutzen, und so vertrauen wir uns.
Dem unsympathischen Erdkundelehrer hingegen, von dem ich erfuhr, dass es Asien gibt, traute ich nicht. Geglaubt habe ich ihm trotzdem und wäre bis heute jederzeit bereit, in ein Flugzeug zu steigen, das nach Sumatra fliegt, ohne einen weiteren Beweis für seine Existenz zu verlangen.
Man mag einschränken, dass ich halt nicht dem Menschen, sondern seiner Kompetenz vertraut hätte. Nun, als Kind konnte ich um die nicht wissen. Warum also glaubte ich ihm und seinen Kollegen? Was ließ mich sicher sein, dass Vokabeln tatsächliche sinnvolle Worte in einer fremden Sprache waren, und kein Unsinn? Der Mathematiklehrer bewies wenigstens noch, was er sagte, doch alle weiteren behaupteten einfach etwas und forderten, ich solle das lernen. Hinterher „konnte“ ich Englisch und „wusste“, dass es Asien gibt, ohne als Beleg mehr zu haben als die Lehrer, von denen andere mir sagten, sie wüssten Bescheid.
Ich richte mich also nach dem, was andere sagen, und abermals tue ich gut daran: Wäre ich nicht bereit gewesen, das Wissen von Dritten als Grundlage für mein Handeln zu nehmen, ich hätte niemals Indien oder die Korallen des Roten Meeres gesehen.
An Mittelerde hingegen glaube ich nicht. Das Flugzeug nach Sumatra würde ich besteigen, doch keines nach Rohan1, selbst wenn man mir versicherte, dort seien inzwischen Landebahnen gebaut worden.
Zwar ist jedem sofort die Sinnhaftigkeit klar, Sumatra als existent, Rohan hingegen als Fiktion zu betrachten, doch das zu belegen ist nicht leicht. Was, wenn mein Gegenüber nicht nur meine Behauptung anzweifelt, Rohan gebe es nicht, sondern gleich auch die Basis all dessen für falsch hält, das ich als Beweis heranziehe? Man könnte auf den Globus verweisen (den man nicht selbst erstellt hat, sondern dem man glaubt), auf dem Mittelerde nicht zu finden ist, und noch vielerlei anführen, doch überzeugen Argumente nur, wenn sie vom Gegenüber auf die richtige Weise gedeutet werden. Jemandem, der fest von der Existenz Rohans überzeugt ist, kann man keinen Gegenbeweis liefern. Auf die Fakten zu verweisen, die man kennt, reicht nicht, denn gerade die hält der andere für falsch; für ihn zählt, was er selbst als sicher erblickt. Mit demselben Recht, mit dem ich seine Position für falsch halte, unterstellt er mir dieselbe Realitätsferne. Ist man sich über die grundlegenden Fakten nicht einig, kommt zum Tragen, dass auch unvereinbare Positionen rein logisch betrachtet gleich aufgebaut und ebenbürtig sein können. Daher ist es völlig legitim, wenn mein Glaube an Gott von Dritten ähnlich absurd gesehen wird, wie beispielsweise eine flache Erde von mir; von ihrem Standpunkt aus bin eben ich der sture Fanatiker, der keinen Gegenbeweis akzeptiert. Wer das Himmlische Reich verspricht, ist in den Augen vieler nicht besser als einer, der Flugtickets nach Rohan verkauft. Nicht nur genauso unmoralisch, sondern auch genauso unlogisch. Das ist zu akzeptieren.





























