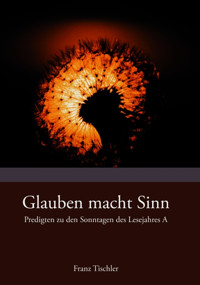
7,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Eine gute Homilie nimmt den Zuhörer mit auf einen Spaziergang in Gedanken. Der kann beschaulich sein oder auch anstrengend, mal interessant und mal erholsam. An einem Sonntag gleicht er eher einem steilen Aufstieg zu einer lohnenden Aussicht, dann wieder einem entspannten Flanieren oder einem ruhigen Ausflug am Flussufer entlang. Gerade die Abwechslung macht einen Teil des Reizes aus. Auf jeden Fall aber soll der Weg so sein, dass jeder ihn mitgehen kann. Auf diese Art versucht das Buch die Leser mitzunehmen auf viele verschiedene Sonntagsspaziergänge entlang der Schriftexte, mit denen die Kirche uns im Lesejahr A den Tisch des Wortes Gottes deckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Zum Geleit
Jeder Zuhörer vertraut dem Prediger einen Teil seiner Lebenszeit an. Darum sollte dieser versuchen, ihm dafür das Beste zu geben, was ihm möglich ist.
Am Schwierigsten ist es in vielen Fällen, eine Idee, einen roten Faden zu finden, der den Zuhörern das „Dabei–Bleiben“ erleichtert und ihnen etwas mitgibt für ihr Leben im Alltag.
In diesem Bemühen bin ich selbst oft reich beschenkt worden von vielen bewundernswerten Predigern, deren Werke mir aus verschiedensten Quellen vorlagen. Ihnen, den zahlreichen Ideengebern, gebührt an dieser Stelle mein aufrichtiger Dank. Insbesondere gilt dieser H. Pater Peter Hinsen, SAC, der mir mit seinem Werk „Vom Wort Gottes leben“ viele gute Gedanken und Impulse zur Entwicklung meines eigenen Stils geschenkt hat. Ebenso auch Matthias Blaha, dem Pfarrer unserer Gemeinde, der durch sein bewundernswertes Vertrauen diese Entwicklung entscheidend gefördert hat.
Jedem Prediger ist bewusst, dass man nicht einfach eine Vorlage nehmen und ablesen kann. Predigt ist gesprochenes Wort und darum Kommunikation, die nur in Verbindung mit der eigenen Art zu sprechen und zu denken glaubwürdig angestoßen werden kann. Darum erachte ich auch dieses Buch nur als einen Impuls, Ihnen, geschätzte Leser, Gedanken in die Hand zu geben, an denen Sie weiter denken und Ihre Sicht der Dinge entwickeln können.
In freundlicher Verbundenheit
Franz Tischler
Ehre sei Gott in der Höhe
und Friede auf Erden den Menschen
Franz Tischler
Glauben macht Sinn
Predigten zu den Sonntagen des Lesejahres A
www.tredition.de
© 2013 Franz Tischler
Umschlaggestaltung:
M.A. Christian Tischler
Lektorat:
StD i.R. M.A. Stefan Hofbauer
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8495-5199-5
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Selbstverständlich dürfen, dem Zweck des Buches entsprechend, Passagen daraus für eigene Ansprachen verwendet werden.
Dazu können Käufer dieses Buches auf der Internetseite www.Glauben-macht-Sinn.de einen Zugang bekommen, mit dem sie die Predigten in digitaler Form herunterladen können.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.deabrufbar.
INHALTSVERZEICHNIS
Zum Geleit
Weihnachtsfestkreis
1. Adventssonntag: Seid also wachsam
2. Adventssonntag: Einander annehmen
3. Adventssonntag: Das Wesentliche
4. Adventssonntag: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht
Christmette: Eine neue Geschichte beginnt
Weihnachten am Tag: Unsere Unzulänglichkeiten nimmt er an.
Sonntag nach Weihnachten (Hl. Familie): Die Heilige Familie war keine heile Familie
Neujahr, Hochfest der Gottesmutter Maria: Gott ist am Werk
2. Sonntag der Weihnachtszeit: Die ‘Göttliche Tragödie’ im Johannesprolog
Fest der Erscheinung des Herrn: Epiphanie
Fest Taufe des Herrn: Du bist mein geliebter Sohn
Osterfestkreis
1. Fastensonntag: Freiheit und Versuchung
2. Fastensonntag: Worauf bauen wir?
3. Fastensonntag: Wasser in der Dürre des Lebens
4. Fastensonntag: Ist Wahrheit irrelevant?
5. Fastensonntag (Misereor): Schöpfung bewahren
Palmsonntag: Er reitet auf einem Esel
Gründonnerstag: Nicht Gedächtnis, sondern Gegenwart
Karfreitag: Das Leid aushalten
Osternacht: Vom schweren Zugang zu Ostern
Ostersonntag: Am größten unter ihnen ist die Liebe
Weißer Sonntag: Gesandt durch Jesus
3. Ostersonntag: Glaube muss auch durch den Körper sprechen.
4. Ostersonntag: Ein guter Hirte ist heute notwendiger denn je
5. Ostersonntag: Der Weg zum Leben
6. Ostersonntag: Lieben und Bleiben
Christi Himmelfahrt: Anbetung und Sendung
7. Ostersonntag: Die Apostel, im Gebet vereint
Pfingstsonntag: Der Geist, der den Weg weist
Dreifaltigkeitssonntag: Der unverfügbare Gott
Im Jahreskreis
2. Sonntag: Wege im Dunkeln
3. Sonntag: Menschenfischer
4. Sonntag: Einige theologische Grundaussagen der Bergpredigt
5. Sonntag: Eure guten Werke sehen
6. Sonntag: Wenn euere Gerechtigkeit nicht weit größer ist
7. Sonntag: Auge um Auge
8. Sonntag: Ein Leben mit Sinn
9. Sonntag: Fundament des Lebenshauses
10. Sonntag: Einen neuen Weg suchen
11. Sonntag: Kirche konkret
12. Sonntag: Fürchtet euch nicht
13. Sonntag: Wer das Leben gewinnen will, der wird es verlieren
14. Sonntag: Das beste Angebot
15. Sonntag: Gott will uns ansprechen in seinem Wort
16. Sonntag: Unkraut im Acker der Welt
17. Sonntag: Schatzsuche
18. Sonntag: Was kann uns scheiden von der Liebe Christi
19. Sonntag: Denn erstens kommt es anders
20. Sonntag: Nicht gleich gültig, aber auch nicht gleichgültig
21. Sonntag: Für wen halten die Leute den Menschensohn
22. Sonntag: Wo mein Platz ist
23. Sonntag: Besser als Juristerei
24. Sonntag: Das verzeihe ich ihm nie
25. Sonntag: Bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin?.
26. Sonntag: Geh und arbeite heute im Weinberg
27. Sonntag: Das Weinberglied des Jesaja
28. Sonntag: Ein hochzeitliches Gewand anlegen
29. Sonntag: Dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört
30. Sonntag: Gottesliebe und Nächstenliebe als Kompass
31. Sonntag: Einer ist euer Vater, ihr aber seid Brüder
Allerheiligen: Der Chor der Heiligen – eine Vielfalt an Stimmen.
32. Sonntag: Klug oder dumm
33. Sonntag: Seine Talente einsetzen
Christkönigssonntag: Ein eigen-artiger König
Anmerkungen
Weihnachtsfestkreis
1. Adventssonntag: Seid also wachsam
Lesung: Röm 13, 11-14a
Evangelium: Mt 24, 29-44
Ein gutes neues Jahr!
Heute, am 1. Adventssonntag, hat ja ein neues Kirchenjahr angefangen. Schon wieder ein Jahr vorbei, fast 2000 sind es nun schon, in denen die Kirche auf die Wiederkunft ihres Herrn wartet.
Dass es so lange dauern würde, das hätten sich die Apostel in den Jahren nach der Himmelfahrt Christi sicher nicht träumen lassen. Sie rechneten mit einer baldigen Wiederkunft.
Darum gab es damals fast eine kleine Krise, als man merkte, dass das Ende doch nicht so unmittelbar bevorsteht. Die Christen begannen, sich darauf einzustellen. Die Naherwartung wurde zur Fernerwartung. Und es traten genau die Probleme auf, die sich einschleichen, wenn wir nicht mehr direkt mit Christus rechnen: Die Gläubigen begannen, sich recht dauerhaft und möglichst gemütlich in dieser Welt einzurichten.
In diese Situation hinein spricht das heutige Evangelium.
Mit sehr harten, fast schon Angst einflößenden Worten will es uns bewusst machen, dass es um eine ernste Sache geht. „Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können”, sagt Jesus, „sondernfürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann.” Es geht hier nicht darum, Angst zu machen, sondern darum, eindringlich vor einer wirklichen Gefahr zu warnen.
Wir, liebe Schwestern und Brüder, leben zur Zeit in einer Phase ganz extremer Fernerwartung. Es ist schon soweit gekommen, dass sogar eine Mehrheit unserer deutschen Mitchristen überhaupt nicht mehr damit rechnet, dass Jesus einmal zurückkommt. Das heißt, sie rechnen auch nicht damit, jemals für ihr Leben Rechenschaft ablegen zu müssen. Als Folge davon wird das Leben an sich, es zu genießen und auszukosten, zum letzten Maß aller Dinge.
Viel mehr noch als für die Gemeinde des Matthäus gilt daher für uns die eindringliche Mahnung des Evangeliums: Bleibt wach! Die sorgenvollen Warnungen Jesu erweisen sich gerade im Blick auf heute als zeitlose Mahnungen. Er weiß halt nur zu gut, wie wir Menschen nun einmal sind.
Zunächst warnt er vor der trügerisch falschen Sicherheit, die der Wohlstand bietet. Man hört es so oft: „Ich hab’ meine Wohnung, ich hab’ meine Arbeit und kann mir deshalb auch einiges leisten. Ich habe Kleidung, genug zu essen und eine Familie. Was will ich mehr? Ich brauche Gott nicht. Ich komme ganz gut ohne ihn aus. Mir fehlt nichts.“
Welche Kurzsichtigkeit gegenüber den wahren Zusammenhängen des Lebens! Welche Egozentrik, in der der Mensch sein Wohlergehen zum Maßstab aller Dinge macht! Wie blind läuft so ein Mensch dem entgegen, was kommen wird. Das stellt Jesus eindringlich durch den Vergleich mit Noach heraus: „Wie die Menschen in den Tagen vor der Flut aßen und tranken und heirateten, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging, und nichts ahnten, bis die Flut hereinbrach und alle wegraffte, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes sein.“
In der Zeitung finden wir tagtäglich genug Beispiele, wie diese Warnung für einzelne Menschen zur traurigen Wirklichkeit geworden ist. Ein Totenbrett im Bayerischen Wald sagt’s so: „Der Weg zur Ewigkeit ist gar nicht weit: Um 8 Uhr ging ich fort, um 9 Uhr war ich dort.“ „Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.“
Eine zweite Warnung folgt in unserem Evangelium unmittelbar: Beruhige dich nicht dadurch, dass du auf andere schaust. Aussagen wie: „Das ist heute nun einmal so“, „Das machen alle“, „Die anderen sind auch nicht besser!“, Phrasen wie „Diese sogenannten Christen“ oder „Schau dir doch einmal die an, die jeden Sonntag in die Kirche rennen“ hören wir doch immer wieder. Dabei dient dieser Blick auf die anderen zumeist als Entschuldigung oder als Vorwand dafür, dass man selbst nicht das tut, was man eigentlich sollte.
Aber jede Beziehung zu Gott ist etwas einzigartiges, und man kann sie nicht davon abhängig machen, wie andere sie verwirklichen. Es sagt ja auch ein Sprichwort: „Wenn zwei das Gleiche tun, dann ist es doch nicht das Gleiche.“ Drastischer drückt das unser Evangelium aus:
„Dann wird von zwei Männern, die auf dem Feld arbeiten, der eine angenommen und der andere weggeschickt werden. Und von zwei Frauen, die mit der gleichen Mühle mahlen, wird eine angenommen und die andere weggeschickt werden.”
Als Kind, muss ich gestehen, hat mich diese Stelle geärgert, weil ich sie als ungerecht empfand und dabei den Menschen als Spielball göttlicher Willkür sah. Heute meine ich, dass sie mich davor warnen will, mein Versagen durch den Blick auf das Versagen anderer zu entschuldigen.
Zum Beispiel warnt sie uns davor, das betrübliche Weggehen vieler Mitchristen als Argument für eine laschere eigene Glaubenshaltung zu verwenden. Etwa nach dem Motto: „Wenn ich ab und zu in die Kirche gehe, bin ich immer noch besser als die, die überhaupt nicht gehen.“
Eine dritte Warnung, oder vielleicht besser eine Empfehlung, gibt uns das Evangelium mit: Selbst angesichts eines totalen Umbruchs nicht zu resignieren. „Gerät alles ins Wanken, was kann da der Gerechte noch tun?“ so fragt der Psalmist. Jesus aber weist uns darauf hin, dass die Endzeit, selbst wenn nichts mehr ganz bleibt, nicht das Ende ist, sondern ein Umbruch. Der Anbruch der neuen Zeit.
Und das hängt nicht von uns ab.
Es ist Christus, der „mit großer Macht und Herrlichkeit“ die Herrschaft antritt. Im Chaos und aus dem Chaos heraus schafft er bleibende Strukturen und Ordnungen, denn er ist nicht nur das Alpha, sondern auch das Omega, das Ende, ja sogar das Ziel der Schöpfung.
Verfallen wir also nicht in eine Mentalität, als müßten wir die Kirche retten. Der Schuh ist zu groß für uns. Gott weiß schon, was er vorhat. Er wird die Initiative ergreifen, wenn die Zeit reif dafür ist. Für uns kommt es nur darauf an, das unsere zu tun. Dann haben wir die Warnung des heutigen Evangeliums verstanden und ernst genommen.
Und weil es gar nicht unsere Aufgabe ist, die Kirche zu retten, darum haben wir auch keinen Grund, angesichts der Zeitumstände in Kleinmut, Verzagtheit oder gar Resignation zu verfallen. Gott – und um den geht es uns ja – sitzt immer am längeren Hebel. Denn auch, wenn der Menschensohn zu einer Stunde kommt, in der wir es nicht erwarten, so ist doch eines sicher: Er wird kommen.
Auf einer Karte habe ich einmal den treffenden Satz gelesen:
Sagt zur Welt, wenn sie euch bedrückt:
Euere Herren gehen, unser Herr aber kommt.
2. Adventssonntag: Einander annehmen
Lesung: Röm 15,4-9
Evangelium: Mt 3,1-12
Das ist mal ein Auftritt, den Johannes da hin legt!
Umgeben von einem großen Kreis von Fans und Sensationstouristen (im Volksmund auch Gaffer genannt) begrüßt er die Pharisäer und Sadduzäer mit einer Schimpfkanonade und gibt ihnen so nette Titel wie „Schlangenbrut“.
Damit profiliert er sich natürlich als ein Mann der klaren Worte. Er zieht eine scharfe Linie zwischen „Gut“ und „Böse“ und möchte so wohl seine Zuhörer zu der Einsicht drängen, dass die Zeit für eine Entscheidung nun gekommen ist.
Aber sicher ist es keine gute Methode um die Angesprochenen zur Umkehr zu bewegen – Honoratioren und Autoritäten schon gleich gar nicht. Die werden sich – zu recht – öffentlich bloßgestellt fühlen, in der Ehre verletzt, und damit zukünftig tunlichst jeden Kontakt vermeiden. Keiner, dem es darum geht, mit seinen Mitmenschen gut auszukommen, würde jemanden auf diese Art begrüßen.
Da ist wohl eher jener Ton zielführend, den Paulus in der Lesung vorhin der Gemeinde von Rom ans Herz gelegt hat: „Nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes.” Und – als ob er den Kontrast zum Täufer aufzeigen wollte – fährt er fort: „Denn, das sage ich, Christus ist – um der Wahrhaftigkeit Gottes willen – Diener der Beschnittenen geworden, damit die Verheißungen an die Väter bestätigt werden.”
Paulus schreibt dies an die Gemeinden in Rom. Rom war damals das Zentrum der Welt. In Rom kam alles zusammen: Karrieresüchtige und Gescheiterte, Adel und Plebs, Reiche und viele Arme, dazu ein unübersehbares Konglomerat aus Menschen aller Nationen und Sprachen.
Ein wenig davon lässt sich vielleicht erahnen, wenn wir auf’s „Multi-Kulti-Berlin“ schauen und die vielen Nationalitäten, die dort zusammen kommen. (Wenngleich Berlin in Bezug auf die Lasterhaftigkeit bei weitem nicht den Ruf hat, der dem antiken Rom seit zwei Jahrtausenden anhaftet.)
Wenn sich also in Rom Christen zusammen fanden, dann stammte die Mehrheit von ihnen wohl aus den unteren Gesellschaftsschichten, viele davon mit Migrationshintergrund, denn die hatten das Christentum aus dem nahen Osten mitgebracht.
Wenn also in Rom Christen zusammen kamen, ein paar Reiche und viele Arme und Ausländer verschiedenster Provenienzen, dann konnte das nicht ohne gravierende Spannungen gehen, sowohl in sprachlicher als auch in sozialer und kultureller Hinsicht.
Und darum bewundere ich den Mut jener frühen Glaubensbrüder, die es dennoch gewagt haben. Für den Menschen an sich wäre es doch viel leichter und bequemer, da nicht hinzugehen, nicht zu riskieren, in seiner Art in Frage gestellt zu werden, nicht sich mit fremden Menschen und Sitten arrangieren zu müssen, sondern daheim gemütlich alles so zu haben, wie man es gewohnt ist. Nein, diese ersten Gemeinden in Rom waren sicher keine Veranstaltungen für „Couch - Potatoes.“ Nicht umsonst taucht in dem kurzen Briefabschnitt, den wir gehört haben, mehrmals das Wort „Geduld“ auf. Wie etwa: „Der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch die Einmütigkeit, die Jesus entspricht.”
Was für ein Wort: „Einmütigkeit“. „Einheit“ steckt da drin und „Mut“. Um Einheit zu finden, da braucht es Mut.
Nicht den Mut der Demagogen, die sich vorne hinstellen, eine Mehrheit hinter sich erhoffen und Fernstehende beschimpfen, sondern den Mut, sich in eine Situation zu begeben, deren Ausgang man nicht in der Hand hat. Mut, auch sich selber und seine Anschauungen in Frage stellen zu lassen, indem man Menschen begegnet, deren Sitten man nicht kennt und deren Verhaltensweisen man deshalb auch nicht abschätzen kann.
Daher bewundere ich auch den Mut all jener Männer und Frauen, die sich in unserem Land auf einen Dialog mit Menschen aus fremden Kulturen einlassen. Denn auch so ein Dialog braucht Mut. Mut, Vorurteile und Ängste beiseite zu schieben.
Die Vorurteile und die Ängste, die kennen wir ja alle zur Genüge.
Immer wieder wird uns in der Presse attestiert, dass wir Deutschen auch im „Ängste haben“ einen europäischen Spitzenplatz halten.
Aber auf Vorurteilen und Ängsten ist noch nie etwas Gutes gewachsen. Ohne Mut zur Begegnung kann es kein friedliches Miteinander geben.
Hier wie vor 2000 Jahren ist es wichtig, was Paulus seinen Römern mitgibt: „Nehmt einander an, wie auch Christus uns angenommen hat“. Das ist die grundlegende Erkenntnis: Christus hat mich angenommen ohne Vorbedingung, ohne jedes „Wenn und Aber“. Aus seiner weltweiten Sicht bin ich genauso Ausländer wie jeder andere auch, bin ich genauso Sünder wie jeder andere auch, bin ich genauso ein „unwürdiger Knecht“ (Lk 17,10) wie jeder andere auch.
Hätten die Christen des ersten Jahrhunderts nicht den Mut gehabt, sich dieser Herausforderung zu stellen, die Vorurteile – die es doch immer und überall gibt, wo Menschen leben – zurückzustellen, und den anderen anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat, so wären wir als Gemeinde heute nicht hier.
Auch Christus gibt uns dafür zahlreiche Beispiele: Zachäus auf dem Baum begrüßt er nicht mit einem: „Du Leutebetrüger, komm herunter!“, auch wenn ihm das bestimmt viel Zustimmung unter seinen Landsleuten gebracht hätte. Und dem barmherzigen Vater legt er nicht den Gruß in den Mund: „Da siehst du, wohin du ohne mich kommst!“, auch wenn ihm das wahrscheinlich den Hausfrieden bewahrt hätte.
Beide nehmen den anderen einfach an. Fertig.
Das heißt – eigentlich nicht. Denn erst als Zachäus sich angenommen weiß, hat er dann selber den Mut Schritte der Umkehr zu tun. Nicht anders war es bei Levi, dem Zöllner und unzähligen anderen. Denn meistens ist: „Jemanden annehmen“ die Basis, auf der dann Gemeinschaft entstehen kann.
Jene von uns, die die Gnade hatten, einen Menschen geschickt zu bekommen, mit dem sie gemeinsam durchs Leben gehen können und dürfen, und die dies mit Gottes Segen taten, werden sich vielleicht an das größtmögliche Versprechen ihres Lebens erinnern:
Es begann mit „Ich nehme dich an“. Das ist die Basis. Alles andere, „Lieben, Achten und Ehren“, kommt erst später. Erst, wenn ich den anderen annehme, so, wie er ist, ohne Bedingungen und Hintergedanken, kann darauf das Haus der Gemeinsamkeit gebaut werden.
Das gilt für unsere Gesellschaft, das gilt für jeden von uns in seinem ganz persönlichen Umfeld, das gilt besonders auch für uns, wenn wir uns als Gottes Gemeinde verstehen.
Einander annehmen – das soll Konrad Adenauer einmal auf den Nenner gebracht haben:
„Nehmen sie die Menschen, wie sie sind. – Andere gibt’s nicht.“
3. Adventssonntag: Das Wesentliche
Lesung: Jes 35,1-6a.10
Evangelium: Mt 11,2-11
Als Kind habe ich nie verstanden, warum Jesus in der eben gehörten Stelle alles so kompliziert macht.
Schon die Frage des Johannes war für mich ein Meisterwerk an „Drumherumreden“: „Bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?“ Warum, so dachte ich mir, fragt der nicht einfach:“Bist du der Messias?“
Aber das ist ja noch gar nichts im Vergleich zu der Antwort Jesu:
„Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder, und Lahme gehen; Aussätzige werden rein, und Taube hören; Tote stehen auf, und den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.” Hätte der nicht einfach „Ja“ sagen können?
Als Kind mag man es halt einfach und klar. Als Kind kennt man noch nicht den dunklen Kosmos von Hintergedanken, Halb- und Scheinwahrheiten, mit denen wir Erwachsenen uns das Leben schwer machen. Als Kind rechnet man noch damit, dass das, was man sagt, auch so ist.
Und so musste auch ich erst erwachsen werden, um zu erkennen: Was wäre denn, wenn Jesus einfach nur „Ja“ gesagt hätte? Das hätte ja lediglich den Status einer Behauptung. Und behaupten kann das jeder.
Zur Zeit Jesu gab es sogar mehrere, die sich selber zum Messias erklärten und Anhänger hinter sich sammelten. Der nächste Satz nach dem heutigen Evangelium lautet: „Dem Himmelreich wird Gewalt angetan; die Gewalttätigen reißen es an sich.“
Und bis zur Gegenwart hat dies nicht aufgehört: Auch in unserer Zeit gibt es Menschen, die sich selber Gott oder Messias titulieren. Und das, trotz der Warnung Jesu: „Viele werden unter meinem Namen auftreten und sagen: Ich bin es!, und: Die Zeit ist da! Lauft ihnen nicht nach!“ (Lk 21,8)
Einen Titel einfach behaupten, das ist keine Kunst: Auch Diktatoren der Gegenwart lassen sich als gute „Väter des Volkes“ feiern, auch wenn es ihnen vollkommen egal ist, dass ein paar tausend ihrer „Kinder“ verhungern, weil sie sich immer wieder neue Raketen leisten.
Nein, behaupten kann man viel. Auf die Taten kommt es an. Und darum wäre es auch zu kurz gegriffen, wenn Jesus auf die Frage des Täufers: „Bist du es?“ nur mit „Ja“ geantwortet hätte. Vielmehr verweist er eben auf das, worauf es ankommt, auf seine Taten: „Blinde sehen, Lahme gehen …“ usw.
„Na also“, könnte man da nun zufrieden sagen, „was will man mehr? Lasst Taten sprechen! Jesus zeigt was er drauf hat, das ist wichtiger als jeder Titel.“
Aber wer heute aufmerksam Lesung und Evangelium verfolgt hat, der wird sagen: „Da ist doch noch mehr!“ Was so aussieht, als ob Jesus seine Taten aufzählt, ist ja in Wirklichkeit eine Rezitation.
Denn er sagt doch die Verse auf, die eigentlich von Jesaja stammen. Wir haben sie – der Deutlichkeit wegen – eben in der Lesung quasi daneben gestellt bekommen:
„Seht, hier ist euer Gott! … er selbst wird kommen und euch erretten. Dann werden die Augen der Blinden geöffnet, auch die Ohren der Tauben sind wieder offen. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch, die Zunge des Stummen jauchzt auf.“
Wir können davon ausgehen, dass Johannes, der letzte der Propheten, die Hl. Schrift kennt und weiß, was seine „Kollegen“ gesagt haben. Dann aber erkennt er in der Antwort Jesu mehr als ein bloßes „Ja, ich bin der Messias.“ Denn dann bezeugt sie dem Johannes, dass nun eingetreten ist, was seit 600 Jahren angekündigt, aber immer noch offen im Raum steht: „Seht, hier ist euer Gott!“ Er selbst ist nun gekommen, um euch zu retten.
Es verweist darauf, dass es hier um viel mehr geht als um Tagespolitik oder momentanes Wohlbefinden. Hier weht der Atem der Ewigkeit. Hier tickt der Plan, der die Weltgeschichte prägt.
Unerkannt von den Großen dieser Welt, ohne Echo in den Ereignissen, die ihre Welt ausmachen, geschieht hier das Wesentliche, das alle Zeiten überdauern wird.
Und nicht anders ist es für uns heute hier:
Eingespannt im Advent mit seinen unzähligen Aufgaben und Vorbereitungen, in Beschlag genommen von Arbeit oder Schule, die unsere Kräfte manchmal bis an die Grenzen fordert, ein wenig durchatmend an einem Sonntag, um ein wenig zu entspannen, (vielleicht auch lieber woanders als jetzt hier,) geschieht doch genau hier dieses Wesentliche.
Hier berührt uns der Hauch der Ewigkeit.
Hier passiert eine Begegnung, die unser ganzes Leben fundamental prägen und verändern kann.
Hier erwerben wir uns Schätze und Werte, die die 80 oder 90 Jahre unseres Lebens bei weitem überdauern werden.
Hier geschieht das Wesentliche.
Hier ist Gott für uns da. Er selbst ist gekommen, um euch zu retten.
4. Adventssonntag: Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht
Lesung: Jes 7, 10–14
Evangelium: Mt 1, 18–24
Er hat ganz schön Angst, dieser Ahas, zu dem Jesaja in der heutigen Lesung spricht und der von 734 bis 728 vor Christus als König von Juda in Jerusalem regiert.
Ephraim, also das Nordreich Israel, hat sich mit den Aramäern verbündet und beide zusammen ziehen nun gegen ihn in den Krieg. Wie sehr Ahas vor dieser Gefahr bibbert, beschreibt die Bibel mit den Worten: „da zitterte das Herz des Königs … wie die Bäume des Waldes im Wind zittern.“(Jes 7, 2c)
Zu ihm, diesem Nervenbündel, wird Jesaja hinausgeschickt. Er soll ihn am Ende der Wasserleitung des oberen Teiches treffen, um ihm als Prophet den Ratschlag Gottes zu übermitteln.
Die Botschaft, die Jesaja ausrichten soll, gipfelt in dem Satz: „Wenn ihr euch nicht fest macht,“ (gemeint ist in Gott festmacht) „so seid ihr nicht festgemacht“, oder wie die Einheitsübersetzung etwas freier übersetzt: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“ (Jes 7,9c)
Dieser Satz, nur für sich genommen, wäre schon eine eigene Betrachtung wert, zeigt er doch in seltener Klarheit die Grundbedingungen unserer Existenz:
Als Geschöpfe sind wir dem Kommen und Gehen, dem Werden und Vergehen unterworfen, und unsere einzige Chance trotzdem zu bestehen ist es, sich bei dem zu verankern und festzumachen, der als der Schöpfer nicht unter den Gesetzmäßigkeiten der Natur steht, der als einziger darüber steht und deswegen auch die Macht hat, uns ein weitergehendes Bleiben zu ermöglichen: „Wenn ihr euch nicht fest macht, seid ihr nicht festgemacht. – Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“
Aber Glaube, das wissen wir alle, hat etwas von Risiko an sich, ist ein Schritt ins Unbekannte, ins Ungewisse. Er findet auf der Basis des Vertrauens statt, nicht des Beweises. Er meint begründete Hoffnung, aber nicht Sicherheit. Darum bietet Gott mittels Jesaja dem Ahas sogar an, er dürfe sich ein Zeichen erbitten, ganz egal welches, von unten oder von oben.
Aber so genau will Ahas das gar nicht wissen, denn er hat längst schon seine eigenen Pläne. Und da kommt ihm dieses Angebot Gottes mehr ungelegen als gelegen: In seiner Angst ist ihm das Greifbare lieber als das Unbegreifliche: Statt auf die – in seinen Augen – unsichere Macht Gottes zu setzen, setzt er lieber auf die sichtbare Weltmacht der Assyrer, die er gegen die verbündeten Feinde zu Hilfe holt – um den Preis der eigenen Abhängigkeit. Juda wird zum Vasallen der Assyrer, wird zwar die Angst vor den Gegnern los, muss dafür aber mit dem teueren Preis der Freiheit bezahlen.
Da steht er ja nicht alleine da: Menschen in Diktaturen spüren das Dilemma ja täglich: Für Freiheit kämpfen – und vielleicht sterben, oder unterdrückt, aber leben. Wie viele Mitmenschen in Beziehungen, in denen Gewaltausbrüche vorkommen, wie viele an erniedrigenden Arbeitsplätzen stehen vor der Wahl: Freiheit riskieren oder unterdrückt, aber sicher.
Auch manchen Israeliten auf der Flucht aus Ägypten waren bald schon die Fleischtöpfe in der Sklaverei lieber als die Freiheit unter der Führung Gottes durch die Wüste.
Auch König Ahas will sich nicht auf das Angebot des Jesaja einlassen bzw. sich auf Gott verlassen. So bietet Gott von sich aus ein Zeichen an:
„Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel – Gott mit uns – geben“ (Jes 7,14b)
700 Jahre hat es gedauert, bis aus dem Versprechen Wirklichkeit wurde, aus dem „hoffentlich“ ein „tatsächlich“, aus dem Glauben ein Schauen. Am Heiligen Abend und die Tage darauf werden wir ja dieses Geheimnis feiern.
Damit, könnte man meinen, wäre nun alles geklärt, das Zeichen erfüllt, der Beweis erbracht. Und trotzdem spüren wir alle deutlich:
Wir sind nicht aus dem Glauben entlassen zur Sicherheit. Dieser Schritt des Glaubens wird weiterhin von uns ganz persönlich gefordert, auch hier, in dieser Messfeier:
Dreifach, so sagen wir ja, ist Gott hier und jetzt unter uns gegenwärtig: In uns, die wir uns versammelt haben um miteinander dieses Mysterium zu feiern. In seinem Wort, in dem er uns in der Lesung und mehr noch im Evangelium anspricht, und im Sakrament des Leibes und Blutes, jenem Geheimnis des Glaubens, dem wir in jeder Eucharistiefeier zurufen und versprechen, seinen Tod zu verkünden und seine Auferstehung zu preisen, bis er wiederkommt.
Diese drei Arten, in denen Gott gegenwärtig ist, sind es auch, denen in feierlichen Gottesdiensten durch Weihrauch gehuldigt wird.
Aber alle drei sind auch eine enorme Herausforderung für unseren Glauben: Dieses Stückchen Brot, klein und zerbrechlich, dazu da, um von mir gegessen zu werden – Gegenwart des lebendigen Gottes?
Dieses Wort vom Ambo, schon oft gehört, jederzeit nachlesbar, mit vielen klugen Worten kommentiert – Gottes gegenwärtiges, lebendiges Ansprechen an mich in meiner jetzigen, momentanen Situation?
Und dann diese Leute, viele kenne ich gar nicht. Am besten kenne ich noch mich selber – und darum umso mehr fragwürdig: Gott gegenwärtig in seinem Volk, also auch in mir?
Und doch ist es so. Und darin wird deutlich, wie die Prophezeiung an Ahas durch Jesaja und an Josef durch den Engel tatsächlich Wirklichkeit wurde: „Immanuel – Gott mit uns“
Es ist Wirklichkeit geworden: Gott ist mit uns. Trotzdem ist für uns, nicht anders als für Ahas und Millionen anderer Menschen, der Schritt des Glaubens notwendig. Eine andere Sicherheit als ihn, unseren Gott, gibt es nicht: „Wenn ihr euch nicht festmacht, seid ihr nicht festgemacht.“
Und gerade in der gegenwärtigen Krise der Kirche gilt, mehr noch als sonst: „Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“
Christmette: Eine neue Geschichte beginnt
Lesung: Tit 2, 11-14
Evangelium: Lk 2, 1-14
Eine der bahnbrechendsten Erfindungen der Geschichtswissenschaft war sicherlich die Einführung einer durchgehenden Jahreszählung. Wer konnte sich vorher schon vorstellen, wann das war, als z.B. Johannes der Täufer auftrat: „Im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war“ (Lk 3,1). War das vor 100 Jahren oder 500 oder gar 1000 oder etwa noch länger? Wer wusste schon, wann in den grauen Erinnerungen der Vorzeit wer, wie lange, gelebt bzw. regiert hatte? Aber eine andere Möglichkeit, Ereignisse einer Zeit zuzuordnen, gab es früher nicht.
Und so schreibt auch Lukas im heutigen Evangelium: „In jenen Tagen erließ Kaiser Augustus den Befehl,“ und „damals war Quirinius Stadthalter von Syrien.“
Aber indem Lukas die Geburt Jesu mit dem Kaiser Augustus verbindet, bringt er auch zugleich zwei Personen zusammen, wie sie unterschiedlicher gar nicht sein können, ja, er markiert mit beiden gleichsam einen Wendepunkt: Der eine hat die Macht und herrscht, aber er wird gehen müssen. Der andere wird herumkommandiert, aber er ist im Kommen.
Noch steht das Zentrum in Rom, als in Bethlehem, am Rand der Welt, etwas Fuß fasst, das im Fortgang der Ereignisse zum Maßstab aller Geschichte der Menschheit werden soll.
Es ist fast schon witzig: Bei Lukas ist Augustus der Maßstab, um den Zeitpunkt der Geburt Christi einigermaßen einordnen zu können. Aber als Folge dieser Ereignisse wird von uns heute Augustus nach dem Zeitpunkt dieser Geburt eingeordnet: 31 vor bis 14 nach Christi Geburt.
So zeigt sich mehr als deutlich: Ein neuer Angelpunkt der Geschichte strahlt auf unter dem Stern von Bethlehem. Das System der Macht durch Stärke, Gewalt und Heereskraft, das auf niemanden Rücksicht nimmt, weder auf eine arme Familie noch auf eine hochschwangere Frau, wird in Frage gestellt durch ein neues Reich der Liebe, in dem selbst unbedeutende Hirten einer Botschaft des Engels wert sind.
Ein kleines, ohnmächtiges Kind erweist sich im Lauf der Weltgeschichte wichtiger als ein großer Kaiser – für manche sogar der Größte, den Rom je hatte. Kaiser Augustus, der mehr Provinzen dem römischen Reich einfügte als jeder andere: Am Ende nicht mehr als ein zeitlicher Schmuckrahmen für ein Kind, dessen Macht wirklich katholisch – weltumfassend – werden sollte.
Wer hätte das damals wohl gedacht, dass die Geschichte der Liebe tatsächlich am längeren Hebel sitzen würde, dass sie die Nachwelt mehr prägen sollte als die ganze römische Kultur, dass sie sogar 2000 Jahre später noch prägend für das Weltverständnis der Menschen sein wird.
So sehr beeinflusst sie unser Leben bis in den Alltag hinein, dass die meisten von uns in diesem Monat Dezember, den wir nun fast hinter uns haben, mehr als sonst „auf der Achse“ waren und viel zu erledigen hatten.
Zahllose Menschen stürzten sich ins Weihnachtsgeschäft, drängten sich durch Christkindlmärkte, besuchten Weihnachtsfeiern und trafen umfangreiche Weihnachtsvorbereitungen. Jedes Jahr nehmen sich die meisten von uns in dieser Weise die Zeit eines Monats, allein, um das Weihnachtsfest vorzubereiten. Und man fragt sich natürlich: Warum?
Ich will heute abend bestimmt nicht in den Chor derer einstimmen, die Weihnachten nur mehr als Konsumterror wahrnehmen und es deshalb am liebsten abschaffen würden. Denn daran, dass wir so einen Aufwand auf uns nehmen, sieht man doch auch, dass es uns um etwas Großes gehen muss.
Selbst Mitbürger, die nur wenig vom Christentum wissen, erahnen darin doch etwas von dieser Hoffnung auf eine bessere Welt, die das Negative nicht ausblendet oder verdrängt: Das Kind liegt im Stall, in der Krippe, und keine noch so süße Darstellung kann dies verleugnen. Und trotzdem steckt sogar darin noch eine Hoffnung.
Die Geschichte von dem kleinen Licht, das über die große Dunkelheit siegt, von den einsamen Hirten auf dem Feld, deren kleines Dorf für einen Moment zum Zentrum der Geschichte wird, von dem schutzlosen Kind, das den mächtigen Kaiser und Weltenherrscher Augustus zu einer Randnotiz verblassen lässt.
Es ist die Geschichte der Hoffnung auch für die Ställe und Krippen unserer ganz persönlichen kleinen Welten.
Hoffnung trotz all der Türen in unserem Leben, von denen wir abgewiesen und abgelehnt werden. Hoffnung, die all der Heimatlosigkeit trotzt, die wir verspüren, wenn die Begrenztheit unseres Leben sich in unser Bewusstsein drängt. Hoffnung, dass auch unsere Kinder noch Gemeinschaft und Geborgenheit finden dürfen in der dunklen, kalten und kommerzialisierten Welt.
An Weihnachten feiern wir, dass die Liebe den Kampf aufgenommen hat gegen die ob ihrer Macht anscheinend dominierenden Kräfte dieser Welt. Und – wenn wir ehrlich sind – sie ist die einzige Alternative, die wir überhaupt haben.





























