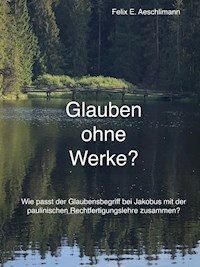
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Paulus schreibt: Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke (Röm 3,28). Jakobus stellt fest: Ihr seht, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein (Jak 2,24). Was gilt nun? Rechtfertigt Gott Menschen allein durch deren Glauben an Jesus Christus und dessen Erlösungstat (Monergismus) oder braucht es dazu auch das Mitwirken der Menschen durch gute Taten (Synergismus)? Korrigiert Jakobus den Apostel Paulus, weil er in dessen Gnadenlehre eine Gefahr für eine billige Christusnachfolge sieht? Wie müssen wir das Verhältnis von Glauben und Werke verstehen? Haben wir es bei Paulus und Jakobus mit einem Widerspruch zu tun oder drücken sie mit gleichen Begriffen unterschiedliche Konzepte aus? Die vorliegende theologisch-exegetische Untersuchung gibt Antworten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 143
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GLAUBEN OHNE WERKE?
Kurzbeschrieb0. Einleitung1. Verschiedene Ansätze zur Lösung des Problems 1.1 Jakobus polemisiert gegen Paulus 1.2 Jakobus polemisiert gegen falsch verstandenen Paulus 1.3 Paulus polemisiert gegen Jakobus 1.4 Paulus und Jakobus als völlig unabhängige Autoren 2. Verfasser und Abfassungszeit des Jakobusbriefes3. Zentrale Begriffe bei Jakobus und Paulus 3.1 Gesetz 3.1.1 Das Gesetz bei Paulus 3.1.2 Das Gesetz bei Jakobus 3.2 Werke 3.2.1 Werke bei Paulus 3.2.2 Werke bei Jakobus 4. Das Verhältnis von Glauben und Werken hinsichtlich der Rechtfertigung 4.1 Römer 3,21-31: Rechtfertigung durch Glauben, ohne Gesetzeswerke 4.1.1 Die Rechtfertigung kommt aus Glauben aufgrund der Erlösungstat Christi (3,21-26) 4.1.2 Die Rechtfertigung aus Glauben stellt Juden wie Heiden unter ein neues Gesetz (3,27-31) 4.2 Jakobus 2,14-26: Glaube ohne Werke rechtfertigt nicht 4.2.1 Die Nutzlosigkeit des Glaubens ohne Werke (2,14-20) 4.2.2 Die Begründung aus der Schrift (2,20-24) 5. Synthese 5.1 Unterschiedliche Frontstellung 5.2 Unterschiedlicher Ausgangspunkt 5.3 Unterschiedliche Terminologie 5.3.1 Gesetz des Alten Bundes - Gesetz des Neuen Bundes 5.3.2 Gesetzeswerke - Glaubenswerke 5.3.3 Rettender Glaube - unwirksamer Glaube 6. SchlusswortBibliographieImpressumKurzbeschrieb
Felix E. Aeschlimann studierte evangelische Theologie und ist Rektor des Seminars für biblische Theologie Beatenberg
Copyright 1996 und 2022 beim Autor / Seminar für biblische Theologie Beatenberg
Verlag Seminar für biblische Theologie, 3803 Beatenberg/Schweiz
Kurzbeschrieb des Inhalts
Paulus schreibt: „Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke“ (Röm 3,28).
Jakobus stellt fest: „Ihr seht, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein“ (Jak 2,24).
Was gilt nun? Rechtfertigt Gott Menschen allein durch deren Glauben an Jesus Christus und dessen Erlösungstat (Monergismus) oder braucht es dazu auch das Mitwirken der Menschen durch gute Taten (Synergismus)? Korrigiert Jakobus den Apostel Paulus, weil er in dessen Gnadenlehre eine Gefahr für eine billige Christusnachfolge sieht? Wie müssen wir das Verhältnis von Glauben und Werke verstehen? Haben wir es bei Paulus und Jakobus mit einem Widerspruch zu tun oder drücken sie mit gleichen Begriffen unterschiedliche Konzepte aus? Die vorliegende theologisch-exegetische Untersuchung gibt Antworten.
0. Einleitung
"Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke" (Röm 3,28).
"Ihr seht, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein" (Jak 2,24).
Das sich scheinbar widersprechende Glaubens- und Recht-fertigungsverständnis des Paulus und Jakobus, wie es sich nach Meinung vieler Theologen besonders deutlich in den obenstehenden Sätzen ausdrückt, hat seit frühester Zeit für viel Diskussionsstoff gesorgt. Es war auch ein Grund, weshalb der Jakobusbrief wegen seiner angeblichen Diskrepanz zur paulinischen Rechtfertigungslehre relativ spät in den biblischen Kanon aufgenommen wurde. Bekannt ist auch Luthers abfälliges Urteil über den Brief: "Darumb ist sanct Jacobs Epistel eyn rechte stroern Epistel gegen sie, denn sie doch keyn Euangelisch art an yhr hat."1 "Jeckel wollen wir schier aus der Bibel stossen hier zu Wittenberg, denn er redet nichts von Christo."2 Für den ehemaligen Augustiner-Mönch Luther, der sich nach langem inneren Kampf von dem Joch römischer Werkgerechtigkeit befreit hatte, bot der Jakobusbrief besondere Probleme. Dieser Brief, der so stark die Werke betont, schien ihm überhaupt nicht in rechte evangelische Theologie zu passen. Luthers Äusserungen haben sich in der Folge nachhaltig auf das theologische Verständnis des Jakobusbriefes ausgewirkt. So gehen denn auch heute die Meinungen über den Wert des Briefes sowie sein Verhältnis zur paulinischen Rechtfertigungslehre weit auseinander.
Die Fragen jedoch, die sich die neutestamentliche Forschung bezüglich des Verhältnisses zwischen Jakobus und Paulus stellt, sind seit Luther weitgehend dieselben geblieben: Haben wir tatsächlich zwei sich widersprechende Theologien in unserem biblischen Kanon? Versucht Jakobus das Rechtfertigungsverständnis des Paulus zu verwerfen oder umgekehrt? Gehört der Jakobusbrief womöglich nicht in den biblischen Kanon? Sind solche Widersprüche ein Beweis gegen das Verständnis einer göttlichen Inspiration der Autoren des Neuen Testaments?
Als Christen, die der Bibel vertrauen, müssen wir uns diesen kritischen Fragen stellen und versuchen, eine Antwort darauf zu finden, denn mit der Diskussion über das Verhältnis zwischen Jakobus und Paulus steht letztlich auch die Überzeugung von der Einheit und inneren Übereinstimmung der Schrift auf dem Spiel. Nun müssen zwar ungelöste "Widersprüche" noch lange nicht den Wahrheitsanspruch der Bibel hinfällig machen, jedoch ist ein solcher m. E. doch stark gefährdet, wenn sich, wie in unserem Fall, ein gesamter Brief nicht in den biblischen Kanon einordnen lässt, ja dieser sogar grossen Teilen neutestamentlicher Theologie (namentlich Paulus) widerspricht. Man kann deshalb die Frage über das Verhältnis zwischen Paulus und Jakobus nicht einfach als unlösbar liegen lassen, ohne damit den Wahrheitsanspruch der Schrift zu gefährden. Ich meine aber, dass sich Jakobus durchaus mit dem paulinischen Rechtfertigungsverständnis harmonisieren lässt, dass beide Autoren also in keiner Weise in einem Widerspruch zueinanderstehen, sondern vielmehr jeder seinen besonderen, unverzichtbaren Beitrag zur neutestamentlichen Theologie leistet. In der folgenden Arbeit werde ich daher versuchen, diese These theologisch-exegetisch zu begründen. Dabei soll die methodische Vorgehensweise wie folgt aussehen:
Die in dieser Untersuchung diskutierten Sachfragen sollen unbedingt in den Mittelpunkt gestellt werden. Schwerpunkt kann deshalb nicht die gesamte Forschungs- und Wirkungsgeschichte der behandelten Thematik sein, sondern die theologische und exegetische Auseinandersetzung mit Jakobus und Paulus. Ebenso wenig geht es in dieser Arbeit um eine erschöpfende Diskussion der fast unzähligen Ansätze zur Lösung des Problems. Trotzdem sollen aber die wichtigsten Ergebnisse der neutestamentlichen Wissenschaft in zusammengefasster Form an den Anfang der Arbeit gestellt werden und so deutlich machen, welche Wege die Forschung gegangen ist und welche Probleme mit den entsprechenden Lösungsversuchen verbunden sind. Ferner sollen die verschiedenen Ansätze auch in der theologischen und exegetischen Arbeit an den entsprechend relevanten Stellen mitdiskutiert werden. Die Beschäftigung mit den Forschungsergebnissen soll auch zeigen, welche Konsequenzen aus einer sogenannten Früh- bzw. Spätdatierung erwachsen und welche Denkvoraussetzungen damit verbunden sind. Im Anschluss soll dann der bevorzugte Ansatz dieser Arbeit dargelegt und begründet werden.
Von den Einleitungsfragen interessiert uns in dieser Arbeit nur die Verfasserschaft und Abfassungszeit, denn sie sind von recht grosser Bedeutung für das Verständnis bzw. die Argumentation über die Beziehung zwischen Paulus und Jakobus. Deshalb werde ich in einem gesonderten Kapitel auf die Möglichkeit eines Pseudepigraphs oder einer Verfasserschaft durch den Herrenbruder Jakobus bzw. einer Früh- oder Spätdatierung eingehen und dabei deren Konsequenz für unsere Diskussion aufzeigen. Methodisch gehe ich dabei so vor, dass ich die Möglichkeit herausfiltern werde, für die es die besten biblischen wie ausserbiblischen Argumente gibt.
Im Hauptteil der Arbeit werde ich mich zuerst mit den Begrifflichkeiten bei Jakobus und Paulus befassen. Dabei beschränke ich mich nicht auf den Glaubensbegriff allein, sondern werde auch das Verständnis von "Werke" und "Gesetz" untersuchen, da diese beiden Termini bei Jakobus und Paulus untrennbar mit zum Glaubens- und Rechtfertigungsverständnis gehören. Es geht also darum, diese zentralen Begriffe biblisch-theologisch zu erfassen, zu beschreiben und gegeneinander abzugrenzen.
Daraus muss erkennbar werden, mit welchem Inhalt Jakobus bzw. Paulus die behandelten Begriffe füllen, wo Gemeinsamkeiten vorliegen, aber auch wo sie deutliche Unterschiede aufweisen und gegeneinander abzugrenzen sind. Es soll dabei deutlich werden, wo Paulus und Jakobus ähnliche Begriffe verwenden, sie aber von einer ganz anderen Perspektive her betrachten, und wo wir in Gefahr stehen, sie misszuverstehen. Umfang dieser Untersuchung müssen daher der gesamte Jakobusbrief bzw. alle dreizehn paulinischen Briefe sein.
Sind die verschiedenen Begriffe theologisch erfasst und gegeneinander abgegrenzt, so wird in einem weiteren Hauptpunkt anhand von Röm 3,21-31 und Jak 2,14-26 die Argumentation von Paulus bzw. Jakobus über ihr jeweiliges Glaubens- und Rechtfertigungsverständnis aufgezeigt. Die beiden Perikopen bieten sich deshalb an, weil sie zum einen eine sehr konzentrierte Form des Rechtfertigungs- und Glaubensverständnisses bei Paulus und Jakobus bieten und zum anderen in der kritischen Forschung als sich gänzlich widersprechende Abschnitte angesehen werden. Es sind dementsprechend zwei Texte, die zur Lösung meiner Fragestellung unbedingt berücksichtigt werden müssen. Der Schwerpunkt soll dabei nicht so sehr auf einer Detailexegese liegen, sondern viel mehr auf der jeweiligen Argumentationsweise. Es geht bei der Exegese der entsprechenden Perikopen um die entscheidenden Punkte im Vergleich zwischen Paulus und Jakobus. Hier soll anhand ihrer konzentrierten Argumentation festgestellt werden, welche Rolle bei ihnen die voruntersuchten Faktoren Gesetz, Werke und Glaube im Heilprozess spielen. Es soll deutlich werden, was Paulus und Jakobus mit ihrer jeweiligen Beweisführung erreichen wollen, ob tatsächlich eine gegenseitige direkte oder indirekte Polemik vorliegt und ob sich die Abschnitte harmonisieren lassen.
In der Exegese über Röm 3,21-31 soll aber auch die Frage geklärt werden, inwiefern der Text von vielen Exegeten vielleicht doch mit einem lutherischen Vorverständnis betrachtet wird. Dazu sollen auch einige ganz neue Ansätze über das paulinische Rechtfertigungsverständnis zur Sprache kommen. Bei diesem Punkt ist mir wichtig, vor allem den Text selbst sprechen zu lassen und auf das zu hören, was Paulus seinen damaligen Lesern vermitteln wollte.
Auch bei der Exegese von Jak 2,14-26 soll es darum gehen, den Text nicht durch die Brille der paulinischen Rechtfertigungslehre zu betrachten, sondern auf sein eigentliches Anliegen zu achten. Die Auslegung soll die Frage klären, ob Jakobus tatsächlich in irgendeiner Weise gegen Paulus polemisiert oder ob eine völlig unabhängige Argumentation gegen eine von Paulus verschiedene Front vorliegt. Da die Analyse von Röm 3,21-31 der von Jak 2,14-26 vorausgeht, werde ich den Vergleich zu Paulus in die Exegese einfügen. Erst wenn die Analyse der beiden Abschnitte sauber und konsequent durchgeführt ist, d.h. die beiden Argumentationsweisen mit den entsprechenden Absichten verstanden sind, kann eine folgerichtige Synthese gezogen werden.
In der Synthese soll der Ertrag der Arbeit zusammengefasst und analysiert werden. Dabei werde ich die Argumentationen in Röm 3,21-31 und Jak 2,14-26 sowie die entsprechende Terminologie einander gegenüberstellen, um so die unterschiedlichen Aspekte, Frontstellungen und Benutzung von Begriffen erkennbar zu machen. Die Analyse soll deutlich machen, ob der Glaubensbegriff bei Jakobus mit der paulinischen Rechtfertigungslehre zusammenpasst oder ob sie jeweils völlig verschiedene Anliegen vertreten und diesbezüglich von verschiedenen Ausgangspunkten her argumentieren, die sich kaum miteinander vergleichen lassen. Ferner soll durch die Synthese klar werden, wo der eigentliche Grund für einen sogenannten Widerspruch zwischen Jakobus und Paulus liegt und auf was bei einem Vergleich zwischen der Rechtfertigungslehre des Paulus und dem Glaubensbegriff des Jakobus geachtet werden muss.
Die Schlussfolgerungen, die aus dieser Arbeit gezogen werden, sollen am Ende noch zu einigen Überlegungen über die entsprechende Konsequenz in der gemeindlichen und evangelistischen Verkündigung führen.
WA, DB 6,10 zitiert in Franz Mussner,Der Jakobusbrief. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament 13 (Freiburg: Herder, 1964), S. 44.
WA, TR 5,414 zit. ebd. S. 45.
1. Verschiedene Ansätze zur Lösung des Problems
Das Verhältnis der paulinischen Rechtfertigungslehre zum Jakobusbrief - im Besonderen zu Jak 2,14-26 - wurde in der exegetischen Literatur schon oft behandelt. In unzähligen Aufsätzen und Kommentaren wurde versucht, Lösungen zu dem Problem vorzulegen. Die wichtigsten Ansätze sollen deshalb in den folgenden Unterpunkten systematisch zugeordnet und grob umrissen werden. Dabei ist zu bemerken, dass es bei jedem Gliederungspunkt wiederum Vorschläge mit den verschiedensten Nuancen gibt, die aber hier nur zusammengefasst werden können. Die verschiedenen Thesen sollen ausgewogen dargestellt und anschliessend kurz bewertet werden. Im letzten Teil dieses Kapitels soll dann auch der in dieser Arbeit bevorzugte Ansatz dargestellt werden.
1.1 Jakobus polemisiert gegen Paulus
Es ist bezeichnend für die Meinung der meisten neutestamentlichen Forscher, dass der Jakobusbrief in Hübners Theologie des Neuen Testaments im Inhaltsverzeichnis unter der "Wirkungsgeschichte der paulinischen Theologie" aufgeführt wird.1 Dies steht für ein Programm, das den Jakobusbrief als starke Polemik gegen die Rechtfertigungslehre von Paulus sieht. Vorausgesetzt wird hierbei, dass der Jakobusbrief relativ spät verfasst wurde, also in einer Zeit, in der zumindest der Römer- und der Galaterbrief schon im Umlauf waren und entsprechende Wirkungen in den Gemeinden erzielten. Meist geht man aber von einer Abfassungszeit Anfang des 2. Jahrhunderts aus (125-130 n.Chr.). Die Verfechter der These, Jakobus polemisiere gegen die Trennung von Glauben und Werken bei Paulus, gehen davon aus, dass sich Jakobus mit Paulus unmöglich harmonisieren lasse.2 Damit stehen sie durchaus im Einklang mit Luther, der seinen Doktorhut dem Gelehrten aufsetzen wollte, der Jakobus mit Paulus "zusamen reymen kan".3 Als Argumente, die für eine Polemik des Jakobus gegen Paulus sprechen, werden folgende Punkte genannt:
Die Argumentation in Jak 2,14-26 kann nur als direkter Bezug auf paulinische Aussagen - vor allem im Römerbrief - verstanden werden, denn die Antithese von Glauben und Werken ist typisch paulinisch.
4
Der Bezug auf eben dasselbe Beispiel (Abraham) aus Gen 15,6, das Paulus in Röm 4 und Gal 3 erwähnt, und dessen Interpretation durch Gen 22 werden als gezielter Einspruch gegen das paulinische Verständnis von Gen 15,6 gesehen.
5
Jak 2,24 wird als eindeutige Antiformulierung zur paulinischen Rechtfertigungslehre ausgelegt.
6
Die Ansicht, Jakobus polemisiere gegen Paulus, ist heute praktisch Konsens in der kritischen Forschung. Dies ist weiter nicht erstaunlich, denn wer nicht mehr eine einheitliche Theologie im biblischen Kanon voraussetzt, braucht sich erst gar nicht um eine Harmonisierung zu bemühen. Hier sind die Nachwirkungen von Ferdinand Christian Baur deutlich zu erkennen, der von einem starken Gegensatz zwischen Heiden- und Judenchristentum ausging und deshalb im Jakobusbrief eine Entschärfung der paulinischen Theologie erkennen wollte, die zu einem Ausgleich der beiden Lager führen sollte.7
Aber selbst recht konservative Exegeten wie etwa Hengel gehen von einer direkten Kontroverse zwischen Jakobus und Paulus aus, die sich nicht unter einen Hut bringen lässt. Hengel führt in diesem Zusammenhang als Argument nicht nur die Polemik gegen die paulinische Rechtfertigung durch den Glauben allein an, sondern will im gesamten Jakobusbrief eine antipaulinische Tendenz entdecken. So sieht er u. a. in Jak 4,13-16 einen Tadel gegen Paulus, der grossräumig plante und sich seiner Erfolge rühmte.8 Für Hengel rechnet Jakobus in seinem Brief mit dem "persönlichen Verhalten des Paulus, seiner Missionspraxis und gefährlichen Tendenzen seiner Theologie" ab.9
Die Ansicht, dass Jakobus direkt gegen Paulus polemisiere, wirft jedoch einige Fragen auf:
Macht Paulus in seinen Ausführungen über den Glauben tatsächlich die christliche Tat überflüssig? Wenn dies nicht der Fall ist, hätte dann Jakobus Paulus nicht völlig missverstanden, wenn er ihm vorwirft, er trenne den Glauben von den Werken? Weshalb würde der Verfasser des Jakobusbriefes nur in indirekter Weise gegen Paulus vorgehen und ihn nicht namentlich erwähnen? Ist die Rechtfertigung aus Glauben eine ausschliesslich paulinische Interpretation, die im krassen Widerspruch zu den anderen Aposteln steht? Ferner muss sich diese These mit den biblischen Belegen auseinandersetzen, die ein durchaus positives Verhältnis zwischen Jakobus und Paulus bekunden und Jakobus als den stets Vermittelnden zwischen der Jerusalemer Gemeinde und den entstehenden heidenchristlichen Gemeinden beschreibt.10 Dies gilt nicht nur, wenn man eine Verfasserschaft durch den Herrenbruder annimmt, denn weshalb sollte jemand unter dem Namen Jakobus eine antipaulinische Schrift verfassen, wenn doch seine vermittelnde Rolle zwischen Juden- und Heidenchristen bekannt ist? Die These setzt auch eine relativ späte Abfassung voraus, die in der Forschung nicht unumstritten ist.11 Das Argument, in Jak 2,21f könne unmöglich das Beispiel von Abraham genannt sein, wenn es sich nicht um einen direkten Bezug auf Röm 4 und Gal 3 handele,12 lässt sich mit der Begründung abwenden, dass Gen 15,6 in einer langen jüdischen Auslegungstradition bezüglich des Verhältnisses von Glauben und Werken steht und damit sowohl von Paulus wie auch von Jakobus unabhängig verwendet werden konnte.13
Am schwersten wiegt jedoch das Problem, wie sich eine völlig widersprechende Theologie zwischen Paulus und dem Jakobusbrief mit der Einheit und inneren Übereinstimmung des biblischen Kanons vereinbaren lässt. Letztlich wird mit der vorgenannten These die göttliche Inspiration der Schrift in Frage gestellt.
1.2 Jakobus polemisiert gegen falsch verstandenen Paulus
Ein zweiter Lösungsversuch geht von einer sich gänzlich harmonisierenden Ansicht bezüglich Rechtfertigung bei Paulus und Jakobus aus. Jakobus greift nicht Paulus an, sondern will vielmehr ein durch verschiedene Kreise verfälschtes Bild der paulinischen Rechtfertigungslehre zurechtbiegen. Er kämpft gegen ein erschlafftes Christentum, das sich die paulinische Rechtfertigungsformel zum "quietistischen Ruhekissen" gemacht hat.14 Vertreter einer frühen Abfassung des Jakobusbriefes, d.h. durch den Herrenbruder Jakobus, wie etwa Kittel dies favorisiert, halten ein Missverständnis zu einem Zeitpunkt, in dem der Galater- und Römerbrief im Umlauf waren, für ausgeschlossen, denn dann hätte der Verfasser von Jakobus den richtigen Paulus zitieren können.15 In ihrer Argumentation verweisen sie auf Verzerrungen und Missdeutungen der paulinischen Theologie, auf die schon Paulus in Röm 3,8 und 6,1 aufmerksam macht. Von diesen Fehldeutungen hörte man durch zweite Hand auch in Jerusalem, ohne jedoch Gelegenheit zu haben, mit Paulus direkt zu sprechen. So hat denn Jakobus zu verschiedenen Schlagworten Stellung genommen, ohne jedoch in der Lage zu sein, gegenüber den Verzerrungen auf den richtigen Paulus hinzuweisen.16 Dieser Standpunkt setzt eine sehr frühe Abfassung des Jakobusbriefs voraus, also noch vor dem Galaterbrief, oder wie Kittel meint, noch vor dem Apostelkonzil.17
Die Mehrheit der Neutestamentler, die im Jakobusbrief eine Berichtigung eines verzerrten Paulinismus sehen, halten jedoch einen Spätansatz für das Richtige, d. h. eine Abfassung in der nachpaulinischen Zeit (die meisten gehen von einer Abfassung Anfang des 2. Jhdts. aus). Der Brief wurde dann als Pseudepigraph verfasst, in einer Zeit, die schon weit von Paulus entfernt ist. Er befasst sich demnach nur noch mit einem formelhaften Paulus; mit einem Christentum, das zu einer toten Rechtgläubigkeit und zu einem weltförmigen Liberalismus degenerierte.18 Diese Theorie passt sehr gut zu dem im Brief beschriebenen desolaten und zunehmend in reinen Bekenntnisglauben verfallenden Christentum. Eine Gemeinde, die Reiche als Mitglieder bevorzugt (Jak 2, 1-13), wo Verleumdungen an der Tagesordnung sind (Jak 3,1-12; 4,11-13), in der Streit und Neid die Gemeinde zu zerreissen droht (4, 1f), Freundschaft mit der Welt (4,4), Vertrauen auf Reichtum (5,1-6) und vor allem ein reiner Bekenntnisglaube ohne tätige Nächstenliebe vorherrschten, kann man sich in der Pionierzeit, kaum zwanzig Jahre nach Christi Tod, nicht recht vorstellen.19 Der Brief scheint vordergründig betrachtet auf eine Polemik gegen falsch verstanden Libertinismus zu deuten, die in einer Zeit abgefasst wurde, als ein falsch verstandener Paulus durchaus negative Konsequenzen erzielen konnte.
Aber auch diese Lösung ist nicht frei von Schwierigkeiten. Zum einen muss man mit Kittel fragen, weshalb der Briefschreiber nicht auf den richtigen Paulus hingewiesen hat.20 Zum anderen scheint es mir durchaus nicht erwiesen, ob Jakobus tatsächlich in Abhängigkeit der paulinischen Theologie seine Ausführungen über den Glauben verfasste. Die unterschiedliche Terminologie - Jakobus polemisiert nämlich gegen einen Glauben "ohne Werke", nicht gegen einen Glauben "ohne Gesetzeswerke", wie ihn Paulus in Röm 3,28 postuliert21 - und die Gesamtbotschaft des Briefes weisen eher auf eine eigenständige Argumentation des Jakobus. Weiter wird zu untersuchen sein, ob eine tote Rechtgläubigkeit oder desolate Zustände der Gemeinde tatsächlich nur eine typische Erscheinung der zweiten Generation sein können.
1.3 Paulus polemisiert gegen Jakobus
Auf diese Möglichkeit machen u.a. Davids22 und Guthrie23 aufmerksam. In abgeschwächter Form - Paulus polemisiere nicht direkt gegen Jakobus, aber gegen eine missverstandene jakobäische Theologie - wird sie von Zahn vertreten.24 Auch diese These setzt zwei unterschiedliche, sich widersprechende Schulen voraus: die heidenchristliche Position um Paulus und die stark judenchristlich geprägte Front um Jakobus. Die Lösung lässt sich also nur vertreten, wenn man von einem judenchristlichen bzw. nomistischen Hintergrund des Jakobusbriefes ausgeht.25 Wenn aber Paulus bereits im Galaterbrief gegen Jakobus polemisiert, so setzt dies eine sehr frühe Abfassung des Jakobusbriefes voraus, für die eigentlich nur der Herrenbruder Jakobus in Frage kommen kann. Ein theologischer Streit zwischen den beiden widerspräche aber der guten Beziehung zwischen Jakobus und Paulus (Apg 15,13; 21,18) und der hohen Achtung, die Paulus vor Jakobus hatte (Gal 1,19; 2,9). Zudem sind sich die meisten Exegeten einig, dass Jakobus mit seiner Terminologie nicht ins gesetzliche, judenchristliche Lager gehört.26 Im Weiteren kämpft auch dieser Lösungsversuch mit der Schwierigkeit, weshalb Paulus im Römer- und Galaterbrief Jakobus nicht explizit nennt.27





























