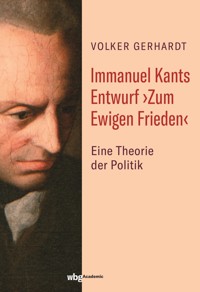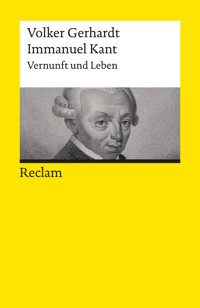6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Ist Religion bloß eine reine Glaubensfrage? Und ist Wissen z.B. um Fakten immer verlässlicher? Auf keinen Fall, so Volker Gerhardt: Glauben setzt nämlich Wissen immer voraus. Also kann er nicht der Gegenspieler des Wissens sein: Wissen und Glauben gehören notwendig zusammen, denn sie bedingen sich gegenseitig und haben beide ihren unverzichtbaren Anteil an der Vernunft. Gegenstand von Gerhardts Essay ist die Untersuchung genau dieser Einheit von Glauben und Wissen. Und dies ist in Zeiten religiöser Intoleranz und wissenschaftsgläubiger Überheblichkeit mehr als notwendig.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Volker Gerhardt
Glauben und Wissen
Ein notwendiger Zusammenhang
Reclam
Alle Rechte vorbehalten
© 2016 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
Covergestaltung: Cornelia Feyll, Friedrich Forssman
Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen
Made in Germany 2016
RECLAM, UNIVERSAL-BIBLIOTHEK und RECLAMS UNIVERSAL-BIBLIOTHEK sind eingetragene Marken der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN 978-3-15-961176-1
Inhalt
Vorbemerkung
Eine Abhandlung über Glauben und Wissen vorzulegen, ohne vorab in Erinnerung zu rufen, was bedeutende Denker zum Teil bereits unter demselben Titel zum Thema veröffentlicht haben, scheint dem Geist der Schule so sehr zu widersprechen, dass mancher geschichtskundige Leser den Text vermutlich erst gar nicht zur Hand nehmen möchte. Sucht er eine Erinnerung an die Theoretiker der Vereinbarkeit von Vernunft und Glauben, an Augustinus, Anselm, Averroes, Thomas, Meister Eckhart, Erasmus, Melanchthon oder Montaigne, tut er gut daran, das Büchlein gleich wieder beiseite zu legen. Auch nur den Neueren, wie Fichte, Schleiermacher oder Hegel, die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken hätte von dem direkten Zugang abgelenkt, den ich zum Glaubensproblem der Gegenwart in der Sprache der Gegenwart suche. So musste ich auch auf eine Würdigung der dem 21. Jahrhundert näher stehenden religionsphilosophischen Anreger wie Peirce, James, Royce oder Jaspers verzichten. Nur der Aufklärer Immanuel Kant, dem ich in epistemischer, ethischer und theologischer Hinsicht besonders verpflichtet bin, wird gelegentlich erwähnt. Bei ihm ist mir mehr als bei allen anderen bewusst, was ich unerwähnt lassen muss.
Zur Rechtfertigung kann ich nur vorbringen, dass der gesuchte Zugang die globale Verdichtung der religiösen Konflikte als neuen Tatbestand anerkennt. Mit ihm haben sich die ohnehin nicht geringen weltpolitischen Spannungen vervielfältigt. Um unter dem durch Terror und Krieg verschärften Druck gleichwohl auch in religiösen Fragen gesprächsfähig zu sein, ist es vordringlich, über die Begrifflichkeit der religiösen Sprache aufzuklären. Man hat kenntlich zu machen, wie eng sie mit der allein durch die Technik von Tag zu Tag bedeutsamer werdenden Lebensmacht der Wissenschaft zusammenhängt und so mit der Alltagserfahrung auch in der globalen Zivilisation verbunden bleibt.
Die vorliegende Untersuchung kann dies nur an einem Beispiel zeigen, das aber ausreicht, um die Unverzichtbarkeit des Glaubens gerade auch unter den Bedingungen des Wissens kenntlich zu machen.
1 Der Anspruch auf epistemische Einheit
Das größte Problem, mit dem es der Glauben in der Moderne zu tun hat, besteht darin, dass er als historischer Vorläufer des Wissens angesehen wird. Die vorherrschende Meinung ist, der Glauben werde nicht mehr benötigt, sobald genügend wissenschaftlich geprüftes Wissen zur Verfügung steht.
So halten es viele nur für eine Frage der Zeit, bis Wissenschaft und Aufklärung so weit fortgeschritten sind, dass endlich auch jene, die heute immer noch an ihrem Glauben hängen, von der Rückständigkeit ihrer Einstellung überzeugt sein werden. Einige dieser vorzüglich soziologisch denkenden Aufklärer sind dabei so großzügig, den Gläubigen zuzugestehen, ihren Glauben zur didaktischen Versicherung moralischer Überzeugungen nutzen zu können. Und solange das noch nötig ist, können sich sogar überzeugte »Säkularisten« zu »Postsäkularisten« erklären, die mit verständnisvollem Wohlwollen auf alle blicken, die noch nicht so weit sind wie sie. Sie reden verständnisvoll über den Glauben, meinen aber, ihn selbst nicht nötig zu haben.
Die Überheblichkeit, mit der seit etwa dreihundert Jahren in Westeuropa über den religiösen Glauben geurteilt wird, so als könne das Wissen jemals in der Lage sein, die Lebensführung des Menschen zu übernehmen, kann als Reaktion auf den Unverstand angesehen werden, mit dem die institutionellen Machthaber des Glaubens ihrerseits über das wissenschaftliche Wissen geurteilt haben.
Die Abwehr des Glaubens, für die sich in den letzten Jahren vornehmlich Naturwissenschaftler starkgemacht haben, lässt sich somit gut verstehen. Ein Glauben, der sich gegen neues Wissen sperrt, zieht den Verdacht auf sich, in prinzipieller Opposition zum Wissen zu stehen. Nimmt man hinzu, was alles historisch im Namen des Glaubens verübt worden ist, wie viele Kriege in seinem Namen geführt worden sind und welche ungeheuren Menschenopfer die Religionen gefordert haben, ist es nur zu verständlich, in ihm den geborenen Widersacher des Wissens namhaft zu machen.
Und dennoch wird dem Glauben mit dieser Diagnose Unrecht getan. Er ist eine in allen Kulturen verbreitete, vermutlich jedes Individuum leitende, sich tatsächlich nur im menschlichen Verhalten äußernde und durchaus voraussetzungsvolle Leistung. Daran ändert nichts, dass man ihn auch als »Gnade« oder »Geschenk« ansehen darf; selbst Martin Luther betont, dass man ihn »üben« müsse. Denn Glauben setzt Wissen voraus. Also kann er nicht der vorgegebene Gegenspieler des Wissens sein, wie manche durchaus angesehene Wissenschaftler und nicht wenige Gläubige meinen.
Wenn wir das Wissen als Voraussetzung des Glaubens bezeichnen, soll das nicht heißen, Wissen könne auch für sich genommen werden und gänzlich unabhängig vom Glauben wirksam sein. Dann nämlich wäre es denkbar, dass Wissen sich selbst genügen und auf den Glauben, mit dem es seit seinem historischen Aufstieg in der menschlichen Zivilisation verbunden ist, verzichten könnte. Tatsächlich aber lässt sich zeigen, dass beide notwendig sind und somit im Kontext menschlicher Lebensführung nicht voneinander zu trennen sind.
Wissen und Glauben wurden in den ersten Jahrhunderten ihres allmählich zunehmenden Gebrauchs vermutlich gar nicht unterschieden. Es würde nicht überraschen, wenn sich eine ausdrückliche Unterscheidung erst mit wachsender Arbeitsteilung zwischen verschiedenen Formen des technischen, militärischen, administrativen, medizinischen und astronomischen Wissens herausgebildet hätte.
Die Arbeitsteilung dürfte mit der Dichte der Besiedlung, mit wachsendem Können und der Zunahme des grenzüberschreitenden Handels an Bedeutung zugenommen haben. Definitiven Einfluss hatte die fortschreitende Individualisierung in den Kulturen an den östlichen Küsten des Mittelmeers. Das ist ein bis weit ins dritte Jahrtausend v. Chr. zurückreichender Prozess, dessen Etappen sich im Gilgamesch-Epos, in den kunstvollen altägyptischen Klageliedern um 2000 v. Chr. und in den hochindividualisierten Gesängen des Königs Salomons verfolgen lassen. In Homers Odyssee, in den Tragödien des Sophokles und in den Dialogen Platons erscheint die Individualität bereits den Charakter des Subjektiven anzunehmen. Im Euthyphron und in der Apologie versteht sich Sokrates auf eine prägnante Unterscheidung zwischen Wissen (epistēmē) und Glauben (pistis). Doch erst die Verkündigung der christlichen Botschaft erfolgt bewusst und nachdrücklich in der Sprache des Glaubens.
Im klassischen Griechenland kommt es auch zu einer institutionellen Differenzierung zwischen den Einrichtungen der Bildung im Geist der entstehenden Wissenschaften und der Hingabe an die darstellenden Künste. Die Verselbstständigung politischer Instanzen nach dem Ende der Königsherrschaft in Athen (680 v. Chr.) sowie im nachfolgenden Aufbau einer demokratischen Ordnung im Lauf des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts spielt ebenfalls eine Rolle: In jener Zeit werden den Tempeldienern politische Beschränkungen auferlegt, die ihren Beitrag zum gesellschaftlichen Leben auf enger gefasste kultische Leistungen begrenzen. In der Folge erhält die Tugend der Frömmigkeit ihr spezielles Gewicht; ihren Platz hat sie nicht über, sondern lediglich neben den anderen Tugenden. Gerechtigkeit, Besonnenheit und Weisheit treten in den Vordergrund philosophischer Aufmerksamkeit.
Die geschichtliche Ausdifferenzierung der Anwendungsfelder von Wissen und Glauben muss Thema einer speziellen Untersuchung bleiben. Sie stellt insbesondere für den Ursprungsbereich der großen Religionen im Vorderen Orient eine nicht geringe sprachliche und kulturhistorische Herausforderung dar. Uns muss es genügen, den auf Erkenntnis beruhenden, epistemischen Zusammenhang zwischen Glauben und Wissen zu exponieren, ohne dessen praktische Bedeutung aus dem Auge zu verlieren. Diese Bedeutung wiederum ist sowohl gesellschaftlich wie auch individuell, wobei der Glauben seine besondere Stellung dadurch erhält, dass er den Menschen existenziell verpflichtet. Hinzu kommt, dass der Glauben nicht erst dort benötigt wird, wo das Wissen an sein Ende kommt; er wird schon in Anspruch genommen, wenn der Mensch glaubt, sich auf sein – ja stets unabgeschlossenes und selten vollkommen gesichertes – Wissen verlassen zu können. Unter den Bedingungen des praktischen Lebensvollzugs fordern sich Wissen und Glauben wechselseitig heraus.
Die Angewiesenheit des Wissens auf den Glauben hat einen geschichtsphilosophischen Rang, der seinerseits von politischer Bedeutung ist. Beide haben damit zu tun, dass Wissen nicht allein als die geistige Macht gelten kann, die über Gegenwart und Zukunft des Menschen bestimmt. Selbst in der größten Begeisterung für das Wissen kann man nicht übersehen, dass es eine Reihe vorgelagerter Faktoren und Motive gibt, ohne die kein Wissen auskommt. Man muss etwas vom Wissen erwarten oder erhoffen, wenn man sich seiner Leitung anvertraut. Und man benötigt sowohl Disziplin wie auch Energie, wenn man Wissen erwerben, erst recht wenn man selbstbewusst mit ihm umgehen können möchte. Nicht erst die Vernunft, sondern bereits das Wissen hat ein Interesse nötig, um erworben zu werden und um es tätig anzuwenden. Doch selbst wenn es nur das Wissen gäbe, könnte niemand behaupten, der Gang der Welt sei dann allein mit einsichtigen und zwanglosen Mitteln zu bewältigen. Ja, man könnte noch nicht einmal sagen, was eine Einsicht bedeutsam macht und was wir eigentlich am friedlichen Umgang miteinander schätzen.
Selbst wenn man, wie es die Logik des verständigen menschlichen Handelns ohnehin gebietet, die Hoffnung auf Vernunft nicht preisgibt, wird man weder die Hoffnung noch die Vernunft auf bloßes Wissen gründen können. Das Vertrauen in ihre Kräfte geht augenblicklich in einen Glauben an die mögliche Verbindung von menschlichem Willen und natürlicher oder gesellschaftlicher Umwelt über, in der er etwas erreichen können soll.
Dem bereits hier wirksamen epistemischen Glauben kommt nur dann eine auch anderen Menschen zumutbare Bedeutung zu, wenn er vom zunächst kulturellen und schließlich humanitären Glauben an positive Auswirkungen auf andere getragen wird. Beide können individuell nur in Form eines moralischen Glaubens verbindlich werden. Und nimmt sich auch nur eine dieser Formen so ernst, dass sie sich mit der Erwartung universeller und existentieller Folgen verbindet, geht sie in einen religiösen Glauben über.
Wissen und Glauben gehören somit notwendig zusammen. Sie bedingen sich gegenseitig und haben beide, auch wenn das vielen Vertretern des Glaubens so wenig gefällt wie manchen Anwälten der Wissenschaft, ihren unverzichtbaren Anteil an der Vernunft. Diese nicht erst in der Vernunft, sondern bereits in der Selbstgewissheit des Wissens hervortretende Einheit von Glauben und Wissen ist Gegenstand der vorliegenden Untersuchung.
Die Überlegungen setzen mit einer exemplarischen Veranschaulichung des bis in die Gegenwart reichenden Konfliktpotenzials zwischen Wissen und Glauben ein. Sie demonstrieren dann im historischen Rückblick auf die Sprache der biblischen Überlieferung, wie wenig Anlass es gibt, hier von einem Gegensatz zu sprechen. Darauf folgt in drei wechselseitig aufeinander bezogenen Überlegungen die den Hauptteil ausmachende systematische Erwägung. Sie bietet kein leichtes Brot, ist aber um Verständlichkeit bemüht. Vorab bedarf nur die vermutlich befremdlich wirkende Rede von der »epistemischen Einheit« von Glauben und Wissen der Erläuterung:
Das Adjektiv »epistemisch« nimmt den griechischen Ausdruck für ›Wissen‹ (epistēmē) auf und vertraut darauf, dass die pragmatische Dimension des Wissens gegenwärtig bleibt. Darin sind für die Griechen verlässliches Erkennen, treffender Gebrauch und angemessenes Urteil verbunden. Im epistemischen Wissen ist zwar der Begriff das Bestimmende, aber nur in der korrigierenden Präsenz von Empfindung, Anschauung und Gefühl. Die epistemische Einheit ist somit darauf angelegt, nicht bloß allgemein Verständliches so aufzunehmen, dass es öffentlich wirksam werden kann. Sie beruht keineswegs allein auf Begriffen, die sich in wechselseitiger Kommunikation überprüfen und in der Rekonstruktion durch die äußeren Sinne versichern lassen. Vielmehr geht in sie auch das mit ein, was sich im affektiven Selbstverständnis der Wissenden mitteilen und vergegenwärtigen lässt. Die epistemische Einheit von Wissen und Glauben ist also auch auf Leidenschaften und Gefühle gegründet, ohne die wir nicht selbstbewusst mit dem Wissen umgehen, es nicht im Vertrauen auf seine Richtigkeit mitteilen und nicht in Erwartung einer gewünschten Wirkung anwenden könnten.