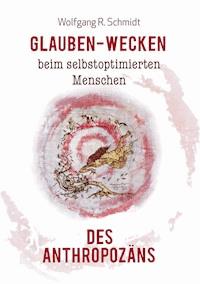
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Ausdruck Anthropozän (zu altgriechisch ánthropos, deutsch 'Mensch' und kaivóc, deutsch 'neu') ist ein Vorschlag zur Benennung einer neuen geochronologischen Epoche: nämlich des Zeitalters, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Der Begriff wurde 2000 vom niederländischen Chemiker und Atmosphärenforscher Paul Crutzen gemeinsam mit Eugene Stoermer ins Spiel gebracht: Die beiden Wissenschaftler wollen damit ausdrücken, dass die Menschheit zu einem geologischen Faktor geworden sei. 2002 präzisierte Crutzen in einem Artikel in der renommierten Fachzeitschrift Nature den Begriff als eine "Geologie der Menschheit". Er modifizierte damit einen Vorschlag des italienischen Geologen Antonio Stoppani, der bereits 1873 "Anthropozoische Ära" beziehungsweise "Anthropozoikum" als Bezeichnungen für ein neues Erdzeitalter vorgeschlagen hatte: "Eine neue tellurische Macht könne es an Kraft und Universalität mit den großen Gewalten der Natur aufnehmen". Andere Wissenschaftler verwendeten auch den Begriff "Noosphäre" oder Psychozoikum. Auch Hubert Markl verwendet 1995 in seiner Publikation Natur als Kulturaufgabe "Anthropozoikum" als aktuellen Faunenschnitt für die alleinige Verantwortung des Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Urlandschaft: Von der evangelischen Vielheit zur kanonisch manipulierten Botschaft
Verschriftete Botschaft
Das Neue Testament
2.1 Evangelien und Apostelgeschichte
2.2 Paulusbriefe
2.3 Johanneische Schriften
2.4 Die katholischen Briefe
Die historische Festlegung auf einen Kanon
Anspruch und historischer Prozess
Interkulturelles Patchwerk
Kanonisierung: Ende der evangelischen Vielfalt-Beginn der Staatskirche
Globale Landschaft: Religionsfreiheit unter staatlicher Kontrolle
Ausbreitung nach dem 4. Jahrhundert und »Religionsfreiheit«
Entdeckung von «Religionsfreiheit« in der Mission.
Religionsfreiheit als vom Staat geschütztes Menschenrecht
3.1. Staatskirchentum und Religionsfreiheit
3.2. Suprematie des Staates über die Kirche
3.3. Trennung von Staat und Kirche: Befreiung von der Kirche
Mission und Befreiung im Schatten staatlicher Suprematie
4.1. Staatliche Schutz- und Aufsichtspflicht über Mission im kolonialen Zeitalter
4.2 Der »sekundäre« Auftrag der Mission unter dem Schutz kolonialer Aufsicht
»Religionsfreiheit« als missionarisches Grundanliegen
5.1. Religionsfreiheit ökumenisch-missionarisch
5.2. Stimulans Befreiung: »Neuer Mensch und neue Welt«
5.3. Bekehrung und neues Leben (Religionswechsel)
5.4. Entprivatisierung der Bekehrung
Religionsfreiheit in der Mission gestern und heute
6.1. Die kritische Praxis der Religionsfreiheit
6.2. Kritisierte Universalität der Religionsfreiheit
6.3. Kritische Egalität der Religionsfreiheit
6.4. Kritische Unteilbarkeit der Religionsfreiheit
Globale Landschaft: Islam und Aufklärung
Missionsgeschichte in der ÖRK-Erklärung 2013
Ausbreitung nach »Osten« im Kontext Islam
2.1 Kirche östlich von Jerusalem
2.2 Die Kreuzzüge: Befreiung vom Islam I
2.3 Seeweg nach Indien: Befreiung II
2.4 Der ferne Osten: überall Islam
Grossraumabsprache für die Missionierung
3.1 Geopolitisch
3.2 Kirchlich
Ausbreitung im neuzeitlichen Kontext der befreiten Vernunft
4.1 Der historische Kontext
4.2 Der philosophische Kontext
4.3 «Reich Gottes» als globale Protest-Projektion des Universalen
4.4 Verlust der Legitimation und Schwerpunktverlagerung
4.5 Counter-Konzept: Kooption und »Missio dei«
Die Welt des Anthropozäns
»Die beste aller möglichen Welten«
1.1. »Tag ohne gestern«
1.2 Typen und Bewohnbarkeit von Planeten
1.3 »Weltformel«
1.4 »Schöpfung«?
Das »Leben«
2.1. Leben als Produkt und Ziel der »Schöpfung«
2.2 Leben: Zehn Milliarden Jahre nach dem »Urknall
2.3 Leben als multiversale Entwicklung
2.4 Kosmische Lebensformen
Der Mensch
3.1 Der »Mensch 0.1«
3.2 Der selbstoptimierte Mensch 0.2
3.2.1 Virtuelle Realität
3.2.2 Synthetische Biologie
3.2.3 Big Data und Künstliche Intelligenz
Anthropozäne Herausforderungen
Glauben wecken (Mission) mit Ignoranz?
1.1. »Urknall«? Nicht gehört!
1.2. »Dunkle Materie«! »Parallelwelten«! Ist das der »Himmel«?
1.3. Ausdehnung des Universums! Warten auf den »Jüngsten Tag«?
1.4. Statistik und Interpretationskonzepte
1.5. Schnittstelle: Glauben wecken
Verstehen
2.1. Glauben und «biblische Irrtumslosigkeit«?
2.2. Glauben mit neuronaler Grundlage?
2.3. Glauben-wecken und Dialog
2.4. »Transformative Nachfolge«
2.5. Internetuelle Bewegung
2.6. Globalisierung und globale Monokultur
2.7. Kapitalismuskritik und Ideologiefreiheit
2.8. Machbarkeit und biblische Erwartung
2.9. «Globales Dominium«
Relevanz für die Verkündigung im Anthropozän
Universale Deutungskompetenz
Glauben jenseits von »archaischer« Landschaft
Atem des Lebens« für die »optimierte Schöpfung«?
Begleitung auf dem Weg der Endlichkeit?
Individuelle »Umkehr«?
Schluss: Transformation?
Anhang
Inhaltsverzeichnis des WCC-Textes (Abk.: TLL)
Anmerkungen
Vorwort
Wolfgang Schmidt spricht die dringend notwendige und prophetische Einladung aus, einen radikalen transformativen Diskurs über Missiologie zu beginnen, einschließlich eines Neuanfangs bei Studium und Planung von Mission im 21. Jahrhundert. Seine äußerst kreative herausfordernde Abhandlung konzentriert sich auf die jüngste Missions-Diskussion in der Ökumenischen Bewegung, einschließlich des Missions-Dokuments des Weltrates der Kirchen aus dem Jahr 2013.
Sein Buch ist bestimmt von dem riesigen kosmischen Kontext des Lebens, der durch menschliche technokratische Innovationen im Entstehen ist, welche die Menschheit über die bisherigen historischen Zivilisationen hinaus entwickeln.
Seine Analyse von »Landschaften«, d.h. Kontexten der Mission, stellt »Glauben-wecken« in den unbegrenzten kosmischen Kontext, der für Wissenschaft und Technologie dadurch in greifbare Nähe rückt, so dass sie in diesem Jahrhundert ihr wissenschaftliches Weltbild in gegenwärtige Wirklichkeit verwandeln.
Dies ist der Punkt, von dem aus Schmidt historische Entwicklungen in der Missiologie seit den biblischen Zeiten bis zur Gegenwart zu verstehen sucht. Drei Punkte sind für den Eintritt in die Diskussion besonders herausfordernd und prophetisch, auch für mein eigenes konkretes Engagement in einer integralen Forschung über Leben.
Er präsentiert eine tiefgehende Analyse der kosmischen wissenschaftlichen Entdeckungen und deren Auswirkungen auf die Definition des Kontextes für Mission.
Er buchstabiert die Auswirkungen auf die Entwicklung von Leben im planetarischen Raum und für das Heraufkommen des sich selbst-optimierenden Menschen durch ständig expandierende technologische Innovationen.
Sehr eindrücklich erfasst er die Krise des Glaubens in diesem technologischen, kosmischen Rahmen.
Er ruft dazu auf, in diesem Rahmen »Glauben-wecken« als ein Schlüsselelement für die Herausbildung einer kreativen und transformativen Missiologie zu sehen.
Wolfgang Schmidts Buch präsentiert nicht nur eine einleuchtende, kritische Analyse der Missionsgeschichte bis zur Gegenwart, sondern weist auch auf die verschiedenen Ausrichtungen der christlichen Missionsgemeinschaften hin, unter anderem auf die Zähmung des technokratischen Triumphalismus und die Mobilisierung spiritueller Weisheit aus Afrika, Asien und der amerikanischen Urbevölkerungen. Eine großartige kosmische Vision!
Prof. Dr. Kim Yong-Bock
Direktor des Asia Pacific Center for Integral Study of Life
Seoul/Südkorea im Oktober 2017.
Einleitung
Das Wissen des Menschen um sich selbst und seine Welt hat sich in den letzten 100 Jahren so verändert, dass es für eine wachsende Öffentlichkeit naheliegt, von einer neuen Epoche der Menschheitsgeschichte zu sprechen. Braucht es daher eine erneuernde Rezeption der christlichen Botschaft, sozusagen eine erneute Reformation für das 21. Jahrhundert? Oder gilt das seit dem 16. Jahrhundert strapazierte reformatorische Befreiungs-Prinzip »Allein aus Glauben« noch?
Die Zeitepoche seit dem Ende des Eiszeitalters vor 11 700 Jahren wird allgemein anerkannt als das Holozän bezeichnet. Natürlich hat es in diesem Zeitraum durch Rodungen und Bejagung großer Pflanzenfresser einschneidende Veränderungen im globalen Ökosystem gegeben. Die Mehrzahl der Befürworter der Einführung einer neuen erdgeschichtlichen Epoche stellen einen qualitativ bedeutsamen Einschnitt um das Jahr 1950 fest als den Beginn der »großen Beschleunigung«. Innerhalb der »International Union of Geological Studies« (IUGS) spricht man von einer völlig neuen Qualität menschlicher Aktivität und von dem Beginn des »Anthropozän«, dem »Zeitalter des Menschen«. Gemeint ist die bis heute anhaltende Periode exponentiellen Wachstums in praktisch allen Parametern der technischen und wissenschaftlichen Entwicklung. Für die grundlegende Veränderung sind drei sich einander begünstigende Effekte verantwortlich: die sehr schnelle technische Entwicklung, das immense Bevölkerungswachstum und die Menge der verbrauchten Ressourcen.
Die Veränderung begann mit der Produktion menschengemachter geologischer Spuren. Ganz neue Werkstoffe und alte – wie Beton und Glas – werden im großen Stil zu großen Städten verbaut. Hinzu kommen Aluminium, Mülldeponien, Strände und Meere voller Plastik, Verbrennnungsrückstände von Holz oder fossilen Brennstoffen, chemische Spuren wie Blei aus Millionen Autotanks, langlebige Radioisotope oder die Zerfallsprodukte des bei Atomtests freigesetzten Plutoniums. Auch die Natur der Ablagerungen selbst, ein wesentliches Erkennungsmerkmal einer geologischen Epoche, verändert sich charakteristisch. Durch industriell betriebene Landwirtschaft und Abholzung steigt die Erosion, Düngemittel schwemmen Stickstoff und Phosphor in Flüsse und ins Meer, entziehen Schelfmeeren den Sauerstoff und begünstigen so die Ablagerung schwarzer Faulschwämme. Fachleute erkennen noch nach Jahrmillionen sauerstofffreie Meeresgebiete an diesen Rückständen. Das gilt auch für die Markerstoffe, die die Atombombentests auf dem ganzen Planeten verteilt zurückgelassen haben.
Die neue Qualität der rasanten Entwicklung der Technik hat der Wissenschaft in allen Bereichen bis dahin ungeahnte Möglichkeiten eröffnet, insbesondere den Astrowissenschaften. Mag man über die geologische Benennung des menschheits- und erdgeschichtlichen Zeitabschnittes noch diskutieren. Der mit »Anthropozän« umschriebene Zeitabschnitt trägt wie kein anderer in der bekannten Geschichte die eindeutige Signatur des sich selbst optimierenden, seine Welt neu durchdringenden und erschaffenden Menschen. Noch bis vor 100 Jahren glaubte man, wir würden in einem statischen, sich nur kaum veränderndem Universum leben. Andere als unsere Galaxie, die Milchstraße, waren nicht bekannt. Die am Himmel erkennbaren Nebelflecken hielt man für Gaswolken. Natürlich gehörten die sichtbaren Sterne zu unserer Galaxie. Das Sichtbare war sozusagen das Universum.
Ohne Beteiligung von Kirchen und Theologen haben Forscher in den vergangenen 100 Jahren ein neues uns unbekanntes Universum »geschaffen« mit unvorstellbaren Dimensionen und ungeahnten Konstellationen, mit einer Vergangenheit von 13,7 Milliarden Jahren und einer noch einmal so langen Zukunft. Unsere Galaxie ist von zahllosen, viele Millionen Lichtjahre entfernten Galaxien umgeben, die unseren Vorfahren wie diffuse Flecken ohne Detail am Himmel vorkamen. Kirchen und Theologen haben diese neue, unsere Welt mit Ignoranz behandelt. Diesen Eindruck hat man, wenn man die gängigen Verlautbarungen und Texte der großen religiösen Gemeinschaften zu Rate zieht. Der Eindruck entsteht, dass sie an einer anderen Welt festhalten, eine andere Welt voraussetzen, zum Beispiel, dass sie möglicherweise noch unterbewusste »Landschaften« beschreiben, an die man sich wehmütig und mit ein wenig Heimweh erinnern mag.
Als Beispiel nenne ich die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (WCC) 2013 in Busan/Süd-Korea. Dort wurde auf Vorschlag der Kommission für Weltmission und Evangelisation (WCC-CWME) einstimmig eine Erklärung unter dem Titel: Together Towards Life in Changing Landscapes (zit.: TTL), deutsch: Gemeinsam für das Leben: Mission und Evangelisation in sich wandelnden Kontexten diskutiert und beschlossen. Seit der Integration des Internationalen Missionsrates (IMC International Missionary Council) in den Ökumenischen Rat der Kirchen im Jahr 1961 in NeuDelhi gab es nur eine WCC Erklärung zur Weltmission: die vom WCC Zentralausschuss genehmigte Erklärung unter dem Titel: Mission and Evangelism: An Ecumenical Affirmation. Inzwischen ist 2016 ein umfangreiches, 634-seitiges Werkbuch zum Thema der TTL unter dem Titel Ecumenical Missiology. Changing Landscapes and New Conceptions of Mission herausgekommen (EM). Dieses Werkbuch dient unter anderem auch der Vorbereitung der nächsten Weltmissionskonferenz, die für März 2018 in Arusha/Tansania unter dem Titel Moving in Spirit. Called to Transforming Discipleship als eine Vertiefung der Inhalte der TTL-Erklärung vom WCC geplant wird. Auch dafür gibt es inzwischen Vorbereitungskonfererenzen und Material (Anm.1). Grund genug, sich mit den sehr verschiedenen Welten zu befassen und zu sehen, ob es wirklich dieselbe Welt, dieselbe Geschichte, derselbe Mensch ist, von dem wir reden, der in »Busan« und der im »Anthropozän«?
Die intensive Beschäftigung des WCC, speziell auch die der CWME, mit der aktuellen Verkündigungssituation lässt darauf schließen, dass die Erklärung offensichtlich als eine ökumenische Wegweisung für die Mitglieder im Blick auf ihr Engagement für Mission und Evangelisation, also als eine Vision für das 21. Jahrhundert zu verstehen ist. Die in EM aufgeführten Beiträge aus allen Kontinenten sind durchgehend positiv und bestätigen meist vertiefend und dimensionierend die traditionelle Sicht und Schwerpunkte zukünftiger missionarischer Engagements der durch den ÖRK vertretenen Kirchen und Gemeinschaften. Geht es nach der deutschen Übersetzung, dann wird »Landschaft« mit »Kontext« übersetzt. Auffallend ist, dass diese sprachliche Neuheit fraglos und diskussionslos akzeptiert wird. Wenn ich recht verstanden habe, so soll »Landschaft« den Begriff »Kontext« ersetzen, was sicher etwas konkreter, blumiger und auch eingängiger sein mag. Es regt vor allem zum verfremdeten Nachdenken an, was mich dazu brachte, einmal neu über die historischen und heutigen »Landschaften« der Verkündigung nachzudenken, und zwar kontextual, nicht mit den Augen des »globalen Südens« oder der schnell wachsenden »Pfingstler«, sondern mit den Augen zunehmend frustrierter, sich aus dem kirchlichen Leben verabschiedender Ehemaliger. In einer Welt des postmodernen, multikulturellen Wertewandels und multireligiösen Konzepten ist die Stimme der Kirche kaum noch zu Gehör zu bringen. Man kann einfach auch das informierte, protestlose Desinteresse in der Hörer-Landschaft nicht mehr übersehen. »Landschaften« können in der beschreibenden Analyse übereinstimmen, stellen sich aber in Motivation und Perspektive anders dar als in der TTL-Erklärung und den gemeinhin von kirchlichen Amtsstellen bedauerten Reaktionen darauf.
Aus dieser landschaftlichen Sichtweise ergeben sich vier, eigentlich nur drei Landschaften. Im ersten Kapitel geht es mir um eine Sicht auf die »Urlandschaft« der ersten vier Jahrhunderte, d. h. einmal auf eine Zeit der Erinnerung des Geschehens um den Menschen Jesus und seiner Botschaft und zum anderen auf die offensichtlich notwendig gewordene Bemühung um eine einheitliche Darstellung der Glaubensinhalte. Im zweiten und dritten Kapitel geht es um die Umsetzung des globalen Anspruchs der Christenheit auf die bewohnte »Globale Landschaft« unter den Gesichtspunkten der Staatskirche, des Kolonialismus, der Religionsfreiheit und der aufgeklärten Vernunft. Im vierten Kapitel schließlich komme ich zu meinem eigentlichen Anliegen, nämlich der Frage nach den sich in unserer Zeit vollziehenden Veränderungen hin zu unserer zunehmend auch vom Menschen geschaffenen »planetarischen Landschaft«. Von dieser dramatischen Neudimensionierung des in der WCC-Erklärung TTL so stark strapazierten »Lebens in der Fülle« oder der offensichtlichen Weiterentwicklung hin zum »selbst optimierten Menschen« ist in dem TTL-Text nichts zu lesen.
Ebenso wenig enthält TTL einen Hinweis auf den tiefgehenden strategischen Wandel, der sich bei näherer analytischer Betrachtung der »landschaftlichen« Ausrichtung der Ausbreitung ergibt. Schon in dem sich herausbildenden, »urlandschaftlichen« Verständnis lässt sich ein starkes konfrontatives Element in der Begegnung mit dem von starken Traditionen besetzten »globallandschaftlichen« Umfeld feststellen. Es zeigte sich sehr bald ein globaler, alle Lebensbereiche durchdringender Anspruch, der nur mit Konfrontation, in allen denkbar möglichen Gestaltungsformen global durchzusetzen war. Mit dieser Strategie erreichte das Christentum im 20. Jahrhundert »die Enden der Erde«. TTL – dies sei positiv gesagt – weist nichts von diesem Geist der Konfrontation mehr auf, der bei dem Vorläufer noch zu spüren war. TTL – bewußt oder unbewußt – ist Ausdruck eines strategischen Paradigmenwandels von der Konfrontation zur Transformation, von einer mechanistischen Do-minierung der Welt zu einem gemeinsamen Zeitalter einer ökologisch weltweiten Gemeinschaft, von Evangelisierung der Welt zum Schalom, vom Monolog zum Dialog. Im TTL-Text findet man viele Hinweise und Ansätze für diesen Wandel und gibt damit ökumenischen Ansätzen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen revolutionierenden Zusammenhang.
Es bleibt aber bewundernswert, wie dediziert und offen sich Astrobiologen und Astrophysiker an den »Rändern« kundig machen und sich damit für das interessieren, was eigentlich Theologen, und nicht nur Missionsstrategen, im Blick auf die Dimensionen ihres Auftrages und die Gestaltung ihrer »Landschaft« beschäftigen müsste. Nicht zuletzt im Vorfeld des mit großem kirchlichen Aufwand betriebenen 500-jährigen Gedenkens der Reformation im Jahr 2017 wäre eine Kontextualisierung dieser wissenschaftlichen Großleistung von entscheidender Bedeutung für die Verkündigungsarbeit der Kirchen gewesen. Schließlich dürfte es sinnvoll und relevant für jeden Gläubigen sein, die Gewissheit zu haben, dass das reformatorische Prinzip ohne Abstriche für den selbstoptimierten Menschen des Anthropozäns auch in diesem neudimensionierten Kosmos noch gilt. Der TTL-Text hat die Chance nicht genutzt, die Potentiale der reformatorischen Vision vom »Allein aus Glauben« für den Menschen der »planetarischen Landschaft« zu aktualisieren. Auch die Erklärung der Konferenz der »International Ecumenical Fellowship« (IEF) im August 2017 wonach man im Lutherjahr begonnen habe, eine »Vision für eine Kirche von morgen« zu formieren, entbehrt jeglicher Anzeichen eines absehbaren Paradigmenwechsels.
Die einfache Methode, in der Vergangenheit nach relevanten Deutungen zu suchen, ist insofern schwierig, als Kommentare zu den neueren provozierenden, um nicht zu sagen: revolutionierenden Forschungsergebnissen des 20. Jahrhunderts in theologischen Abhandlungen nur rudimentär zu finden sind. Vielleicht erklärt es sich daher, dass man erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts Technologien zur Verfügung hatte, die es ermöglichten, weiter ins All zu schauen und die Bedingungen auf den Oberflächen von Planeten und die Zusammensetzung ihrer Atmosphäre genauer zu untersuchen. Diese offensichtlich auf Anhieb rauhen Bedingungen führten zu der weitverbreiteten Ansicht, dass nur die Erde für Leben geeignet sei.
Inspiriert durch die kosmische Entgrenzung des Alls, hat dann auch im vergangenen Jahrzehnt die Suche nach außerirdischem, auch menschlichem Leben in unserem Sonnensystem wieder neues Interesse gefunden. Dies ist wohl auch der Tatsache zuzurechnen, dass Astronomen im Jahr 2013 entdeckten, dass Planeten wie die Erde in unserer Galaxie häufiger sein könnten als bis dahin angenommen. Inzwischen hat sich aber auch die Frage nach dem Ursprung des Lebens neu gestellt. Hat man bis noch vor einigen Jahren angenommen, das Leben auf der Erde sei auch auf unserer Erde entstanden, so neigen Wissenschaftler heute eher dazu, dass sich das Leben irgendwo anders in unserem Sonnensystem gebildet hat. Wann und wie dieses Leben entstanden ist, wie es gestaltet ist und funktioniert, wie es auf unsere Erde kam und wie es sich bis hin zum Menschen entwickelte, das und mehr sind höchst spannende aktuelle Fragen, denen die Astrobiologie nachgeht, ein interdisziplinäres Forschungsgebiet in dem vor allem Astronomie, Astrophysik, Chemie, Geophysik zusammenkommen.
In der TTL-Erklärung wird viel von neuen »Landschaften« gesprochen und auf die neu zu entdeckenden globalen »Ränder« unserer Zivilisation hingewiesen, ohne die real neu entdeckte »planetarische Landschaft« mit den einhergehenden neuen planetarischen »Rändern« des Lebens und des Menschen auch nur zu erwähnen. Auf dieses Versäumnis soll mit diesem Beitrag hingewiesen werden. Dies verbinden wir mit der Hoffnung, dass die TTL-Konsultation, die 2018 in Ostafrika, also in dem Teil unseres Planeten stattfinden soll, der noch immer als die Urheimat und Wiege des Menschen gilt, so etwas wie eine planetarische Dimensionierung des Glauben- weckenden Zeugnisses zu reflektieren beginnt. Dabei sollte man es sich nicht zu leichtmachen und allzu schnell auf ein sehr altes Attribut für den Auferstandenen zurückgreifen und von dem »kosmischen Christus« sprechen. Die Geschichte des Kosmos, des Lebens und des Menschen, so wie sie sich heute darstellt, ist grundsätzlich von der Geschichte und dem Weltbild derer zu unterscheiden, die diese neutestamentliche Terminologie benutzt (Anm. 2) oder später auch wiederentdeckt haben (Anm. 3).
Diese Publikation ist ein Plädoyer dafür, Glauben-wecken in dem faszinierenden entgrenzten Kontext der neu entdeckten planetarischen oder auch kosmischen Landschaft zu überdenken. Ein Kernpunkt ist die mit an Sicherheit grenzende Annahme, dass es menschliches außerirdisches Leben in dieser Landschaft gibt und diese wie auch immer gebildeten Exoplanetarischen zur Menschheit gehören, also auch von der evangelischen Botschaft nicht ausgegrenzt werden können. Es darf also keine Begrenzung des Glauben-Weckens auf diese unsere Erde und auf den uns bekannten Menschen und seine Landschaften geben. Der noch unbekannte exoplanetarische, wie auch der sich selbst optimierende Mensch des Anthropozäns gehören zur kosmischen Landschaft des Glauben-weckenden Zeugnisses.
Um der Glaubwürdigkeit des Auftrages willen sollten wir nicht apologetisch auf die neuen Erkenntnisse der Naturwissenschaften so reagieren, als habe Theologie schon immer eine kosmische Entwicklungsdimension vorweggenommen. Sowohl die alttestamentlichen, als auch die antiken und neutestamentlichen Vorstellungen von dem, was auch immer Philosophen, Astrologen und Theologen unter Kosmos oder Universum oder Schöpfung, kurz: unter Astrologie verstanden haben, bleiben quantitativ und qualitativ weit hinter dem zurück, was z. B. das Großteleskop »PS1« mit einer extrem leistungsfähigen Kamera in den Jahren 2010-2015 fotografisch erfasst hat und was nun in einem wissenschaftlichen Lexikon des Weltalls nach weiteren drei Jahren vorliegen wird. Es ist eine Datenbank entstanden, die zwei Petabyte an Daten enthält, d.h. vergleichsweise 40 Millionen Aktenschränke mit jeweils vier Schubladen engbedruckter Texte über Sternenexplosionen, Asteroide, fremde Galaxien, drei Milliarden Himmelskörper und bis zu 12,5 Milliarden Lichtjahre entfernte »Schwarze Löcher«. Es geht nicht an, den qualitativen und quantitativen grundsätzlich neuen Dimensionen unseres Universums weiterhin mit bäuerlichen oder auch priesterlichen Welterklärungen und deren exegetischer Qualifizierung als Glaubenszeugnisse aufzuweichen. Um neue Glaubwürdigkeit für die Botschaft auch beim sebstoptimierten Menschen zu wecken, bedarf es einer neuen Grundlegung der wissenschaftlichen Theologie, die keine simultanen oder konsekutiven neuen Welten schafft, sondern die bekannten Rahmenbedingungen und Dimensionen unserer Welt ernst nimmt, und möglicherweise so bei dem Menschen in unserem Universum ein Stück an Glaubwürdigkeit gewinnt.
Mein besonderer Dank geht an Nyoman Darsane, der ohne jede Auflage sein Gemälde “Die Erschaffung des Windes” für die Gestaltung des Umschlags zur Verfügung gestellt hat; an Kim Yong Bock für Ermutigung und das ökumenische Vorwort; an Hans Edi Moppert und Markus Wyss für viele gute Ratschläge und die hilfreiche Begleitung; an Anna-Lena Grieshaber für alle technischen Gestaltungshilfen; nicht zuletzt an Frau Dr. Bremer für die umfassende, fachliche und zügige Beratung bei Design, Herstellung und Druck des Buches, und an meine Frau Inge für ihre in den vergangenen vier Jahren täglich bewährte Geduld mit mir und der zeitaufwendigen Arbeit am Manuskript.
Herrischried, im Oktober 2017.
I. Urlandschaft: Von der evangelischen Vielheit zur kanonisch manipulierten Botschaft
1. Verschriftete Botschaft
Weitgehend unbestritten ist, dass der Mensch Jesus gelebt hat. Eine besondere Ausstrahlung und sein Anspruch, ein besonderer Lehrer innerhalb der jüdischen Traditionen zu sein, hat ihn für seine Umwelt so interessant gemacht, dass man anfing, Geschichten über ihn zu erzählen und über seine Worte nachzudenken. Dieser Prozess der mündlichen und dann auch schriftlichen Jesustraditionen lässt sich im Einzelnen nur sehr schwer nachweisen. Ein versuchter Nachweis seiner Worte ist sicher die sogenannte Logienquelle, eine Sammlung von Zitaten, die Jesus zugeordnet werden. Aber auch diese Quelle ist, wie später die Evangelien, Resultat eines längeren Überlieferungsprozesses.
Die zunächst mündlich, dann anfänglich auch schon schriftlich tradierten Worte und Geschichten über Jesus aus der Zeit vor seiner Kreuzigung bedurften schon mit der Behauptung seiner Auferstehung der Deutung. Hinzu kamen die Erzählungen nachösterlicher Erscheinungen Jesu und die der Geisterfahrungen der frühen Christen. Mit der beginnenden Verkündigungs- und einsetzenden Missionsarbeit bestand ein ständig wachsender Bedarf an detailliertem und einsehbarem Material über diesen Menschen Jesus, aus dem hervorging, dass dieser gekreuzigte und auferstandene Mensch Jesus, schon zu seinen Lebzeiten sich als der »Menschensohn« verstanden hatte. In Verkündigung und Taufunterweisung berichteten Christen in Gleichnissen und Berichten von Wundertaten Jesu. Prägnante Worte Jesu wurden in Erzählungen über ihn gerahmt und so überzeugend anwendbar. Früh schon entstanden kurze prägnante Bekenntnisse als Antwort (1.Kor. 15,3 eines der Urbekenntnisse). Darüber hinaus schien wohl eine schriftliche Fixierung wegen der Naherwartung der Wiederkunft Jesu nicht relevant. Als diese aber ausblieb, entstanden kleine Sammlungen von Streitgesprächen, Wundererzählungen und in Gleichnisse gefasster ethischer Themen. Daraus wurden ganze Blöcke wie schon früh die Passionsgeschichte und später die Evangelien zusammengestellt.
2. Das Neue Testament
Das Neue Testament (NT) berichtet und reflektiert das Leben, Sterben und Auferstehen des Juden Jesus Christus, der als Mensch, Messias und Sohn Gottes zur Rettung der Menschen im heutigen Israel gelebt hat. Dieser Bericht (Anm. 4) ist eine Sammlung von 27 Schriften, von denen keine im Original überliefert, sondern jeweils nur in Abschriften erhalten ist. Sie wurden ausgewählt aus einer weitaus größeren Anzahl von griechischen Handschriften. Insgesamt geht man von 5.400 Dokumenten aus, die in den ersten christlichen Gemeinden kursierten. Die Sammlung wurde um das Jahr 400 unserer Zeitrechnung abgeschlossen.
Die Geschichte dieser Sammlung ist ebenso spannend wie menschlich und zeigt die unterschiedlichen Ansätze, sich dem Erlebten, bzw. den Erzählungen der Zeitgenossen zu nähern. Zusammen mit dem Alten Testament (in der als »Tannach« bekannten Fassung [(Anm. 5)]) bilden sie die Bibel, die von allen christlichen Bekenntnisgruppen als Wort Gottes und somit als Grundlage des christlichen Glaubens anerkannt ist.
2.1 Evangelien und Apostelgeschichte
Zum NT gehören grundlegend die vier Evangelien nach Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die sich auf das Leben Jesu und sein Wirken beziehen. Die Namen sind nachträglich hinzugefügt worden und sagen nicht unbedingt etwas über den ursprünglichen Verfasser aus. Was die Namen betrifft, so dürften bei Matthäus und Johannes die Apostel gemeint sein. Bei Markus geht man davon aus, dass er seine Informationen von Petrus hatte. Lukas war Arzt und soll ein Begleiter des Paulus gewesen sein. Diese Namen wurden bereits früh den Evangelien zugeordnet und auch einheitlich in den Gemeinden benutzt. So dürfte der Kirchenvater Irenäus von Lyon erstmals schriftlich Lukas dem Evangelium zugeordnet haben.
Die Entstehung der Evangelien ist von der historisch-kritischen Forschung des 20. Jahrhunderts zum Teil sehr verschieden gesehen worden. Die heutige Mehrheitsmeinung nimmt für die Sammlung der griechischen Texte den Zeitraum zwischen den Jahren um 70 (Markus), 80-90 (Matthäus und Lukas) und um 100 (Johannes) an. Für die sehr alte Annahme eines hebräischen oder aramäischen Urevangeliums gibt es bisher keine ernstzunehmenden Belege. Auch wird die Frühdatierung in die 30er Jahre heute kaum noch vertreten.
Die historische Einordnung der vier Evangelien beruht auf stilistischen Eigenheiten, wechselseitigen Textbezügen, Hinweisen auf historische Fakten und auf theologischen Unterschieden. Aufgrund der Stilunterschiede lassen sich auch der Wirkungsbereich und die Adressaten bestimmen. Das Matthäus-Evangelium dürfte in Syrien entstanden und für Gemeinden mit einem stark judenchristlichen Anteil geschrieben sein. So galt das Evangelium nach Markus Heidenchristen in Kleinasien, Griechenland, Rom und Ägypten. Ebenfalls an gebildete Heidenchristen in Jerusalem, Kleinasien und Rom war das Evangelium nach Lukas gerichtet, während sich das Evangelium nach Johannes zur Glaubensvertiefung allgemein an Christen wandte.
Die Apostelgeschichte gilt als Fortsetzung des Lukasevangeliums. Kernstück ist das Apostelkonzil, die Aufhebung der Begrenzung der christlichen Gemeindegründung auf den Bereich des Judentums und die Rolle, die der Apostel Paulus dabei spielt.
2.2 Paulusbriefe
Die ältesten schriftlichen Quellen sind allerdings 7 Briefe, die von dem im Jahre 5 unserer Zeitrechnung geborenen Paulus geschrieben wurden. Nach dem Apostelkonzil (48 n Chr.) begann der »Apostel« Paulus seine ausgedehnte Reisetätigkeit, mit der er die evangelische Botschaft weit in das römische Imperium trug und christliche Gemeinden gründete. Dabei ergaben sich theologische und ethische Probleme, sowie persönlicher Erklärungsbedarf. Dies und mehr spiegeln diese Briefe wider. Die intellektuelle Leistung des Juden Paulus im Prozess der Auseinandersetzung mit seinen Glaubensgenossen, Neuchristen und Nichtjuden war die theologische Transformation der wenigen bekannten authentischen Jesusworte zu einer visionären Botschaft der Befreiung und Gleichheit aller Menschen.
Das älteste authentische Quellendokument ist der um das Jahr 50 in Korinth geschriebene 1. Thessalonicherbrief. Es folgt der im Jahr 54 in Ephesus geschriebene 1. Brief an die Korinther, gefolgt von dem in Mazedonien im Jahr 55 geschriebenen 2. Korintherbrief. Ebenfalls und zum Ende des Jahres 55 entstand in Makedonien der Brief an die Galater. Im folgenden Jahr, 56, entstand in Korinth der Brief an die Römer. Der Philipperbrief wurde von Paulus im Jahr 60 im Gefängnis in Rom geschrieben. Dort entstand auch im Jahr 61 der Brief an Philemon.
Nach dem Tod des Apostels entstanden im Umkreis seiner Schüler und Mitarbeiter die 6 sogenannten deuteropaulinischen, also Paulus zugeordneten Briefe: Kolosserbrief, Epheserbrief, der 2. Thessalonicherbrief, der 1. und 2. Timotheus- und der Titusbrief. Sie unterscheiden sich von den authentischen Briefen insbesondere dadurch, dass die bis dahin gängige Naherwartung der Wiederkunft Jesu inzwischen aufgegeben ist und in den Gemeinden mittlerweile ein Anpassungsprozeß an die geschichtlichen Gegebenheiten begonnen hatte. Die Gemeinden arrangieren sich mit den herrschenden Verhältnissen.
2.3 Johanneische Schriften.
Von einem unbekannten Verfasser der johanneischen Schule in Ephesus entstanden um das Jahr 100 das Johannes-Evangelium und die 3 Johannesbriefe. Die Reden Jesu sind bereits »Theologie«, also Johannes in den Mund gelegte Texte seiner Schüler. Thema ist nicht mehr das Reich Gottes, sondern die Bedeutung der Person und des Werkes Jesu. Es beansprucht, unter Leitung des Geistes eine authentische Darstellung des Lebenswerkes zu geben. Dazu gehört auch die sogenannte Offenbarung des Johannes, die um das Jahr 95 auf Patmos, eine Insel vor der türkischen Westküste, entstand. Adressat sind verfolgte Gemeinden In Kleinasien, die unter Zwangsmaßnahmen, verbunden mit der Durchsetzung des römischen Kaiserkultes, litten. Leiden, Prüfungen und Verfolgungen werden auf eine endgeschichtliche Ebene verdichtet, die auf die ewige Gemeinschaft mit Gott im himmlischen Jerusalem hinweist.
2.4 Die katholischen Briefe
Zu dieser Briefsammlung gehören der Jakobusbrief, der 1. und 2. Petrusbrief und der Judasbrief. Sie werden als katholisch bezeichnet, weil sie nicht an bestimmte Gemeinden gerichtet, sondern an allgemeine (»katholische«) Empfänger gerichtet sind. Sie sind relativ spät zusammengestellt und abgeschlossen worden. Der um 130 datierte 2. Petrusbrief ist wohl das jüngste Dokument des Neuen Testaments. Die Briefe behandeln ethische und dogmatische Probleme der frühen Christenheit. In die Nähe dieser Briefsammlung gehört der Hebräerbrief, der seiner Form nach ein schriftlich fixierter Lehrvortrag ist, und dessen Zugehörigkeit zum Kanon noch lange strittig war.
3. Die historische Festlegung auf einen Kanon
Die wachsenden juden- und heidenchristlichen Gemeinden des zweiten Jahrhunderts waren vor die Frage gestellt, welche der in großer Anzahl kursierenden Schriften die Maßstäbe für die christliche Lehre abgeben sollten. Inzwischen gab es Ansätze kirchlicher Organisation und einer sich entwickelnden Hierarchie. Es musste vor allem Klarheit geschaffen werden über das Verhältnis zur aufkommenden Gnosis und anderen konkurrierenden Erkenntnislehren und Welterklärungen. Der Klärung bedurfte auch das Verhältnis zu den inzwischen entstandenen christlich-gnostischen Gruppierungen. Neben neuen ‚Briefen‘ waren neue Evangelien mit neuen besonderen Erkenntnissen im Umlauf, so das ‚Philippus-Evangelium‘, das ‚Evangelium der Wahrheit‘ oder auch das ‚Thomas-Evangelium‘. Hinzu kam um 150 das Auftreten von Markion in Rom, der einen eigenen Kanon, ohne das Alte Testament, mit einem ‚revidierten‘ Lukas-Evangelium und ‚gereinigten‘ Paulusbriefen vertrat. Dies beförderte den Klärungsprozess. Gegen Ende des 2.Jahrhunderts hatte sich der Kern des neutestamentlichen Kanons durchgesetzt: 13 Paulusbriefe, 4 Evangelien und die Johannesbriefe. Im 3. und 4. Jahrhundert kamen dann noch die restlichen Briefe und die Johannes-Offenbarung hinzu. Endgültig wurden die 27 Schriften als Lehrgrundlage, »Quelle des Heils«, durch Athanasius von Alexandrien, Bischof der ägyptischen Kirche, im Jahr 367 in seinem 39. Osterfestbrief amtlich festgestellt. Nach und nach wurde diese Entscheidung dann auch in den anderen Kirchen akzeptiert (Anm. 6).
4. Anspruch und historischer Prozess
Die Entstehung der christlichen Lehrgrundlage, d.h. des neuen Testaments, ist die nacherzählte Geschichte eines historischen Prozesses. Aus den wenigen überlieferten, nachweislichen und kontextualisierten Jesusworten bildete sich insbesondere aufgrund der systematisierenden Durchdringung der Zeugnisse durch den jüdischen Theologen Paulus eine vereinheitlichte dogmatische Interpretationsrichtung heraus. Sie birgt nach Meinung der Verfasser den Anspruch in sich, dass in dem verschrifteten menschlichen Wort Gott selbst spricht (2.Thess. 2,13). Um der Wahrheit willen wird man auch feststellen müssen, dass alle theologischen Aussagen auf geschichtliche, religiöse oder philosophische Hintergründe zurückzuführen sind. Die Verfasser der neutestamentlichen Schriften ebenso wie die dogmatischen konziliaren Aussagen der ersten vier Jahrhunderte sind beschränkt und auf dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen Weltbildern entstanden.
Ein sehr realistisches Bild der religiösen Strömungen und politischen Verhältnisse im Palästina des ersten Jahrhunderts hat Reza Aslan gezeichnet. Er hat dabei nicht viel mehr historisches Material und Fakten verwendet als bereits im vorigen Jahrhundert durch historisch-kritische Bibelwissenschaftler bekannt war (Anm. 7). Er beruft sich u.a. ausdrücklich auf Rudolf Bultmann und dessen nicht von allen Theologen akzeptiertes Entmythologisierungsprogramm (Anm.8). So kommt ein ausgesprochen klares historisches Jesus-Profil zustande: ein jüdischer Revolutionär in einer apokalypisch aufgeladenen Zeit, der als Zelot für die Verwirklichung des Gottesreiches in dieser Welt einsteht und dabei zum erklärten Feind der römischen Besatzungsmacht wird. Ein Revolutionär aus dem armen Galiläa, dessen Ziel aber nicht so sehr ein himmlisches Königreich war, als ein Palästina ohne römische Besatzungsmacht. Eine sympathische Gestalt zu Lebzeiten mit einem ambivalenten Verhältnis zur Gewalt. Reza Aslan lässt aber auch deutlich werden, warum die frühen Christen diesen Menschen Jesus nach seiner Hinrichtung aus einer völlig anderen Erinnerung heraus zum dogmatisierten Christus gemacht haben.
Auch die Weihnachtsgeschichte ist ein weithin von neutestamentlichen Wissenschaftlern anerkanntes Beispiel dafür, dass es nur schwer vorstellbar ist, dass sich die Geschichte so mit Stall und Krippe zugetragen hat. Vermutlich hat der Verfasser des Lukasevangeliums aus den ihm zugängigen mündlichen Überlieferungen eine aufwendig komponierte Erzählung geformt, um bestimmte dogmatische Positionen damit zu belegen.
So sind die Geschichten und Worte der Evangelien nicht allgemeine zeitlose, sondern durch den Zusammenhang des jeweiligen Erkenntnisstandes begrenzte »Wahrheit«. Sie sind Interpretationen dessen, was man mit Jesus erlebt hat oder meinte, mit ihm erlebt zu haben. Es gibt in diesem Sinne keine »objektive Christologie«, wie es auch keine »objektive Schöpfungslehre« oder »objektive Pneumatologie« gibt. Auch die Lehre von der Trinität (Anm.9) hat ihr Grundschema in der spätgriechischen Philosophie, ebenso wie der Logos. Sie sind kollektive oder individuelle Wahrheiten, Doktrin sozusagen als Projektion »christlicher« Erfahrung von bewusst in ihrer Zeit und in ihren Traditionen lebenden Menschen, zunächst individuell als Zeitgenosse, oder dann als »Jüngerin« und »Jünger«, später zunehmend im Kollektiv. Der Wahrheitsanspruch ist nicht beweisbar. Jede Generation kann »Wahrheit« nur glaubwürdig als in-der-Zeit-gebundene Wahrheit bezeugen. Das Gotteswort im Menschenwort erschließt sich dann trotzdem nur im Glauben an die Menschwerdung Gottes in dem Menschen Jesus Christus. Liebe und Nähe Gottes zum Menschen werden nachvollziehbar, verständlich, auch wenn sie in Menschenworten gekleidet und akzeptabel sind (2.Kor.4, 7).
5. Interkulturelles Patchwerk
Bernhard Heininger hat über die historisch-kritische Textanalyse des NT hinausgehend nach dem interkulturellen Hintergrund der Texte des NT gefragt und ist dabei auf interessante Zusammenhänge gestoßen (Anm. 10). Der folgende kurze Einblick in den Inkulturationsprozeß möge die Bedeutung andeuten, die verschiedenen inner- und außerjüdische Überlieferungen für die Kanonbildung hatten.
Was den historischen Jesus betrifft, so geht Heininger davon aus, dass sich in der Vorstellung Jesu vom Reich Gottes die Naherwartung der Gottesherrschaft seines Lehrers, des Täufers Johannes, widerspiegelt. Jesus hat diese dann in seiner eigenen Tätigkeit zur Aussage über das gegenwärtige Reich Gottes weiterentwickelt. Erst mit dem bevorstehenden Tod kehrt er zurück zur Ankündigung des nahebevorstehenden Gottesreiches. Diese Annahme bezieht Heininger auf die Zweite Du-Bitte des Vaterunsers. Nach der synoptischen Reduktion auf die Urfassung des Gebets, sieht er die Heiligungs- und Herrschaftsbitte als Ausdruck der jesuanischen futurischen Eschatologie. In diesem Zusammenhang steht für ihn auch der Schuldenerlass. Hingegen ordnet er die Brot- und Versuchungsbitte dem präsentischen Reich-Gottes-Verständnis zu. Das Vaterunser ist sozusagen ein Beleg für die apokalyptische Wende in der Biographie Jesu.
Bezieht sich diese biographische interkulturelle Interpretation auf die AT-Tradition, so sieht Heiniger in einem weiteren Versuch die Inkulturation des hellenistischen Symposions in den neutestamentlichen Aussagen über die Eucharistie. Danach handelt es sich im NT um zwei Typen, einmal die paulinisch-lukanische, die wohl auf einer antiochenischen Mahltradition beruht. Dabei wird die Mahlfeier durch einen Brotritus eröffnet. Dem folgt ein Sättigungsmahl. Ein Becherritus beendet die Mahlfeier. Anders der wahrscheinlich in Jerusalem praktizierte markinisch-mathäische Ritus. Bei diesem geht das Sättigungsmahl vorauf und wird mit einer eucharistischen »Doppelhandlung« beschlossen. Diese beiden Typen sind zu unterscheiden, weil sie zwei verschiedene Traditionen aufnehmen. Aus einem synoptischen Vergleich ergibt sich ein »Urbericht«, der größtenteils auf die Tradition des jüdischen Gastmahls zurückgeht und erst nachösterlich dem Passahmahl angepasst wurde. Durch den Zusatz (zum Brotwort) »für viele« gewinnt das letzte Mahl den Charakter einer genuin jesuanischen kultkritischen Symbolhandlung, die erst auf Grund des Ostergeschehens zur kultstiftenden Symbolhandlung gedeutet werden konnte.
6. Kanonisierung: Ende der evangelischen Vielfalt – Beginn der Staatskirche
Die autoritäre Entscheidung für einen verbindlichen Kanon der Wahrheit war von grundlegender Bedeutung für eine sich zentralistisch entwickelnde Kirche. Nur mit einer klaren Ausrichtung, die sich auf eine eindeutig definierte Grundlage bezog, konnten sich die entstehenden Gemeinden gegen Anfeindungen und Bedrohungen behaupten, sich ausbreiten und zunehmend auch Vertrauen bei Außenstehenden erwirken, das dann auch zur staatlichen Anerkennung führte. Es ist nicht auszudenken, wie sich die Geschichte des Christentums gestaltet hätte, wären die durch den Hirtenbrief des Athanasius ausgeschlossenen Schriften im Umlauf geblieben. Die Entwicklung wäre möglicherweise authentischer verlaufen, aber hätte sicher nicht so schnell mit dem Status einer staatlichen Einheitsreligion geendet. Die Amtskirche setzte erfolgreich auf Einheit und Minimalkonsens. Sie verabschiedete sich von der Vielfalt der Glaubenserfahrungen, wie sie in einigen der seit 367 verbotenen und vernichteten Schriften u. a. auch als »Evangelien« zu Worte gekommen waren.
Ein Hauch früher kirchlicher Radikalität, wenn es um die »reine« Lehre geht, lässt die Tatsache erkennen, dass 53 »verfemte« Texte nahezu 1600 Jahre in einer Ton-Tonne verborgen, im Jahr 1945 von ägyptischen Bauern gefunden und damit dem geschichtlichen Bewusstsein der Christenheit wieder zugänglich gemacht wurden. Der Mythos von einem uranfänglichen monolitischen Christentum ist sehr schnell, bereits nach anfänglichen kontextualen Studien der Texte geplatzt.
Diese und andere nicht in den Kanon aufgenommene Texte zeigen die Vielfalt der kirchlichen Verkündigung, die zunächst in vielen Teilen des römischen Reiches als Ausdruck einer christlichen, religiösen und politischen Oppositionsbewegung gesehen wurde. Dabei verlangten die Römer nicht einmal, dass Christen ihren Glauben aufgeben sollten. Es gehörte zur Praxis des römischen Imperiums, dass unterworfene Völker ihren eigenen Göttern und Ritualen auch nach der Unterwerfung weiterhin treu bleiben durften. Erwartet wurde allerdings auch von Christen, dass sie die polytheistische römische Göttervielfalt und die Göttlichkeit des römischen Kaisers anerkannten. Der einzige Gott, den die Römer lange Zeit nicht duldeten, war der monotheistische und missionierende Gott der Christen. Erst als die Christen sich weigerten und kompromisslos blieben, verfolgten die Römer die Minderheit, weil sie ihnen auch als eine politische Bedrohung erschien. Es entstand das historische Bild einer staatlich verfolgten Märtyrerkirche. Tatsächlich hat es in den ersten drei Jahrhunderten lediglich vier vom Kaiser angeordnete und organisierte staatliche Christenverfolgungen gegeben: 64 p.Chr. Rom (Brand), um 250 von Kaiser Decius, 257/58 von Kaiser Valerian, 303-305/311-313 von Kaiser Diocletian/Maximinius Daia. Hinzu kamen allerdings einige von Provinzstatthaltern und Gouverneuren auf eigene Faust durchgeführte Pogrome. Insgesamt sind in den drei Jahrhunderten im Zusammenhang mit Verfolgungen einige Tausend Christen grausam von den polytheistischen Römern ermordet worden.
Diese Opfer für die staatliche Anerkennung auf dem Erfolgsweg der religiösen Revolution, stehen in keinem Vergleich zu dem, was in den kommenden anderthalb Jahrtausenden an blutigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden großen Religionen Christentum und Islam, innerhalb der christlichen Konfessionen und bei der Missionierung Amerikas geschah. Im Kampf um die rechte Lehre und für die Durchsetzung des Alleinanspruches göttlicher Herrschaft schlachteten sich Christen gegenseitig zu Millionen ab. Von besonderer Gewalttätigkeit waren die Religionskriege zwischen katholischen und evangelischen Christen, die im 16. Und 17. Jahrhundert ganz Europa überzogen.
Am 23. August 1572 überfielen französische Katholiken, die an die Mit-Wirksamkeit guter Taten glaubten, die französischen Protestanten, die an Gottes allein-wirksame Liebe zu den Menschen glaubten. Innerhalb von 24 Stunden wurden allein bei diesem Progrom, in der sogenannten Bartholomäusnacht, an die 10 000 Protestanten ermordet. Der Papst war begeistert, ließ ein Dankgebet abhalten und beauftragte den Maler Giorgio Vasari, einen Raum des Vatikans mit Darstellungen des Massakers auszumalen. Dieser Raum ist bis heute der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Allein in diesen 24 Stunden töteten Christen mehr Christen als die polytheistischen römischen Machthaber in den Christenverfolgungen der ersten drei Jahrhunderte bis zur staatlichen Anerkennung zusammen.
Man muss sich klarmachen, dass mit der konstantinischen Aufwertung einer kleinen esoterischen Sekte mit jüdischem Hintergrund ein Durchbruch von weltgeschichtlischer Bedeutung geschah. Die Geburtsstunde monotheistischer Religion wird mit dem Jahr 1350 ante Christus benannt, dem Jahr, in dem der ägyptische Pharao Echnaton eine eher unbekannte Gottheit des ägyptischen Götterhimmels, Aten, zum uneingeschränkten Herrscher des Universums erklärte. Diese religiöse Revolution und ihre kultische Praxis fanden ein frühes Ende mit dem Tod Echnatons. Der mit dem Judentum entstandene regionale Monotheismus wurde insbesondere durch die von Paulus konsequent universalistisch interpretierte Jesus-Geschichte zu einem christlichen, universalen Monotheismus, und zwar durch den von ihm formulierten Anspruch auf kosmische Gültigkeit und dessen Durchsetzung über die Missionierung der gesamten Menschheit. Ohne die radikale Modifizierung ökumenischer Vielfalt der urgemeindlichen Verkündigung wäre die entscheidende Voraussetzung für eine Staatskirche nicht gegeben gewesen und der sich seit 313 anbahnende Prozess der Verstaatlichung wäre nicht so schnell und nachhaltig verlaufen.
Die Wirksamkeit der Botschaft lag darin, dass ihre Inhalte durch die Kanonisierung einheitlich und darum auch einfacher in der ethischen und politischen Umsetzung geworden waren. Außerdem wurden mit der einhergehenden Formulierung eines ausführlichen Glaubensbekenntnisses auch selektiv bestimmte Anknüpfungen an jüdische und synoptische Traditionen legalisiert, von denen die Kirche meinte, dass sie der Akzeptanz beim Gegenüber im Verkündigungsvorgang und somit auch der politischen Loyalität dienlich seien. Im Verlauf der Kanonisierung und der Bekenntnisbildung begann auch die dogmatische Festlegung auf ein bis heute weitgehend die biblische Hermeneutik bestimmendes Weltbild, zu dem das Reich des Guten, der Himmel, und das Reich des Bösen, die Hölle gehören, außerdem der Gegensatz von Geist und Materie, Körper und Seele, einschließlich der besonderen Ausgestaltung und Überwindung des Bösen. Die Ur-Landschaft der christlichen Botschaft war eindeutig und einfach für den Einzelnen und die Gemeinschaft definiert.
II. Globale Landschaft: Religionsfreiheit unter staatlicher Kontrolle(Anm. 11)
1. Ausbreitung nach dem 4. Jahrhundert und »Religionsfreiheit«
Zunächst generell zu »Religionsfreiheit«: die Sache stand erstmals auf der »globalen« Tagesordnung der ersten Weltmissionskonferenz 1910 in Edinburgh und die Diskussion fand eine Fortsetzung auf der Weltmissionskonferenz in Jerusalem 1928 mit einer offiziellen Erklärung des Internationalen Missionsrates zur individuellen Religionsfreiheit, ebenfalls 1928. Der 1948 gegründete »Ökumenische Rat der Kirchen« (ÖRK) verabschiedete in seiner ersten Vollversammlung eine »Erklärung über die religiöse Freiheit«. Im selben Jahr 1948 und unter Mitwirkung von Vertretern des ÖRK einigten sich die Vereinten Nationen über die Formulierung der »Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte«. Der Artikel 18 der Charta lautet: »Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.«
Aber erst die 1966 von der UN-Vollversammlung verabschiedeten »Internationalen Pakte« über bürgerliche und politische sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte wurden nach der Ratifizierung durch die Mitgliedsstaaten zehn Jahre später (1976) auch rechtsverbindlich. Die europäische »Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten« (1950) fügte hinzu: »Die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung zu bekennen, darf nur Einschränkungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen sind und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die öffentliche Sicherheit, zum Schutz der öffentlichen Ordnung, Gesundheit oder Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer.« (Art.9, Absatz 2). Diese Konvention wurde 1974 auch von der Schweiz ratifiziert.
2. Entdeckung von «Religionsfreiheit« in der Mission.
Das Recht auf freie Religionsausübung ist also jung und in der Geschichte des Christentums erst spät anerkannt worden. Diese Feststellung schließt auch die allgemeine Zurückhaltung europäischer Kirchen und Theologie gegenüber der amerikanischen Menschenrechtserklärung 1776 und den französischen Menschenrechtserklärungen 1789 ein. Erstmals verwendet der Dominikaner Bartolomé de Las Casas den Begriff der Menschenrechte in einem Schreiben zur Sklavenfrage in Peru 1552. Für die frühen Missionen waren sie kein formales Kriterium, auch deswegen nicht, weil man Menschenrechte bis dahin nur als eine in der rationalen Philosophie der Aufklärung begründete, universale Rechtsforderung verstand. In der Praxis gingen Missionen allerdings immer fraglos von der Voraussetzung der individuellen Freiheit aus, die Religion zu wechseln. Erst die Erfahrung von zwei Weltkriegen, die grauenvolle Missachtung der menschlichen Würde und Rechte durch die Nazis, der stalinistische Terror und die Anwendung von Massenvernichtungsmittel ließen eine verfassungsrechtliche Kodifizierung der Menschenrechte und damit auch der Religionsfreiheit als notwendig erscheinen. Generell bleibt festzustellen, dass die Missionsbewegung des 19. Jahrhunderts, trotz ihrer Zurückhaltung in Sachen Menschenrechten und Religionsfreiheit, allein durch ihre Erfahrung in der Begegnung mit anderen Kulturen und Religionen einen nicht übersehbaren Beitrag zur Entdeckung und Formulierung der Religionsfreiheit als ein universales Menschenrecht erbracht hat.
Der Exekutivausschuss des ÖRK hat sich nach 1948 öfters, meist zu konkreten Anlässen geäußert. Die Vollversammlung des ÖRK in Nairobi 1975 hat die traditionelle Formulierung bekräftigt, d.h. »das Recht, aus freiem Entschluss eine Religion oder einen Glauben zu haben oder anzunehmen sowie das Recht, diese Religion oder diesen Glauben einzeln oder gemeinsam mit anderen öffentlich oder im privaten Bereich, im Gottesdienst, in dem herkömmlichen Brauchtum, in Praxis und Lehre zu äußern.« Hinzu kam ein weiterer Aspekt: »Zur Religionsfreiheit muss auch das Recht und die Pflicht der religiösen Institutionen gehören, die herrschenden Mächte, wo dies notwendig ist, im Einklang mit ihren religiösen Überzeugungen zu kritisieren.«
Die neuere Missionsbewegung hat in ihrer strategisch-universalen Orientierung auf Christianisierung und aufgrund ihrer biblischen und zivilisatorischen Motivation eigentlich nie ein prinzipielles Problem weder mit der »positiven« noch mit der »negativen« Religionsfreiheit gehabt. Für die Missionen relevant ist indirekt oder auch direkt die mit Religionsfreiheit einhergehende Schutz- und Aufsichtsverpflichtung des Staates.
3. Religionsfreiheit als vom Staat geschütztes Menschenrecht
3.1. Staatskirchentum und Religionsfreiheit
Religionsfreiheit als Teil der allgemeinen Menschenrechte gehört sachlich zum antiken wie zum jüdischen Erbe europäischer Tradition. Erste praktische Erfahrungen in der christlichen Verkündigungspraxis fallen bereits in die frühe Zeit der Ausbreitung des christlichen Glaubens durch Laien- bzw. Wandermissionare. In Auseinandersetzung mit zeitgenössischen, religiösen und philosophischen Strömungen entwickelte sich zunächst eine theologische Begrifflichkeit. Dabei gingen Theologen von der Vorstellung aus, dass der Staat der Lenkung durch die Organe der religiösen und im engeren Sinne später auch der kirchlichen Hierarchie bedarf. Diese Zuordnung gestaltete sich zu der Vorstellung einer Civitas dei (Gottesstaat), eines Corpus christianum, in dem der weltliche Arm der Leitung des geistlichen Armes bedurfte. Ein gesetzlich gesichertes Recht auf freie Religionswahl gab es in dieser Konzeption nicht.
Die Entscheidung für die Mitgliedschaft in einer christlichen Gemeinde war wohl von Anfang an eine individuelle, oft folgenreiche Reaktion auf die ganzheitliche Verkündigung. Dies änderte sich mit dem Mailänder Toleranzedikt Kaiser Konstantins, 313 n. Chr. Die christliche Kirche erhielt das Recht der freien Ausübung der Religion und des Kultus. Aus der so geduldeten Religion wurde das Christentum bis zum Jahr 380 die offizielle Religion des mächtigsten Staates der damals bekannten Welt. Rom wurde zum Mittelpunkt der Christenheit. Als 476 die Herrschaft des weströmischen Reiches zu Ende war, übernahm das Frankenreich und später das »Heilige römische Reich deutscher Nation« diese tragende religiöse Grundlage. Das Christentum wurde zur »westlichen« Religion.
Die Entwicklung der Kirche war zunächst ganz anders verlaufen. Paulus, der prominenteste neutestamentliche Missionsreisende, hatte sich mit seiner Verkündigung als hellenisierter Judenchrist auf den ihm bekannten Kulturbereich konzentriert. Die Berichterstattung über diesen Trend hat sich im Neuen Testament niedergeschlagen. Darüber ist die wirkungsvolle Orientierung der jungen Christenheit nach Osten weitgehend verloren gegangen. Dass der Apostel Thomas in Indien gewesen ist, ist keine exotische Legende. Bereits um 100 vor Chr. war der Seeweg vom Ausgang des Roten Meeres über die offene See nach Indien entdeckt worden. Nach vierzigtägiger Fahrt trafen ägyptische und römische Kaufleute an der Küste Indiens die Händler aus dem fernen China. Noch im 1.Jahrhundert nach Christus entstand östlich des Euphrat auf der Grenze des römischen und persischen Reiches in Edessa ein erstes asiatisch-christliches Zentrum. König Abgar IX. trat um das Jahr 200 zum Christentum über und wurde der erste christliche Regent (179-216). Im Jahr 200 wurde auch der erste Bischof Palut von Edessa von einem antiochenischen Bischof geweiht. Edessa wurde zum Missionszentrum in Ostsyrien und im dritten Jahrhundert auch für Persien. 216 bereiteten die Römer dem teilweise souveränen Staat ein Ende.
Um das Jahr 220 hatte das Christentum auch in den östlichen Teilen des Perserreiches eine ansehnliche Verbreitung gefunden. 224 gab es zwischen Kaspischem Meer und dem Persischen Golf über 20 Bischöfe. In dem neu geschaffenen Sasaniten-Reich (224-642) entstand die erste Diaspora-Kirche christlicher Syrer. In den Jahren 484-486 traf die »Kirche des Ostens« eine schwerwiegende Entscheidung. Sie übernahm die Lehre des Nestorius, die auf dem Konzil von Ephesus im Jahr 431 offiziell verdammt worden war. Damit hatte sich die persische Kirche von der universellen Kirche theologisch und demzufolge auch vom römischen Machtanspruch losgesagt. Diese Entscheidung bedeutete eine klare erste Absage an die Identifizierung des Christentums als »Religion des Westens«. Die Synode, zu der rund 40 Bischöfe gehörten, hat bewusst die Verbindung zu den »westlichen« Kirchen abgebrochen, der Patriarch wurde vom Staat anerkannt.





























