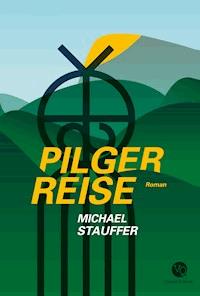Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dass man durch Spekulation über Nacht irre reich, aber auch schnell wieder sehr arm werden kann, ist ein fades Gesetz. Mikka kennt es schon lange. Wenn sie nach der Schule mit Andreas bei seinem Onkel am Pool rumhing, wurde ständig investiert, optimiert, transferiert - aber die Welt ist davon nicht besser geworden, und auch der Pool war eines Tages dahin. Als Studentin der Volkswirtschaft trifft Mikka auf eine Professorin, die das Erstsemester ermuntert: »Macht euch ruhig Sorgen, dass die Menschen aus ihrer ›Alles-muss-wachsen-Welt‹ nicht mehr herausfinden. Erfindet neue Szenarien!« Ja, hat man erst einmal erkannt, dass Geldvermehrung hauptsächlich auf Vorstellung und Vertrauen beruht, kann man sich leicht auch das Gegenteil vorstellen. Mikka ist bereit für das Neue, das ganz Andere, und sie weiß um ihre besonderen Fähigkeiten, die bestimmt mit ihren finnischen Wurzeln zu tun haben. Gemeinsam mit Andreas, der inzwischen bei einer Genfer Bank reiche Kunden betreut, gründet sie Onnepekka Pankki - die Glückspilzbank. Eine Bank, die Geld auflöst. Eine Bank, die wirklich die Welt rettet.Glückspilzbank beschreibt die Wirklichkeit als Groteske. Mit subversivem Humor stellt Michael Stauffer die Grundidee der ständigen Akkumulation von Kapital auf den Kopf und imaginiert die Geldauflösung als nie gedachten Ausweg aus der fatalen Schlaufe, in der die Welt heute steckt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Stauffer
Glückspilzbank
Roman
atlantis
Für Noëlle und Araell
Man kann nicht voraussagen, wie sich ein Mensch entwickeln und verändern wird. Man kann selten dabei zuschauen und dann sagen, aha, deshalb! Es ist immer auch Zufall, was aus jemandem wird, und Glück. Manche überwinden ihren mentalen Jetlag nie. Andere schweifen dauernd ab, driften davon. Ich behielt meine Richtung immer bei. Was mir dabei geholfen hat, war zu wissen: Es ist bei allen gleich. Man ist zuerst ein Mensch, der nichts bedeutet, dann bekommt man einen Namen. Dann tut dieser Name irgendetwas. Danach bedeutet der Name dieses Menschen kurz etwas. Vielleicht tut dieser Mensch dann noch mal etwas anderes, und sein Name bedeutet wieder kurz etwas. Wenn er Glück hat, etwas anderes. Wenn ein Mensch Pech hat, bleibt er stecken. Deshalb vielleicht als einziger Ratschlag: Bleib lieber eine Frage, oder, wenn du es erträgst, gar ein großes Fragezeichen, das sich am Ende mit allem, was es besitzt, in Luft auflöst!
(Mikka Vihuri-Rikkala, Chinle, Arizona, USA2023)
Was für eine Scheiße, wie fad ich leben muss. Manchmal wünsche ich, dass ich kurz die Besinnung verliere und durch einen feinen Riss in der Zimmerdecke einen flüchtigen Durchblick erwische, nur um zu wissen, dass es ihn gibt. Ich brauche keine Erleuchtung, ein kleines Schaudern reicht vollkommen.
Meine Mutter war Verkäuferin in einem fast völlig automatisierten Supermarkt und stand dort den ganzen Tag allein neben 25 Selbstbedienungskassen. Ihre fünf Kolleginnen waren schon lange entlassen worden, der Filialleiter hatte meine Mutter als Engel in diesem Laden behalten. Sie schenkte jedem Kunden die größte Aufmerksamkeit. Sie scherzte mit alten Damen, brachte grimmige Jünglinge zum Lachen und holte offensichtlich Betrunkene oder mit Drogen Zugedröhnte kurz aus ihrer Dunkelheit. Sie konnte Witze erzählen, von denen sie selber nichts wusste.
Meine Mutter nahm mit vielen Menschen gleichzeitig Kontakt auf. Sie konnte problemlos in mehrere Menschen gleichzeitig hineinschauen, und ich lernte, was man alles sehen konnte, ohne auch nur ein Wort mit den Menschen zu wechseln.
Dank ihrer Fähigkeit blieb es im Supermarkt fast immer friedlich. Ich stand tagelang in der Nähe meiner Mutter bei den Kassen, schaute zu, speicherte alles, wurde vor lauter Beobachten fast unsichtbar, fühlte mich wie ein Schwamm, der alles aufsaugt. Alle paar Stunden brachte uns der Sicherheitsbeauftragte etwas zu essen und zu trinken. Wir wohnten fast in diesem Supermarkt.
Zu Hause gab es ein Kinderzimmer und meinen größenwahnsinnigen Vater Felix, der als Buchhalter und Trinker tätig war. Ich glaube, die ersten Lebensjahre und die frühe Kindheit verliefen in einem geschützten, noch halbwegs funktionierenden kleinbürgerlichen Rahmen. Die Errungenschaften des Wirtschaftswachstums wurden miterlebt. Es gab einen reich gedeckten Tisch, Mutter und ich brachten regelmäßig Cremeschnitten mit nach Hause, die nach 16 Uhr aus der Auslage genommen und entsorgt wurden, weil eins der vier Blätterteigblätter etwas eingesunken war oder die Puderzuckerglasur eine Delle hatte.
Wenn mir kalt war, wurde ich von meiner Mutter gewärmt. Wenn ich krank war, wurde ich von ihr, meistens ohne Medizin, geheilt. Meine Mutter hatte mir früh beigebracht, sie nicht nur Mutter zu nennen, sondern auch mal mit »Wer bist du?« oder »Kennen wir uns?« anzusprechen. Am wichtigsten war ihr aber, dass ich mich geborgen und beschützt fühlte und wusste, dass sie mich im schlimmsten Fall immer wieder zusammenflicken würde.
Mein Vater ging an meiner Mutter vorbei zur Arbeit, ohne sich zu verabschieden. Mutter nickte oder winkte ihm beim Fortgehen jedes Mal aufmerksam zu, ohne ein böses Wort zu denken. Ich dachte immer: Du musst nie mehr zurückkommen, du Trinker, du fauler Sack, du armes Schwein, du Pudel, du Nichtsnutz, du Grobian, du Feigling, du Pfeife, du Blinder, du Ignorant, du verantwortungsloser Depp! All das dachte ich, und meine Mutter schaute mich jedes Mal strafend an. »Ich kann hören, was die Menschen denken, das weißt du doch.« Ich schämte mich, und so brachte sie mir bei, wie ich durch den Vater und seine bösartige Oberfläche hindurchsehen und so versuchen konnte, ihm zu helfen. »Es geht nicht darum, dass du ihn ignorierst oder versuchst, ihn wegzudenken, das wäre eine menschenfeindliche Strategie! Das machen schon andere mit ihm. Wenn du durch ihn hindurchsiehst, dann kannst du ihm helfen, ein wenig von diesem schrecklichen Bild, das er von sich selber hat, abzulegen.«
Meine Mutter konnte aber auch noch ganz andere Dinge. An Geburtstagen und Weihnachten machte ich mit meinem Smartphone immer Familienfotos. Wenn Mutter nicht mit ihm auf dem Bild war, wirkte mein Vater fast immer traurig, leer, gehetzt, er sah aus, als würde er unter seinen Kleidern etwas Schlimmes verbergen oder als hätte ihn gerade jemand verprügelt. Wenn Mutter neben ihm stand, änderte sich das alles. Mein Vater sah dann recht freundlich aus, ein bisschen braun gebrannt, glücklich, so als wäre er im Urlaub gewesen. Dafür fehlten meiner Mutter auf diesen Fotos Körperteile. Mal war es ein Stück Arm, mal ein halbes Bein, das nicht zu sehen war. Die Abbildungsfehler konnte niemand erklären. Ich schaltete alle Funktionen, die das Smartphone hatte, ein und aus. Die Lücken, weißen Flecken und Unschärfen bei meiner Mutter blieben ein unerklärbares Phänomen.
Einmal hatte ich auch eine Freundin eingeladen und bat sie, ein paar Fotos von uns als Familie zu machen. Erschrocken zeigte sie mir wenig später auf einer Aufnahme, auf der wir alle drei zu sehen waren, eine Stelle an meinem Kopf, wo ein Teil vom Ohr und von der Stirn fehlte.
Diskussionen mit meinem Vater waren immer langweilig, außer wenn meine Mutter mit im Raum war. Das Einzige, was mein Vater zu bieten hatte, wenn wir allein waren, war Besserwisserei. Alle Lehrer sind faul. Alle Beamten sind faul, außer Polizisten. Handwerker sind alle in kriminellen Kartellen organisiert, Katholiken sind schlimme Lügner, italienische Autos sind super, französische Autos sind für Weichlinge, Pfarrer sind Heuchler, evangelische Pfarrer sind die schlimmsten Heuchler. Wenn etwas schiefging, war immer ich Schuld, aus mir würde nie etwas werden! Und so weiter. Ich gebe zu, dass ich es interessant fand, den Vater so lange zu provozieren, bis er sich mit seiner Besserwisserei selber völlig an die Wand argumentiert hatte und tobend und schnaubend aufgab.
Irgendwann konnte ich voraussehen, wie die Gespräche ablaufen würden, ich wusste, wann die Lautstärke anschwoll, wann der Vater aufstehen, wann er davonlaufen würde, wann Türen zugeknallt würden und so weiter. »Das musst du jetzt halt akzeptieren, dass man mit mir so nicht reden kann«, hatte ich meinem Vater erklärt. Danach hörte ich auf, mit ihm zu sprechen. Meine Mutter hat mich eine Weile machen lassen, dann fasste sie mich an beide Handgelenke und sagte: »Du musst etwas im Umgang mit deinem Vater verändern.«
Mein Kinderzimmer verkam mehr und mehr zu einer Gaststätte für meinen betrunkenen Vater und dessen Freunde. Es wurde geraucht, gefeiert, geprahlt und über andere gelästert. Mein Vater verlor wegen seiner Trunksucht die Arbeit, bekam ein aufgedunsenes Gesicht, eine riesige Nase, Zahnschäden. Er gründete ein Treuhandbüro, und bald verkehrten in unserer Wohnung diverse Figuren aus der Halbwelt. Einer hieß Bienenmann und erzählte, er könne mit Lottospielen und Pferderennen ganz viel Geld verdienen. Ein anderer, Hackebarth, wollte sich mit Edelsteinen eine goldene Nase verdienen. Auch eine Frau tauchte regelmäßig auf, sie hieß Hengstmengel und sammelte von diversen anderen Besuchern Geld ein, führte Listen und zahlte manchmal auch Geld aus. Als ich sie einmal fragte, was sie genau mache, sagte sie zu mir: »Ich nehme das Geld von Männern, die an den Weihnachtsmann glauben. Und dann kommt er nicht.« Frau Hengstmengel zweigte immer wieder kleinere oder größere Summen für mich ab. Einmal schenkte sie mir eine Spielzeug-Fabrikhalle aus Holz. Darin standen viele kleine Holzgalgen, an denen kleine Kerzchen hingen. Die Kerzchen waren schön farbig.
Als das Kinderzimmer wieder einmal mit muffig riechenden Trinkerfreunden überfüllt war, konzentrierte ich mich so lange auf die kleinen Kerzchen, bis eines davon zu brennen begann. Ich bekam Angst, meine Mutter war nicht zu Hause, ich verließ die Wohnung und zog die Tür mit einer Hand im Rücken ins Schloss, schaute nicht zurück, ging weg, wartete. Es kam keine Feuerwehr.
Irgendwann hatte meine Mutter mein Bett aus dem Kinderzimmer ins Elternschlafzimmer getragen und das Bett meines Vaters vor dem Hauseingang auf die Straße gestellt. Ich hatte keine Ahnung, wie sie das alles allein geschafft hatte. Mein Vater lag fast nur noch auf dem Sofa. Er sah aus wie eine tiefgekühlte Statue. Die Stimmung zu Hause war sehr, sehr schlecht, es war, als schliefen vor allen Türen unsichtbare Kühlaggregate.
Ich sagte nie, ich wohne da und da, das ist meine Adresse, da bin ich zu Hause. Wenn jemand nachfragte oder mich besuchen wollte, gab ich einfach zurück: »Und du? Wo wohnst du? Ist es da schön, wo du wohnst?«
Während dieser Phase waren meine Mutter und ich viel draußen und saßen auf einer Parkbank. Ich lernte, wie man direkt mit dem Hirn anderer Menschen Kontakt aufnehmen kann. Meine Mutter zeigte auf jemanden in der Nähe, drehte ihren Kopf in die Richtung, und schon hörte ich einzelne Gedanken dieses Menschen. Wenn meine Mutter mir gleichzeitig die Hand auf den Kopf legte, konnte ich ganze Gedankengänge empfangen, und manchmal hörte ich, was diese Menschen sagten, bevor sie ihren Mund überhaupt aufmachten.
Die Wohnung wurde immer mehr zu einem Ort aus Schatten und Abendlicht, dunklen Wolken, schwarzem Nebel und Regen. Meine Mutter versprach mir: »Du wirst bald ein neues Zuhause mit einem Spielplatz und einem Regenbogen haben, ein Zuhause, in dem Schuhe ganz allein herumlaufen.«
Man hat vierzig Möglichkeiten, was man aus einem Leben machen kann, und mein Vater hatte sich einfach dem Alkohol ergeben und hat sich dann auch von ihm töten lassen. Den Krankenschwestern konnte er nur noch zuzwinkern, die Lippen konnte er nicht mehr bewegen. Pfeifen konnte er auch nicht mehr. Meine Mutter und ich saßen immer nur ganz kurz im Krankenzimmer und empfingen fast gleichzeitig die Gedanken des Sterbenden. »Es ist zu spät, ich bin schon weg, ihr müsst nicht mehr kommen.« Es war schwierig, die Krankenschwestern und Ärzte davon zu überzeugen, dass ihr Patient sich absichtlich zu Tode gesoffen hatte und von ihnen nur erwartete, dass sie ihn endlich sterben ließen. Schließlich übermittelte meine Mutter dem zuständigen Arzt direkt die Gedanken seines Patienten. Am nächsten Tag war mein Vater tot.
Der Arzt bedankte sich mit ganz entspanntem Gesichtsausdruck bei meiner Mutter und sagte: »Ich hatte einen Traum. Es tut mir leid, dass ich es nicht früher verstanden habe!« Meine Mutter lächelte.
Unsere letzte Mahlzeit in der alten Wohnung dauerte nur wenige Minuten, ich hatte das Gefühl, unser Tisch sei so lang wie eine Tiefgarage. Wir aßen selbst gemachten Fleischkäse mit Blumenkohl, redeten nichts. Am einen Ende saß meine Mutter, und ganz weit weg am anderen Ende war ich. Einen Tag später kündigte meine Mutter die Wohnung, und wir zogen in eine WG.
Wir wurden von Andreas begrüßt, der als Einziger zu Hause war.
Mutter wurde die Mutter der ganzen WG. Wir saßen alle auf engstem Raum zusammen. Andreas verliebte sich etwas in mich, und wir kifften ab und zu. In diesem Zustand übten die Tapeten meines Zimmers eine starke Faszination auf mich aus, und ich starrte sie oft stundenlang an. Was Andreas in diesen Momenten tat, weiß ich nicht mehr. Die kleinen Lichter und die ornamental leuchtenden Muster an den Wänden verschwanden meistens nach einer Stunde wieder. Die Heizung in der Wohnung war ein hydranthoher Kasten mit verschiedenen Knöpfen, einer großen Klappe und einem Guckloch. Nachdem ich Holz reingelegt hatte, schaute ich gern und lange in das Guckloch. Die Flamme flackerte und sprach mit mir. Manchmal schrieb ich auf, was sie sagte: »In einer Alles-ist-durcheinander-Wohnung wurdest du geboren. Es war nicht deine Aufgabe, dich mit einem von der Sonne zu wenig beleuchteten Menschen zu beschäftigen, deshalb wohnst du jetzt hier. Hier kannst du viel lernen. Lass dir nichts vorgeben, sei nicht funktional! Wenn du etwas anderes als das, was im Lehrbuch steht, besser findest, sag es!«
Meine Mutter brachte immer wieder Menschen mit, die dann eine Woche in der WG wohnten. Auf die Frage, woher sie die Mitgebrachten kannte, sagte sie immer nur: »Es werden noch viele kommen.« Mir gefiel es in dieser WG sehr gut. Wir waren ein fröhlicher Haufen junger Leute. Manchmal brachte meine Mutter auch Bier mit nach Hause. Einige wurden davon ganz nervös, wie Hühner, und mussten sehr schnell alles auf einmal leer trinken.
Einmal kam ein Amerikaner und machte mit uns eine Übung. Sie hieß: You are not shit. You can change yourself into gold. Dazu mussten wir uns einer nach dem anderen auf den Küchentisch legen. In der rechten Hand hielten wir einen verfaulten Apfel, in der linken Hand einen frischen roten Apfel. Schreiend vor Schmerz mussten wir dann simulieren, dass wir unser altes Herz gegen ein neues austauschen ließen. Dazu bewegte der Amerikaner ein großes Messer über dem Herzen desjenigen, der auf dem Tisch lag, so als würde er gleich auf ihn einstechen.
Meine Mutter arbeitete weiter im Supermarkt, ich ging ins Gymnasium. Bis sie eines Tages sagte: »Mikka, mir wurde heute gekündigt, ich bin froh! Mach dir keine Sorgen. In Neapel gibt es einen Opernsänger, der seit Jahren regelmäßig Geld auf ein Konto überweist! Pack ein paar Sachen für uns ein, wir fahren ihn besuchen.«
Der Opernsänger in Neapel stellte sich mit Renato vor. Er schaute mich an, hielt kurz meine Handgelenke, dann meine Ohren und sagte: »Deine Mutter hat mich immer, wenn ich bei euch war, gefragt, ob ich Neapel hören könne, wenn ich so weit weg sei.« Ich erkannte ihn sofort wieder. Er war ein paarmal zu Besuch gewesen, als mein Vater schon ganztags betrunken war und, weil er bei seinen Saufkumpanen wohl im Koma lag, tagelang nicht nach Hause kam. Renato lachte. Meine Mutter lachte auch. »Weißt du, was er gesagt hat? Wenn man das perfekte Gehör hat, kann man alles hören, also auch jedes Rascheln in Neapel.«
So hatte ich plötzlich wieder einen gesunden, lebendigen Vater, der seit zwanzig Jahren zu Fuß zur Oper ging. Eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde heim fürs Mittagessen, wieder eine halbe Stunde zurück zur Oper und am Schluss wieder eine halbe Stunde nach Hause. Jeden Tag.
Renato hatte Geld für uns gespart, nebenher, wie er sagte. 200000 Franken in all den Jahren. Nach einer Woche Neapel, mehreren Konzerten und viel wunderbarem Essen reiste ich allein in die WG zurück. Meine Mutter blieb bei Renato, das Geld traf ein paar Wochen später auf meinem Konto ein.
Die WG bedauerte, dass meine Mutter nicht mehr bei uns wohnte. Ich wusste auch nicht genau, was ich Andreas alles erzählen sollte. »Meiner Mutter geht es gut. Das muss fürs Erste reichen«, sagte ich etwas unwirsch.
Wenn man eine Teekanne füllt, dann zwei Tassen nimmt und jemanden zum Teetrinken einlädt, dann stellt das Gesellschaft her. Wenn man allein am Tisch Tiefkühlprodukte isst, stellt das nichts her.
Im Gymnasium fiel ich vor allem durch meinen komisch verteilten Ehrgeiz auf. Die Lehrer und Lehrerinnen konnten nicht nachvollziehen, wie es möglich war, dass meine Noten in sämtlichen Fächern völlig unvorhersehbar in alle Richtungen ausschlugen. Einmal, als ein Lehrer mich in seiner Verzweiflung nach meinen schulischen Zielen fragte, sagte ich: »Mit 6000 Stundenkilometern durchs Universum fliegen!«
»Ja, aber bezogen auf deine Zeit an unserer Schule, jetzt hier, aktuell?«
»Auf sich bewegenden tektonischen Platten tanzen, ohne runterzufallen?«
Der Lehrer fand beide Antworten kindisch, Andreas applaudierte und erklärte: »Phantasie ist doch zehnmal wichtiger als reines Wissen. Ihre Logik bringt uns vielleicht von A nach B oder bis zur Matura. Mit Mikkas Vorstellungskraft können wir aber schlicht überall hinkommen.«
Ich spürte, dass Andreas mich beeindrucken wollte, sein endloser Kampf um meine Anerkennung war schön. Wir knutschten manchmal in der Pause im Treppenhaus, manchmal griffen wir uns unter der Schulbank in die Hosen und massierten uns gegenseitig die Geschlechtsteile. Es war immer schön mit Andreas. Ich habe oft auch bei ihm übernachtet, ohne Anfassen. Andreas ließ sich die Haare wie Don Johnson von Miami Vice schneiden, hatte ein Faible für beige Sakkos, die ihm alle an den Armen zu kurz waren. Ich mochte Andreas, weil wir ganz verschieden waren. Ich war an materiellen Dingen wenig interessiert. Andreas legte viel Wert auf seine Erscheinung, redete oft von Ehre, Geld und Ruhm und begann plötzlich mit »Super-Ideen«, wie man ganz einfach und schnell Geld verdienen konnte, im Gymnasium herumzubluffen. Mir sagte das nichts. Ich war aber neugierig, woher dieser Erfolg-Geld-Gewinn-Wind bei Andreas wehte.
Er hatte regelmäßig Sonnenbrand, weil er stundenlang am Pool seines reichen Onkels lag und davon träumte, ebenso reich zu werden. Natürlich wollte ich diesen Onkel kennenlernen.
Beim ersten Besuch durften wir im Büro dabei