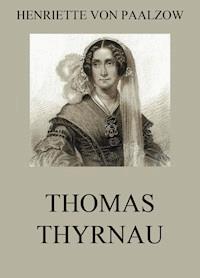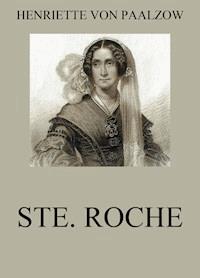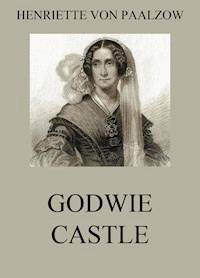
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein historischer Roman, basierend auf Aufzeichnungen der Herzogin von Nottingham.
Das E-Book Godwie Castle wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1082
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Godwie Castle
Henriette von Paalzow
Inhalt:
Henriette von Paalzow – Biografie und Bibliografie
Godwie Castle
Vorwort des Verlegers
Erster Theil
Zweiter Theil
Dritter Theil
Godwie Castle , H. von Paalzow
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849638962
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Henriette von Paalzow – Biografie und Bibliografie
HenrietteP. wurde als das jüngste von drei Kindern des Kriegsrats Wach gegen Ende des vorigen Jahrhunderts (1788) zu Berlin geboren. Der Vater war ein tüchtiger Geschäftsmann, dem die Bildung seiner Zeit nicht fehlte, der aber dennoch an manchen Vorurteilen eigensinnig festhielt und der Bildung und Erziehung seiner Kinder strenge Grenzen zog. So hielt er für seine beiden Töchter die Unterweisung im Lesen und Schreiben und in den weiblichen Handarbeiten für völlig ausreichend und wies jede Sehnsucht derselben, diese eng gezogenen Grenzen zu durchbrechen, mit aller Entschiedenheit zurück. Nur mit dem Sohne, dem später berühmt gewordenen Maler Wilhelm Wach wurde bald eine Ausnahme gemacht und besonders sein auffallendes Zeichentalent frühe schon durch entsprechenden Unterricht unterstützt. Dieser war es denn auch allein, der durch Mittheilungen aus seinem Verkehr mit der Welt und aus den eifrig gesammelten Geistesschätzen den Gesichtskreis der Schwestern erweiterte. So wuchs Henriette, ein mit natürlichen Anlagen und einer reichen Phantasie begabtes Kind, eigentlich in ihr widerstrebenden Verhältnissen auf, obwohl sie sich dieses Missverhältnisses erst spät, und ohne dadurch in der Liebe zu ihren Eltern beirrt zu werden, inne ward; und lediglich aus der eigenen Schöpferkraft einer glücklichen Natur bildete sich im Gegensatz zu jenen Verhältnissen die schwärmerisch bewegte Seele eine Welt, in welcher sie bald heimischer wurde, als in der ihr äußerlich gegebenen, und in dieser Richtung ward sie, da die ältere Schwester sich früh verheiratet hatte, von dem Bruder unterstützt. Beide gaben sich in der vollen Kraft der Jugend einem idealen Leben hin, welches sie für immer von der guten alten Zeit emanzipierte. Eine besondere Quelle des Glücks entsprang für Henriette aus dem Umstande, dass ihr Bruder durch immer bedeutendere künstlerische Leistungen sich auszeichnend, sich damals im Hause des Vaters ein Atelier gründete. Dadurch erhielt sie Gelegenheit, ihre Liebe zur Kunst zu bilden und zu befestigen, so dass dieselbe als ein nicht mehr zu Entbehrendes in ihr Bewusstsein überging. Immer mehr bildete sich auch aus ihr selbst ein entschiedenes Urteil heraus, und ihre von einem auffallenden Scharfblick unterstützte feine Kombinationsgabe lernte bald das Gute vom Mittelmäßigen und Schlechten mit großer Sicherheit absondern. Um diese Zeit lernte die Prinzessin Wilhelm (die ältere) von Preußen unsere Henriette im Atelier ihres Bruders kennen und wurde so unwiderstehlich von der Erscheinung des jungen Mädchens angezogen, dass sie bei jedesmaligem Besuch um die Gegenwart desselben bat. Die Rückwirkung blieb nicht aus. Begeistert für alles Schöne und Hohe, nährte Henriettes Seele eine glühende Liebe zu dieser edlen Frau – und nach und nach befestigte sich in beider eine Zuneigung und wahre Freundschaft, die fürs Leben dauerte, und die auf Henriette einen nachzuweisenden Einfluss bis zu ihrem Tode übte. Das Jahr 1813 sprengte den Freundeskreis unserer Dichterin. Nicht dem Bruder allein drückte sie mit Begeisterung die Waffen in die Hand, der Krieg warf auch die ersten frischen Keime zukünftigen Glückes dem jungen Mädchen zerknickt in den Schoß und begrub die Hoffnungen und Träume einer seligen Jugendzeit. Damals griff Henriette oft zur Feder, um ihren Gedanken Form und Ausdruck zu geben. Aber nichts genügte ihr darin, und was entstand, wurde wieder verworfen. Mit wahrer Leidenschaft dagegen erfasste sie die Musik und, weil ihr da ein guter Lehrer zu Hilfe kam, namentlich das Studium des Generalbasses. Sie machte Fortschritte, komponierte ihre Lieblingslieder ganz meisterhaft und bildete ihre schöne, umfangreiche Stimme zu größter Vollkommenheit aus. In ihrem 28. Jahre heiratete Henriette auf Wunsch ihrer Familie den Major Paalzow. Hatte sie es aufgegeben, selbst glücklich zu sein, so hielt sie es in der Selbsttäuschung ihres edlen Herzens wohl für möglich, andere noch glücklich zu machen. Indes erwies sich dieser Schritt nur zu bald als verfehlt, und nachdem sie mit ihrem Gatten fünf Jahre verbunden gewesen war und während dieser Zeit in Westfalen und am Rhein gelebt hatte, löste sie das Band der Ehe und kehrte zu ihrer Mutter nach Berlin zurück. Nach dem Tode der letzteren bezog sie mit ihrem, damals aus Italien zurückgekehrten Bruder Wilhelm ein Haus, und den Geschwistern wurde so ein Traum ihrer ersten Jugend erfüllt: sie konnten ein gemeinsames Leben beginnen und genießen. Die verwandte Richtung ihres Geistes und Geschmacks gab demselben bald einen Reichthum, über welchen die Wünsche dieser beiden Künstlerseelen nicht hinausgingen. Selbständig und frei, wurde auch ihr äußeres Leben immer mehr ein Abdruck ihres Geistes. Vorzugsweise mit ernsteren Studien beschäftigt, suchte Henriette auch in ihren geselligen Verkehr die Vertreter von Kunst und Wissenschaft hineinzuziehen, und besonders der freundschaftliche Umgang mit Wilhelm v. Humboldt und seiner Familie wurde von beiden Geschwistern mit großer Liebe kultiviert. Nicht also in Kampf und Entbehrung, sondern in harmonischer Ruhe wurde Henriettes Dichtertalent geboren; denn um diese Zeit begann sie, einem inneren Drange folgend, zu schreiben, und der Genuss dieses geheimen Schaffens bildete mehr und mehr den Kern ihres damaligen Lebens. Es entstand, von niemand gewusst und geahnt, ihr erster Roman „Godwie Castle. Aus den Papieren der Herzogin von Nottingham“, mit dem sie zugleich ihre schriftstellerische Tätigkeit abzuschließen gedachte. Eine bedenkliche Krankheit, die im Frühjahr 1835 eine schmerzhafte Operation nötig machte, verschob die Veröffentlichung des Romans bis ins Jahr 1836. Zur Aushilfe ihrer Gesundheit ging die Verf. im Herbst 1836 nach Köln am Rhein, wo sie fast ein Jahr weilte. Hier versuchte sie sich auch in einem Drama „Maria Nadasti“, das sie nur als eine Probe ansah, die sie ihren Fähigkeiten stellte und daher auch nie für die Öffentlichkeit bestimmte. Wider ihren Willen erschien es 1845 in Robert Hellers Taschenbuch „Perlen“ abgedruckt. Nach ihrer Heimkehr gestaltete sich ihr äußeres Leben auf das glücklichste. Die Salons der vornehmen Gesellschaft waren ihr geöffnet, und zuweilen sah sie auch größere gesellige Kreise bei sich, die sich aus den hervorragendsten Künstlern, Dichtern und Gelehrten Berlins zusammensetzten. Dies ganze, unendlich anregende Leben eröffnete ihr wieder eine neue Welt, und sie fühlte, dass ihr Talent mit ihrem ersten Werke doch nicht begraben sei. Bald hatte sie neuen Stoffen neues Leben gegeben, und so erschienen 1839 ihr Roman „Sainte-Roche“ und Ende 1842 der Roman „Thomas Thyrnau“. Nach Beendigung des letzteren vergingen Jahre, in denen die Verf. so krank war, dass jeder Sommer einen langen Badeaufenthalt notwendig machte, und sie nur wenig oder gar nicht zum Schreiben kam. Doch erschien zwischendurch Ende 1844 der Roman „Jakob van der Nees“. Der plötzliche Tod ihres Bruders Wilhelm im Herbste 1845 beugte sie auf das tiefste, und sie fühlte dadurch ihr Leben derartig zerrissen, dass sie meinte, der Schmerz müsse sie vernichten. Dennoch kämpfte ihr Geist noch zwei Jahre gegen die zunehmende Kränklichkeit des Leibes, bis sie endlich am 30. Oktober 1847 im 60. Lebensjahre von dieser Erde schied. – Henriette Paalzows Romane haben eine sehr verschiedene, oft einander gerade widersprechende Beurteilung erfahren, woraus Heinrich Kurz sehr richtig den Schluss zieht, dass die Schriftstellerin weder übermäßiges Lob, noch übermäßigen Tadel verdiene. Sie war weder so genial, wie sie den Einen erschien, noch so talentlos, wie die Andern behaupteten. Diejenigen, welche ihre Romane für historische halten, haben ja recht mit ihrem Vorwurf, dass die Dichterin das geschichtliche Material, das den Romanen zu Grunde liegt, auch nicht annähernd bewältigt habe; aber die Romane der P. sind eben keine historischen, sondern nur Familienromane, da die in ihnen eine Rolle spielenden historischen Persönlichkeiten nur in Beziehung zu Privatverhältnissen erscheinen. Ferner hat die Tatsache, dass die Romane der P. eine besonders bevorzugte Lektüre am preußischen Königshofe bildeten, manchen Kritiker zu dem Urteile Veranlassung gegeben, dass die Dichterin nur für hocharistokratische Kreise geschrieben habe, dass sie in diesen Kreisen allein eine freie und lebendige Entwickelung des rein Menschlichen finde, und das sie nur auf der Höhe der Gesellschaft eine Freiheit von aller Rohheit und allem niederen Treiben erblicke. Aber nichts lag der Dichterin ferner. Wenn sie als bürgerliche Frau aus bürgerlicher Familie in ihren Romanen die Etikette und Konvenienz bis ins kleinste beachtete, so lag dies in ihrer ganzen Erziehung und Charakterbildung; sie hatte eben von Jugend auf nichts anderes gesehen als die strengste Beobachtung der edelsten Formen, und sie hat sich, wie sie selbst bekennt, in den letzteren bewegt, „ohne je zu glauben, dass eine gesellschaftlich höher stehende Klasse dies alles für sich allein beanspruche“. Übrigens lässt sie ja selbst in manchen vornehmen Personen ihrer Romane die gemeinste Gesinnung in Erscheinung treten, wie z. B. im Roman „Sainte-Roche“, der ganz besonders den Kampf zwischen dem rein menschlichen Leben und seiner Korruption in den höheren Kreisen zum Gegenstande hat. Der Erfolg der Paalzowschen Romane lag in erster Linie in der würdigen Haltung und der sittlichen Größe und Reife, welche die Schriftstellerin in jeder Zeile offenbart. Außerdem besitzt sie die Gabe psychologischer Entwickelung, besonders weiblicher Gemüter; ihre Schilderung der Charaktere ist fast immer eine gelungene; das aristokratische Leben in England zur Zeit der Stuarts (in „Godwie Castle“), die französische vornehme Gesellschaft in Frankreich zur Zeit Ludwigs XIV. (im „Sainte-Roche“), die Zustände in Böhmen seit dem 30jährigen Kriege (im „Thomas Thyrnau“) sind mit großer Wahrheit aufgefasst und dargestellt; die Verschlingung der Begebenheiten ist spannend, so dass das Interesse von einer Situation zur andern steigt; die Beschreibung der Äußerlichkeiten, wie der Kostüme, der Toiletten, der Landschaften und besonders auch der Architekturen ist sorgfältig, wenngleich hier oft eine zu große Breite den Eindruck schmälert: alle diese Vorzüge verdecken manche kleinen Mängel und erklären das lange andauernde Interesse, dass vom Publikum den Paalzowschen Romanen geschenkt wurde.
Godwie Castle
Vorwort des Verlegers
Zur ersten Auflage
Die Handschrift des hier im Druck erscheinenden Buches ist aus der Ferne auf eine nicht gewöhnliche Weise in die Hände des Verlegers gekommen, und zwar ohne Namen des Verfassers, der ihm völlig unbekannt geblieben ist. So unwahrscheinlich das vielleicht auch Manchem erscheinen mag, so ist es doch die volle Wahrheit.
Was den Inhalt des Werkes anbetrifft, so werden Leser, die nicht flüchtig, sondern mit Geist und Beobachtungsgabe zu lesen gewohnt sind, die Bedeutsamkeit desselben bald erkennen, und dem Urtheil solcher schärfer und tiefer Blickenden muß es denn auch anheim gestellt bleiben, ob sie das hier Mitgetheilte als wirkliche Erlebnisse und eigentliche Denkwürdigkeiten, oder als Dichtung auffassen und betrachten wollen.
Zur zweiten Auflage
Die günstige Aufnahme, welche dieses Werk bei gebildeten Lesern gefunden, so wie die gleich bleibende Theilnahme des Publikums, machten diese zweite Auflage binnen Jahresfrist nöthig.
Obschon im Wesentlichen nichts verändert, so ist doch eine sorgfältig verbesserte Durchsicht der Sprache, wie der Sachen bei der jetzigen Auflage nicht unterlassen worden.
Die Frau Verfasserin, die zwar dem Verleger gegenüber ihre Anonymität abgelegt, dem Publikum aber nur ihr Werk, nicht ihren Namen darbieten will, wird in der fortgesetzten Theilnahme an demselben gewiß die befriedigendste Genugthuung und einige frohe Lebensstunden mehr finden.
Zur dritten und vierten Auflage
Die neueste Auflage dieses deutschen Dichterwerks, welches im Andenken gebildeter Leser sich forterhält und dessen wiederholte Lektüre den Geistreichsten unter ihnen zum Bedürfniß geworden ist, meint der Verleger nicht besser und würdiger einleiten zu können, als durch den Abdruck jener ersten Recension, welche gleich damals erschien, als das Werk noch kaum bekannt war, und als deren Verfasser Herr Braniß, Professor der Philosophie an der Universität Breslau, sich unterzeichnet hat. Diesem bleibt das Verdienst, der Erste gewesen zu sein, der durch sein tief begründetes Urtheil die hohe Bedeutung von Godwie-Castle anerkannte und klar entwickelte, den Autor, dessen Name noch nicht einmal vermuthet werden konnte, freudigst begrüßte und ihm jenen immergrünen Kranz, der nur Wenigen in diesem Felde der Dichtung zu Theil geworden, zuerst darreichte.
Jene Beurtheilung, welche vor fünf Jahren, am 7. November 1836, erschien, und hier als einleitendes Vorwort wieder abgedruckt ist, wird denkenden Lesern gewiß eine werthvolle Beigabe sein.
»Walter Scott's geistreiche Weise, im Romane Dichtung und geschichtliche Wirklichkeit geschickt mit einander zu verweben, hat mit Recht die Theilnahme der Lesewelt in hohem Grade erregt, und wenn diese Theilnahme jetzt sehr gesunken ist, so mag dies wohl hauptsächlich von den vielen Nachahmern Scottischer Manier herrühren, welche ohne das Talent des geistvollen Britten, doch alle seine Fehler aufgenommen haben. Solcher Fehler giebt es denn freilich auch viele. Jener breiten Detailmalerei nicht zu erwähnen, welche, weit entfernt eine größere Anschaulichkeit zu bewirken, den Leser vielmehr nur seine Unfähigkeit empfinden läßt, alle die kleinlichen Elemente zu einem Gesammtbilde zu vereinen, sei hier nur des großen Mißverhältnisses gedacht, in welchem bei Scott die Dichtung zu dem gegebenen geschichtlichen Stoffe steht. Nur zu sehr in der That läßt der Dichter es uns merken, daß er selbst sich weit mehr für das Historische, als für seine eigene Schöpfung interessirt, und jemehr es ihm vermöge der Lebendigkeit seiner Darstellung gelingt, auch dem Leser ein Interesse für das Geschichtliche einzuflößen, desto dürftiger muß diesem der innerhalb mächtig hervortretender Weltverhältnisse sich abspinnende kleine Liebesroman erscheinen. Ja selbst der von Scott mit großem Erfolg gebrauchte Kunstgriff, durch das geheimnißvolle Dunkel, darein er eine lockere Erfindung so lange als möglich zu hüllen weiß, die Neugier des Lesers in Spannung zu erhalten, dient nur dazu, bei endlich erfolgter Entwickelung um so mehr das Gefühl der Enttäuschung hervorzurufen, indem der lange genährten Erwartung statt einer wichtigen, weitgreifenden Katastrophe, zuletzt doch nichts dargeboten wird, als die Vereinigung eines halbwüchsigen Liebespärchens, an dem sich die großartigsten weltgeschichtlichen Bewegungen verkrümeln. – Unstreitig ist der unmittelbare und wesentliche Stoff des Romans überhaupt das Leben der Familie, wie denn dies in der Romanen-Literatur stets durch die That anerkannt worden ist. Wir erinnern nur an die älteren englischen Romane; und selbst unsere verrufenen deutschen Familiengemälde sind nicht darum so geringhaltig, weil sie das Familienleben darstellen, sondern weil sie es in seiner größtmöglichsten Dürftigkeit auffassen, weil sie die Poesie darin suchen, es aus allem Zusammenhang mit allgemeinen Interessen herauszureißen, und seine ganze Energie auf die ungestörte Erhaltung einer isolirten Existenz hinzurichten; daher denn auch Armuth bei ihnen ein so wichtiges tragisches Motiv ist, und dauerndes Familienglück hauptsächlich durch plötzlich hereinscheinenden Reichthum bewirkt wird. Ein würdiger Gegenstand für die Poesie ist aber die Familie erst, wenn sie der gemeinen Noth des Lebens durch günstige äußere Verhältnisse entrückt, zu keiner Verzichtleistung auf höheren und feineren Lebensgenuß gezwungen ist. Mannigfaltigere Interessen treten dann in ihr hervor, sie selbst öffnet sich dem, was die Welt bewegt, und ohne sich an das öffentliche Leben aufzugeben, nimmt sie doch dessen Wirkung in sich auf, und entwickelt erst so ein in Gesinnung, Karakter und Thatkraft innerlich reiches, wahrhaft sittliches Dasein. Wird nun die Familie in dieser Würde und Bedeutsamkeit Gegenstand dichterischer Produktion, so kann sie nur entweder in bestimmten allgemeinen Beziehungen zu den Mächten des geschichtlichen Lebens festgehalten werden, – wie z. B. der edle Familienkreis, in welchen Wilhelm Meister uns einführt, an Kunst, weltbürgerlicher Erziehung und großartiger Industrie die Bezüge hat, die ihn der Geringheit und Dürftigkeit eines blos selbstischen Familieninteresses entreißen – oder es muß eine bestimmte, im Leben eines Volkes bedeutsame, geschichtliche Zeit sein, in die der Dichter uns versetzt, und die er am Familienleben reflektirt zu unserer Anschauung bringt. Eben dieser letztere Gedanke liegt nun auch den Scottischen Romanen zu Grunde, konnte in ihnen aber freilich nicht genügend zur Ausführung kommen, weil Scott die Familie durch die allgemeinen Interessen völlig bewältigt, weil er uns nicht die Geschichte durch die Familie hindurch, sondern umgekehrt die Familie nur in der Geschichte, sei es nun als thätiges Organ derselben, oder als leidenden Spielball der Ereignisse erblicken läßt. Es liegt zwar auch in dieser Fassung eine Wahrheit, eine solche jedoch, zu der wir des Dichters nicht bedürfen, die uns die Geschichte selbst auf allen ihren Blättern lehrt. Jene unvergängliche Seite der Familie dagegen, welche alle geschichtlichen Kämpfe und Wirren überdauert, jene in allem Wechsel des mannigfach bewegten öffentlichen Lebens sich unveränderlich erhaltende stille Macht der Liebe, Treue, Innigkeit und heiligen Vertrauens ist es, welche schon an sich gediegene Poesie, auch für die dichterische Behandlung ein unerschöpflicher Stoff ist. Wie trefflich nun dieser Stoff, wenn ein Meister ihn behandelt, sich gestalten läßt, zeigt das Werk, auf welches aufmerksam zu machen, der Zweck dieser Zeilen ist.
Wir werden durch Godwie-Castle mit einer englischen Familie bekannt, deren hoher Rang sie von alter Zeit her in nahe Beziehung zu den Herrschern des Landes gebracht, und zur Theilnahme an der Leitung des Staats berufen hat, so daß die Schicksale des Hauses vielfach durch den Gang der öffentlichen Angelegenheiten, und durch innigere, persönliche Verhältnisse zur Königsfamilie bestimmt werden. Die Personen, die wir kennen lernen, haben an dem Hofe der Königin Elisabeth und ihres Nachfolgers eine bedeutende Stellung eingenommen, und die vertraute Freundschaft zwischen dem Haupte der Familie und dem Prinzen von Wales führt Verwickelungen herbei, welche auf das sonst ungetrübte Familienglück einen düstern Schatten werfen, der sich erst spät zerstreut. Ueber die Begebenheiten selbst enthalten wir uns jedes Berichts, und bemerken von ihnen nur, daß sie ganz geeignet sind, die Theilnahme der Leser in hohem Grade in Anspruch zu nehmen. Desto angelegentlicher möchten wir die poetische Trefflichkeit des Werkes hervorheben. In der That sind darin alle oben an Scott gerügten Fehler auf das glücklichste vermieden. Viele höchst interessante historische Momente treten uns zwar darin entgegen: das letzte Lebensjahr Jakobs des Ersten, der sinnlose Uebermuth seines Günstlings Buckingham, die Verhandlungen wegen der Vermählung des unglücklichen Prinzen Karl, Burleigh's und Bristol's gewandte, aber in aller Staatsklugheit den Adel der Gesinnung bewahrende Politik in ungleichem Kampfe mit Richelieu's schleichenden auf Hofintriguen, Weibergunst und Jesuitismus sich stützenden Machinationen – alles dieses und dem ähnliches führt der Verfasser mit dramatischer Anschaulichkeit unsern Blicken vorüber. Dennoch hält er es mit großer Besonnenheit so sehr als möglich im Hintergrunde, und läßt es nur so weit hervortreten, als es unmittelbar auf die Nottingham'sche Familie einwirkt, für welche er unser Interesse ungetheilt in Anspruch nimmt und erhält. In das Stammschloß derselben versetzt er uns gleich beim Beginn der Erzählung, und entfaltet vor uns dessen mannigfach kombinirte, den großen Sinn seiner Besitzer aussprechende Architektur mit so bewundernswürdigem Talent, so ungetrübt von jener das Auge verwirrenden antiquarischen Pedanterie, in welche bei solchem Anlaß Scott so leicht verfällt, daß wir darin völlig heimisch werden. Und welchem herrlichen Menschenkreise begegnen wir darin! Die alte Herzogin, eine wahrhaft verklärte, von keinem Erdenschmerze mehr berührbare Gestalt, auf ein abgeschlossenes inhaltreiches Leben mit dem Frieden eines schönen Bewußtseins heiter zurückblickend, und jetzt nur noch in der Liebe zu den Ihrigen lebend. Ihr zur Seite die jüngere Herzogin, ein tief leidenschaftliches, von einem großen Schmerz umnachtetes Gemüth, dessen Heftigkeit dennoch stets von hoher Willenskraft gebändiget, nur um so rührender die Fülle von Liebe, die es einschließt, und um so schöner die Stärke einer edeln Gesinnung offenbart. Wir müssen es uns versagen, diese andeutende Karakteristik fortzusetzen. Gleich den genannten Personen sind auch die übrigen, bis zur jüngsten Enkelin, welche in ihrer Kinderunschuld das anmuthigste Gegenstück zu der herrlichen Großmutter bildet, scharf individualisirt; wie verschieden aber auch in Karakter und Lebensrichtung, sind sie doch durch gegenseitige Liebe und Anerkennung, durch das Alle erfüllende Bewußtsein der Familienehre und einen für Gemeines unnahbaren Seelenadel zur schönsten Einheit und zu einem sittlichen Gesammtleben verbunden, in welches hineinzublicken Genuß und Erhebung zugleich ist. Die schönste Zeichnung freilich ist die junge Fremde, an deren Erscheinen in Godwie-Castle sich viel Lust und Leid knüpft. Der Verfasser hat die Fülle von Liebreiz, die er über diese Gestalt ausgegossen, zugleich so durchsichtig für die ihr einwohnende hohe Seelenschönheit zu halten gewußt, daß die herzgewinnende Macht, die sie über ihre Umgebung ausübt, gewiß auch jeder Leser erfahren wird. Das liebe Mädchen muß viel leiden, so viel, daß wir mit dem Verfasser darüber rechten könnten, warum er sie über manche Widerwärtigkeit nicht sanfter hinweggeführt hat, wenn wir nicht wüßten, einmal daß im Romane der Zufall sein Recht unbeschränkt behaupten müsse, und zweitens vornehmlich, daß gerade in jenen Schmerzen die größere Liebe des Dichters zu seinem Geschöpf sich kundgiebt, welcher allein wir eine so lebenswarme Zeichnung verdanken. Seltsam genug, daß im Reiche der Poesie der Satz gilt: was der Dichter liebt, läßt er leiden. Dies zu belegen, braucht man nicht gerade an Heinrich Kleist zu erinnern, der seine Lieblinge förmlich quälen kann, selbst Göthe darf dafür angeführt werden; denn ruht nicht z. B. unter allen im Wilhelm Meister auftretenden Personen des Dichters Liebe vorzugsweise in Marianen und Mignon? Es sind diese beiden Gestalten aber auch die schönsten unter allen, wie sie die leidvollsten sind. So wollen wir denn auch unsern Verfasser dieser Dichterneigung ungestört folgen lassen, und statt unbefugt zu tadeln, lieber auf eine besondere Virtuosität desselben aufmerksam machen. Dies um so mehr, weil er sich in so strenge Anonymität zu hüllen gewußt hat, daß selbst dem Verleger, wie ein Vorwort berichtet, sein Name völlig unbekannt geblieben ist; ein kluger Leser, der sich aufs Rathen legen will, mag vielleicht dadurch einen Fingerzeig erhalten. Es versteht nämlich der Verfasser nicht nur Gemälde mit der größten Gewandtheit und in anschaulichster Klarheit zu beschreiben, sondern er giebt auch von einzelnen Gegenständen so pittoreske Darstellungen, und liebt es besonders, ganze Scenen in so bestimmter anmuthiger Gruppirung zu einem Leben athmenden Tableau zu gestalten, daß er sich als einen in die Geheimnisse der Malerkunst tief Eingeweihten verräth. Wir selbst wollen uns durch diesen Fingerzeig nicht zum Rathen verführen lassen, sondern uns nur des Trefflichen freuen, das die Kunst des Verfassers in dieser Beziehung uns dargeboten hat. Ein Talent, wie der Verfasser es hier zeigt, und wie wir es in anderer Weise an Göthe und Tieck kennen und bewundern, läßt es recht inne werden, daß, wie die Malerei in ihrer großen längst abgeschlossenen Zeit die Poesie in sich trug, so umgekehrt die mündig gewordene Poesie die Malerei einschließt. Und so mag man es wohl als einen richtigen Takt bezeichnen, wenn eine berühmte deutsche Malerschule unsrer Zeit sich so gern an die Dichter lehnt und ihnen in ihren Darstellungen nachstrebt; wiewol es immer eine bedenkliche Frage bleibt, wozu doch das Streben nach einem bereits Erreichten führen könne, nach einem Erreichen zumal, welches für dieses Streben ein Unerreichbares ist; denn für eine Anschauung oder Empfindung, die der echte Dichter bereits gestaltet, und der er am Worte einen geistigen, helldurchsichtigen Leib gegeben hat, sind selbst Farbe und Klang zu stoffartige, trübe Darstellungsmittel. Sei dem nun wie ihm wolle, wir, die wir nichts von der Berliner Kunstausstellung abbekommen, wollen uns an unserm Lesepulte der herrlichen seelenvollen Bilder, welche der Dichter von Godwie-Castle uns vorführt, dankbar freuen.
Unerwähnt darf nicht bleiben, daß der Verfasser, was ihm sehr hoch anzurechnen, es in echter Dichtervornehmheit vorschmäht hat, den Leser mit der Auflösung der räthselhaften Begebenheit, die den Inhalt des Buches bildet, in beliebter Scottischer Weise möglichst lange hinzuhalten, und so durch Spannung einen vorübergehenden Effekt zu erzielen. Schon am Anfange des zweiten Theiles erhalten wir diese Auflösung, und wenn der Verfasser, wie er selbst sehr schön sagt, es vorgezogen hat, den Leser lieber »in die Stimmung eines besorgten Freundes zu versetzen, der die Gefahren kennt, wie sie zu vermeiden wären, weiß, und doch außer Stand gesetzt ist, schützend oder warnend einzuschreiten« – so ist es ihm mit der Erzeugung dieser Stimmung bei dem Referenten wenigstens vollständig gelungen.
Die Sprache des Verfassers hat viel Eigenthümliches; ein sehr kompakter Periodenbau, in welchem durch eine zuweilen etwas ungewöhnliche Wortstellung ein klingender Rhythmus sich bemerkbar macht, der oft nahe an den Vers streift, zeichnet besonders die beiden ersten Theile aus. Im dritten läßt die auf den Ausdruck gewandte Sorgfalt merklich nach; einzelne Stellen verrathen Eilfertigkeit, auch Inkorrektheiten laufen mitunter. Diese letzteren indeß zu rügen fällt dem Referenten gar nicht ein, vielmehr freut er sich über so eine Inkorrektheit, wie Tischbein über den Esel. Es ist nämlich in unsern Tagen nichts so wohlfeil geworden, als ein sogenannter guter Stil; Alles besitzt ihn, ja je bornirter einer ist, desto besser handhabt er ihn; eine geleckte, geschwätzige, in bestimmter fertiger Phraseologie glatt und ohne Anstoß wie auf einer Chaussee dahinrollende Redeweise ist völlig zum Gemeingut worden. Weil denn nun Alle einen guten Stil haben, und zwar Alle den nämlichen guten Stil, so steht zu befürchten, daß darüber aller Stil zu Grunde gehe, der nämlich, von dem es heißt: le style ce'st l'homme! Ein bedrohliches Zeichen, daß wir uns wirklich dem glänzenden Elend der Klassicität nähern, womit für eine Nation doch nichts anders gesagt wird, als daß sie in ihrer Literatur das Bewußtsein einer großen Vergangenheit ausspricht, ohne eine über sich hinausragende Gegenwart zu haben. Mußten wir ja sogar erst kürzlich, und zwar aus der Mitte des weiland jungen Deutschlands heraus, ein Liedchen singen hören, daß die graue Nebelgestalt des alten Ramler mit den berufenen Wappenschildern von klassischem Muster, Korrektheit, Geschmack u. s. w. aus ihrer Vergessenheit heraufbeschwört. Solcher Richtung gegenüber muß man es noch für ein günstiges Symptom halten, wenn der herrliche Göthe nicht allgemein anerkannt, ja wenn er verunglimpft wird; besser so, als daß er, was von einer andern Seite her in kurzsichtiger Aesthetik geschieht, zum Musterpoeten verknöchert wird. Es hat indeß mit der Klassicität keine so große Gefahr, so lange es noch Ludwig Tieck
Der Tag neigte sich zu Ende. Leichte Nebel stiegen aus den Thälern und verbreiteten eine seltene zauberische Beleuchtung, indem sie die Strahlen der Sonne, welche einen warmen Frühlingstag verklärt hatten, sanft verhüllten. Wer hätte nicht der Natur Momente abgelauscht, wo die wunderbare Gestaltung der Wolken oder das durch Nebel gebrochene Licht so phantastische Erscheinungen hervorruft, daß wir uns an die reizenden Fabeln erinnert fühlen, denen wir schon im Schooß der Wärterin horchten, und die mit ihren goldnen Bäumen auf Wiesen von Smaragd, ihren Palästen von Rubin und Edelstein, ihren Ursprung in nichts Anderem, als in solchen zauberischen Naturgemälden, gehabt haben mögen.
Die weite Aussicht von dem Standpunkt, an den wir hier unsere Mittheilungen hauptsächlich anknüpfen, zeigte eine entzückende Vereinigung erhabener und lieblicher Naturgegenstände, und das Auge konnte von keinem unbefriedigt zurückkehren.
Wir befinden uns in dem schönsten Theile der Grafschaft Nottingham, zwischen Chesterfield und den anmuthigen Höhen von Cheffield. Hier lag das Stammschloß der Grafen von Derbery, Herzöge von Nottingham, und bildete mit seinen weitläuftigen Wäldern und reizenden Thälern den vornehmsten Theil dieser Gegend, indem es zugleich ein prächtiges und ausgezeichnetes Denkmal verschiedener Jahrhunderte mit ihrem fortschreitenden Geschmack und erweitertem Bedürfniß darstellte. Es brachte seinen alten Namen, Godwie-Castle, aus einer so grauen Vorzeit herüber, daß selbst das alte Geschlecht, das sich jetzt seine Besitzer nannte, es nicht wohl erweisen konnte, ob es einen ihrer fernen Urväter als Erbauer des eigentlichen Castells nennen dürfe, das mit seinen von der Zeit fast spurlos verwischten Wappenschildern alle Bemühungen der Heraldik vereitelte. Nicht weniger aber ward es mit einer Sorgfalt geehrt und erhalten, von der es zweifelhaft blieb, ob sie der Verehrung für die früheste Periode der Baukunst angehöre, oder dem schmeichelhaften Glauben an einen bis in die graueste Vorzeit reichenden Besitz. Gewiß blieb es aber, daß die Vergrößerungen des Schlosses, die eben so vielen verschiedenen Zeiten, als Besitzern, angehörten, stets mit einem schonenden Rückblicke auf die erste, wenn auch rohe, doch von Ausdehnung zeugende Anlage unternommen wurden. So war, von dem frühesten Bedürfniß, nur eine gesicherte Wohnung zu besitzen, bis zu der freieren Existenz in einer Zeit, die, durch öffentliche Sicherheit, Reichthum und vorschreitende Bildung, das Schöne und Angenehme forderte und zuließ, ein überall beabsichtigter, wenn auch oft schwer zu erreichender Zusammenhang unter den verschiedenen Bauwerken beobachtet worden. Das Castell, das so als der älteste Theil bezeichnet ward, lag an dem Rande einer Höhe, die unfehlbar in früheren Zeiten einen Theil der Befestigungen getragen hatte und den späteren Besitzern, welche hier nur unscheinbare Trümmer vorfanden, den weiten Raum für ihre großartigen Anlagen gab. Das Castell war noch immer der Eingang zum Schlosse geblieben, und allerdings dazu durch den Ernst und die Größe seiner Formen und die überall noch sichtbaren Befestigungen sehr geeignet. Die breiten geebneten Wege, die das Thal und den Wald in verschiedenen Richtungen durchschnitten, liefen in dem weiten grünen Raume zusammen, der sich vor den Befestigungen ausbreitete und gegen Norden hin von dem prächtigen Walde in einem Halbkreis umschlossen ward. Die wasserreichen Gräben mit ihren grünen Wällen und befestigten Brücken schienen noch jetzt einer kriegerischen Macht jeden Widerstand bieten zu können, doch blieb dem gründlicheren Beobachter nicht lange verborgen, wie diese schirmenden Wälle und Gräben sich sanft hinter der Hügelreihe in den schönen Wiesengründen verloren, die dem Thal nach Süden hin mit dem Zauber der Kultur eine bessere Aussicht auf Schutz und Sicherheit gewährten. Von dort aus zogen sich die Meiereien und ländlichen Wohnungen der Fischer und Waldheger, welche zerstreut angebaut waren, in einem Kreise um den Park, der nach Abend hin einen See umschloß. Die größte Ausdehnung hatte dieser nach Norden und verband sich dort mit dem Walde, der bis dicht an die Terassen des Schlosses seine mächtigen Häupter trug und, durch roh in Stein gehauene Stufen damit verbunden, theilweis zu den Park-Anlagen benutzt war.
Noch immer unterhielt man auf den verschiedenen Brückenthürmen Wächter, welche die Ankunft von Fremden aus der Ferne schon durch den Ruf ihrer Hörner verkündigten. Aber an die grauen Thürmchen mit ihren Schießscharten und Fallgattern lehnten sich freundliche Hütten; und blühende rothwangige Kinder, in trauter Gemeinschaft mit den zahmen Bewohnern des Waldes, die die grünenden, von der Sonne beschienenen Wälle gern zu ihren Futterplätzen ersahen, schienen die einzige streitbare Macht dieser ersten Festungslinie. Doch überschritt wohl keiner die letzte Brücke, ohne einen Augenblick zu weilen und den Ueberblick zu genießen, der diese großartige Architektur zugleich als eine interessante Geschichte der Baukunst darstellte.
Den Eingang zum Castell erreichte man über eine Zugbrücke, die unmittelbar in ein hohes gewölbtes Thor führte, das von zwei sonderbar gewundenen und mit Gallerien verbundenen Thürmen gehalten ward. Man hatte alsdann den Schloßhof erreicht, und dem Eingangsthor gegenüber zeigte sich die schönste, wenn auch nicht die älteste Seite des Castells. Sie gehörte einer spätern Zeit und schon bestimmt der gothischen Baukunst an; aber sie war – durch welche Begebenheiten, blieb unentschieden, – in ihrem oberen Ausbaue der Zerstörung am meisten anheim gefallen und zeigte nur noch die unteren Räume erhalten, die in drei hohen gewölbten Hallen bestanden und den Durchgang nach dem zweiten Schloßhof bildeten. Mit angenehmem Erstaunen sah man sich von hier aus dem prächtigen Wohngebäude gegenüber, das, mit allem Glanz seiner stets reichen Besitzer in dem reinsten Style errichtet, den wohlthuenden Eindruck hervorrief, als ob man die Herrschaft des Schönen unter dem Schutze civilisirterer Zeiten hier aufgeblüht sähe.
Das Schloß lag auf dem höchsten Punkte und daher höher, als das Castell, und der Schloßhof führte in breiten gemauerten Wegen die leichte Anhöhe hinan. Die Hinterseite des Schlosses lag auf der Terrasse ausgebreitet, welche von da zu dem Parke führte. Hier, von der Gartenseite aus, gewahrte man den neuesten Anbau, unter dem Großvater des letzverstorbenen Herzogs entstanden, und zwar nach seiner Rückkehr aus Italien von einer Gesandtschaft an Sixtus den Fünften, wohin ihn Elisabeth gesendet, während ihrer kurzen Freundschaft mit dem heiligen Stuhle.
Der Erbauer hatte hier den Geschmack seiner Vorfahren am meisten beeinträchtigt. Italien hatte seine Phantasie mit Bildern entzückt, die keinen Raum auf dem vaterländischen Boden fanden. Kunstwerke jeder Art waren ihm gefolgt; aber die hohen gothischen Gemächer des alten Stammschlosses, mit ihren schmalen spitzen Fenstern und dem ungewissen Lichte der in tausend Farben spielenden Scheiben, war kein Aufenthalt für die Marmorbilder, die man aus ihren heiteren Säulenhallen weggeführt, noch für Kunstwerke des Pinsels, die vergeblich eine Gemeinschaft suchten an den mit Zierrathen überladenen Wänden, wo, nächst zahllosen, in Stein und Marmor gehauenen Wappenschildern, nur die düsteren Ahnenbilder, aus der Kindheit der Kunst herstammend, zu ihnen niederstarrten. Die hierdurch erregte Besorgniß des Herzogs um seine Lieblinge löste sich bald im fröhlichen Gefühl ungemeiner Mittel, und er gab ihnen in einem neuen Flügel hinter hellen Scheiben und luftigen Kuppeln die Heimat wieder, so weit dies unter Englands Nebelhimmel möglich war.
Nahm der italienische Flügel vom Hauptgebäude aus den nördlichen Theil der Terrassen ein, so hatte dagegen die Gemahlin des Herzogs, eine Gräfin aus dem Hause Devereux, an der anderen Seite der Terrasse nach Süden eine Kapelle aufgeführt, die deutlich die Einwirkung zeigte, welche der Geschmack des Herzogs durch den Aufenthalt in Italien davon getragen. Aber es war auch nicht zu läugnen, daß man sich hier von dem unreinen Geschmack berührt fühlte, der später seine Verwirrung der gothischen und griechischen Baukunst über halb Europa ausbreitete. Dessenungeachtet diente auch diese weit aus der Erde gehobene Kapelle, mit ihren schönen Portalen, herrlichen Treppen und im blumenreichsten Schnitzwerk prangenden Fenstern, nicht minder zu einer Verherrlichung des Ganzen. Es führten von hier sanfte Wege ab in die angebauten Thäler, deren Bewohner sich auf denselben nach der Kirche begeben durften. Die Kapelle war durch den südlichen Thurm unmittelbar mit dem Schlosse verbunden. Der untere Raum desselben ward die Begräbnißkapelle genannt, weil darunter sich die Familiengruft befand und der Raum darüber vor Erbauung der neuen Kapelle zum Gottesdienst gebraucht ward. Dieser fast leere Raum grenzte an die fürstlichen Hallen, die in drei Abtheilungen sowohl die Tiefe als Länge des ganzen Schlosses einnahmen. Nur um den Eingang von dem Schloßhof her zu trennen und die breiten Treppen nach den obern Gemächern zu führen, war der mittlere Saal durch prachtvolle Gitter und die Decke tragende Pfeiler getheilt. Trotz seiner ungeheuern Größe und seiner verschwenderischen Ausstattung ward er weniger geachtet, und bei feierlichen Gelegenheiten mehr als stillschweigend gestatteter Tummelplatz der höheren Schloßbeamten und der zahllosen Dienerschaft angesehn.
Dagegen waren die daranstoßenden Säle mit einem überraschenden Glanze geschmückt, und trugen den ganzen Stolz ihrer fürstlichen Bewohner und allen Luxus, den England damals aufzuweisen wußte, ergänzt durch Italiens Schätze und den Kunstfleiß der vorschreitenden Niederländer, zur Schau.
Statt der Fenster öffneten sich weite Thüren nach den Terrassen hin, die, gegen die Annäherung der verschiedenen Thiere des Waldes durch goldene Gitter geschützt, Luft und Licht gar anmuthig einließen, und bei unfreundlicherem Wetter häufig zu den regelmäßigen Spaziergängen der Frauen benutzt wurden; wie denn jene Säle überhaupt allem gemeinschaftlichen oder öffentlichen Verkehr der Schloßbewohner gewidmet waren.
Die Fürsten gaben hier ihren Unterthanen oder dem Adel der Grafschaft Audienzen. Hohe Gäste wurden hier bewirthet, die fürstliche Jugend mit ihren Gespielen trieb hier ihre verschiedenen Lustvarkeiten; Familienfeste und Zusammenkünfte, in guter Jahreszeit das allgemeine Frühstück und die Tafel, Alles ward hier abgehalten; bis zu den pomphaften Leichenbegängnissen dieser Familie, welche mit ihren strengen Ceremonien den Saal zunächst dem Erbbegräbniß füllten. Dagegen schloß der nördliche Thurm im Erdgeschoß die prächtige Bibliothek in sich, und durch sie gelangte man zu den schönen Marmorstiegen, die den italienischen Flügel sogleich als das Kind einer fremden Zone ankündigten, welcher seit dem Tode des Erbauers, der ihn nie mehr verließ, die stete Wohnung der Herzöge blieb.
Die Zimmer, welche die Herzoginnen bewohnten, hatten jedoch, obwohl die alterthümliche Urgestalt weder entfernt werden konnte, noch sollte, nach und nach Umgestaltungen erlitten, welche zu ihrer ursprünglichen Pracht noch das Schöne und Angenehme fügten; und wenn wir den ferner liegenden Waffensaal und den der Ahnenbilder, den man noch immer die Gallerie nannte, abrechnen, boten diese Zimmer zugleich einen schönen und imposanten Anblick dar. Das Schlafzimmer der Herzoginnen war im südlichen Thurm und von der Erbauerin der Kapelle durch einen verhüllten Eingang unmittelbar mit dem Chorstuhl verbunden, den die Herzoginnen darin einnahmen. Außerdem waren unter dem letzt verstorbenen Herzoge für den Prinzen von Wales, welcher in naher Verbindung mit ihm stand, eine Reihe Zimmer eingerichtet, eines so hohen Besuches und so freigebigen Wirthes gleich würdig, welche, wenn auch nur selten geöffnet, doch stets für die vornehmsten Gäste ihre Bestimmung behielten. Alle Theile des Schlosses waren, wenn auch mit einem großen Aufwand an Raum, außerdem bewohnt, denn es gehörte zu dem Luxus damaliger Zeit, außer der höheren Dienerschaft beider Geschlechter noch einen unübersehbaren Troß geringer Dienstleute zu besitzen. Der argwöhnischen Politik der Königin Elisabeth war es zwar nach und nach gelungen, die eigentliche bewaffnete Dienerschaft ihrer Großen zu entfernen, die freilich fast jedes befestigte Schloß zu einer kleinen Festung umschufen, doch war kaum etwas Anderes erreicht, als daß die Waffen in den Rüstkammern hingen, und diejenigen, die sonst darin geübt murden, jetzt noch unnützer und geschäftsloser umherschweiften. Die nach Außen und Innen friedlichen Zeiten hatten diese frühere Gewalt auch von selbst ihres Werthes beraubt, denn entlassen waren diese zahllosen Bedienten nicht, und Herr und Diener sahen diese Schwelgerei unbeschäftigter Vasallen als einen nothwendigen Tribut an, den sie der Hoheit ihres Standes brachten. Doch war dieser Brauch, der in die Häuser der meisten Großen den Geist der Unordnung und Zügellosigkeit brachte, hier auch in Grenzen gewiesen, die in Uebereinstimmung standen mit der hohen sittlichen Strenge ihrer Oberhäupter. Geprüfte Personen, an Bildung und Rang über die Dienerschaft erhaben, sorgten in den verschiedenen Abtheilungen dieses weiten Palastes für die Befolgung der strengen Vorschriften, welche diese Schwelger in Ordnung hielten, und waren mit hinreichender Gewalt bekleidet, um ihren Geboten Nachdruck zu geben. So glich das Schloß mehr einem kleinen, wohlgeregelten Staate, worin durch Pflichttreue und Fähigkeiten Erhöhung zu erlangen, und der Dienst im Schlosse, endlich in den Gemächern der herzoglichen Familie, ein Gegenstand war, um den sich der Ehrgeiz der Schloßdienerschaft drehte; denn grenzenlos war die Verehrung für ihre großmüthigen und erhabenen Herren, durch deren Glanz sie sich selbst über die Klasse ihres Standes erhoben wähnten.
Fast theilte England die Meinung der Vasallen. Das Geschlecht der Herzöge von Nottingham hatte durch Jahrhunderte einen seltenen Rang behauptet, in der Geschichte des Vaterlandes sowohl, als in der öffentlichen Meinung, die über Tugend und Karakter entscheidet; und es war um so höher zu verehren in den unruhigen Zeiten, welche die Inkonsequenz der Beherrscher über dieses so lange den schrecklichsten Parteiungen hingeopferte Land herbeigeführt hatte.
War das Schicksal auch nicht, ohne Opfer zu fordern, an ihrer Schwelle vorüber gegangen, das Höchste war ihnen geblieben: eine feste Behauptung edler Gesinnung! Nicht dem thörichten Wankelmuth zum Raube, der England seit Heinrich dem Achten zum religiösen und politischen Spielball seiner sich stets widersprechenden Könige machte, blieben sie treu ihren Unterthanspflichten, aber bei freier Bewahrung religiöser Ansicht, und zugleich in Milde und Duldung gegen anders Denkende. So wurden sie nie in die unseligen Kriege und Zwistigkeiten verwickelt, die, der Natur und ihren heiligen Gesetzen Hohn sprechend, die Bewohner eines Landes, oft eines Heerdes zu blutiger Verfolgung für einen Glauben bewaffneten, dessen kaum Einer unter Tausenden sich klar bewußt war! Sie hatten in einer ruhmvollen Reihefolge den Feinden nach Außen sich gegenüber gestellt, die Verläumdung scheiterte an ihren patriotischen Opfern für Englands Beschützung, während an auswärtigen Höfen zu allen Zeiten die oft wiederholten Sendungen geistvoller Männer dieses Hauses achtungsvolle Aufnahme fanden.
Zur Zeit der Reformation warb Ortmar, Graf von Derbery, um die Prinzessin von Cleve für Heinrich den Achten. Erleuchtet von dem göttlichen Geiste Luthers, kehrte er aus Deutschland zurück, und von ihm ging für die Familie die Aufklärung aus, welche sie in fester Ueberzeugung ihrem alten Glauben entführte, und von da an zu treuen Anhängern der unter Eduard dem Sechsten beginnenden, unter Elisabeth endlich fest begründeten anglikanischen Kirche machte. Zur Zeit der katholischen Maria vom Hofe verbannt, zu ausgezeichnet, um größeren Verfolgungen ausgesetzt zu sein, entstiegen sie in verdoppeltem Glanze mit Elisabeth ihrer tugendhaften Verborgenheit, und der Vater des eben verstorbenen Herzogs genoß mit seinem ganzen Hause alle Auszeichnungen, welche diese erhabene Fürstin für die Belohnung treuer Anhänglichkeit so sinnreich zu erdenken wußte. Gern hätte sie dazu die unmittelbare Mitwirkung des Herzogs an den Regierungsgeschäften gefügt, wäre nicht die Neigung desselben, bei zunehmendem Alter sich auf den Umgang seiner Familie zu beschränken, ihr hinderlich gewesen, worein sie sich jedoch fand, ohne ihm ihre Gnade zu entziehen. Was indessen der Vater ihr versagen gedurft, glaubte sie desto bestimmter von seinem einzigen Sohne fordern zu können, und so ward der junge und schöne Mann an ihren Hof gerufen. In den ernsten und gelehrten Cirkeln, die sie selbst umgaben, legte er, als der erste ihrer Diener, durch Umgang mit den ausgezeichnetsten Personen der damaligen Zeit den Grund zu der hohen Bildung, welche sich so segensreich für seine Familie zeigte. Sie sandte ihn später mit höchst wichtigen Aufträgen an Wilhelm von Oranien und vermählte ihn bei seiner Rückkehr mit einer Gräfin von Burleigh, welche sie als das erste Fräulein ihres Hofes angesehen wissen wollte, und welche in jeder Beziehung diesen Vorzug ihrer Königin verdiente. Sie sah ihren ehemaligen Pagen, wie sie ihn gern nannte, als ihr Werk an und war eitel darauf, die Erziehung eines Mannes vollendet zu haben, wie sie sich oft ausdrückte. Als dem Grafen kurz hintereinander zwei Söhne geboren wurden, äußerte sie lebhaft ihre Freude über das Fortblühen dieses Geschlechts, und machte sich mit einem Geschenke, welches bei ihr selten vorkam, zur Pathin des ersten, und ernannte den zweiten Sohn zum Grafen von Glandford, mit Wiederverleihung einer unter Maria confiscirten Besitzung, welche früher der Familie als freies Witthum der Gräfin Devereux mit der Bestimmung zugefallen war, dem zweiten Sohne der Familie Namen, Rang und Reichthum zu gewähren. Elisabeth freute sich, diese Stiftung auf Wunsch der Oberhäupter der Familie erneuern und sanctioniren zu können, und so zugleich eine Ungerechtigkeit ihrer gehaßten Vorgängerin wieder gut zu machen. Wenige Jahre später sandte sie ihn nach Frankreich an Catharina von Medicis, wo damals Troymorton, ihr ausgezeichneter Gesandter, sich aufhielt. Sie verzögerte seine Zurückberufung um ein Jahr, ihn selbst und den arglistigen Versailler Hof, der eine Vermählung des Herzogs von Anjou mit Elisabeth beabsichtigte, durch tausend kleine Vorspiegelungen hinhaltend, hinter denen sie gern ihre wahren Absichten verhüllte.
Der Graf von Derbery fand bei seiner Rückkehr seinen Vater nicht mehr und das Schloß nur von seiner trauernden Gemahlin bewohnt; er eilte nun mit seinen beiden Söhnen nach London, um zu den Füßen seiner Königin den Lehnseid zu leisten und ihr die hoffnungsvollen Jünglinge vorzustellen, die sich schon in der Wiege ihrer Gunst erfreuten, und welche sie nun augenblicklich zum Aufenthalt an ihrem Hofe bestimmte. Der letzte und sicher nicht erwünschteste Auftrag der Königin bestimmte den Grafen, an Jakob den Sechsten die Nachricht von dem Tode seiner Mutter, der unglücklichen Maria von Schottland, zu überbringen. Wahrscheinlich leitete sie, neben der Rücksicht auf die Persönlichkeit dessen, der Jakob ihren Schmerzensbrief einhändigen und ihren merkwürdigen, allerdings etwas zweifelhaften Zorn gegen die Urheber dieser That bestätigen sollte, hauptsächlich der Wunsch bei dieser Wahl, den Herzog mit Jakob, den sie schon damals in der Stille zu ihrem Nachfolger ersehen hatte, zu befreunden. Durch die Art, wie sie den Herzog dem Könige empfahl, und der ungemeinen Hochachtung vertrauend, welche er sich überall zu erwerben wußte, war sie dies zu erreichen gewiß. Sie verlangte ausdrücklich, daß seine beiden Söhne ihn begleiten sollten, und berief unterdessen die Herzogin an den Hof. Robert, Graf von Derbery, der älteste Sohn, benutzte eben so, wie Archimbald, Graf von Glandford, diese Gelegenheit zu seiner Entwickelung mit ausgezeichnetem Eifer, und Archimbald, wie zum Diplomaten geboren, begleitete schon in den letzten Jahren der Regierung Elisabeths die Gesandtschaft, die mit Heinrich von Bearn wegen Sendung von Hülfstruppen gegen die Ansprüche Philipps des Zweiten auf die Thronfolge in Frankreich unterhandelte. Sein Benehmen war hier zwar ohne Einfluß, aber so fein und schicklich, daß Elisabeth von ihm Größeres für die Zukunft prophezeite. Zurückgekehrt, lebte er unter der Anleitung seines Oheims Cecil, ganz sich diesem Fache widmend. Er war das Bild der Selbstbeherrschung! Seine Figur war mittler Größe und ohne Fülle, doch von einer augenscheinlich großen Kraft, die auch jeder seiner Bewegungen die vollkommenste Gewandtheit gab. Dies ließ die Meisten sehr leicht vergessen, daß dem Ausdrücke seines Gesichtes sowohl als seiner Figur jener imponirende, die Hoheit der Seele voraus verkündigende Anstand fehlte, den man vorzüglich später, als sein Name in seinem Vaterlande, wie an fast allen fremden Höfen bekannt ward, oft mit Befremden vermißte. Er beherrschte aufs Vollkommenste seine Muttersprache und außerdem fast alle fremden Sprachen, so wie die Sitten der von ihm besuchten Höfe ihm völlig bequem waren. Die Gabe, ohne allen Anschein der Beobachtung auch das Geringste wahrzunehmen, Alle durch seine Anreden oder Antworten zu befriedigen oder zu beschwichtigen, war ihm vollkommen eigen. Im Streit, in gelehrten oder politischen Unterhandlungen, bei der größten Ueberlegenheit im Wissen, Folgern und Beschließen, wußte er doch stets in die Einkleidung das bescheidene Aufhorchen eines Lernenden zu legen. Man konnte ihm nichts sagen oder mittheilen, was er nicht im Stande gewesen wäre, als längst bekannt und selbst in seinen fernsten Resultaten vorausgesehen, zurückzuweisen. Mit höchster Ruhe vermochte er den längsten Erörterungen zuzuhören, ohne das kleinste Zeichen der Ermüdung oder der Unaufmerksamkeit zu geben, und es stand eben sowohl in seiner Macht, endlich den Beifall daran mit Gründen zu rechtfertigen, als ihm die gefährliche Gewalt zu Gebote stand, in wenigen satyrischen oder kritischen Worten die auch noch so künstlich verflochtenen Gedanken ihres falschen Scheins zu entkleiden, und in ihr Nichts zurückzuführen. Doch konnte man ihm in seinem langen Leben nie nachsagen, daß er an einer guten Sache seinen Hang zur Satyre versucht hätte. Sein Stolz hatte bei dem vollen Bewußtsein seines Ranges und Namens doch jenen freieren Karakter, der sich in ihm mehr als Kosmopolit, denn als Engländer entwickelt hatte, und den zu hegen, er mehr vielleicht noch seinen Eigenschaften, als seinem Namen vergab.
Robert, Graf von Derbery, der älteste Bruder und Erbe des herzoglichen Ranges, hatte bei mancher Verschiedenheit an Geist und Bildung den Bruder nicht erreicht. Er hatte von Elisabeth trotz seiner Jugend die Erlaubniß erhalten, den englischen Truppen zu folgen, die in der Normandie bei Dieppe zur Unterstützung des heldenmüthigen Heinrichs von Navarra erschienen, und so seinen heißesten Wunsch erreicht, der ihn mit schwärmerischer Verehrung zu diesem Prinzen zog. An Heinrichs kleinem Hofe, den kein anderer Glanz, als der der Waffen, schmückte, fand er jedoch Menschen, erwärmt von der großen Empfindung für Recht und begeistert von dem Gedanken der guten Sache: Zu siegen oder zu sterben! Ihm ward die Wohlthat, die erste Idee, die ihn ausschließlich erfaßte, für eine große und erhabene ansehen zu dürfen, für die er das Leben mit allen seinen Gütern einsetzte, und sich in diesem Brennpunkt aller Kräfte, noch vor den Jahren, zum Manne zu zeitigen.
Bald nachher war England durch den Tod seiner großen Beherrscherin in die tiefste und gerechteste Trauer versenkt. Elisabeth starb am vierundzwanzigsten Mai 1603, und nachdem Jakob der Sechste von Schottland als Jakob der Erste den Thron von England bestiegen, hielten die Großen, die ihm durch frühere Verhältnisse näher getreten waren, es für nöthig, am Hofe zu erscheinen, und die Familie des Herzogs von Nottingham zeigte sich für einige Zeit in London. Zwar war Jakob umlagert von den schottischen Großen, denen er sich verpflichtet hatte, und die jetzt Hülfe forderten und fanden; aber er war dennoch gerecht gegen seine neuen Unterthanen. Mit Erstaunen sah man Cecil, den Sohn des Grafen von Burleigh, seinen wichtigen Posten ruhig weiter behaupten, ohne seines Einflusses auf den Tod der unglücklichen Königin Maria weiter zu gedenken; und während Jakob eben so eilig die Essex, Howards und Devereux aus ihrer Verbannung rief, gab er seinen Prinzen die Weisung, die Söhne der Gräfin Nottingham zu ihrem Umgange zu wählen. Nicht leicht ward ein Befehl des Königs mit mehr Lust erfüllt, als dieser. Die jungen Prinzen hatten schon in Schottland bei der damaligen Sendung des Herzogs, nach dem Tode der Königin Maria, wo die Jünglinge ihn begleiteten, mit den Grafen Freundschaft geschlossen. Obgleich Beide jünger, als die Grafen, glich sich doch dies leichter aus durch die angeborne Würde der Königssöhne.
Seltsam aber und doch bei der Prüfung der Karaktere sehr natürlich, schlossen sich, wie magnetisch angezogen, die am innigsten aneinander, die durch das Alter sich ferner standen. Heinrich, Prinz von Wales, hing sich mit Enthusiasmus an den Grafen von Glandford, während Carl, der jüngere Bruder, sich nicht mehr von seinem geliebten Robert zu trennen vermochte. Jakob sah die jungen Leute, unter denen er sich stets gefiel, so viel, wie möglich, um sich, doch der Wunsch, seinen geliebten Georg Villers ihnen zuzugesellen, blieb unerfüllt. Ohne sich auszusprechen, schien es eine stillschweigende Verabredung, ihn bei aller Höflichkeit, die sie dem Lieblinge des Königs schuldig zu sein glaubten, auf eine feine Weise von sich entfernt zu halten. Der König war seltsam genug, dies für Geringschätzung gegen seinen, wenn auch alten, doch nicht sehr ausgezeichneten Namen zu nehmen, ließ häufig wohl verständliche Winke darüber fallen und sagte endlich, als er seinen Liebling zum Herzog von Buckingham erhoben hatte: Nun werden meine stolzen Prinzen und ihre Grafen den Villers schon leiden mögen. Leicht hätte er beobachten können, wie wenig er seinen Zweck erreicht hatte, wären nicht Veränderungen in den Verhältnissen der jungen Leute selbst entstanden. Der Herzog von Nottingham wünschte seinen ältesten Sohn zu vermählen, und zwar mit der einzigen Tochter des Heinrich von Digby, Grafen von Bristol. Lange Freundschaft verband die Häupter der Familien, und allerdings schien es für den jungen Grafen eine leichte Wahl, da die junge Gräfin so eben in dem vollen Glanze einer erhabenen Schönheit bei Hofe erschienen war; und abgesehen davon, daß ihrer ein fürstlicher Reichthum harrte, schien ihr Geist von ungewöhnlicher Bildung, und ihr Karakter an Festigkeit und Würde fast ihrem Alter vorausgeeilt zu sein. Sie war der Mittelpunkt aller Träume und Wünsche, aller Intriguen und Huldigungen, während sie selbst mit stolzer Kälte Alle von sich entfernt hielt, und den Herzog von Buckingham blos aus Rücksicht für den König, den Grafen von Derbery aus Gehorsam gegen ihre Eltern zu dulden schien. Doch war leicht wahrzunehmen, wie Robert nur die Rücksicht beobachtete, die ihm die Verhältnisse beider Familien abnöthigten, während er mit glühendem Angesicht einem andern Sterne sich zugewendet hatte, der zur selben Zeit den Hof verherrlichte. Der König hatte die Mutter, den Bruder und die Schwester seines übermüthigen Lieblings in den Grafenstand erhoben, und auch ihnen den Namen Buckingham verliehen. Die neue Gräfin erschien mit ihren Kindern am Hofe, dem Könige zu danken und ihre Tochter der Königin vorzustellen. Die Gräfin war eine schöne, würdevolle Frau, aus einer vornehmen, schottischen Familie, durch eigenen Werth und ausgezeichnete Verbindungen zu einer bedeutenden Stellung berufen. Ihr zur Seite stand das Fräulein von Villers, ihre einzige Tochter, in einer so vollendeten idealischen Schönheit, so abweichend von allem, was man vor ihr darunter verstanden hatte, daß Jakob selbst, höchst unempfänglich für weibliche Reize, lachend sich die Hände vor ihr rieb, und höchst verlegen um einen Ausdruck, oft wiederholte, daß seine hochselige Mutter auch von großer Schönheit gewesen, nicht zum Frommen und Seegen ihres armen Landes. Gott sei ihr gnädig! fügte er stets hinzu. Dies indirekte Lob gab zu verstehn, daß er die Gräfin zu einem ähnlichen Anspruch auf Schönheit berechtigt glaube. Gewiß war es, daß nicht allein der König, der seine Mutter nur nach einem Bilde aus ihrer ersten Jugendzeit kannte, sondern auch Alle, die der unglücklichen Fürstin damals persönlich näher getreten waren, die auffallendste Aehnlichkeit der jungen Gräfin mit jener durch ganz Europa berühmten Schönheit fanden. Man flüsterte, daß, als die junge Gräfin zuerst an dem Hofe der Königin erschien, und zwar wegen ihres kurz vorher verstorbenen Vaters in tiefer Trauer, der Graf von Burleigh gegen die Regeln der Etikette einige Schritte vor dem König vorausgeeilt und, als sie, dadurch erschreckt, die großen melancholischen Augen zu ihm aufgeschlagen, von einem jähen Schwindel befallen worden sei, der ihn genöthigt, Whitehall sogleich zu verlassen. Schrecken war fast auch die erste Empfindung, womit sein Neffe Robert die Gräfin ansah; aber es war das Erschrecken, welches das unentweihte Herz erschüttert, wo die Liebe zuerst ihren Zauber verbreitete. Eine Sekunde schien ihn verwandelt zu haben. Zum ernsten Nachdenken über sich von Jugend auf gewöhnt, begriff er den Taumel nicht, in dem sich selbst wieder zu finden alle Bemühungen fruchtlos schienen! Der erste Seufzer entstieg dieser lebenskräftigen Brust, voll Sehnsucht suchte er den Freund, aber beiden Prinzen hatte ihr hoher Rang an der Seite der höchsten Schönheit einen Platz verschafft, und Buckingham stand mit übermüthigem Lächeln und blickte auf den Triumph, den unbewußt die Schwester ihm erringen half. Der Platz neben der jungen Gräfin von Bristol blieb unberührt von Robert von Derbery. Er war und blieb im Saale, der diesen Zauber in sich schloß, aber er war unfähig zu einem Worte, ja, er sah die Gräfin kaum, die seltsam bleich und verändert den kühnen Annäherungen Buckinghams ein so hingebendes zerstreutes Wesen entgegensetzte, daß er weiter, wie je, gekommen zu sein schien und doch unzufriedener, als sonst, aus ihrer Nähe schied. Als Robert von Derbery den Prinzen nach seinen Zimmern begleitet hatte und das Gefolge bis auf ihn entlassen war, blickten die Jünglinge zuerst sich an, und stumm und heftig sanken sie einander in die Arme! Da fühlte Carl heiße Thränen an seinen Wangen, erschrocken richtete er den Freund in die Höhe und sah fragend in das glühende schöne Gesicht seines Robert. Stumm blickten sie sich eng umschlossen an, und leise öffnete der Graf die Lippen. Das Geständniß, was seine vom Himmelsglanz der Liebe strahlenden Augen verkündigten, sollte ihnen entgleiten, als Carl zum Tode erbleichend sich aus seinen Armen riß und mit fürchterlicher Heftigkeit abwehrend, die Hand nach ihm ausstreckend, ihm fast mit Entsetzen zurief: Schweig! Um Gottes willen, schweig! Kein Wort! Beim Himmel und der Erde, kein Wort! – Starr blieben sie so stehn, alles Leben schien von Beiden gewichen, bis Robert, über den Zustand Carls von zärtlicher Angst ergriffen, seine kalten Hände faßte und an seinem glühenden Gesicht, an seinem treuen Herzen sie zu erwärmen strebte. Doch Carl lag jetzt still und wortlos an des Freundes Brust, seine Augen waren tief zu Boden gesenkt; doch Beide, von Gefühlen überwältigt, sprachen kein Wort, bis schüchtern Porter, der Kammerdiener des Prinzen, die Thüre öffnete. Der Prinz kannte dies demüthige Zeichen, womit der treue Diener oft die langen Nachtwachen des Prinzen zu unterbrechen suchte; er folgte auch dies Mal sanft, wie ein geduldiges Kind. Ohne einen Blick auf Robert zu wenden, drückte er ihm die Hand, und mit kaum vernehmlicher Stimme sagte er ihm: Bleib mir getreu! Bis in den Tod! rief der Graf und beugte ehrfurchtsvoll sein Knie, indem er die geliebte Hand an seine Lippen drückte. Der Prinz entrieß sie ihm, preßte sie mit Heftigkeit an seine Augen und war verschwunden.
So lange der Hof Zeit behielt, war man damit beschäftigt, die beiden schönsten Damen des Hofes, die Gräfinnen von Bristol und von Buckingham, zu vermählen. Am nächsten hierzu schienen wieder die jungen Grafen von Drebery, der Herzog von Buckingham und noch einige minder wichtige Herren des Hafes. Aber wie dies einzurichten war, blieb ein weites Feld für die verschiedensten Muthmaßungen. Buckingham bewarb sich mit größter Zuversicht um die Gräfin von Bristol, und Niemand wagte an seinem Gelingen zu zweifeln, besonders da sein mächtigster Rival, Robert, Graf von Derbery, seit dem Erscheinen der Gräfin von Buckingham verloren schien für die übrige Welt. Ohne sich ihr bestimmt zu nähern, schien er doch in ihrer Nähe nur Luft und Nahrung einzuathmen. Ein Wort aus ihrem holden Munde, ein Blick aus ihren himmlischen Augen, die stets so ernst und freudlos umherschauten, schien Kraft und Leben in ihm hervorzurufen; und wandte sie sich von ihm, brach er zusammen, als ob sie alle Kraft mit sich hinweg geführt. Er war so kindlich, so ohne Arg seinen Gefühlen hingegeben, daß er keine Ahnung davon hatte, wie kein Wesen bei Hofe lebe, das dies Gefühl nicht längst erkannt. Er sah weder die ernsten Blicke des Grafen von Bristol, noch hörte er die sanften Mahnungen seines geliebten Vaters. Seine Mutter berührte vergeblich mit zarter Frauenart die früheren Wünsche der Familie in Hinsicht seiner Vermählung. Mit sanftem Lächeln hörte er sie ruhig an, er verweigerte nicht, er gewährte nicht. Er schaute so rührend freundlich und doch so tief traurig in ihre Augen, daß ihr das Mutterherz zu brechen drohte, und wenn er sie verließ, wußte sie nicht, ob er sie nur gehört habe. Schon oft waren die Freunde zusammen getreten, sie hatten es gewagt, sich das Scheitern ihrer Hoffnungen zu gestehen, sie liebten beide den bezauberten Jüngling väterlich, und ein zartes Mitleiden mit seinem Zustande, den die wunderbar anziehende Erscheinung selbst bei den ältesten Männern zu rechtfertigen schien, nahm ihrem Unwillen seine Schärfe. Die junge Gräfin von Bristol blieb dagegen Allen undurchdringlich. Mit derselben Würde erschien sie jeden Tag in dem ausgesuchtesten Schmucke, mit der Behauptung einer völlig gleichen Laune, bei Hofe. Sie war besonnen und geistreich, ohne Heiterkeit oder Witz zu besitzen; sie war prächtig, und ihre Stirn und der hohe, kalte Blick ihrer Augen wie zu einem Diadem geschaffen. Die blühende Fülle der Jugend, die sie vom Lande mitgebracht, und die ihrer Schönheit fast hinderlich war, hatte in der Stadt und von den endlosen Lustbarkeiten, denen sie wie einer Pflicht sich willig unterzog, gelitten, ihren Wangen war das glühende Licht entschwunden und ihrer Taille der volle Umfang; sie war nur noch schöner dadurch, und Buckingham schwur tausend Mal, sie überstrahle seine Schwester, wie die Sonne den Mond!
Wenige nur theilten diese Meinung. Man kaufte sich mit der Anerkennung ihrer seltenen Schönheit los, um sich an der Gräfin von Buckingham mit allen Entzückungen der Liebe und Bewunderung zu sättigen. Aber man frug sich, warum diese himmlischen Wangen so bleich sahen, warum diese tiefen seelenvollen Augen so melankolisch blickten, dieser süße Mund so selten lächelte, da doch aus diesem Lächeln der Wohllaut eines innern Himmels hervor zu brechen schien. Ihre hohe vollkommene Gestalt, ihre Bewegungen, das einfachste Wort, was von ihren Lippen mit sanftem Tone drang, es schien so ganz anders, wie alles Uebrige; und wenn die holdeste Demuth wie bittend aus ihr sprach, schien sie die Königin aller Gedanken, die Beherrscherin der Gefühle und Meinungen. Sie war der Liebling der Königin. Der König lächelte bei ihrem Erscheinen und sah ihr durch die langen Reihen nach. Man vermuthete, er hätte sie gern angeredet, hätte er je verstanden, einer Frau sich zu nähern; aber er freute sich unter seltsamen Bewegungen des Gesichts und der Hände, wenn man sie rühmte, und rief oft, sein inneres Vergnügen dem Liebling zuwendend: Stenie macht mir immer Freude! Sie gleicht ihm, setzte er hinzu; doch schnell sich besinnend sagte er: Nein, nein, sie gleicht einer Andern! Er meinte damit unfehlbar das Bild seiner Mutter, vor welches er den Herzog von Buckingham geführt hatte, in der Absicht etwas zu sagen, aber sein geheimer und großer Stolz hielt ihn doch ab, diese Aehnlichkeit auszusprechen, und so schwieg der ganze Hof.