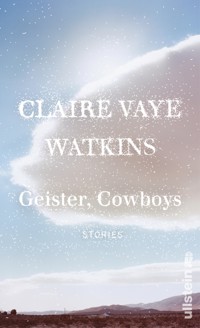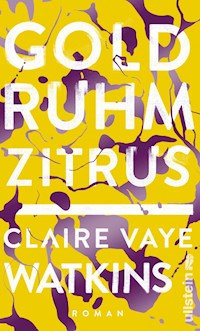
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Niemand kann sagen, wann es das letzte Mal in Kalifornien geregnet hat. Das Land liegt unter einer gigantischen Dünenformation begraben, die Bewohner werden, teils mit Waffengewalt, teils durch undurchsichtige bürokratische Vorschriften davon abgehalten, in fruchtbarere Regionen zu ziehen. Die meisten haben sich mehr oder weniger freiwillig in Notlager begeben, einige wenige hausen in den Villen und Bungalows, die andere verlassen haben, und leben von Notrationen. Auch Luz und Ray gehören zu ihnen. Als das Schicksal ein zweijähriges Mädchen namens Ig in ihre Hände legt, ändert sich für sie alles. Luz, ehemaliges Model, will des Kindes wegen die Flucht nach Osten wagen, ihr Freund Ray, Kriegsveteran und Surfer, unterstützt sie trotz seiner Vorbehalte. Spätestens als sie in den Weiten der Amargosa-Wüste auf eine sektenartige Kommune und ihren charismatischen Anführer stoßen, wird klar, dass Gefahr nicht nur von der erbarmungslos brennenden Sonne ausgeht. Die gleißende Schönheit der Landschaftsbeschreibungen lässt in keiner Sekunde die tödliche Bedrohung vergessen, die über allem liegt. Ein kluger Roman über die Folgen von Gier und Ausbeutung der Natur und das Urmenschliche im Angesicht der Katastrophe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Niemand kann sagen, wann es das letzte Mal in Kalifornien geregnet hat. Das Land liegt unter einer gigantischen Dünenformation begraben, die Bewohner werden, teils mit Waffengewalt, teils durch undurchsichtige bürokratische Vorschriften, davon abgehalten, in fruchtbarere Regionen zu ziehen. Die meisten haben sich mehr oder weniger freiwillig in Notlager begeben, einige wenige hausen in den Villen und Bungalows, die andere verlassen haben, und leben von Notrationen. Auch Luz und Ray gehören zu ihnen. Dann tritt ein kleines Mädchen namens Ig in ihr Leben und alles ändert sich. Gemeinsam begeben sie sich auf die gefährliche Reise durch das Dünenmeer nach Osten.
Die gleißende Schönheit der Landschaftsbeschreibungen lässt in keiner Sekunde die tödliche Bedrohung vergessen, die über allem liegt. Ein kluger Roman über verzweifelte Hoffnung, Glücksritter und das Urmenschliche im Angesicht der Katastrophe.
Die Autorin
Claire Vaye Watkins wurde 1984 im Death Valley geboren und ist in Nevada aufgewachsen. Ihre Erzählungen und Essays sind u.a. in Granta, Tin House, The Paris Review, One Story, Glimmer Train und der New York Times erschienen. Ihr 2012 erschienener Erzählungsband »Geister, Cowboys« wurde vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Story Prize und dem Dylan Thomas Prize. Derzeit unterrichtet Claire Vaye Watkins kreatives Schreiben an der University of Michigan.
Susanne Höbel, seit fünfundzwanzig Jahren Literaturübersetzerin, übertrug Autoren wie Nadine Gordimer, John Updike, William Faulkner und Thomas Wolfe ins Deutsche. Sie lebt in Hamburg und Südengland.
Claire VayeWatkins
GOLD
RUHM
ZITRUS
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Susanne Höbel
Ullstein
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2015 unter dem TitelGold Fame Citrus bei Riverhead, New York.
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN: 978-3-8437-1430-3
© 2015 by Claire Vaye Watkins© der deutschsprachigen Ausgabe2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinInnenabbildungen: © Lauren KolmUmschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenUmschlagmotiv: nach einer Vorlage von © Riverhead Booksby Penguin Random House
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Für D.A.P.
BUCH EINS
Da ist’s. Nimm’s.
William Mulholland
Den Präriehund vor sich her ins Haus zu jagen war ein Fehler gewesen. Das verstand Luz Dunn jetzt, aber sie hatte so lange kein kleines Lebewesen gesehen, und das Tier hatte sie überrascht. Gegen Mittag war sie aufgewacht, nachdem sie im Traum eine großartige Idee gehabt hatte, die sie umgehend verwirklichen wollte: Sie würde alle Kleider im Haus anprobieren. Die Gewänder hingen wie Federschmuck im Kleiderschrank des Schlafzimmers, Kleider in den herrlichsten Farben, jedes einzelne unglaublich teuer – wenn man sich vorstellte, welche das Hollywood-Sternchen mitgenommen hatte! Im Traum hatte Luz alle Kleider auf einmal getragen, die Brüste mit Strass geschmückt und mit Silberstaub überpudert, der Rücken mit Reihen kupferblinkender Pailletten geziert, gefältelte Satinsegel auf den Hüften gehisst und die Füße von hellem Tüll wie gesponnenem Zucker umschwebt. Natürlich, in der leblosen wachen Welt kam eins nach dem anderen dran.
Es sei wichtig, ein Projekt zu haben, hatte Ray gesagt, und sei es noch so unsinnig. Die Santa-Ana-Winde bliesen durch den Canyon und brachten unsichtbare Partikel mit sich, die einen in den Wahnsinn trieben, und Ray sagte, Luz solle versuchen, sich zu beschäftigen. Sie solle versuchen, nicht so viel zu schlafen. Eins von Rays Projekten war das Ausheben einer Sickergrube, ein anderes das Absaugen von Benzin aus den Luxuslimousinen, die überall im Canyon zurückgeblieben waren.
Gestern hatte Luz’ Projekt darin bestanden, sich Ray als Geschenk zu präsentieren, wie eine Praline verpackt in einen Pelzmantel, den sie aus einem der höhlenartigen Wandschränke ausgegraben hatte, dabei war sie längst nicht so dunkel wie Schokolade. Unter dem Nerz verging sie vor Hitze, und ihre zitternde Oberlippe war mit Schweißperlen besetzt, als sie durch den Garten zu Ray ging, der dort arbeitete, und in die ewig scheinende, ewig brennende, alles verdunstende Sonne hinaustrat. Sonne aller Sonnen. Dürre aller Dürren. So sahen ihre Tage jetzt aus, Luz und Ray und die gnadenlose Sonne im Canyon, eine Familie des Lichts, in dieser Luxusvilla, die wie ein Ausleger in den Hügel gebaut war, mit einer Brücke als Zufahrt. Luz hatte den blödsinnigen Mantel zu Boden fallen lassen, sich nackt auf einer sonnengebackenen Liege ausgestreckt und bis zum Abend unter einer Reihe blattloser Weinranken geschlummert. Einmal kam Ray zu ihr und fuhr ihr mit der Hand zwischen die Knie, aber sie hatte bloß gestöhnt: Zu heiß für Sex. Der Nerz lag auf dem Boden – Skulptur eines Irrtums.
Dies hier war ein besseres Projekt, sagte sie sich, als sie vor dem Standspiegel in einem pfirsichgelben Etuikleid auf und ab ging, so hübsch, selbst auf ihrer schmutzigen Haut. Im Wandschrank hing ein handgewebter Poncho in Orange und Gold, er würde wunderbar zu dem Kleid passen, bloß dass Wolle Selbstmord war. Lieber ein Hermès-Schal – nein, besser noch ein zartes Tennisarmband, dessen winziger Verschluss ihr einige Mühe bereitete. Wie Tautropfen um ihr elfenhaftes Handgelenk – etwas in der Art hätten die Fotografen gesagt. Aber inzwischen waren fast alle Menschen dünn. Luz streifte das Etuikleid ab und schlüpfte in ein hautenges Meerjungfrauenkleid in Kobaltblau, dicht mit Perlen bestickt. Ein bezauberndes Kleid, und sie sah bezaubernd darin aus, selbst mit ihrem verfilzten Haar, den feuchten Kuhaugen und den kräftigen Augenbrauen, mit den Zähnen, die vorstanden, als wollten sie die Richtung angeben, und der Lücke zwischen den Vorderzähnen, weshalb sie die schmale Oberlippe immer auf die volle Unterlippe presste, auch jetzt, als sie allein war und vor dem Spiegel tänzelte und die hängenden Perlen leise klickklickklick machten. Wie eine Wassernymphe sah sie aus, und so wollte sie sich Ray zeigen.
Bekleidet mit dem Gewand und Gummigaloschen, auf dem Kopf einen Federschmuck, funkelndes Geschmeide an jedem Finger und um ein Handgelenk, stapfte sie die freischwebende, geländerlose Treppe hinunter. Unten angekommen erstarrte sie. Im Vorraum saß der hellbraune Präriehund mit seinen Knopfaugen. Er hatte sich auf die Hinterbeine erhoben. Er schnüffelte in die Luft. Er hielt etwas in den beweglichen Vorderpfoten. Irgendwie süß. Nur dass er jetzt den Kopf senkte und, so schien es ihr, auf sie zukam. Luz kreischte vor Schreck, dann führte sie in Zeitlupe und mit überraschender Anmut und Wucht einen Tritt mit gestrecktem Bein aus, als wäre plötzlich ein lange verlorener Reflex aus ihrer Zeit in der American Youth Soccer Organisation erwacht.
Galoschen, ein müder Witz. Desgleichen Regenschirme, Gummimäntel, Gullis, Dachrinnen, Scheibenwischer. Hier hatte es in ihrem ganzen Leben nicht genug Regen gegeben, dass Galoschen nötig gewesen wären. Aber Gott sei Dank trug sie welche, sonst hätte das Tier mit seinen Klauen womöglich ihren nackten Fuß blutig gerissen, statt mit einem lauten Schrei durch die offene Tür in die Bibliothek zu fliegen. Ein entsetzlicher Schrei, dieses Kreischen, und in ihrem Entsetzen schob Luz die Tür zur Bibliothek mit einem so heftigen Ruck zu, dass die auf ihren Rollen erbebte. Für diesen grausamen Reflex bezahlte Luz Stunden später, als schlimme Langeweile und Wehmut sie überkamen, nachdem sie ein ausgezeichnetes Buch – eine Biographie über John Wesley Powell – ausgelesen und kein neues zur Hand hatte.
Jetzt war die Frage, ob sie Ray – der im Garten eine offene Wasserrinne aus dem Holz zimmerte, das sie von den Fenstern und Türen in dem ultramodernen Château des Hollywood-Sternchens abgerissen hatten – unterbrechen sollte oder ob sie mit der Präriehund-Situation allein fertig werden konnte. Kreisch, hatte der Präriehund gemacht, und Luz ging zum Balkon und rief nach unten zu ihrem Liebsten.
Ray blickte mit zusammengekniffenen Augen nach oben und pfiff. »Scharf, Baby.«
Luz hatte ihren Meerjungfrauenaufzug ganz vergessen und spürte bei dem Kompliment einen kleinen Freudenflicker. »Wie kommst du zurecht?«, rief sie.
»Ist doch peinlich«, sagte er mit einem Kopfschütteln. »Zehn Millionen leere Pools in der Stadt, und wir kriegen diesen hier.«
Die Peinlichkeit befand sich gleich neben seiner halbfertigen Rinne: der Pool des Hollywood-Sternchens, seit langem wasserleer, hatte keine Wände aus glattem Beton, sondern welche aus edlen schwarzen Flusskieseln, und seine Form war keine Mulde, sondern ein Kasten. Harte Kanten und rechte Winkel. Eindeutig nicht zerkleinerbar. So ein Mist, hatte Ray gesagt, als er sich das erste Mal davorgekniet und die Seitenwände befühlt hatte, wobei sich seine Augen zu zwei glatten Murmeln verwandelt hatten, wie die nierenförmigen Pools im Valley. Ray war im ewigen Krieg gewesen – er war ein Kriegsheld, obwohl er das Wort verboten hatte – und absentierte sich manchmal.
Hier war er, ohne Hemd, schlank, fast mager, ein Sperrholzblatt zwischen den Knien. Sein offenes Haar, zottelig und lockig, reichte ihm bis zu den Schultern. Auf dem Boden des trockenen Pools lagen ein paar Kringel pergamentartigen Schleims, erbsengrün und kupferglänzend. Haareschneiden, dachte Lutz, ein Projekt für den nächsten Tag.
Sie sah ihm beim Arbeiten zu und lehnte sich dabei an die Balkonbrüstung, wie es das Hollywood-Sternchen getan haben mochte. Originell und inspiriert zu sein war unmöglich, wenn man, wie sie, das Geisterleben einer anderen lebte. Ray konnte das Sternchen auseinandernehmen, spalten, zerhacken und mit dessen Knochen bauen, aber Luz darbte unter ihr. Sie teilten in allem dieselbe Größe.
Als Ray Oben im Canyon gesagt hatte, waren vor Luz’ Augen Säulengänge und Armleuchter erschienen, kunsthandwerkliche Keramikkacheln, ein funktionierendes Bad mit türkisgrüner Patina auf dem Wasserhahn in der Form eines Delphins und dazu passend Seesternknäufe, Vogelnester in den Kronleuchtern und Bougainvillea, die sich um Marmorsäulen rankte und von den verschnörkelten Deckenlampen solcher Villen – wie hießen die gleich noch? – herabhing. Aber das Haus, das sie fanden, war ein Kasten und bestand hauptsächlich aus Fenstern. Überall Schiefer und Birkenfurnier, Schiebetüren statt Schwingtüren, der falsche Stil für Säulen. Alle Rankgewächse waren verwelkt. An Pflanzen gab es den getrockneten Schleim im Pool und die knorrigen, blattlosen Weinranken und etwas Stacheliges, das sich durch die Ritzen der Terrassenbohlen bohrte und nicht abtöten ließ, weil es einfach zu wild war.
Unter ihr machte Rays Hammer bangbangbang.
Lüster, so hießen die, und natürlich gab es keine.
Wo blieben die wilden Tiere aus den sonnenverdörrten Bergen, die hier Rettung suchten? Wo war der Vogelgesang, den sie sich versprochen hatte? Was es gab: Skorpione, die aus den Abwasserrohren krochen, ein paar mumifizierte Frösche im wasserlosen Springbrunnen, das Gerippe eines Kojoten in der Schlucht, das zu Bambus wurde. Natürlich, ein Skorpion hatte schon etwas Besonderes, aber sie wünschte sich charismatischere Exemplare von Fauna. »Genau solches Denken hat uns diese Situation eingebracht«, sagte Ray, und damit hatte er recht.
Die Natur hatte sich ihnen verweigert. Wasser, Vegetation, Säugetiere, das Tropische, das Semitropische, Blattwerk, Grün, in Gottes Namen Zitrusbäume – all das war ihnen versagt und wurde ihnen jetzt schon so lange versagt, dass es mit jedem Tag und mit jedem Projekt schwieriger wurde, sich eine Zeit vorzustellen, in der es ihnen nicht versagt gewesen war. Die Aussicht, dass Mutter Natur ihre Beine öffnen und Los Angeles in ihre Fruchtbarkeit zurückholen würde, verdunstete von Tag zu Tag mehr, so wie die Pfützen in den letzten Wasserbecken der Vorberge, wo die National Guard patrouillierte.
Aber Luz sehnte sich nach einer Menagerie, Tag und Nacht ließ sie die Fenster offen, um sie anzulocken, selbst wenn Ray über den Staub klagte, selbst wenn er sie warnte, dass die Santa-Ana-Winde sie in den Wahnsinn treiben würden. Das stimmte vielleicht, denn in ihrem Kopf trippelte jetzt das Nagetier. Hier war endlich ein Geschöpf, das in dem Haus, das ihnen nicht gehörte – es gehörte niemandem –, Gesellschaft suchte, und was hatte sie gemacht? Sie hatte das kleine Ding mit einem Tritt in die Eingeweide durch die Luft befördert und eingeschlossen.
Diesige Luft, bernsteingelb vom Rauch. Malibu brannte, und Luz’ frühere Wohngegend brannte auch. Zecken hangelten sich durch das tote Gras. Sand in den Laken, in den Achselhöhlen, der Arschritze. Bettwanzen nisteten in der Matratze und waren umso schlimmeres Ungeziefer, als es wahrscheinlich nur eingebildet war. Ein zerstörter Himmel, dieser lorbeerlose Canyon.
Luz hatte gelesen, früher seien Feuer bekämpft worden, indem man mit Hubschraubern über Seen geflogen sei und mit Eimern Wasser daraus geschöpft habe, die dann über den Brandflächen ausgeschüttet wurden. Damals ging es am Himmel verrückt zu: Bürokraten spannten unsichtbare Schirme aus Aerosol über die Täler, Ingenieure stellten Trichter auf, in denen Regenwasser aufgefangen werden sollte, bevor es verdunstete, Universitäten mit Forschung-I-Status schossen Raketen in den Himmel, um Regen auszulösen. Einmal, bei einem ihrer ersten Canyon-Projekte, waren Luz und Ray auf einen Berg gestiegen, der, so schrecklich es war, Lookout hieß, und dort auf einen ramponierten Regenmacher gestoßen, eine von diesen Wundermaschinen, so groß wie eine Scheune, die kristalline, Feuchtigkeit produzierende Chemikalien in die Atmosphäre sprühten. Ein andermal waren sie auf einen Kamm geklettert und hatten mit Blick auf den farblosen Archipel leerer oder fast leerer Wasserbehälter überall in der Stadt Picknick gemacht. Sie hatten Salzkekse gegessen, von der zugeteilten Cola getrunken und sich Geschichten von den Bergen, dem Tal, dem Canyon und dem Strand erzählt. Von der ganzen zerstörten Landschaft. Und weil sie sich geschworen hatten, nie über das versiegte Wasser zu sprechen, sprachen sie stattdessen über die Erde, die wie Wasser in Bewegung war. Ray erzählte von Felsbrocken, die in der Schlucht aneinanderrasselten, von einer großen Geröllschnecke, die sich durch den Canyon in die Tiefe schlängelte. »Slug«, so nannten die Geologen es, und Luz wartete auf die perfekte Schnecke, langsam und formlos und dunkel, die den ganzen Raum ausfüllen und alle Hindernisse aus dem Weg schieben würde. Die ihr zuschanden gerichtetes Überschwemmungsgebiet reinigen würde.
Ray ging oft zu dem Kamm hoch und nahm das Notizheft mit, das er in der Tasche bei sich trug, aber Luz war nie wieder da oben gewesen. Manches überstieg einfach ihre Kräfte, wie zum Beispiel die Tür zu der nur selten benutzten Bibliothek aufzumachen, wo in den Regalen lauter Biographien über Männer wie Francis Newlands und Abraham Lincoln und Lewis and Clark und Sacajawea und William Mulholland und John Muir (auf den sie ein Auge hatte) standen, und das kleine Nagetier herauszuholen.
Sie ging wieder an den Wandschrank des Hollywood-Sternchens, nahm ein Paar ungetragene Espadrillos aus einem Karton, warf sie auf den Boden und ging mit dem Karton in den Garten. »Ich glaube, in der Bibliothek ist ein Präriehund«, sagte sie zu Ray.
Ray hörte auf zu hämmern. »Ein Präriehund.«
Luz nickte.
»Wie ist er da reingekommen?«
»Ich weiß nicht.«
»Hast du ihn reingelassen?«
»Gewissermaßen.«
»Wann war das?«
»Kannst du ihn rausholen?«
»Lass ihn doch«, sagte er und wandte sich wieder dem Gerippe der offenen Rohrleitung zu. Ray las nicht viel. Früher hatte er jeden Morgen die Zeitung gelesen, doch jetzt gab es keine Zeitungen mehr, und er sagte, er sei fertig mit all dem Lesen und Schreiben, aber Luz hatte die geheimen Gedichte in seinem Notizbuch gelesen.
»Das ist nicht … artgerecht«, sagte sie und gab ihm den Karton. »Außerdem scheißt er bestimmt überallhin.«
Ray seufzte und zog sich den Werkzeuggürtel ab – Besitz eines Handwerkers, der längst abgehauen war –, nahm den Schuhkarton und ging ins Haus. »Wie groß ist er?«
»Also, wie ein Fußball? Ich glaube, er hat Tollwut.« Das war gelogen. Mittlerweile kam sie sich lächerlich vor.
Ray schob die Bibliothekstür hinter sich zu. Luz lauschte. Im Canyon war es heiß und still, im Haus ebenfalls. Dann brach in der Bibliothek ein Tumult los. Ray sagte: Scheißekackemist. Er sagte: Himmelarsch.
Dann kam er raus. Er wirkte wie ein Geistesgestörter, der seinen Auftritt in einem Theaterstück hat, und schob krachend die Tür hinter sich zu.
Luz fragte: »Wo ist der Karton?« Ray verlangte mit erhobener Hand Ruhe und schritt von der Halle in das höhlenartige Wohnzimmer. Luz folgte ihm. Nachdem er ein paarmal auf und ab gegangen war, nahm er den rußigen Schürhaken vom Haken beim Kamin und ging wieder in die Bibliothek.
Luz setzte sich auf die zweite Treppenstufe und wartete. Getöse war zu hören, ein Poltern, das Kreischen eines Schreibtischstuhls, der über blanken Betonboden gezerrt wurde. Fluchen, mehr Fluchen. Dann Stille. Sie wollte die Tür öffnen, traute sich aber nicht.
»Hast du ihn?«, fragte sie schließlich.
Die Tür wurde einen Spalt aufgeschoben, und Rays geröteter und schweißnasser Kopf kam heraus. »Guck besser nicht hin.«
Luz verbarg das Gesicht in den Händen, im nächsten Moment hob sie es wieder. Sie erschrak. Vor ihr stand Ray. An der Spitze des Schürhakens aufgespießt hing der pulsierende Präriehund. Sein Maul stand offen, seine Vorderläufe zuckten einmal, zweimal. Ray ging schnell nach draußen.
Luz stand auf, ihr war heiß, ihr war übel. Sie sah aus einer Höhe auf sich selbst hinab und erkannte, dass sie einen dieser Augenblicke erlebte, in denen ihr bewusst wurde, dass Ray – ihr Ray – als Teil seiner Berufsausübung Menschen getötet hatte.
Sie drehte sich um und quälte sich die Treppe nach oben. Sie wollte nicht da sein, wenn er wieder reinkam. Auf halbem Wege stolperte sie. Die Hängetreppe hatte Luz von Anfang an verstört, jetzt versetzte sie sie in helle Wut. Außer sich und mit großer Anstrengung schüttelte sie die klobigen Galoschen von den Füßen, so dass sie ins Wohnzimmer unter ihr flogen, sie zerrte sich das plötzlich kratzende Meerjungfrauenkleid vom Leib, kletterte in das riesige, ungemachte Bett und weinte in das sandige Laken.
Sie weinte kurz um das tote Tier, dann lange und ausführlich um alle ihre Identitäten in rückläufiger Reihenfolge. Zuerst um Luz Dunn, deren feurigster Liebhaber und bester Freund ein Mörder war und vielleicht immer sein würde, dann um Luz Cortez, mittelmäßiges Model, erst umworben, dann abgeschoben. Mit vierzehn war sie, was ihr Vater mit seinen ausbeuterischen Absichten angestrebt hatte, auf sich gestellt und abgetrennt von ihm und den Gesetzen gegen Kinderarbeit. Und schließlich weinte sie mit großer Hingabe um Baby Dunn. Als Paradebeispiel für vage und ohnehin nicht eingehaltene Versprechungen wurde sie am Vorabend einer symbolischen und umstrittenen Grundsteinlegung geboren und in die offenen Stellen einer Rede eingefügt, die für einen inzwischen vergessenen Senator geschrieben worden war:
Das goldene Kind des Naturschutzes kam heute Morgen um 8.19 Uhr am UCLA Medical Center als Tochter von Mr und Mrs William Dunn aus San Bernardino, Kalifornien, zur Welt. Das Kind, das bei der Geburt acht Pfund und hundertfünfzig Gramm wog, wurde vom Amt für Naturschutz adoptiert, das am heutigen Tag mit der Umsetzung eines heldenhaften Unternehmens beginnt, nämlich der Verlängerung des California Aqueduct um das Hundertfache, mit dem Ziel, Baby Dunn und allen anderen an diesem Tage zur Welt gekommenen Kindern eine Zukunft zu ermöglichen, die sicherer, wohlhabender und fruchtbarer ist als unsere eigene. Heute wagen wir uns auf Neuland vor, damit für Baby Dunn und ihre Kinder frisches Trinkwasser, Bewässerungsanlagen und Grünflächen bereitstehen. …
Baby Dunn, das mit einer goldenen Schaufel in der Hand zur Welt gekommen war, das vom Naturschutz und dessen Feinden gleichermaßen adoptiert und vereinnahmt wurde, dessen Lebensstationen in Pressemitteilungen bekannt gemacht wurden, dessen Leben buchstäblich und symbolisch Schlagzeilen machte, dessen Babybuch mit Zeitungsausschnitten zugekleistert war:
Gouverneur unterzeichnet HSB 4579: Die Leerung aller Pools in Kalifornien, bevor Baby Dunn alt genug ist, um schwimmen zu lernen.
Baby Dunns erster Tag im Kindergarten – nirgendwo Grünflächen, auf denen das Kind spielen kann.
Die letzte Farm im Central Valley gibt wegen Versalzung auf: Baby Dunn, 18, wird nie wieder Obst und Gemüse aus Kalifornien essen.
Berkeley-Hydrologen: Ohne Evakuierung wird Baby Dunn vor ihrem vierundzwanzigsten Lebensjahr mangels Wasser sterben.
Jetzt war Baby Dunn fünfundzwanzig und versuchte sich vorzustellen, wie das damals gewesen war. Hatten ihre Eltern Geld dafür bekommen? War ihr Gesandtenstatus von langer Hand geplant oder eine spontane Idee gewesen? Hatte ein Praktikant des Senators auf der Entbindungsstation auf der Lauer gelegen? Irgendein ehrgeiziger Gutmensch von einer Ivy-League-Universität, der mit einem Aufnahmegerät in der Jackentasche die Wartesäle nach fotogenen und redegewandten neuen Eltern abgesucht hatte? Wie musste sich dieser junge Pirscher gefreut haben, als er Luz’ Vater fand, große deutsche Zähne, Pastor und Handelsreisender, vom Heiligen Geist bewegt, dem Rotary Club beizutreten, jeden Morgen um sechs ins Sportstudio zu gehen, seinen Liebling in kirchlichen Talentshows auftreten zu lassen und die Sozialunterstützung seiner Frau für eine sehr gute Haartransplantation auszugeben. Billy Dunn war nicht im Kreißsaal, mit Sicherheit nicht. Zuzusehen, wie der Frauenkörper seiner Frau seiner Strafe unterzogen wurde, war nichts für ihn. Sein Temperament erlaubte es nicht, dass er sich mit Dingen wie Gebärmutter, Vagina, Menstruation, Menopause oder Pubertät befasste. Nicht damals, am Tage der Geburt seines einzigen Kindes, und auch später nicht, als Luz’ Mutter gestorben war und Luz lange Beine bekam und zu bluten begann, dunkelrot und bräunlich, und er ihr hätte erklären können, was da mit ihr passierte und was sie tun konnte und wie es jetzt in ihrem Leben weitergehen würde – jeder Mann hätte das tun können. Aber er sagte nichts, und so stahl sie ein kariertes Spültuch aus der Küche und schnitt es mit der Papierschere ihrer Mutter in Streifen – weshalb die Streifen denselben gezackten Rand hatten wie die Zeitungsausschnitte in ihrem Babybuch – und stopfte sie sich zwischen die Schamlippen. Und sie lernte von den anderen Mädchen und, oftmals, von den Fotografen.
Luz, sagte Billy Dunn, ist das Kreuz, das ich zu tragen habe.
Das war es, worauf sie immer wieder zurückkam: Ihr Vater, fromm und redselig, vielleicht nervös, der von dem Untergebenen eines Politikers im Wartesaal des Krankenhauses angesprochen wurde. Ihren Namen, Luz, sagte er so, dass er sich mit Strass reimte, bevor ihre Mutter, ihre Heimat Guadalajara hervorblitzen lassend, Gelegenheit hatte, ihn zu korrigieren. Reiner Zufall, dass sie die Angebetete des Landes wurde, dessen Vernichtung schon in vollem Schwange war, bevor sie auf der Welt kam. Baby Dunn.
Die Stunde, in der das Wasser angedreht wurde, kam und ging. Luz hörte das Kreischen der Handpumpe und Ray, der unten ihre beiden Trinkflaschen füllte. Sie blieb lange im Bett liegen, verheult und verschwitzt, und starrte auf die dunklen zugezogenen Vorhänge und die Kleiderhaufen, die sie im ganzen Zimmer aufgetürmt hatte und die wie die Millionen von Löchern in den Canyons waren, ein jedes mit einem kleinen Häufchen groben Sands am Eingang. Früher hatte sie diese Löcher für Höhlen von Backenhörnchen gehalten, doch jetzt wusste sie, dass es Schlangenlöcher waren. Säugetiere gab es keine mehr. Los Angeles gehörte den Reptilien, es war in den Urzustand zurückgefallen. Ihr Vater könnte bestimmt eine Bibelstelle dazu zitieren.
Nach einer Weile kam Ray ins Schlafzimmer und stellte ein Glas lauwarmes Wasser auf den Nachttisch an ihrer Seite. Er blieb im Zimmer, schweigend, und Luz sagte: »Kannst du mir John Muir holen?«
»Na klar.« Er ging, kam zurück und legte das Buch auf den Nachttisch neben das Glas mit dem ungetrunkenen Wasser. Er setzte sich auf die Bettkante, beugte sich vor und berührte sie sanft.
»Sag was«, sagte sie, »damit ich mich besser fühle.«
»Ich liebe dich?«
»Das nicht.«
Er gab ihr das Glas. »Trink das.«
Sie trank.
Er machte einen weiteren Versuch: »Ich glaube, es war ein Ziesel. Kein Präriehund.«
Darauf fühlte sie sich etwas besser, warum auch immer. Sie drehte ihr Gesicht zu ihm hin. »Was hast du mit ihm gemacht?«
Ray biss sich in die Wange. »Ihn in die Schlucht geworfen. Wenn du willst, steig ich runter und hole ihn wieder raus.«
»Nein«, sagte sie. Sie hätte das Tierchen gern richtig beerdigt – hätte das zu ihrem Projekt gemacht –, aber sie war überzeugt, dass Ray nicht zurückkommen würde, wenn er in die Schlucht hinunterstieg.
»Komm her«, sagte Ray und zog Luz, nackt und zusammengerollt, wie sie war, zu sich auf den Schoß. Er nahm ihre Finger der Reihe nach in den Mund und saugte die Ringe des Hollywood-Sternchens ab. Er nahm den Federschmuck aus ihrem Haar und entwirrte sorgsam Strähne um Strähne, was sie unendlich liebte. »Es ist Samstag«, sagte er.
»Das wusste ich gar nicht.«
»Wir könnten morgen zum Regentanz gehen. Vielleicht finden wir Beeren.«
Sie zog die Nase hoch. »Meinst du wirklich?«
»Ja, sicher.«
Sie lachten. Ray sagte, komm, und führte Luz vom Bett ins Badezimmer. Er hielt ihre Hand, als sie nackt in die trockene Wanne stieg, eine runde Designerwanne aus Keramik, so weiß wie ein Kinderzahn. Ray ging nach unten und kam mit seinem Krug Wasser zurück. Er befeuchtete ein Handtuch mit Wasser und wusch Luz von oben bis unten. Als er fertig war, ließ er sie in der Wanne. »Bleib da liegen«, sagte er, bevor er die Tür schloss. Sie lag im Dunkeln und spielte mit dem Armband des Hollywood-Sternchens, das sie noch umhatte und auf dessen Diamanten sich, so unwahrscheinlich das schien, ein Licht brach, so dass sie funkelten. Ray kam sie holen, hievte sie sich über die Schulter und legte sie auf dem Bett ab, und erst als sie die nackten Beine unter das Laken streckte, merkte sie, dass die Kissen und die Bettdecke und alles Leinen sanft und glatt waren. Ray hatte den ewigen Sand davon abgeschüttelt.
Die Sonne war untergegangen, und die Türen zum Balkon standen offen. Luz stellte sich vor, dass die Meeresbrise auf ihrem unglaublichen Weg zu ihnen war. Morgen würden sie Beeren essen. Sie lagen zusammen, glücklich und still, und das war mehr, als irgendjemand hier mit Recht verlangen konnte. Sie wusste, dass Ray eingeschlafen war, als das Zucken und Wimmern und Um-sich-Schlagen begann, die Abwehr der Alpträume, an die er sich nicht erinnerte. Sie hielt ihn im Arm und sah zu dem blutroten Glühen im Osten hinaus, wo die letzten Chaparralpflanzen explodierten.
Selbst nach ihrer eigenen großzügigen Einschätzung hatte Luz sich ganz schön tief in die Scheiße geritten. Dieser Gedanke kam ihr, als die Sonne aller Sonnen im Pazifik versank und sie barfuß in einem Trommlerkreis stand, ein Tamburin – ein Reebok-Karton, in dem zerbrochene Weihnachtskugeln rappelten – schüttelte und ihre kleinen Brüste hüpfen ließ. Luz war keine Tänzerin, war nie eine Tänzerin gewesen. Aber das hier war ein Elefantenrhythmus, so einfach wie das schlürfende Öffnen und Schließen der Ventile im Körper – eine gleichmachende Melodie. Sie drehte sich und stampfte mit den Füßen im trockenen Schlick des Kanals. Einen Moment war sie um Ray besorgt, dann ließ sie die Sorge fahren. Wahrscheinlich war er sich, wie es seine Art war, über ihre Situation im Klaren. Und wahrscheinlich beobachtete er sie vom Rand aus und trank das selbstgemachte Gebräu, von dem auch sie schon den ganzen Tag trank.
Und warum sollte sie nicht davon trinken? Sie hatten den hübschen grasgrünen Karmann Ghia des Hollywood-Sternchens – Ray nannte ihn »Melone« – befreit und waren aus ihrem Canyon in die ausgedörrte Stadt hinuntergefahren, zum Regentanz, der umsonst war für alle Feuerleger und Gassenpunks, die jetzt in den ausgetrockneten Kanälen von Venice Beach johlend und krakeelend herumhopsten und aus dem Betonwurm, der sich in vier Armen voll mit Schlick und Graffiti und zerfetztem Unrat zwischen den lächerlichen Bungalows hindurchwand, ihre Musik in die Luft sandten. Ray und Luz hatten im Schatten einer Fußgängerbrücke, an der die weißen Geländer abmontiert worden waren, ein Lager aufgeschlagen, und Ray hatte einen Krug mit dem Gebräu, eine Tüte Mandeln und sechs Knoblauchzehen ergattert, die der Dealer Gilroy nannte, obwohl in Gilroy seit bestimmt zehn Jahren nichts gewachsen war. Glücklicher Tag, ein Tag des Schlemmens und Feierns, denn Geld bedeutete in Los Angeles immer noch etwas, sogar im Chaos des Regentanzes, und davon hatte Luz Cortez – verdammt noch mal! – eine Menge verdient, als sie unter dem Mädchennamen ihrer Mutter als Model gearbeitet hatte, bis ihre Agentur in den schmutzigen Dunst von New York geflohen war und man Luz wegen ihres Alters nicht gebeten hatte mitzukommen.
Also schwing das Bein, Schwester. Shake, shake, shake. Stör dich nicht an dem Detail, dass auch Geld irgendwann seine Bedeutung verlieren wird. Verweile nicht mit Bitterkeit bei den Erinnerungen, was dieses Geld dich gekostet hat: die ultravioletten Blitze, die vorübergehend deine Augen versengt haben, das Honorar, das dir gestrichen wurde, weil du zum Notarzt musstest, die alten Männer, die dir in die Oberschenkel, deinen dicken Chicana-Arsch und den Babyspeck an den Achseln gekniffen oder mit dem Finger und einmal auch mit einem Bleistift in dich hineingestochen haben. Gut, du warst in Paris und Mailand und London undsoweiter und kannst dich an nichts erinnern. Aber halte dich nicht bei dem Negativen auf, auch wenn du immer zu pummelig, zu klein, zu haarig, zu alt und zu mexikanisch warst. Der Arsch zu flach, die Titten hängend, die Brustwarzen zu groß – wie Unterteller, sagte einer. Fang nicht mit dem alten Kreislauf an: Zieh das Hemd aus, und: Dreh dich um, Schätzchen, und: Beug dich vor, und: Nimm den Wurm in den Mund, Baby, du weißt, wie es geht. Werd nicht bitter, auch wenn du erst vierzehn warst und nicht wusstest, wie es geht, und es noch nie gemacht hattest, auch noch nie einen Jungen geküsst hattest. Weck nicht wieder diesen Hunger den Hunger den Hunger. Glaub nicht, dass es alles für nichts war.
Denk nicht. Tanz.
Dreh dich! Dreh dich!
Denn, Herr im Himmel, Geld war immer noch Geld, wenn das kein Grund zum Feiern war. Denn noch konnte man mit genug Geld frisches Gemüse und Fleisch und Milchprodukte bekommen, auch wenn das, was sie Käse nannten, gallertartig und im Glas war, und wenn der Fisch meist vergiftet war und stank, und wenn das Rindfleisch grau war und die Äpfel selbst in der Apfelzeit Faulstellen hatten und die Birnen matschig waren, obwohl man extra bezahlt hatte für Bartletts von einer Amish-Farm. Harte, saure Erdbeeren und staubige Brombeeren. Weiche Mohrrüben, welker Spinat, geplatzte Oliven, faulige Mangos zu hundert Dollar, saftlose Apfelsinen, verschrumpelte Zitronen, bittere Clementinen, Himbeeren mit toten Blattläusen in der Mitte, eine Avocado, deren faseriges braunes Fleisch dir Tränen in die Augen trieb.
Der Rhythmus wurde immer wilder, Luz stolperte im trockenen Schlick und fiel.
Benommen stand sie auf und taumelte stilvoll durch die Tanzenden, sie kletterte das Bankett hoch zu der schrägen Betonfläche, wo sie Ray unter der Fußgängerbrücke zuletzt gesehen hatte.
Und da war er noch und bewachte ihr Lager, den Krug mit dem Gebräu in der einen Hand, die juwelenbesetzten Sandalen des Hollywood-Sternchens in der anderen. Die Fersenriemen hatten gescheuert, fiel Luz jetzt wieder ein.
»Ich habe einen sitzen«, sagte sie und rieb sich die Stirn an seinem warmen Oberarm.
»Ich weiß«, sagte er.
»Und Durst.«
Ray kniete sich hin und stellte den Bierkrug zwischen seine Füße auf den Beton. Er nahm erst den einen von Luz’ schmutzigen Füßen und zog ihm die Sandale an, dann den anderen. Luz schwankte und lehnte sich an seinen herrlichen breiten Rücken. Als er fertig war, holte er eine Rationscola aus seinem Rucksack, das einzige Getränk, von dem alle reichlich hatten. Die Cola war warm und schal und sehr süß – sie wurde verschenkt, so ging das Gerücht, weil sie zu kippen drohte. Aber sie war Flüssigkeit, und das war Grund genug, Ray zu lieben.
Sie setzte sich und trank, und Ray stand – er saß nicht gern – und konsultierte seine Liste. Rays winziges Notizbuch, das er in einem Drugstore hatte mitgehen lassen, war im Grunde ein Spiralblock, wie Reporter sie früher benutzt hatten, und eigentlich hätte er vorm Schreiben seinen gelben Bleistift anlecken müssen, nachdem er ihn zunächst mit seinem Leatherman-Taschenmesser angespitzt hatte.
Wann immer Luz Gelegenheit hatte, las sie heimlich in Rays Notizblock, seine geheimen Gedichte und seine Zeichnungen vom Skatepark und seine Listen. Ray war ein Listenschreiber. Kein Tag seines Lebens verging, an dem er nicht eine Liste machte; Luz hatte in ihrem Leben keine Listen gemacht – so hatte jeder seins. Und so sahen seine Listen aus:
– Streichhölzer
– Salzkekse
– L
– Wasser
Oder:
– Sickergrube
– Garagentor
– L
– Wasser
Oder:
– Kerzen
– Spiritus
– Erdnüsse
– L
– Wasser
Oder:
– Axt
– Benzin
– Schuhe
– L
– Wasser
Oder:
– Grillkohle
– Feuerzeugbenzin
– Marshmallows für L
– Wasser
Oder:
– Trockenspiritus
– Augentropfen
– Kieselzinkerz
– Katzenstreu
– L
– Wasser
Oder oft auch nur:
– L
– Wasser
»He«, sagte Ray und gab ihr einen Klaps mit dem Notizblock. »Ich habe von jemandem gehört, der Blaubeeren aus Seattle hat.«
»Seattle«, flüsterte sie, das Wort an sich klang nach Regen. »Kann ich mitkommen?« Sie war noch nie auf einem Beschaffungstrip, wie Ray es nannte, dabei gewesen.
»Möchtest du?«
Luz gab ein zustimmendes Quieken von sich und trank die Rationscola aus. Hand in Hand machten sie sich auf den Weg, Ray mit phosphoreszierenden Augen, wie an dem Tag, als er in ihrem Dabeisein aus den Wellen gestiegen war.
Ray hatte dieselben brennenden Prophetenaugen wie John Muir, und wie John Muir war er mit zerrütteten Nerven und klapperdürr aus dem Krieg zurückgekommen. Das Meer hatte ihn geheilt. Seiner Schilderung nach hatte ihn ein Schiff von der Größe einer Stadt, auf dem das Symbol des Mutterlandes flatterte, im flussarmen Westen, in San Diego, ausgespien. Er wurde entlassen – ehrenhaft, irgendwo hatte er auch Medaillen –, aber auf dem gesamten Rückweg war er unruhig gewesen, schlaflos, und hatte das Dunkle mit Mühe zurückgehalten. Nichts besänftigte ihn, erst das weiße Rauschen der Brandung hatte eine glättende Wirkung. Statt also nach Hause zu fahren, ins Binnenland, befreite er aus einem Garten ein Surfbrett und machte sich in den Wellen sein Zuhause. Er hatte die Absicht, alle Krisen und Knappheiten und Konflikte der Vergangenheit und Gegenwart zu durchsurfen. Er würde die Küste in ein Vakuum verwandeln, nichts konnte dort passieren, auch nicht das, was vor seiner Geburt passiert war. Er ritt auf den Wellen, als der Colorado River für tot erklärt wurde, und er ritt auf den Wellen, als der Fluss hundert Jahre zuvor gestaut wurde. Als eine allmächtige Strömung ihn Richtung Norden und nach Los Angeles trieb, ließ er das zu. Er ritt auf den Wellen, als die Aquädukte der Stadt austrockneten. Er ritt auf den Wellen, als die Stadt neue Aquädukte baute, breitere, tiefere Aquädukte, die bis zu den wasserreichen Staaten Idaho, Washington, Montana führten und den Westen durchzogen, ein Netz grandioser offener Rohrleitungen von einer Länge von fünfhunderttausend Meilen, die sich links des hundertsten Längengrads erstreckten und dessen Architekten, wie auch die Gegner des Projekts, den Namen Baby Dunn gelegentlich erwähnten. Ray ritt auf den Wellen, als Betonwasserleitungen bis nach Alaska krochen, er ritt auf den Wellen, als die Mojave und die Sonoran an den Ausläufern der Gletscher leckten. Er ritt auf den Wellen, wann immer Terroristen und Visionäre die riesigen leeren Aquädukte in Bend und Boise, in Boulder und Eugene mit Bomben attackierten. Er ritt auf den Wellen, als Staaten einander verklagten und Gerichte die offenen Leitungen für immer schlossen. Er ritt auf den Wellen, als das Central Valley, ein halbmondförmiges Gebiet und die fruchtbarste Gegend Amerikas, zu einer Salzebene verkam und die Landwirtschaftsbetriebe regelmäßig Löcher bis in eine Tiefe von tausend Metern in die harte Erde bohrten und auf wasserführende Adern zu stoßen hofften, aber nichts als heiße Salzlauge zutage förderten; als die Bewohner der Mojave-Wüste das Grundwasser von Texas absaugten; als ein Geflecht von Interstate-Straßen auf einer Fläche von einer Quadratmeile in ein Senkloch stürzte und alle, die da unterwegs waren, in den Tod riss; als sich der ganze Südwesten durch das Absenken des Landes in eine Mondlandschaft verwandelte; als die Winde aufkamen und Phoenix in Flammen aufging und eine weißglühende Riesendüne Las Vegas unter sich begrub.
Dann, eines Tages, stieg Ray bei Point Dume aus der tosenden Vergessenheit des Pazifiks, und da, im Sand, saß ein mageres Mädchen, eine Lücke zwischen den Vorderzähnen und neben sich im Sand ein Koffer und eine Hutschachtel, und verweinte ihr Augen-Make-up.
Von Meerwasser triefend, mit bebender Brust, das Surfbrett an sich gedrückt, so näherte Ray sich dem Mädchen. Was waren seine ersten Worte? Luz konnte sich nicht erinnern, aber sie mussten sprühend gewesen sein. Sie erinnerte sich an seine Hände, die vor Kälte gerötet waren, seine wasserblauen Prophetenaugen und dass sie als Antwort sagte: »Ich habe seit Jahren niemanden surfen sehen. Ich habe ganz vergessen, dass es Surfen gibt.«
Mit unverhohlener Hoffnung fragte Ray: »Kannst du surfen?«
Sie lächelte dünn und schüttelte den Kopf. »Nicht mal schwimmen.«
»Ernsthaft? Wo bist du her?«
»Von hier.«
»Und du kannst nicht schwimmen?«
»Hab ich nie gelernt.«
Eine Weile saßen sie stumm nebeneinander im Sand, von den lockenden Wellen gebannt.
»Und woher bist du?«, fragte sie, weil sie die Stimme dieses Wilden wieder hören wollte.
»Aus Indiana.«
»Dem Hoosier-Staat.«
»Genau.« Er grinste. Er hatte einen unglaublich schönen Mund.
»Warum bist du hier?«
»Ich war in der Army.«
»Im Einsatz?«
Er nickte.
»Was hast du gemacht?«
Er zuckte die Schultern und zerdrückte einen Seetangpolypen zwischen den Fingern. »Den Vortrag kennst du schon.«
Er sagte seinen Namen, sie sagte ihren, und dann saßen sie wieder stumm da. Die Entsalzungsanlage hinter ihnen, die von der tiefstehenden Sonne mit einem korallenroten Schimmer überzogen wurde, war außer Betrieb, aber in Wahrheit war sie nie in Betrieb gewesen. Den Vortrag kannten sie auch.
Luz fragte: »Setzt du dich nach Indiana ab?«
»Nein.«
»Wohin dann?«
»Nirgendwohin.«
»Nirgendwohin?«
»Nirgendwohin.«
Er erzählte vom Meer, wie sehr er es gebraucht habe, und als sie Washington State vorschlug, sagte er, Kalifornien habe ihn geheilt, jetzt würde er hier nicht weggehen. Und später erzählte er ihr von seiner jüngeren Schwester, die ohne Gehirn geboren war, nur mit dem Hirnstamm – was ein bisschen wie Hirnstumpf klang –, und die angeblich keine zwei Wochen überleben konnte, aber inzwischen einundzwanzig war und immer noch atmete, weil eine Maschine das für sie machte. Luz musste an eine Eiserne Lunge denken, aber das war nicht ganz dasselbe. Ein falsches Staubkorn konnte sie umbringen, sagte Ray. Ein einziges Staubkorn. Und deshalb würde seine Mutter die ganze Zeit putzen, fieberhaft putzen, mit Reinigungsmitteln, die von der Regierung geschickt wurden. Sie wollte Ray nicht im Haus haben. »Es wächst ihr über den Kopf«, sagte er. »Außerdem haben sie in Washington State ziemlich strenge Einreiseauflagen, und die einzigen Fähigkeiten, die ich besitze, möchte ich nie wieder benutzen.«
»Du hast Charme«, sagte sie. »Charisma.«
»Ich glaube, die haben da alles an Charisma, was sie brauchen können.«
»Du kannst surfen.«
»Das habe ich sogar in meiner Bewerbung geschrieben.«
»Und was ist damit passiert?«
»Ist im Schlund eines Killerwals verschwunden.«
Viele Leute sagten, sie würden bleiben, aber Ray war der Erste, dem Luz glaubte. »Und was hast du jetzt vor?«, fragte sie.
»Ich kenne ein paar Leute, die hier ein Haus haben. Und wenn nicht – Leute aus Indiana hauen nicht ab. Leute aus Kalifornien schon. Nimm’s nicht persönlich. Ihr habt einfach eine Rastlosigkeit im Blut.«
»Ich nicht«, sagte sie, aber er redete weiter.
»Eure Leute sind hergekommen, weil sie etwas Besseres suchten. Gold, Ruhm, Zitrus. Phantasmen. Sie waren leichtgläubig, richtig? Ränkeschmiede. Deswegen will sie jetzt keiner. Mojavs.«
Er machte nur Spaß, aber das Wort war ein Stich, in dem Moment, und auch da, wo Schilder an Fabriken hingen, in Houston und Des Moines, handgemalte Schilder an den Toren von Wohnanlagen in Knoxville und Beaumont, oder mit schiefen Plastiklettern auf den Markisen der Grundschulen in Indianapolis: MOJAVS unerwünscht. Keine Arbeit für Mojavs. Kein Zutritt für Mojavs. Ein Kindervers, der auf den feuchten Spielpätzen der Nation gesungen wurde, ging so: Die Rosen, sie welken / Orangenbäume gibt’s keine mehr / Auf den Köpfen der Mojavs / spazieren die Läuse umher.
Aber Ray lächelte, und auch diesmal war Luz von seinem freundlichen Mund beruhigt. »Wir sind Bleiber«, sagte er, aber eigentlich meinte er, das wusste sie, dass sie zusammen Mojavs sein konnten.
Ray schob ihr eine Haarsträhne aus den Augen und sagte: »Du siehst aus, als würde ich dich kennen.« Hatte er sie schon einmal gesehen? Luz sagte, vielleicht, und beschrieb verlegen die ramponierte Plakatwand am Sunset Boulevard, auf dem sie in billigem BH und Höschen zu sehen war, die Augen wie zwei Veilchen geschminkt, über einen Männerarsch gebeugt, als wollte sie hineinbeißen. Zeig deine verrückten Zähne, hatte der Artdirector gesagt, noch nicht einmal geflüstert. Ein Streifen des Plakats hatte sich gelöst, so dass ihre nackten Beine geschrumpft aussahen, im Verschwinden begriffen. »Der Höhepunkt meiner Karriere«, sagte sie. »Von einer Werbung für Weinkühler abgesehen.«
Ray sagte: »Nein, woanders«, und da küsste Luz ihn.
Danach war es zwischen ihnen wieder still, aber es fühlte sich nicht wie Schweigen an. Es fühlte sich wie Frieden an.
Ray fragte: »Und du? Willst du dich absetzen?«
Man wurde mit Bussen weggebracht. Auf Lager verteilt in Louisiana, Pennsylvania, New Jersey. Man wusste nicht, in welches Lager man geschickt wurde, aber eigentlich war das auch gleichgültig. Es sei vorübergehend, hieß es. Das Beste, was man tun konnte, wenn man helfen wollte. Sie war anderer Meinung, aber sie war für einen Transport gemeldet. Der Koffer neben ihr war gestopft voll mit Büchern und Designerklamotten, die Hutschachtel mit ihren Ersparnissen. Aber sie mochte Menschenansammlungen nicht, sie mochte keine Menschen, außer dem einen, der neben ihr saß. Sie hatte den plötzlichen und heftigen Wunsch, am nächsten Tag nicht in einen Bus zu steigen. Sie wollte sich lieber verlieben. Sie machte sich selbst Angst, als sie sagte: »Ich hatte es vor.«
Also nahm Ray sie mit zu sich, in die ausgeräumte Wohnung in Santa Monica, wo seine Freunde in kleinem Widerstand ausharrten. Auf Rays Campingmatratze in der Wäschekammer schliefen sie miteinander. Danach sagte er: »Du musst mir versprechen, dass du nicht über den Krieg sprichst.«
Sie sagte: »Und versprich du mir bitte, nicht über das Wasser zu sprechen.«
Er sagte: »Ich käme nicht im Traum drauf.«
Inzwischen dämmerte es in den trockenen Rinnen, wo der Regentanz stattfand. Luz folgte Ray auf der Betonrampe und dann, obwohl es ihr Angst machte, in einen mannshohen, rostigen Abflusskanal aus Wellblech, wo angeblich der Beerenmann zu finden war. Drinnen schlug ihnen Gestank entgegen, heiß, nach Fäkalien. In der Dunkelheit war ein Kratzen, dann ein Kreischen zu hören. Als das Licht vom Eingang schwand, legte Luz sich die Hand vor den Mund und suchte mit der anderen Halt bei Ray. Hier, das ging ihr durch den Sinn, war es nicht gut, eine Frau zu sein.
Die Riemen der Sandalen des Hollywood-Sternchens schnitten ihr wieder in die Fersen, und Luz stolperte. »Alles klar?«, flüsterte Ray. Sie nickte, obwohl ihr schwindlig und heiß war und sie unter den Schläfenknochen einen neuen Druck spürte, und obwohl Ray in dieser unterirdischen Dunkelheit ihr Nicken wohl kaum sehen konnte.
Bald hatten sich ihre Augen so weit an die Dunkelheit gewöhnt, dass sie Rays Silhouette vor sich erkannte. Mit einer Hand hielt sie sich an ihm fest, mit der anderen fuhr sie an der metallenen Seitenwand entlang, zuckte bei rostigen Splittern zusammen und stolperte über kniehohe Haufen Unrat und vertrocknete Abwässer. Der Tunnel verzweigte sich, und Ray musste sich in der niedrigen Röhre krümmen. Jetzt waren menschliche Stimmen zu hören, Handeln und Feilschen hallte in der Röhre wider.
Frische Socken, reine Baumwolle.
Ovomaltine, eine ganze Dose, he!
Luz und Ray schoben sich weiter nach vorn, aber die Röhre war bald von der kollektiven stinkenden Lethargie der Menge blockiert. Wohin sie sich auch wandten, immer versperrten Menschen ihnen den Weg. Luz hätte gern spanische Stimmen gehört, als Erinnerung an ihre Mutter, aber auch hier war kein Spanisch zu hören, schon vor langer Zeit war Influx zu Exodus geworden. Ray warf die Wörter Blaubeeren und Seattle in das Getümmel, und was zurückkam, war: Nicht bei mir, Weißer. Weiter rein, Bruder. Und dann: Hm-hm. Aufpassen. Er ungut.
Schließlich rief Ray Blaubeeren in die Menge und hörte: Hier, mein Junge. Aus der Dunkelheit trat ein Muskeltyp mit freiem Oberkörper, die Haut fahl, der kahle Kopf glänzend, ein schmaler Mund, in dem ein schwarzes Plastikrührstäbchen steckte. Neben ihm stand ein Filipino mit vernarbten Händen und einem Rucksack.
Der Muskeltyp hielt eine Coladose in die Höhe. »King County Blaubeeren. Einsfünfzig.« Ray nahm die Dose und prüfte den Inhalt. Er reichte sie an Luz weiter. Eine Handvoll Blaubeeren bedeckte den Boden der Aluminiumdose. Luz hielt sich die Dose unter die Nase und glaubte säuerlichen Beerengeruch riechen zu können.
»Ich geb dir fünfundsiebzig«, sagte Ray.
Der Muskeltyp verneigte sich vor der Dose. »Bei allem Respekt, Jüngelchen, das hier sind voll saftige Beeren. Saftiger als Muschi.« Er zwinkerte Luz zu. »Muss schon hundert dafür haben.«
»Gut, dann achtzig.«
»Achtzig«, sagte der Muskeltyp zu seinem Kompagnon. Er zog die Luft durch die Zähne.
Der Filipino sagte: »Früher konnten auch Nigger in dieser Stadt überleben.«
»Mehr hab ich nicht«, sagte Ray, obwohl das nicht stimmte.
»Mehr hast du nicht, wie?«, sagte der Muskeltyp. Er streckte die Hand nach der Dose aus. Luz gab sie ihm, aber statt sie zu nehmen, stach er mit seinem langen Fingernagel durch das Tennisarmband des Hollywood-Sternchens, das immer noch Luz’ Handgelenk wie Tautropfen schmückte. Er zerrte daran, aber das Armband hielt stand. Luz stockte der Atem.
»Glaub ich kaum«, sagte der Typ.
»He«, sagte Ray, aber Luz sagte schnell: »Nehmen Sie«, und ihre Finger fummelten nervös an dem Verschluss.
Der Muskeltyp warf ihr die Hand zurück. »Für wen hältst du mich, he?« Zu Ray sagte er: »Zweihundert.«
Ray gab dem Muskeltypen zwei Scheine – er hatte sie zuvor aus der Hutschachtel genommen, die sie im leeren Whirlpool des Hollywood-Sternchens versteckt hielten –, nahm die Dose mit den Beeren und zog Luz mit sich fort. Ihr drehte sich alles im Kopf, sie hatte die Orientierung völlig verloren. Sie wollte allein weglaufen, wusste aber nicht, ob sie den Weg durch die Rohrleitungen finden würde. Ihr blieb nichts anderes übrig, als hinter Ray herzugehen, der im Dunkeln immer wieder unsichtbar wurde, dann zum Vorschein kam und sie hinter sich herzog. »Mensch!«, flüsterte er, und damit meinte er: Mensch, pass besser auf, und: Mensch, du bist so blöd, und: Mensch, ich liebe dich, und ich habe nur dich, und deshalb hast du die Aufgabe, besser auf dich aufzupassen. Luz blickte nach vorn und suchte nach einem Schimmer des Tageslichts, das sie verlassen hatten, aber sie sah überall nur Menschen, viele Menschen. Jemand trat auf die Ferse ihrer Sandale, und sie stolperte. Sie musste weg von diesen Leuten, weg, aber sie waren überall. Jetzt führte Ray sie barmherzigerweise zu einer freien, dunklen Stelle.
Langsam erkannte sie den Kreis von Körpern, den sie durchbrochen hatten. Die Menschen starrten sie mit offenen Mündern an. Nein, nicht sie starrten sie an. Luz folgte den Blicken der Menschen und sah neben sich eine alte Frau, die auf einem Gartenklappstuhl aus Metall saß. Sie trug ein Kleid, das einst sehr prächtig gewesen sein musste, jetzt aber fadenscheinig und voller Brandlöcher war. Die Frau trug Wasserschuhe, und auf ihren beiden von Leberflecken verunzierten Schultern saß je ein riesiger Ara, einer rot, einer blau.
Luz blieb stehen, gebannt von den Vögeln. Der Kreis der Menschen kam näher. Der rote Ara hatte eine Nuss oder einen Stein im Schnabel und bearbeitete ihn mit seiner schauerlichen, fingerartigen schwarzen Zunge. Er ruckte mit dem Kopf. Er zwinkerte mit einem blutunterlaufenen Auge.
Plötzlich atmete Luz die faule Atemluft der Menschen ein und wieder aus, Ray war wütend, er war verschwunden, die Luft hier unten wurde knapp, alle wollten davon atmen, und wo war Ray jetzt? Hatte er nicht davon gehört, dass Mädchen aus dem Kanal in die leeren Häuser verschleppt wurden, deren Anleger jetzt im Trockenen lagen und über ihnen in den Kanal ragten – Häuser, die einmal drei oder vier oder fünf Millionen wert gewesen waren und jetzt allesamt als öffentliche Bedürfnisanstalten benutzt wurden? War er nicht bei ihr gewesen, als sie eines Abends eine abgezehrte und verwirrte Frau aus einem der Häuser hatte torkeln sehen, die zurück in den Kanal und zu der Musik runtersteigen wollte, nur um sofort wieder nach oben gezerrt zu werden?
Luz trat einen Schritt von den Vögeln zurück und rempelte einen streichholzdürren Jungen an. Er trug ein weißes T-Shirt, auf das mit schwarzem Marker irgendein gemeiner Spruch geschrieben war und das statt Ärmeln nur Löcher hatte, durch die man seine magere, tätowierte Brust sehen konnte. Seine Jeans hatte in einem Bein einen langen Riss, der mit Dutzenden von Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurde, wie Heftklammern im Fleisch. In der Hand hatte er ein Seil, an dessen Ende ein strohfarbener Hund mit struppigem Fell nach Luft schnappte. Der Junge legte Luz seine raue Hand auf die nackte Haut zwischen den Schulterblättern und rieb sie.
»Immer sachte, Puppe«, sagte er. Aus seinem Mund kam fauliger Geruch.
Ein bleierner, bösartiger Griff legte sich um ihren Herzmuskel. Sie machte sich frei. »Ich kriege keine Luft«, sagte sie, hauchte es nur.
Ray drehte sich um. »Was ist?«
»Ich kriege keine Luft.«
»Was soll das heißen?«
»Ich sterbe.«
Er legte ihr die Hand auf den Nacken.
»Ich kriege keine Luft«, sagte sie. »Ich kriege einfach keine Luft, verdammte Scheiße.«
Ray lachte nicht, obwohl es lächerlich war. Luz wusste das selbst, auch in diesem Moment, nur dass das Bewusstsein davon unter dem Gefühl, an der Vogelzunge und dem Muskeltypen und der Puppe zu ersticken, vergraben lag.
»Es ist alles gut, glaub mir«, sagte er. »Hör zu.«
Sie griff mit beiden Händen nach seinem Hemd und zog daran. »Ich kriege keine Luft, Ray.«
»Es ist alles gut, wirklich«, sagte er. »Sag es mir.«
Einer der Vögel gab ein unglaublich lautes Krächzen von sich, und Luz erschauderte. Erneutes Krächzen, und sie klammerte sich an Rays Hosenbund. Die Menschen sahen zu ihnen her, manche lachten, und sie hatte den Wunsch, ihren Freund aufzureißen und sich in ihm zu verstecken.
Ray nahm ihre fahrigen Hände in seine, wie ein Geschenk, und sah ihr in die Augen. »Es ist alles gut«, sagte er wieder. »Sag es mir.«
»Es ist alles gut«, sagte sie, aber gleichzeitig starb sie auch.
»Sag es mir noch einmal.«
Sie sah ihn an, sie atmete. »Es ist alles gut.«
»Wir gehen weiter«, sagte er und nahm sie bei den Schultern.
Sie gingen und atmeten und gingen und atmeten, und bald sahen sie eine schwache Scheibe Licht vor sich schweben. Ray führte sie darauf zu, es war wie ein Wunder, und Luz sagte: »Es ist alles gut, es ist alles gut, es ist alles gut, es ist alles gut.«
Ihre Decke – eine Bettdecke für Gäste aus dem Haus des Hollywood-Sternchens – lag noch unter der Brücke, als sie wieder hinkamen, und auch das war ein Wunder. Ray bedeutete Luz, sie solle sich setzen. Er gab ihr seine Trinkflasche, sie wies sie zurück, darauf gab er ihr ihre eigene.
Sie trank, und er beobachtete sie.
»Danke«, sagte sie nach einer Zeit.
»Möchtest du, dass wir nach Hause gehen?« Er wollte das Feuer sehen, das wusste sie. Er sagte: »Es ist in Ordnung, wenn du nach Hause möchtest.«
Am liebsten hätte sie ein paar Ativan eingeworfen und eine Flasche Rotwein getrunken, aber diese Zeiten waren vorbei. Im Kanal war es jetzt kühler, die Luft frischer, oder wenigstens regte sie sich. Die langen Schatten der reichen Häuser gaben ihnen Schutz, die Decke war nicht gestohlen worden, Ray war da, und er gab sich Mühe. Sie sagte sich, dass sie aus alldem Trost schöpfen konnte.
»Nein«, sagte sie, »lass uns bleiben.« Sie saß auf der Decke und atmete ein und aus. Nach einer Weile fragte Ray sie, ob sie wieder zum Regentanz gehen wolle.
»Können wir einfach ein bisschen hierbleiben?«, fragte sie.
»Natürlich.«
»Es tut mir leid.«
»Muss dir nicht«, sagte Ray, und das sagte er immer. Er bedeutete ihr, sie solle sich ausstrecken und ihren Kopf auf seinen Schoß legen. Das tat sie. Sie schlief ein und schlief traumlos.
Luz wachte auf, weil sie pinkeln musste. Es war fast dunkel, aber entlang des Kanals glühten die Lagerfeuer, und das weiter unten brannte am hellsten. Ray hatte sich die Schuhe ausgezogen und lag auf dem Rücken. Luz saß neben ihm und betrachtete ihn im rauchgeschwängerten Licht: die feinen Hände, die ebene Brust, die schwarzen Haarbüschel in der Kuhle unter den Schlüsselbeinen, über dem Halsausschnitt seines T-Shirts kaum zu sehen. Die flachen, leicht gespreizten Füße. Alles an ihm schien Beständigkeit zu versprechen. Sie stand auf und küsste ihn auf den Kopf. »Ich muss mal.«
Ray wollte aufstehen.
»Es geht schon«, sagte sie. »Ich komme klar.«
Luz kletterte an der Seitenwand des Kanals hoch. Der Graben dahinter war dunkel und verströmte einen warmen Gestank, aber sie fühlte sich besser. Sie grätschte über den Graben, hob das Kleid an und urinierte, dann schüttelte sie die Tropfen ab und richtete sich wieder auf. Doch, sie fühlte sich besser. Die Sonne war untergegangen, die Kanäle kühlten ab, der kurze Schlaf hatte das Dröhnen in ihrem Kopf verscheucht, so gut das ein Kurzschlaf konnte. Sie fühlte sich besser. Sie würde Wasser trinken, etwas essen. In Rays Rucksack waren die Blaubeeren, in seinem Krug war noch von dem Gebräu. Es ging ihr besser. Sie würden zusammen wieder zu dem Trommlerkreis gehen. Sie würden tanzen. Um das Feuer herum. Sie hätte doch nicht alles kaputtgemacht.
Als sie wieder zu dem staubigen Kanal runterkletterte, sah sie zu dem Feuer in der Ferne, und noch weiter, wo jemand einen Molotowcocktail hatte hochgehen lassen. Sie sah die kleine Rauchwolke und hörte den Knall. In dem Moment – in exakt diesem Augenblick, als sie den Knall hörte, so dass der Moment für immer als kleine Explosion in ihrem Kopf eingegraben blieb – prallte etwas an ihre Knie. Sie sah zu Boden und erblickte ein zitterndes Kind mit blondem Struwwelkopf, das sich um ihre Waden schlang.
Luz hatte keine Erinnerung, wann sie zum letzten Mal einen kleinen Menschen gesehen hatte. Das Kind war vielleicht zwei Jahre alt. Ein Mädchen, das erspürte Luz, obwohl es nur eine schmutzige Windel trug. Das Kind sah zu Luz hinauf, die Augen wie graublaue Münzen in tiefen Augenhöhlen. Die Haut war durchscheinend, larvenartig, und Luz stellte sich vor, dass sie den Bauch des Kindes untersuchte und durch die Bauchdecke die Schatten der inneren Organe sehen könnte.
»Na du«, sagte Luz.
Das Kind sah sie unverwandt mit seinen Münzaugen an.
»Hast du dich verlaufen?«, fragte Luz. »Wo ist deine Mommy?« Das Kind hatte eine vorgewölbte Stirn, die es jetzt in Luz’ Schritt presste. Luz, die das verlegen machte, versuchte, das Kind von sich zu lösen. Aber es klammerte sich nur noch fester an sie und wimmerte mit hoher, kummervoller Stimme. Luz verging vor Mitleid.
»Schsch«, sagte sie. »Es wird alles gut.« Luz klopfte dem Kind leicht auf den Rücken und fuhr ihm spontan durch das weißblonde Haar, das im Nacken wie Eischnee zu einer Spitze geformt war. Sie löste die Umklammerung des Kindes und kniete sich vor ihm hin. Das Mädchen kletterte Luz in den Schoß, schlang ihr die dünnen Ärmchen um den Hals und schluchzte. Luz, im Schlick kniend, hielt das Kind, und ihr Kleid spannte an den Beinen. Gleich würde jemand kommen, dachte sie, und das Kind holen, aber niemand kam. Niemand kümmerte sich im allermindesten um sie beide.
Nach kurzer Zeit hörte das Kind auf zu weinen. Es betrachtete Luz mit Neugier und legte ihr dann eine Hand aufs Gesicht, mit der es Luz’ rechtes Auge halb verdeckte. Die kleine Hand war feucht von Rotz und Spucke und glatt wie eine nasse Wurzel.
»Wo sind deine Mama und dein Papa?«, fragte Luz wieder.
Das Kind beachtete die Frage nicht, falls es sie verstand. Es drehte die Hand und legte sie Luz quer über die Stirn. Das Kind presste konzentriert die Lippen zusammen. Dann legte es auch die andere Hand auf Luz’ Gesicht, als gewönne es aus der Berührung Erkenntnisse. Luz fühlte sich seltsam entspannt. Der Regentanz war in den Hintergrund gerückt, sie beide waren allein im rauchgefüllten Zwielicht, nur die Lagerfeuer loderten lockend in der Ferne. Luz lächelte, und das Kind lächelte auch, und als es lächelte, spürte Luz das Aufwallen von großer Wärme, Wärme zu dem Kind und von dem Kind ausgehend.
Dann sagte das Kind, ohne die Hände von Luz’ Gesicht wegzunehmen: »In Ohr?«
»Ins Ohr?« Luz versuchte zu verstehen.
Das Kind machte ein angestrengtes Gesicht. »In Ohr sagn?«, sagte es wieder.
»Aha«, sagte Luz. »Na gut.«
Das Kind streckte sich zu Luz’ Ohr hin. Luz gab sich Mühe zu verstehen, was das Kind sagte, aber dann begriff sie, dass es keine Worte sprach, sondern nur ein leises Wispern machte. »Pspspsp.«
Als es fertig war, lehnte es sich zurück und sagte mit großem Ernst: »Nieman sagn, ja?«
»Ist gut.«
»Nieman.«
»Niemand.«
In dem Moment durchbrach eine Gestalt die Dämmerung und näherte sich ihnen. Es war Ray, der ein völlig erstauntes Gesicht machte, als er Luz am Boden knien und mit dem Kind flüstern sah. »Was ist hier los?«, fragte er.
»Sie hat sich verirrt«, sagte Luz.
»Hast du jemanden gefragt?«
»Ich habe sie gerade erst gefunden.«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.