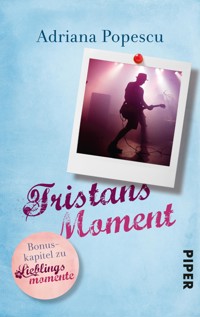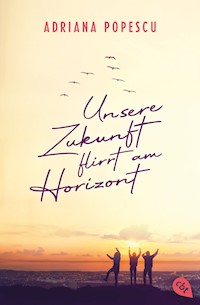12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine große Liebe, die nicht sein durfte, und eine Freundschaft, die mit jedem Kilometer wächst. Eine rüstige alte Dame begibt sich mit ihrer jungen Pflegerin auf eine Reise quer durch Osteuropa, um die Liebe ihres Lebens wiederzusehen. Ein warmherziger Frauenroman mit viel Herz und Humor von Erfolgsautorin Adriana Popescu! Die rüstige Altenheimbewohnerin Frau Kaiser weiß etwas über Karla, das sie nicht wissen sollte. Sie erpresst die junge Pflegehelferin damit, um von ihr in einem alten Renault quer durch Europa kutschiert zu werden. Wohin? Das wird Karla schon noch sehen. Warum? Das geht sie nichts an. Karla soll einfach nur fahren – möglichst schnell, denn viel Zeit bleibt ihnen nicht. Aus Kaisers Koffer blitzt eine goldene Medaille. Eine Erinnerung an längst vergangene Tage, als sich zwei junge Schwimmer bei den Olympischen Sommerspielen 1956 in Melbourne fanden, aber nicht lieben durften ... Adriana Popescu, 1980 in München geboren, arbeitete als Drehbuchautorin für das Deutsche Fernsehen, bevor sie als freie Redakteurin für verschiedene Zeitschriften und schließlich als Autorin für mehrere renommierte Buchverlage Romane schrieb. Sie lebt mit großer Begeisterung in Stuttgart. Über "Goldene Zeiten im Gepäck" sagt sie: »Mein Herzensprojekt und ein Ende, bei dem ich geweint habe. Wer da übrigens nicht weint, hat sich ein Betonherz gießen lassen! Dazwischen muss man aber, wie ich hoffe, ganz viel und herzhaft lachen.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Goldene Zeiten im Gepäck« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
Für Măiţa, Nicoleta und Alina.Für immer. Und alles danach.
© Piper Verlag GmbH, München 2019© Adriana Popescu 2018. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Michael Gaeb.Covergestaltung: FAVORITBUERO, MünchenCovermotiv: Chip Simons / GettyImages und Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com
Inhalt
Cover & Impressum
Kapitel eins
Karla
Kapitel zwei
Karla
Kapitel drei
Karla
Kapitel vier
Elisabeth
Kapitel fünf
Karla
Kapitel sechs
Karla
Kapitel sieben
Elisabeth
Kapitel acht
Karla
Kapitel neun
Elisabeth
Kapitel zehn
Karla
Kapitel elf
Karla
Kapitel zwölf
Elisabeth
Kapitel dreizehn
Karla
Kapitel vierzehn
Karla
Kapitel fünfzehn
Elisabeth
Kapitel sechzehn
Karla
Kapitel siebzehn
Karla
Kapitel achtzehn
Elisabeth
Kapitel neunzehn
Karla
Kapitel zwanzig
Karla
Kapitel einundzwanzig
Elisabeth
Kapitel zweiundzwanzig
Karla
Kapitel dreiundzwanzig
Elisabeth
Kapitel vierundzwanzig
Karla
Kapitel fünfundzwanzig
Elisabeth
Kapitel Sechsundzwanzig
Karla
Kapitel siebenundzwanzig
Karla
Kapitel achtundzwanzig
Elisabeth
Kapitel neunundzwanzig
Karla
Kapitel dreißig
Karla
Kapitel einunddreißig
Elisabeth
Kapitel zweiunddreißig
Karla
Kapitel dreiunddreißig
Karla
Kapitel vierunddreißig
Elisabeth
Kapitel fünfunddreißig
Karla
Kapitel sechsunddreißig
Elisabeth
Kapitel siebenunddreißig
Karla
Kapitel achtunddreißig
Elisabeth
Kapitel neununddreißig
Karla
Kapitel vierzig
Elisabeth
Kapitel einundvierzig
Karla
Kapitel zweiundvierzig
Elisabeth
Kapitel dreiundvierzig
Karla
Kapitel vierundvierzig
Elisabeth
Kapitel fünfundvierzig
Karla
Kapitel sechsundvierzig
Elisabeth
Kapitel siebenundvierzig
Karla
Kapitel achtundvierzig
Karla
Kapitel neunundvierzig
Elisabeth
Kapitel fünfzig
Karla
Kapitel einundfünfzig
Karla
Kapitel zweiundfünfzig
Elisabeth
Kapitel dreiundfünfzig
Karla
Kapitel vierundfünfzig
Karla
Kapitel fünfundfünfzig
Elisabeth
Kapitel sechsundfünfzig
Karla
Kapitel siebenundfünfzig
Karla
Kapitel achtundfünfzig
Elisabeth
Kapitel neunundfünfzig
Karla
Kapitel sechzig
Karla
Kapitel einundsechzig
Elisabeth
Kapitel zweiundsechzig
Karla
Kapitel dreiundsechzig
Elisabeth
Kapitel vierundsechzig
Karla
Kapitel fünfundsechzig
Karla
Kapitel sechsundsechzig
Elisabeth
Kapitel siebenundsechzig
Karla
Kapitel achtundsechzig
Elisabeth
Kapitel neunundsechzig
Karla
Kapitel siebzig
Karla
Kapitel einundsiebzig
Elisabeth
Kapitel zweiundsiebzig
Karla
Kapitel dreiundsiebzig
Karla
Kapitel vierundsiebzig
Elisabeth
Kapitel fünfundsiebzig
Karla
Kapitel sechsundsiebzig
Karla
Kapitel siebenundsiebzig
Karla
Kapitel achtundsiebzig
Elisabeth
Kapitel neunundsiebzig
Karla
Kapitel achtzig
Karla
Kapitel einundachtzig
Elisabeth
Kapitel zweiundachtzig
Karla
Kapitel dreiundachtzig
Karla
Kapitel vierundachtzig
Elisabeth
Kapitel fünfundachtzig
Karla
Kapitel sechsundachtzig
Karla
Kapitel siebenundachtzig
Elisabeth
Kapitel achtundachtzig
Karla
Kapitel neunundachtzig
Elisabeth
Kapitel neunzig
Karla
Kapitel einundneunzig
Elisabeth
Kapitel zweiundneunzig
Karla
Kapitel dreiundneunzig
Elisabeth
Kapitel vierundneunzig
Karla
Nachwort
DANKSAGUNG
Kapitel eins
Karla
Stuttgart, 1. August 2017, 09:30 Uhr
Zimmernummer elf.
Obwohl ich das hier schon seit knapp einem halben Jahr mache, schlägt mir das Herz noch immer so hektisch in der Brust, als wäre es das erste Mal. Tief durchatmen, anklopfen, entspannt wirken.
In Filmen öffnet sich die Tür in solchen Szenen immer sofort, aber in der Realität warte ich. Und warte ich. Und warte ich. Die schlurfenden Schritte auf der anderen Seite der braunen Holztür sind unerträglich langsam. Nervös werfe ich einen Blick den hellen Flur hinab, aber weit und breit ist niemand zu sehen.
»Moment noch. Bin gleich da.«
Der tiefe Bariton, der gefiltert durch das Holz zu mir dringt, lügt, denn es vergehen weitere Ewigkeiten, bis Herr Römer mir endlich öffnet. Doch dann steht er da, in seinem karierten Tweedjackett, der beigen Cordhose, dem gänzlich ergrauten, sauberen Kurzhaarschnitt und mit einem strahlenden Dritte-Zähne-Lächeln, das dezent nach Kräuterbonbons riecht.
»Frau Metuschke, da sind Sie ja endlich.«
Er klingt erleichtert, und ich verkneife mir einen Kommentar darüber, dass ich hier schon länger warte und kurz davor war, mir einen Kaffee zu holen. Stattdessen versuche ich, die Dinge ein wenig zu beschleunigen.
»Haben Sie das Geld?«
Er nickt verschwörerisch und greift in die Innentasche des Jacketts, zieht ein kleines Bündel Geldscheine hervor und beginnt – in Zeitlupe – die Scheine abzuzählen. Manchmal frage ich mich, ob die alten Leute hier einfach verdrängen, dass sie nicht mehr allzu lange zu leben haben.
»Stimmt so.«
Herr Römer zwinkert mir zu. Das Trinkgeld ist höher als nötig. Kurz wirft mein schlechtes Gewissen meinem Großhirn einen vorwurfsvollen Blick zu, was ich jetzt wirklich nicht gebrauchen kann. Den Gewissensblick, nicht das Großhirn – denn ohne das bin ich aufgeschmissen. Ohne das Geld allerdings auch.
»Für Ihre Mühen.«
Ach, was soll’s! Ich nehme das Geld und reiche ihm eine kleine Plastiktüte mit vierzehn fein säuberlich gedrehten Zigaretten. Römers Lächeln wird noch breiter, als er sie annimmt und dorthin verschwinden lässt, wo das Geld herkam.
»Danke, Herr Römer.«
»Ich habe zu danken. Seit gestern ist es nämlich wieder richtig schlimm geworden, wissen Sie?«
Er massiert seine knochigen Finger und sieht mich ernst an, aber ich habe heute einfach keine Zeit für Kaffee, Kekse und Krankengeschichten. Ich muss weiter.
»Nächste Woche, gleiche Zeit?«
Römer nickt und tippt sich an die Nase wie Paul Newman und Robert Redford im Film Der Clou. Weil ich nicht so sein will, tue ich es ihm gleich. Gut möglich, dass diese Unterhaltung das Highlight seines Tages ist. Wer weiß? Ich habe jedenfalls noch nie mitbekommen, dass ihn hier irgendwer besucht. Außer mir.
Bevor jemand etwas von unserem kleinen Deal mitbekommt, verabschiede ich mich und marschiere den Flur entlang in Richtung Aufzug. Das Quietschen meiner Billigplastik-Crocs auf dem polierten Linoleumfußboden unterstreicht dabei jeden meiner schnellen Schritte, während meine weiße Stoffhose mit dem zugehörigen weißen Männershirt dank des verboten hohen Polyesteranteils fröhlich um die Wette knistert. Nein, zu überhören bin ich in der vormittäglichen Stille des Seniorenheims leider nicht.
Aus der Ferne und mit hoher Dioptrie wirke ich sogar wie eine kompetente Pflegekraft. Aber weit gefehlt. Ich bin weder kompetent noch eine echte Pflegekraft. Ich bin Karla Metuschke, unausgebildete Pflegehelferin und selbstständige Teilzeitdealerin. Ich weiß, das klingt ebenso absurd wie abwegig, entspricht aber leider genau meiner Realität.
»Frau Metuschke!«
Die schrille Stimme gehört meiner Chefin Martha Geiger, der Bereichsleiterin unserer Station. Sie erwischt mich genau in dem Moment, als ich in den offenen Aufzug verschwinden will. Verdammt. Gnadenlos schließt sich die Tür vor mir, während ich mich langsam zu meiner Vorgesetzten umdrehe.
»Wieso sind Sie nicht längst im Gewächshaus und bereiten die Pflanzen für den Kurs vor?«
Wenn ich ihr diese Frage wahrheitsgemäß beantworten würde, hätte ich a) die Polizei am Hals und b) keinen Job mehr. Also versuche ich mich stattdessen an einem freundlichen Lächeln.
»Bin gerade auf dem Weg.«
»Das will ich auch schwer hoffen. Ach, und achten Sie heute bitte darauf, dass Sie nicht wieder zu spät mit Ihrer Mittagsrunde fertig werden. Es ist wirklich wunderbar, dass Sie so viel Interesse an den Bewohnern zeigen, aber wir haben auch einen Zeitplan, der eingehalten werden will. Ja?«
»Ja. Klar. Mache ich.«
Warum wir nicht einfach ein bisschen mehr Zeit für ein bisschen mehr »Interesse an den Bewohnern« in den Zeitplan aufnehmen, frage ich lieber nicht, denn ich bin hier, um zu arbeiten, nicht um Fragen zu stellen. Das hat mir Frau Geiger von Anfang an klar zu verstehen gegeben.
»Und wenn wir schon dabei sind …«
Ich blende das, was die Geiger herunterleiert, aus und beobachte stattdessen interessiert, wie ihr blonder Damenbart beim Sprechen hin und her wippt. Denn ich weiß genau, was sie sagt, und ich kann es nicht mehr hören.
Seit gut einem Jahr bin ich jetzt als Pflegehelferin in der Seniorenresidenz Schattige Pinie im wunderschönen Stuttgarter Süden angestellt und erledige jede Arbeit, die mir zugeteilt wird. Meistens helfe ich den Bewohnern einfach nur bei so alltäglichen Dingen wie Waschen, Anziehen oder beim Essen, und natürlich muss ich das alles als unausgebildete Hilfskraft ohne Tariflohn fein säuberlich dokumentieren, damit das ausgebildete Pflegepersonal weiß, wie viel Tee Herr Römer oder Frau Zimmermann heute getrunken hat. Manchmal schummle ich meinen Alten ein paar Milliliter mehr auf das Krankenblatt, damit sie keinen Ärger mit den echten Pflegerinnen bekommen. Deswegen ist noch keiner gestorben, aber es entschärft die Situation für die alten Leute ungemein.
Jetzt bin ich also hier als feste Aushilfe gestrandet und erledige die Aufgaben, die mir aufgetragen werden. In der Patientenbetreuung und neuerdings auch als Hüterin des Gewächshauses. Zum einen bedeutet das, dass ich einmal in der Woche einen Kurs geben muss, in dem ich den Senioren etwas über die Schönheit der Fauna erkläre, damit sie geistig fit und agil bleiben, zum anderen hat es irgendwie dazu geführt, dass ich zur Kleinanbauerin von Marihuana geworden bin, und der kleine Rest meiner letzten Ernte befindet sich gerade neben einem Bündel Geldscheinen in meiner Brusttasche – wie mir siedend heiß einfällt. Mein Herz beginnt wieder, wie wild zu schlagen.
Umso wichtiger ist es jetzt, dass ich nicht negativ auffalle, und – wenn wir schon dabei sind – auch nicht positiv. Wirklich zu gelingen scheint es mir aber nicht, denn Geigers Lippen sind inzwischen quasi nicht mehr existent. Vielmehr bilden sie einen feinen, strengen Bleistiftstrich in ihrem runden Gesicht, das von dünnen, blonden Haaren eingerahmt wird. Ich sollte schleunigst von hier verschwinden.
»… muss man dann einfach kürzen. Ich hoffe, Sie verstehen mich da nicht falsch. Es ist ja auch in Ihrem Interesse, nicht wahr?«
Geiger sieht mich fragend an und scheint mit ihrem Monolog am Ende.
»Ja, verstanden. Dann … gehe ich mal. Schnell.«
»Tun Sie das.«
Hektisch drücke ich mehrmals den Fahrstuhlknopf neben mir, und als sich die Tür endlich öffnet, hetze ich aus Geigers Blickfeld und atme tief durch. Dieser kleinkriminelle Nebenjob ist nicht gut für meine Nerven und mein Herz.
Das größte Risiko dabei ist aber nicht einmal, dass ich in flagranti von Geiger beim Dealen erwischt werde, sondern eher, dass die Senioren sich verplappern. Denn sie tratschen gerne. Vor allem über Themen, über die man im Allgemeinen zu schweigen hat. Wie zum Beispiel die eigenen Gebrechen und Körperausscheidungen oder eben den Kauf und Konsum von illegalen Drogen.
Gerade als sich die Fahrstuhltür endlich schließen will, schlüpft die alte Frau Kaiser zu mir ins Innere. Wunderbar. Die hat mir gerade noch gefehlt.
Die Schattige Pinie fährt ja wirklich jede Menge sonderbarer Charaktere auf. Angefangen bei Herrn Römer, der als ehemaliger Universitätsprofessor noch immer viel Wert auf sein Äußeres legt und sich gerne mal einen Joint reinpfeift, über die schwerhörige Frau Zimmermann, die fast täglich vergisst, ihr Hörgerät einzuschalten, bis hin zu Frau Kaiser, die erst seit Kurzem hier ist und mir gerade ein knappes Nicken zuwirft.
Man sieht es ihr nicht auf den ersten Blick an, aber irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Wie jeden Tag ist sie auch heute wieder so schick gekleidet, als würde sie auf royalen Besuch – oder ein erstklassiges Date – warten. Sie trägt eine schlichte, aber sicherlich teure schwarze Stoffhose, eine cremefarbene Seidenbluse, an der eine edle, silberne Brosche hängt, dazu passende Perlenohrringe und einen Hauch von Lippenstift. Ein süßlicher, aber unaufdringlicher Duft lässt mich wissen, dass sie nicht auf ein paar Spritzer Parfüm verzichtet hat. Dazu sind ihre hellgrauen Locken wie immer perfekt frisiert. Trotzdem stimmt etwas nicht mit ihr. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber gerade diese adrette Harmlosigkeit macht mich misstrauisch. Und die Tatsache, dass sie mir in letzter Zeit ständig über den Weg läuft – rein zufällig natürlich. Hin und wieder will sie auch etwas von mir, ein frisches Handtuch oder eine Extraportion Nachtisch, aber meistens ist sie einfach nur in meiner Nähe. Ich drehe mich um, und da steht sie. Auch wenn es vielleicht paranoid klingen mag, habe ich seit Längerem das Gefühl, dass sie mich irgendwie … beobachtet. So wie jetzt. Sie starrt mich förmlich an. Über die verspiegelte Fahrstuhltür hinweg. Mal sehen, wer als Erste blinzelt.
Ich vermute außerdem, dass sie heimlich eine Visagistin beschäftigt. Wie sonst kann sie zu jeder Tages- und Nachtzeit – und jenseits der siebzig – so viel gepflegter aussehen als ich? Plötzlich bin ich fast froh, dass wir gerade diesen absurden Starrwettbewerb am Laufen haben, denn auf den Anblick des ernüchternden Bildes meiner selbst kann ich gut verzichten: den schief geschnittenen Pony meiner braunen, schulterlangen Haare, denen jeder Glanz fehlt, die tiefen Ringe unter meinen dunkelbraunen Augen und die für den Sommer unnatürlich blasse Haut. Noch dazu überragt mich die Seniorin um fast einen Kopf. Gut, ich bin zugegebenermaßen ziemlich klein, aber die Kaiser ist für ihr Alter und im Vergleich zu den anderen Heimbewohnerinnen trotzdem wirklich groß. Mindestens einen Meter fünfundsiebzig. Vielleicht hat aber auch ihre ungewöhnlich aufrechte Körperhaltung etwas mit ihrer imposanten Erscheinung zu tun. Jedenfalls komme ich mir neben ihr noch kleiner und grauer vor als sonst schon.
»Sie sehen müde aus, Frau Metuschke.«
»Ich sehe nicht nur so aus.«
»Viel Stress?«
»Allerdings.«
Kaiser versucht sich heute also an Small Talk. Das ist neu. Ich halte meine Antworten trotzdem bewusst knapp, solange ich nicht weiß, worauf dieses Gespräch hinauslaufen soll.
»Sie haben ja auch einen furchtbar stressigen Job.«
Haha. Sehr witzig. Wenn sie wüsste! Moment. Kaiser lächelt mich vielsagend über den Aufzugspiegel hinweg an. Weiß sie mehr?
»Verraten Sie mir mal, Frau Metuschke …«
Plötzlich wird mir ganz heiß, und mein Herz beginnt schon wieder zu rasen, was zu wildem Blinzeln meinerseits führt. Außerdem brennen meine übermüdeten Augen inzwischen wie Feuer.
»… wie geht es eigentlich meiner Guzmania?«
Ich atme erleichtert aus. Darauf will sie also hinaus.
Vor einigen Tagen hat sie mir eine etwas vertrocknete Pflanze mit der Aufforderung überreicht, mich um sie zu kümmern, sie wieder aufzupäppeln und ihr tägliche Berichte über ihre Entwicklung zu geben. Aufgepäppelt habe ich das eigenwillige Tropengewächs, Berichte habe ich allerdings nicht geliefert.
»Sie meinen Selena?«
»Wer ist denn bitte schön Selena?«
»Na, Ihre Pflanze. Ich habe mir erlaubt, Ihrer Guzmania einen Namen zu verpassen.«
Sie zieht eine Augenbraue in die Höhe und wirft mir erneut einen vielsagenden Blick zu, der von Respekt für meine Hingabe bis hin zu »Sind Sie bescheuert, Metuschke!« alles bedeuten kann.
»Wie Sie meinen. Also, wie geht es meiner Selena?«
»Bestens. Blüht und gedeiht.«
Kaiser scheint trotzdem nicht ganz zufrieden.
»Was denn? Das wollten Sie doch, oder? Deswegen haben Sie mir das halb tote Ding doch angeschleppt. Damit ich es rette.«
»In der Tat, und das haben Sie.«
Plötzlich hellt sich ihre Miene etwas auf. Allerdings auf eine Art und Weise, die mir nicht wirklich gefällt. Sie hat plötzlich eher etwas von einem Haifisch kurz vor dem Angriff.
»Dann stimmt es also, was man über Sie sagt.«
»Was stimmt? Und was sagt man über mich?«
Mein ganzer Körper spannt sich mit einem Mal wieder an.
»Die Gerüchte hier im Haus besagen, Sie hätten einen … grünen Daumen.«
Kaiser gehört nicht zu meinen Kunden, ergo sollte sie auch nichts über mein zweites Standbein – oder meinen grünen Daumen – wissen. Mich beschleicht aber immer mehr das Gefühl, dass sie vielleicht doch von meiner zusätzlichen Einnahmequelle weiß. Oder … will Sie vielleicht sogar in den Kreis meiner Kunden aufgenommen werden?
»Na ja, klar habe ich einen grünen Daumen. Ich bin ja auch für das … Gewächshaus zuständig.«
Zugegebenermaßen wollte ich, als ich die Aufgabe übernommen habe, einfach eine Möglichkeit haben, ab und zu mal ungestört eine Zigarette zu rauchen. Über Pflanzen wusste ich gerade einmal, dass man sie gießen und düngen sollte. Zu meiner eigenen Überraschung bin ich aber tatsächlich ganz gut im Umgang mit Pflanzen – sei es Kohlrabi oder Hanf.
Frau Kaiser sieht mich noch immer eindringlich an.
Da öffnet sich plötzlich die Fahrstuhltür, und Frau Zimmermann betritt den engen Lift. Die zierliche, weißhaarige Frau stellt sich lächelnd neben mich.
»Guten Morgen, Frau Metuschke.«
Auch heute hat sie ihr Hörgerät nicht eingeschaltet, denn sie schmettert mir ihre Begrüßung entgegen.
»Guten Morgen, Frau Zimmermann.«
Sie lehnt sich etwas zu mir herüber.
»Haben Sie für mich die zwei Zigaretten, die ich bestellt habe?«
Ich starre Frau Zimmermann fassungslos an, und die beiden Joints in meiner Brusttasche fühlen sich mit einem Mal tonnenschwer an. Doch die alte Dame lächelt mich nur selig an, und ihre hellgrauen Augen funkeln ein kleines bisschen gegen die wachsende Trübheit. Es fällt mir schwer, wütend auf sie zu sein, selbst jetzt, da wir eine interessierte Zuhörerin haben.
»Ich wusste gar nicht, dass Sie rauchen, Dorothea.« Kaiser lächelt die alte Frau freundlich an. Diese winkt nur ab.
»Nur vor dem Zubettgehen. Ich schlafe viel besser, seitdem Frau Metuschke mir ihre Zigaretten gibt.«
Großartig. Spätestens jetzt dürfte Frau Kaiser ein Licht aufgehen, und wenn Frau Zimmermann noch etwas lauter brüllt, wird es auch die Geiger in ihrem Büro drei Stockwerke über uns hören.
»Frau Metuschke, Sie sollten keine Zigaretten an alte Damen verteilen.«
Kaisers Blick und ihr Ton sind nicht wirklich tadelnd, eher wissend. Dann wendet sie sich wieder an Frau Zimmermann.
»Und nur zur Sicherheit: Rauchen ist tödlich.«
»Ach was, das Leben ist tödlich.«
Zimmermann kichert über ihren eigenen Witz, während ich Kaiser genau beobachte. Sie lässt sich nicht in die Karten schauen, behält eine gewisse Distanz und hat doch immer diesen glasklaren Blick, den einige Bewohner hier vermissen lassen.
Zu meiner Erleichterung erreichen wir das Erdgeschoss, bevor Zimmermann noch mehr herausposaunen kann, und die Tür öffnet sich. Kaiser verlässt als Erste den Fahrstuhl, allerdings nicht, ohne mir noch einmal einen seltsamen Blick aus ihren klaren blauen Augen zuzuwerfen. Diese Seniorin macht mich nervös, und ich weiß noch immer nicht, ob sie eine Kundin werden oder mich verpfeifen will.
Frau Zimmermann hakt sich bei mir unter, und wir gehen langsam – sehr langsam – den Gang entlang.
»Komische Frau, diese Kaiser. nicht wahr?«
Die Zimmermann riecht nach einer Mischung aus Pulmoll-Bonbons und Jasmin, während sie mir die Frage ins Gesicht schmettert.
»Allerdings.«
»Aber ich mag sie. Leider wird sie uns bald schon verlassen. Es sieht nicht gut bei ihr aus.«
»Wieso? Was hat sie denn?«
Ich wusste nicht, dass Frau Kaiser krank ist. Sie wirkt gar nicht so, als würde sie in nächster Zeit einen Abgang machen.
»Nein, sie hat nichts. Sie hat nur erfahren, dass sie verlegt wird.«
»Verlegt? Wohin denn?«
»In die Sonnenwende. Das ist ein Psychiatrisches Sanatorium in der Nähe von Rostock.«
»In eine Klapse? Wow. Aber warum denn? Sie wirkt auf mich eigentlich ziemlich klar.«
»Ja, aber sie hatte wohl vor ihrer Einlieferung hier eine Art … Episode zu hause.«
»Ach, was für eine Episode?«
»Es heisst, nach dem Tod ihres Mannes habe sie einen Zusammenbruch erlitten. Das Haus war in einem totalen Chaos, überall Müll, und gegessen hat sie auch nicht mehr richtig. So etwas passiert, wenn jemand, den man gernhat, überraschend stirbt.«
Sie tätschelt meinen Arm, an dem sie noch immer hängt, während ich sie ins Freie führe.
Um diese Uhrzeit gönnt sie sich gerne eine kleine Pause in einem Liegestuhl auf der Terrasse zum Garten hin, das Gesicht in der Sonne. Ich achte darauf, dass sie eine angenehme Sitzposition hat, und stelle ihr die Lehne so ein, wie sie es am liebsten hat. Dann gehe ich neben ihr in die Hocke.
»Nach meinem Kurs hole ich Sie ab, okay?«
Sie nickt zufrieden, und ich greife nach einem kurzen Rundumblick in meine Brusttasche. Nachdem ich mich vergewissert habe, dass wir alleine sind und niemand uns beobachtet, ziehe ich die zwei selbst gedrehten Zigaretten hervor und schiebe sie ihr unauffällig in die Hand.
»Für Sie.«
Ihr Lächeln wächst und wirft noch mehr Falten in ihrem freundlichen Gesicht.
»Ach, Karla, auf Sie ist eben verlass. Ich gebe Ihnen das Geld dann später, ja?«
Ich zucke kurz zusammen und bin froh, dass wir die einzigen Gäste auf der Sonnenterrasse sind.
»Keine Sorge, das hat keine Eile.«
»Danke, liebes. Die Pinie kann froh sein, jemanden wie sie zu haben. Sie sind wirklich die Beste.«
Zimmermann tätschelt mir liebevoll die Wange.
Ich richte mich schnell auf und lächle ihr noch einmal freundlich zu, bevor ich mich wegdrehe, damit sie die Tränen nicht sehen kann, die plötzlich und vollkommen unerwartet in meine Augen drängen.
»Sie haben ja keine Ahnung, wie falsch sie da liegen.«
Ich habe es nur gemurmelt, aber trotzdem höre ich hinter mir das leise Quietschen des Gartenstuhls.
»Nein, Karla, Sie können nur nicht sehen, wie richtig ich liege.«
Es überrascht mich, dass Zimmermann plötzlich in einem normalen Gesprächston mit mir spricht. Vielleicht hört sie doch besser, als wir alle denken.
Allerdings nur dann, wenn sie will.
Kapitel zwei
Karla
Stuttgart, 1. August 2017, 10:00 Uhr
Die weitläufige Gartenanlage der Schattigen Pinie ist überaus gepflegt, die Bäume und Büsche werden regelmäßig getrimmt, der Rasen gemäht, und ich wette, selbst Tiger Woods könnte hier ein veritables Golfturnier spielen, falls es ihn mal ins beschauliche Stuttgart verschlägt. Die Rosenbüsche haben Preise gewonnen, der Ententeich hat eine bessere Qualität als das hiesige Trinkwasser, und nichts von all dem ist mein Verdienst. Mir wurde lediglich der Schlüssel zum alten Gewächshaus und die alleinige Verantwortung dafür übergeben. Das ungeliebte Stiefkind der Gartenanlage, vergessen hinter großen Bäumen am Ende des Parks beim Notausgang. Dort soll ich Tomaten anpflanzen, ein bisschen Salat, gerne auch Kohlrabi, Karotten, Gurken und alles, was sich sonst noch anbietet und den Herrschaften, die zu meinem wöchentlichen Botanikkurs kommen, bei der Ernte Freude bringen könnte. Ich bin selbst davon überrascht, wie gut hier alles wächst und gedeiht. Weniger überrascht bin ich allerdings davon, dass daraus nichts Gutes werden konnte.
Andererseits fielen im Übergabegespräch vor einem halben Jahr auch nicht die Worte »Bauen Sie unter keinen Umständen Marihuana an!«, und den Senioren bringen meine selbst gedrehten Zigaretten Freude. Somit halte ich mich streng genommen an die vorgegebenen Regeln. Außerdem ist es auch eher ein Versehen als eine geplante Kriminellenlaufbahn, wenn ich ehrlich bin. Die Aushilfe, die sich vor mir um das Gewächshaus gekümmert hat, ist offenbar von einem auf den anderen Tag verschwunden – und hat ein kümmerliches Pflänzchen hinterlassen, das beinahe im Kompost gelandet wäre, wenn mir die sonderbare Form der Blätter nicht so bekannt vorgekommen wäre. Diesem traurigen Überbleibsel hat, wie sich herausgestellt hat, die Braunerde besonders gutgetan. Seitdem wächst und gedeiht es unter meinen Augen und hat auch schon Ableger bekommen, die noch besser wachsen als erwartet. Bevor ich wusste, wie mir geschieht, hatte ich Eins-a-Marihuana zur Hand. Als Herr Römer dann eines Tages beim Abendessen über die starken Beschwerden seiner rheumatoiden Arthritis geschimpft und die Politik verflucht hat, weil sie ihm bürokratische Steine von der Größe eines Hochhauses in den Weg legt und er nicht an das schmerzlindernde Marihuana herankommt, hatte ich eine Idee, die ich bald auch in die Tat umsetzte. Herrn Römer ging es daraufhin sofort besser. Kurz darauf habe ich erfahren, dass Frau Zimmermann an extremen Schlafstörungen leidet, die man – laut Herrn Römer – mit Marihuana ebenfalls zumindest ein bisschen lindern könnte. Also habe ich auch sie mit Marihuana versorgt. Der beruhigende Effekt war tatsächlich überraschend gut, was wohl auf die Erweiterung der Arterien durch die Wirkung des Tetrahydrocannabinols zurückzuführen ist. Dadurch wird nicht nur der Blutdruck gesenkt, sondern auch die Körpertemperatur. Frau Zimmermann schläft, seit sie abends meine »Zigaretten« raucht, jedenfalls deutlich besser und gewinnt beim Rommé wieder häufiger gegen die bösartige Mayer. Beides Tatsachen, die mir durchaus gefallen. Es hat dann auch nicht lange gedauert, bis ich herausgefunden habe, welche Patienten noch als potenzielle Kunden infrage kommen. Chronische Schmerzen, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Tinnitus … Ein Altersheim schien plötzlich wie das natürliche Biotop für den Konsum von Marihuana, und meine Kundenzahl stieg schnell.
Natürlich weiß ich, dass der Handel mit Rauschmitteln nicht zwingend legal ist und dass ich eigentlich kein Geld von den Alten nehmen sollte. Senioren können allerdings ganz schön hartnäckig sein. Geschenkt wollen sie schon mal gar nichts! Sie bestehen regelrecht darauf, mir Geld zu geben. Sonderbare Generation. Nur Frau Zimmermann lässt mich ihr ab und an etwas schenken. Allerdings auch nur, weil sie, wenn sie nicht sofort bezahlt, meistens vergisst, mir die Beträge später auszuhändigen. Hinzu kommt, dass ich die Kohle gut gebrauchen kann. Ich habe es noch nicht übers Herz gebracht, aus meiner alten Dreizimmerwohnung auszuziehen und in eine kleinere, meinen neuen finanziellen Verhältnissen als Aushilfe angemessenere Bleibe zu wechseln. So weit bin ich selbst nach einem Jahr noch nicht, und der Rauschgifthandel gewährt mir noch eine gewisse Gnadenfrist.
Jetzt stehe ich jedenfalls mit einer tonnenschweren, uralten Blechgießkanne im Gewächshaus und wässere meine Einnahmequelle, die in zwei Blumenkisten hinter den Tomatensträuchern und den Erbsenranken versteckt steht. Dabei rauche ich genüsslich eine – ganz gewöhnliche – Zigarette und bin fast ein bisschen stolz auf mein Werk. Das sind die seltenen Momente, in denen ich beinahe zufrieden mit meinem ansonsten komplett verkorksten Leben bin.
»Frau Metuschke? Sind Sie da drinnen?«
Die Kaiser! Ertappt lasse ich die Zigarette fallen und trete sie hektisch mit den klobigen Crocs aus. Ich will den Rauch auspusten und gleichzeitig antworten, wobei ich mich, wie ein Anfänger an seiner ersten Zigarette, verschlucke und fürchterlich zu husten beginne.
Bevor die Person, die zu der Stimme gehört, in mein heiliges Reich treten kann, schleife ich die Gießkanne schnell in Richtung Ausgang und versuche mich an einem entspannten Lächeln, als ich die Tür des Gewächshauses öffne.
Und da steht sie.
»Frau Kaiser, Sie sind ein bisschen früh dran. Der Kurs beginnt erst in einer Viertelstunde.«
Kaiser hat noch nie an einem meiner Kurse teilgenommen. Meistens bleibt sie für sich, und außer zu ihrer morgendlichen Dehn- und Stretchingrunde verirrt sie sich recht selten nach draußen.
»Ich weiß. Deshalb bin ich auch nicht hier. Ich würde mich einfach gerne selber vom Zustand meiner Guzmania überzeugen.«
Sie deutet an mir vorbei ins Innere des Gewächshauses und will schon einen Schritt hinein machen, als ich mich vor ihr aufbaue und mich ihr in den Weg stelle – was bei meiner Körpergröße, mit der ich höchstens Kylie Minogue beeindrucken kann, gar nicht so einfach ist.
»Warten Sie hier, ich hole sie schnell.«
»Ich könnte doch auch …«
»Nein! Warten Sie hier. Da drinnen … ist es viel zu schwül für Sie.«
Bevor sie etwas darauf erwidern kann, hechte ich los, schleudere die Tür zu und suche nach der Pflanze im blassrosa Übertopf mit aufgemalten Herzen, den ich auf einem der Tische abgestellt habe. Es war nicht einfach, die etwas eigenwillige Blume aufzupäppeln. Das Markanteste an dieser tropischen Zimmerpflanze sind eindeutig die leuchtend gelben, trichterförmigen Hochblätter, die sich mittig hervorrecken und entfernt an eine sehr schlanke Ananas erinnern. Ich bringe sie nicht ohne Stolz zur Kaiser, die zu meiner Erleichterung artig vor dem Gewächshaus gewartet hat.
»Voilà! Da haben wir das gute Stück.«
Sie betrachtet Selena eingehend, als würde sie irgendwo einen Fehler erwarten.
»Das ist beeindruckend, Frau Metuschke.«
»Wenn man sie richtig gießt, ein bisschen mit ihr redet …«
Kaiser nimmt mir die Pflanze aus der Hand, hebt sie prüfend gegen das Licht und sucht noch immer nach etwas, das sie an meiner Arbeit bemängeln kann, was mich langsam wütend werden lässt.
»Was passt Ihnen denn jetzt wieder nicht?«
»Gar nichts. Ich bin nur angenehm überrascht, dass Sie sich so gut um die Pflanze gekümmert haben. Das hatte ich gar nicht erwartet.«
»Danke sehr! Ich nehme meinen Job als Aushilfsgärtnerin eben sehr ernst.«
»Nun, ich habe zu danken. Die Guzmania ist wie neu. Ich werde sie als Erinnerung an die Pinie mitnehmen.«
»Stimmt. Sie ziehen um, an die Ostsee, nicht wahr?«
»Ich ziehe nicht um. Ich werde dorthin transferiert. Gegen meinen Willen, wie ich betonen möchte. Ich habe neuerdings einen Vormund, weil mein ›emotionaler Zusammenbruch‹ …«
Noch nie habe ich so perfekt ausgesprochene Anführungszeichen gehört.
»… sie davon überzeugt hat, dass ich wohl nicht mehr alleine für mich sorgen kann.«
Ich mustere sie eingehend, aber so resolut, wie sie gerade vor mir steht, würde ich ihr absolut zutrauen, einen hohen Kredit bei einer Bank zu bekommen.
»Wie dem auch sei …«
Da ändert sich plötzlich etwas an ihrem Blick, und mir wird sofort mulmig zumute.
»Um ehrlich zu sein: Ich bin eigentlich wegen etwas ganz anderem hier.«
Warum überrascht mich das nicht?
»Es heißt, wenn man ein Problem hat, solle man sich an Sie wenden.«
»An mich?«
Dieser Ruf, so schmeichelhaft er auch sein mag, sollte noch einmal gründlich auf den Prüfstand gestellt werden.
»Sie helfen hier jeden Tag so vielen Heimbewohnern. Können Sie mir denn auch helfen, Frau Metuschke?«
Langsam dämmert es mir, und ich entspanne mich etwas. Sie will also doch einfach nur Drogen bei mir kaufen. Na, das hätte sie auch leichter haben können. Dazu hätte sie mich nicht auf Schritt und Tritt verfolgen und mir damit Paranoiaattacken bescheren müssen.
»Nun, das kommt ganz darauf an. Was brauchen Sie denn?«
Ich lächle sie an, während Kaiser mich abermals einer ziemlich genauen Musterung unterzieht.
»Haben Sie ein Auto?«
Verdutzt halte ich inne.
»Ein Auto?«
»Ja, ein Auto. Haben Sie eines?«
»Ja, warum?«
»Was für eines?«
»Einen roten Renault 4 GTL.«
»Hm. Baujahr?«
»1984.«
»Wie bitte?!«
»Hey, das ist ein Klassiker.«
»Fährt er denn?«
»Es handelt sich um eine Sie.«
Kaiser wedelt diesen Einwurf mit der Hand beiseite und wiederholt ihre Frage.
»Ja, sie fährt wie eine Eins.«
»Familie?«
»Ich?«
»Ja.«
»Ähm, klar. Oder glauben Sie, ich wäre aus einem Ei geschlüpft?«
»Ich meine, ob Sie eine eigene Familie haben.«
»Nein, habe ich nicht.«
»Freund?«
»Nein.«
»Freundin?«
»Auch nicht.«
»Kinder?«
»Nein.«
»Haustiere?«
»Nein. Allerdings habe ich schon eine Weile nicht mehr ins Gemüsefach meines Kühlschranks geschaut. Da könnte inzwischen was leben.«
»Humor, das mag ich.«
»Das freut mich.«
So langsam wird sie mir doch wieder etwas unheimlich. Möglich, dass der Umzug an die Ostsee gar keine so blöde Idee ist.
»Was wollen Sie jetzt eigentlich von mir?«
»Vorerst nichts. Sie kommen in die engere Auswahl.«
Sie nickt freundlich, dreht sich um und lässt mich mit der Blume und einer ganzen Reihe unbeantworteter Fragen zurück.
Kapitel drei
Karla
Stuttgart, 1. August 2017, 11:30 Uhr
Nach einem – für meine Verhältnisse – erfolgreichen Kurs zum Thema »Wie wässere ich Tomaten richtig« mit immerhin vier Teilnehmern komme ich zurück auf die inzwischen recht gut besuchte Terrasse, wo Frau Zimmermann noch immer in ihrem Gartenstuhl döst und die Sonne genießt. Manchmal, so habe ich den Eindruck, schaltet sie ihr Hörgerät absichtlich ab, um sich nicht dem ganzen Getratsche der übrigen Heimbewohner aussetzen zu müssen und sich in eine eigene, friedlichere Welt zurückzuziehen. Ich beneide sie um dieses Feature. Ebenso wie um das kleine Nickerchen, aus dem ich sie jetzt reißen muss. Aber wenn sie rechtzeitig zu ihrer Rommé-Runde erscheinen will, muss sie langsam, aber sicher in die Gänge kommen.
»Frau Zimmermann, es ist Zeit fürs Kartenspielen.«
Ich sage es in einem möglichst ruhigen Tonfall, um sie nicht zu erschrecken, bis mir einfällt, dass sie mich vielleicht nicht hören kann. Also gehe ich neben der alten Dame in die Hocke und stupse sie sanft an der Schulter an.
»Frau Zimmermann, Ihre Rommé-Runde fängt gleich an.«
Aber ihre Augen bleiben geschlossen.
An manchen Tagen sehen einige der Bewohner so zerbrechlich aus, als wären sie aus Glas. Nicht alle. Die Kaiser, zum Beispiel, ist robust wie ein Mammutbaum, aber Frau Zimmermann wirkt, als könne sie bei einer unbedachten Bewegung in tausend Splitter zerspringen.
»Frau Zimmermann, die Rommé-Runde …«
So tief und fest, wie sie jetzt schläft, werde ich das Gefühl nicht los, dass sie meine Zigaretten bereits still und heimlich hier auf der Terrasse geraucht hat. Ich lege meine Hand auf ihre und bemerke, dass die Haut ziemlich kühl ist, wenn man bedenkt, dass sie schon eine ganze Weile in der warmen Vormittagssonne brutzelt.
Sie sieht so friedlich aus.
Zu friedlich!
Irgendeine Zelle meines Körpers drückt den Alarmknopf, denn mein Herz beginnt zu rasen, als müsse es eine neue persönliche Bestzeit aufstellen. Ich schließe meine Finger um Zimmermanns zartes Handgelenk und versuche, einen Puls zu erfühlen, finde ihn aber nicht.
»Frau Zimmermann?«
Ich stehe schnell auf und beuge mich mit dem Ohr über ihren Mund und die Nase. Keine Atmung.
»Frau Zimmermann!«
Die schrille Stimme, die in meinen Ohren schallt, ist meine eigene, als ich die tief schlummernde Frau an der Schulter rüttle – etwas heftiger als zuvor, was dennoch keine Wirkung zeigt.
»Hilfe! Hilfe! Ich glaube, ich brauche hier Hilfe!«
Eine Ärztin oder eine ausgebildete Pflegekraft würde jetzt wissen, was zu tun ist, aber ich werde einfach nur panisch und sehe mich hektisch nach Hilfe um.
»Nein, nein, nein, nicht sterben!«
Während die Heimbewohner um mich herum ebenfalls in Aufregung geraten, sitzt Dorothea Zimmermann weiterhin einfach da, egal, wie laut ich rufe oder wie kräftig ich sie schüttle. Sie hat ein entspanntes Lächeln auf den Lippen, die Augen noch immer geschlossen und das Hörgerät ausgeschaltet.
Diesmal wohl für immer.
Ich verstumme und sehe mir meine Lieblings-Heimbewohnerin noch ein letztes Mal an. Mein Blick streift dabei zwei selbst gedrehte Zigaretten, die aus ihrer Hosentasche lugen – und mir wird plötzlich eiskalt. Ohne nachzudenken, greife ich schnell nach ihnen und lasse sie möglichst unauffällig in meiner Brusttasche verschwinden. Als ich mich danach kurz umsehe, ob mich jemand dabei beobachtet hat, trifft mein Blick auf den von Frau Kaiser. Verdammt. Sie hat es gesehen. Sie macht zu meiner Überraschung aber keinerlei Anstalten, Alarm zu schlagen. Vielmehr dreht sie sich wortlos zur Seite und geht.
»Frau Metuschke! Machen Sie endlich Platz da!«
»Was?«
»Los, aus dem Weg!«
Das verstehe ich viel zu spät. Nämlich erst, als zwei Pflegerinnen und ein Arzt mich unsanft zur Seite schieben, so als hätte ich in diesem Theaterstück nichts mehr zu suchen. Die durch mich ausgelöste Hektik legt sich, und die Handgriffe bekommen bei ihnen sofort viel mehr System. Es sieht so professionell aus, wie sie den Puls, die Atmung, die Reflexe prüfen. Um diese Ruhe beneide ich alle Beteiligten, um die schnelle Reaktion und auch ein bisschen um ihr Verständnis der Situation. Diese Leute wissen, was sie tun. Das erkennt man sofort. Ein abschließendes kurzes Kopfschütteln ist alles, was es braucht. Sofort kehrt wieder Ruhe ein.
Überall, nur nicht bei mir.
Es ist nicht das erste Mal, dass ich einen toten Menschen sehe. Aber ich weiß trotzdem, dass ich diesen Anblick nicht vergessen werde, denn es ist die erste Tote, deren Namen und Lebensgeschichte ich kenne. Die erste, die mir am Herzen liegt.
»Wenn man bedenkt, dass sie jahrelang an extremen Schlafstörungen litt, ist es fast ironisch, dass sie jetzt einfach eingeschlafen ist.«
Geiger stellt sich zu mir, und ich muss keinen besonders frischen Eindruck machen, denn sie legt mir sorgenvoll die Hand auf die Schulter und sieht mich ernst an.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?«
Ich nicke benommen.
»Sie dürfen sich das nicht so zu Herzen nehmen. So ist das manchmal in Seniorenheimen. Frau Zimmermann war achtundachtzig Jahre alt, da passiert so was durchaus.«
War. Sie benutzt bereits die Vergangenheitsform.
»Meine Güte, Sie sehen ganz blass aus. Geht es Ihnen wirklich gut?«
Vermutlich nicke ich wieder, aber so genau weiß ich das nicht, weil sich alles ein bisschen taub anfühlt.
»So sehen Sie aber nicht aus. Sie sollten sich lieber irgendwo hinsetzen und vielleicht einen Schluck Wasser trinken. Gönnen Sie sich eine kleine Pause, Karla.«
Geiger hält eigentlich nichts von Pausen, und sie nennt mich sonst auch nie bei meinem Vornamen. Ich bin immer nur Metuschke. Jetzt bin ich Karla und fühle mich dadurch plötzlich wie ein kleines Kind.
Ein letztes Mal sehe ich zu Frau Zimmermann, die noch immer lächelt und so friedlich aussieht. Bevor ich zu weinen anfange, verlasse ich lieber die Bühne. Eine besonders große Hilfe bin ich hier ohnehin nicht.
Siehst du, Karla? Du hast mal wieder auf ganzer Linie versagt! Genau deswegen bist du jetzt hier. Als nutzlose Hilfskraft. Und nicht mehr. Du wirst nie mehr sein.
Meine Schritte führen mich weg von der Terrasse, wo es gespenstisch still geworden ist, über den feinen Kiesweg hin bis ans Ende der Anlage, zurück zu meinem Gewächshaus.
Ich brauche eine Zigarette.
Dringend.
Du bist wirklich ein hoffnungsloser Fall!
Mit zittrigen Händen zünde ich mir eine Zigarette an und nehme einen tiefen Zug.
Sie alle hatten recht. Er hatte recht. Und du weißt es genau. Es war lächerlich zu glauben, du könntest mehr sein.
Ich schließe die Tür des Gewächshauses hinter mir und lasse mich erschöpft daran hinabgleiten. Es ist alles so …
»Frau Metuschke, sind Sie da drinnen? Ich habe noch einige Fragen.«
Auch das noch. Die Kaiser. Auf sie und ihre verrückten Fragen habe ich jetzt wirklich keine Lust. Wenn ich mich still verhalte, denkt sie vielleicht, dass ich nicht da bin, und geht wieder.
»Frau Metuschke, seien Sie nicht lächerlich. Ich weiß, dass Sie da drin sind. Ich kann Ihre Zigarette riechen.«
Mist.
»Jetzt nicht, ich habe zu tun!«
Schnell sperre ich die Tür von innen ab.
»Unsinn. Nur noch ein paar Kleinigkeiten.«
Ja, die Kleinigkeiten kann ich mir schon vorstellen, nachdem sie mich dabei erwischt hat, wie ich einer Toten zwei Joints aus der Hosentasche stehle. Dafür habe ich jetzt aber keinen Nerv. Kann sie mir nicht mal ein paar Minuten gönnen, in denen ich um Frau Zimmermann trauern darf?
»Hauen Sie ab!«
»Haben Sie Punkte in Flensburg?«
Was? Diese Frau treibt mich noch in den Wahnsinn.
»Und falls ja, wie viele?«
»Haben Sie nicht mitgekriegt, dass Frau Zimmermann gerade gestorben ist? Da fragen Sie allen Ernstes nach Punkten in Flensburg?«
Ich kann ihre Silhouette durch das geriffelte Glas der Scheibe über mir sehen. Wie sie dasteht, einen Block oder etwas Ähnliches in der Hand.
»Genau genommen frage ich nach Ihren potenziellen Verkehrsvergehen.«
»Lässt Sie der plötzliche Tod einer Mitbewohnerin wirklich kalt?«
»Nun, mit Ende achtzig kann man wohl kaum von ›plötzlich‹ sprechen.«
Es überrascht mich, wie nüchtern sie mit der Situation umgeht. Liegt das am Alter oder daran, dass diese Frau sich ein Herz aus Beton hat gießen lassen?
»Wenn Ihnen das lieber ist, kann ich zu Frau Geiger gehen und ihr von dem erzählen, was sich in Ihrer Brusttasche befindet.«
Na, wunderbar. Jetzt also doch. Ich erhebe mich zögerlich, sperre die Tür wieder auf, öffne sie einen Spalt und sehe in ein freundlich lächelndes Gesicht, das jegliche Spuren von Mitgefühl gänzlich vermissen lässt.
»Zimmermann geht Ihnen am Arsch vorbei, oder?«
»Nein.«
»Doch.«
»Ganz im Gegenteil. Ihr Ableben hat mir die Dringlichkeit meines Unterfangens endgültig vor Augen geführt.«
»Was für ein Unterfangen?«
»Dazu kommen wir später. Zuerst beantworten Sie mir bitte meine Frage.«
Kaiser erinnert mit ihrem kleinen Schreibblock an eine überambitionierte Klatschreporterin, die gerade an einem frischen Tatort eingetroffen ist.
»Also, wie viele Punkte haben Sie in Flensburg?«
»Zwei.«
»Tatsächlich. Zwei gleich? Wegen?«
»Zu schnellen Fahrens.«
»Sehr gut, sehr gut.«
Sie lächelt noch immer, ich schüttle den Kopf.
»War es das dann?«
»Im Großen und Ganzen.«
»Dann entschuldigen Sie mich jetzt bitte, ich möchte gerne alleine sein.«
Damit lasse ich sie stehen und gehe tiefer in das Gewächshaus. Aber Kaiser wäre nicht Kaiser, wenn sie mir nicht folgen würde. Sie ist wie eine dieser Erkältungen, die man einfach nicht mehr loswird.
»Hören Sie. Warten Sie, Frau Metuschke! Sie wollten sich noch verabschieden, habe ich recht?«
»Wie bitte?«
Ich gebe mir große Mühe, mich formatfüllend vor ihr aufzustellen, um ihren Blick in eine gewisse Ecke des Gewächshauses zu verhindern, und wieder wünschte ich mir, mit zehn Zentimetern mehr Körpergröße gesegnet zu sein.
»Sie wurden um ein letztes Lebewohl betrogen, und das nagt jetzt an Ihnen. Habe ich recht?«
Kaiser trifft mit ihrer nüchternen Aussage tatsächlich einen überraschend wunden Punkt. Ich kannte Frau Zimmermann erst seit einem Jahr, und die Geiger hat mir von Anfang an eingebläut, mich emotional nicht zu sehr auf die Patienten einzulassen, aber die alte Dame ist mir irgendwie trotzdem ans Herz gewachsen. Und ja, ich hätte mich wirklich gerne von ihr verabschiedet.
Da ich nicht antworte, spricht Kaiser ungerührt weiter.
»Wissen Sie, mein Mann ist eines Tages bei der Gartenarbeit einfach umgefallen. Ich habe ihm Eistee in der Küche gemacht, und als ich mit der Karaffe auf die Veranda kam, lag er neben der Heckenschere.«
Sie sieht mich ernst an, und ich bin über ihre Offenheit ein wenig erstaunt. Auch darüber, in welch gefasstem Tonfall sie vom Ableben ihres Mannes spricht.
»Ich konnte mich nicht verabschieden. Er war von heute auf morgen einfach nicht mehr da. All die Streitereien und Diskussionen über Nichtigkeiten, die wir zuvor in unserem gemeinsamen Leben geführt haben, konnte ich mir verzeihen. Nur dieses eine letzte Adieu, das hängt mir nach. Es ist so wichtig, sich anständig zu verabschieden.«
Sie sagt es, als ginge es um so etwas Banales wie die Notwendigkeit, sich vor dem Essen die Hände zu waschen.
»Wann ist Ihr Mann denn gestorben?«
»Vor drei Monaten. Wir waren knapp sechzig Jahre verheiratet.«
Das ist ein ganzes Leben. Das ist eine halbe Ewigkeit.
»Und jetzt bin ich … hier.«
Sie seufzt und macht eine Handbewegung, die dieses Gewächshaus ebenso umfasst wie die ganze Schattige Pinie und vielleicht auch ihr Leben.
»Und bald in der Sonnenwende. Endstation Irrenhaus. Warten auf den Tod.«
Mit nur zwei Schritten ist sie bei mir. Ich zucke kurz zusammen, als sie mir an die Schultern fasst und mir direkt in die Augen sieht.
»Und genau deswegen brauche ich Sie.«
Vielleicht ist es doch keine so gute Idee, mit Kaiser zwischen Erbsen und Hanfpflanzen über den Tod und letzte Abschiede zu reden. Immerhin stehe ich hier in einem abgelegenen Gewächshaus alleine mit einer wildfremden Seniorin, die mich seit einiger Zeit verfolgt und demnächst in die Klapse eingeliefert wird.
»Sie sind meine letzte Hoffnung.«
Spätestens jetzt ist es nicht mehr nur etwas unheimlich, sondern wird absurd.
»Frau Metuschke, ich muss hier weg.«
Und es wird immer besser. Ich spüre, wie sich in mir ein leicht irres Lachen seinen Weg nach oben bahnt. Die Sonnenwende ist definitiv keine so schlechte Idee.
»So, so, Frau Kaiser. Sie müssen also weg? Wissen Sie, was? Das begrüße ich sogar. Tun Sie sich keinen Zwang an. Soll ich den Hinterausgang für Sie offen lassen?«
»Nein. Ich muss ganz weg.«
Oh. Das klingt jetzt doch etwas zu endgültig. Ich mache einen Schritt weg von ihr.
»Moment. Bitten Sie mich gerade um Sterbehilfe?«
»Nein. Um Lebenshilfe!«
»Was?«
»Ich muss noch etwas erledigen.«
»Was denn?«
»Eine kleine Reise.«
Und schon sind wir zurück in Absurdistan, und ich habe langsam genug davon.
»Ich glaube, Sie sollten das lieber mit Frau Geiger besprechen, sie kann Sie …«
»Unsinn. Sie wissen genau, dass das nicht geht.«
Kaiser wirkt plötzlich wieder so beherrscht und klar bei Verstand wie eh und je. Dennoch ergibt das eben Gesagte keinen Sinn.
»Und Sie fahren mich.«
Das ergibt noch viel weniger Sinn als alles davor, und ich höre mich auflachen.
»Ich? Soll Sie irgendwo hinfahren?«
»Ja. Sie haben einen Wagen, und Sie fahren zu schnell. Sie sind die perfekte Komplizin.«
»Komplizin?«
»So sagt man das doch, oder? Eine Komplizin für den Roadtrip.«
»Den Roadtrip?!«
Ich klinge wie eine umgekehrte Souffleuse. Anstatt ihr die Dinge vorzusagen, plappere ich alles nach und finde trotzdem immer noch keinen Sinn hinter ihren Worten.
»Wir müssen schnell los, bevor sie mich in die Sonnenwende abschieben und dort für immer ruhigstellen.«
Okay, jetzt reicht es. Ich glaube fast, sie meint das ernst.
»Hören Sie mal, ich denke nicht, dass Frau Geiger …«
»Genau! Deshalb darf sie nichts davon erfahren!«
»Erleiden Sie hier gerade einen Schlaganfall? Oder eine weitere … Episode?«
»Seien Sie nicht albern, Frau Metuschke!«
»Ich soll nicht albern sein? Hören Sie sich eigentlich selbst zu?«
Damit schiebe ich sie nicht ganz so sanft in Richtung Ausgang, bevor sie noch mehr Unfug erzählt – oder mehr sieht, als sie sollte.
»Heute um Mitternacht, Frau Metuschke. Am besten, wir treffen uns am Hinterausgang hier beim Gewächshaus! Ich warte draußen an der Bushaltestelle auf Sie.«
»Vergessen Sie es. Ich fahre Sie doch nicht einfach so mitten in der Nacht spazieren!«
»Doch, das werden Sie.«
»Kann es sein, dass Sie immer ›ja‹ verstehen, wenn ich ›nein‹ sage?«
»Nein. Also bleibt es beim Ja?«
»Rufen Sie sich ein Taxi!«
»Frau Metuschke …«
»Nein!«
Ich greife nach dem blassrosa Topf mit Selena und drücke ihn ihr in die Hände.
»Die gehört Ihnen. Nehmen Sie sie, und gehen Sie. Jetzt.«
»Ist ›nein‹ Ihr letztes Wort?«
»Ja.«
Damit schiebe ich sie ins Freie. Ich will gerade wieder die Tür zum Gewächshaus schließen, als sie einen Fuß dazwischenstellt.
»Erlauben Sie mir noch eine Frage?«
»Was ist denn jetzt noch?«
»Um welches Gemüse handelt es sich dahinten links bei den Tomaten?«
Verdammt!
»Da sind … Bohnenranken.«
Ich wette, sie kann meine Panik durch die halb geschlossene Tür hindurch riechen wie ein Bluthund.
»Für mich sieht es aus wie Hanf. Laut Betäubungsmittelgesetz § 30 wird das Strafmaß auf mindestens zwei Jahre Freiheitsstrafe erhöht, wenn Anbau, Herstellung oder Handel bandenmäßig oder die Handlungsweisen des § 29 BtMG gewerbsmäßig betrieben werden.«
Schnell öffne ich die Tür und ziehe sie zurück zu mir ins Gewächshaus.
»Seien Sie still! Sie reden Unsinn.«
»Nein, ich habe recherchiert.«
»Ich würde sagen, Sie haben zu viel Zeit.«
»Nicht mehr so viel.«
»Sterben Sie etwa?«
Zugegeben, ein etwas gemeiner Hoffnungsschimmer, den ich am Horizont erahne.
»Nicht so bald, wie Sie es sich vielleicht wünschen.«
»Wie ärgerlich. Aber wissen Sie, was? Ihre Recherchen können Sie sich an den Hut stecken. Sie haben offiziell einen Sprung in der Schüssel. Ich wäre mir an Ihrer Stelle also nicht so sicher, dass irgendwer Ihre Wahnsinnsgeschichte glaubt. Und bis Sie zu Geiger gehumpelt sind, um mich zu verpfeifen, habe ich die Pflanzen längst über alle Berge gebracht.«
Die Raumtemperatur sinkt. Kaiser verengt die Augen und beugt sich zu mir vor.
»So ein Humbug. Ich bin topfit! Aber es geht hier nicht um mich, sondern um Sie – und Sie wollen doch nicht ins Gefängnis, oder?«
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man sich im Notfall einfach stur und dumm stellen soll. Eine Taktik, die mir jetzt sehr gelegen kommt.
»Warum sollte ich denn ins Gefängnis? Wegen Erbsen und Tomaten?«
»Nein, wegen Römer, Zimmermann, Flörchinger, Häberlin, Kabitzke …«
Sie zählt nicht einfach nur Bewohner der Schattigen Pinie auf, nein, sie nennt alle meine Kunden, und ich spüre, wie mit jedem Namen mehr Blut aus meinem Kopf schwindet. Sie hat wirklich recherchiert.
»Sie sind eine Drogendealerin, Karla.«
Mein Lachen hallt hohl und unsicher im Gewächshaus wider.
»Um es mit Ihren Worten zu sagen: So ein Humbug!«
»Die Blumenkisten im Gewächshaus sollten belastend genug sein. Und machen Sie sich da keine Hoffnungen: Ich habe Fotos davon. Außer Ihnen hat niemand einen Schlüssel zum Gewächshaus, oder?«
Verdammt, verdammt, verdammt!
»Wie sind Sie überhaupt hier … Whatever. Was wollen Sie, Kaiser?«
»Sie haben offensichtlich nicht aufmerksam genug zugehört. Ich will einen Roadtrip. Mit Ihnen.«
»Das ist doch Wahnsinn! Und wieso ausgerechnet mit mir?«
Kaiser zuckt lässig die Schultern.
»Sie haben keine Familie, keinen Partner, keine Haustiere. Niemand wird Sie vermissen.«
Autsch. Das ist ein unfairer Treffer unterhalb der Gürtellinie. Na gut, sie nimmt sich also das Recht heraus, so über mich und mein Leben zu sprechen. Das Spiel beherrsche ich zum Glück ebenfalls.
»Sagt die Verrückte, die demnächst in ein Sanatorium im Nirgendwo abgeschoben wird, um sie vollends zu vergessen.«
Sie gibt sich Mühe, meine Worte an sich abprallen zu lassen, aber ich weiß, dass das gesessen hat. Gut so. Es kostet sie offensichtlich viel Selbstbeherrschung, aber sie spricht ruhig und besonnen weiter.
»Frau Metuschke, ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe sonst niemanden. Mein Mann ist verstorben, wie Sie wissen.«
»Haben Sie keine Freunde? Oder Kinder? Was ist mit denen? Können die nicht Taxi für Sie spielen?«
Jetzt wackelt ihr Emotionsgerüst gewaltig, doch sie fängt sich schnell wieder.
»Unsere Ehe blieb kinderlos, und in meinem Alter … Ich habe niemanden mehr, den ich sonst fragen kann.«
Ihr Blick löst plötzlich etwas in mir aus, das sich verdammt nach Mitleid anfühlt. Aber ich darf jetzt nicht einknicken. Außerdem bin ich noch immer wütend, dass sie mir so die Pistole auf die Brust setzt.
»Also erpressen Sie mich einfach. Haben Sie sich mal überlegt, dass Sie vielleicht genau wegen solcher Aktionen jetzt alleine dastehen?«
»Ich bitte Sie, Karla. Ich erpresse Sie doch nicht. Ich … liefere Ihnen lediglich eine Entscheidungshilfe.«
»Sie erpressen mich!«
»Von mir aus. Aber so, wie Sie es sagen, klingt es wie etwas Schlimmes.«
»Weil es etwas Schlimmes ist! Ich lasse das nicht mit mir machen. Was ist, wenn ich mich der Heimleitung stelle?«
»Zwei Jahre Freiheitsstrafe. Das wird keine sehr schöne Zeit. Aber natürlich schreibe ich Ihnen Briefe ins Gefängnis.«
Sie lächelt so kühl wie ein Yeti im Sommerurlaub.
Kurz gehe ich meine Optionen durch: Auf ihre Erpressung eingehen kommt nicht infrage. Mich der Heimleitung stellen auch nicht. Der Heimleitung wegen des Fluchtplans Bescheid geben geht nicht wegen der Fotos, die Kaiser angeblich von meinen Pflanzen gemacht hat. Mist. Es nervt mich, dass sie mich in der Hand hat und das auch weiß. Mit triumphierendem Lächeln spricht sie weiter.
»Heute um Mitternacht. Vergessen Sie Ihren Reisepass nicht. Ich möchte keinen Ärger an der Grenze.«
»An der Grenze?!«
»Ja.«
»Welche Grenze? Wo soll es denn hingehen?«
»Zu Freunden.«
»Zu welchen Freunden? Ich dachte, Sie haben keine.«
»Ich habe Freunde. Nur nicht hier in Stuttgart.«
»Und wo wohnen Ihre Freunde?«
»Das sage ich Ihnen, wenn es so weit ist.«
»Und Sie glauben, ich lasse mich darauf ein.«
»Sie haben keine Wahl.«
Wir starren uns an. Wer zuerst wegsieht, hat verloren. Sie besteht unbedingt auf ihrem Willen, ich auf meine Freiheit. Ein Unentschieden wird es nicht geben. Dummerweise hat sie die besseren Druckmittel. Also sehe ich weg – und sie gewinnt.
»Sie sehen etwas blass aus, Karla. Vielleicht brauchen Sie ein paar Tage Urlaub. Gehen Sie zu Geiger, und reichen Sie, sagen wir, eine Woche Urlaub ein. Das sollte für unser Vorhaben reichen.«
»Eine Woche?! Frau Kaiser, wo wohnen Ihre Freunde?«
»Nicht weit weg, aber beantragen Sie trotzdem eine Woche. Das ist unauffälliger.«
Ich kann nicht garantieren, dass wir beide diese Woche überleben werden. Entweder ich erdrossle sie, oder sie bringt mich ins Grab.
»Unter den gegebenen Umständen sollte das kein Problem sein. Dorotheas Dahinscheiden hat Sie sehr mitgenommen.«
Sie denkt an alles, das muss man ihr lassen. Es ist ein perfider Plan, gereift im Gehirn einer auf den ersten Blick harmlos aussehenden Seniorin.
»Was, wenn ich heute um Mitternacht nicht da bin?«
»Dann verpassen Sie ein großes Abenteuer.«
»Darauf verzichte ich gerne. Sie müssen mir schon einen besseren Grund nennen. Warum wollen Sie diese Reise machen?«
Regungslos steht sie da, sieht zu mir, holt tief Luft und zerstört meine Wut mit einem einfachen Satz.
»Weil ich schon über sechzig Jahre zu spät bin.«
Kapitel vier
Elisabeth
Melbourne, 21. November 1956
»Wo willst du hin?«
Marie bleibt ertappt an der Tür stehen, dreht sich zögerlich zu mir um und starrt durch die nur schwach vom Mond erhellte Dunkelheit des Zimmers zu mir.
»Ich … Äh …«
Sie sucht eine Ausrede, und sie sucht zu langsam. Für gewöhnlich kommen ihre erfundenen Geschichten wie aus der Pistole geschossen, aber heute Nacht ist sie erstaunlich schlecht vorbereitet.
»Ich muss noch mal los.«
»Es ist nach elf. Wo willst du denn um diese Uhrzeit noch hin? Wir müssen morgen früh schwimmen.«
Jetzt setze ich mich auf und mache mir Sorgen, weil Marie dazu neigt, sich in Schwierigkeiten zu bringen.
»Elli, bitte.«
Sie will mich nicht anlügen, was ich ihr hoch anrechne, stattdessen kommt sie wieder einen Schritt ins Zimmer, sucht meinen Blick und findet ihn erst, als ich die kleine Nachttischlampe einschalte.
»Du verrätst mich doch nicht, oder?«
»Kommt darauf an, wo du hinwillst.«
Ich sehe, wie sie kurz mit sich ringt, dann gibt sie auf.
»Es gibt noch eine heimliche Fete bei den Ungarinnen, eine Party, und es heißt, dass auch Jungs eingeladen sind!«
»Aber es ist doch schon so spät.«
»Deswegen ja auch heimlich.«
Maries helle Augen blitzen vor lauter Vorfreude auf, und jetzt erst fällt mir auf, dass sie sogar etwas Lippenstift aufgetragen und sich ihre schulterlangen blonden Locken wie ihr großes Vorbild Marilyn Monroe frisiert hat. Dazu trägt sie einen roten, wadenlangen, weit ausgestellten Rock und eine eng anliegende helle Bluse.
»Eine Party, ja?«
Ein merkwürdiges Gefühl macht sich in meinem Magen breit. Ein vertrautes, bitteres Gefühl.
»Ja, und ich hoffe, dass dieser große Italiener auch da ist.«
Natürlich geht es um den großen Italiener, den Marie heute Vormittag gesehen hat, als wir zur Schwimmhalle gegangen sind. Ob sich die Mitglieder des Internationalen Olympischen Komitees darüber bewusst waren, dass so etwas passieren kann, als sie beschlossen haben, das erste Mal Männer und Frauen zusammen trainieren zu lassen? Ich fürchte nicht.
»Marie, der ist mindestens zehn Jahre älter als du!«
Sie zuckt die Schultern, als wäre das nur ein kosmetischer Fehler auf dem Papier.
»Ich will ihn doch nur anschauen! Wo denkst du hin?!«
Maries Lächeln wirkt immer etwas verliebt, dabei hat sie mit ihren siebzehn Jahren noch nie einen Jungen geküsst.
»Also, du verrätst mich nicht, ja?«
»Natürlich nicht. Aber pass gut auf dich auf.«
Sie stürmt auf mich zu, umarmt mich und drückt mir einen Kuss auf die Wange.
»Freilich! Und danke, ich bleibe auch nicht zu lange fort!«
Damit ist sie fast schon wieder an der Tür, als ihr noch etwas einfällt und sie zu mir zurücksieht. Wieder ist da dieses abenteuerlustige Funkeln in ihrem Blick.
»Oder willst du mitkommen?«
Ich lache leise auf und schüttle entschlossen den Kopf.
»Nein. Ich habe nicht vor, morgen übermüdet vom Startblock zu fallen.«
»Sicher?«
»Ja. Sicher. Außerdem bin ich nicht mal eingeladen.«
Das klingt so bitter, wie die Worte auf meiner Zunge schmecken. Ich werde nie eingeladen, weil sie meine Antwort kennen. Ich gehöre zu den Besten der Besten. Ich habe keine Zeit, zu feiern.
»Na, Dummerchen, ich lade dich ja jetzt ein. Komm mit!«
Sie klingt dabei so hoffnungsvoll, dass ich fast versucht bin, eine Zusage zu geben, nur damit ich nicht den enttäuschten Hundeblick sehen muss, der unweigerlich folgen wird.
»Ich verzichte. Aber danke.«
»Mensch, Elli. Irgendwann musst du mal mitkommen.«
»Das geht nicht. Deswegen sind wir nicht hier. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen, und das wird uns nicht gelingen, wenn wir uns die Nächte mit schönen Italienern vertreiben. Ich will Gold.«
»Ich doch auch, aber du bist siebzehn, und unsere Eltern sind am anderen Ende der Welt. Das ist die Chance unseres Lebens.«
Kurz ist da wieder dieser Anflug von einem Kribbeln in meinem Bauch, aber wie immer gewinnt die Vernunft. Ich schalte die Nachttischlampe wieder aus.
»Komm nicht zu spät, ja?«
Sie antwortet nicht, sondern schlüpft lautlos aus dem Zimmer und schließt die Tür. Ich bleibe liegen und lausche in die Dunkelheit, aber Marie ist die Meisterin der geräuschlosen Flucht – so oft, wie sie sich in den Trainingslagern zu Hause rausschleicht und nicht erwischt wird. Das ist bestimmt rekordverdächtig.
Ich schließe die Augen und fange an zu zählen. Rückwärts von zweihundert. Meistens schlafe ich ein, bevor ich bei hundertsiebzig bin.
Doch diesmal bin ich auch bei einhundertvierunddreißig noch hellwach. Dabei war ich bis eben noch hundemüde. Bis Marie gegangen ist. Auf eine Party am anderen Ende der Welt. Auf die ich nicht gehen werde. Sicher nicht. Also weiter.
Einhundertdreiunddreißig.
Was soll ich schon verpassen? Jungs? Musik?
Einhundertzweiunddreißig.
Was ich sicherlich verpassen werde, wenn ich jetzt gehe, ist eine neue Bestzeit. Und eine Goldmedaille.
Einhunderteinund…
Wir sind nicht zum Feiern hier. Das weiß Marie. Das wissen wir alle. Wir sind hier, um zu gewinnen.
Ich rolle mich auf die Seite und starre auf das leere Bett mir gegenüber, das ich in der Dunkelheit nur schemenhaft ausmachen kann.
Einhunderteinund… Wo war ich?
Na, toll. Jetzt bin ich wach. Kurz entschlossen schlage ich die dünne Bettdecke zur Seite und setze mich auf. An Schlafen ist jetzt erst mal nicht mehr zu denken. Vielleicht … hilft ein Glas Wasser. Oder ein kurzer Spaziergang an der frischen Luft. Oder … Nein. Das ist eine ganz miese Idee. Hinlegen, weiterzählen, schlafen und morgen mit neuer Kraft loslegen. Andererseits beginnt das Training morgen erst um acht Uhr. Wegen des anstrengenden Flugs rund um die Welt dürfen wir etwas länger schlafen.
Zu Hause wäre es jetzt Mittag. Vielleicht bin ich deshalb so hellwach. Und wenn ich ohnehin schon wach bin, könnte ich ja auch … Nein. Andererseits. Ich könnte einfach einen kleinen Spaziergang machen. Ich muss ja nicht zu den Ungarinnen gehen. Ja, das ist eine gute Idee. Die frische Nachtluft wird mir guttun.
Schnell ziehe ich mich um, schlüpfe in meinen dunkelblauen Trainingsanzug und schleiche zur Tür. Mein Herz schlägt wild, als ich auf den menschenleeren Flur unserer kleinen Wohnanlage auf einem mir völlig fremden Kontinent spähe.
Und dann gehe ich los.
Kapitel fünf
Karla
Stuttgart, 1. August 2017, 23:50 Uhr
Die analoge Uhr in meinem Wagen zeigt an, dass ich noch genau zehn Minuten habe, um aus dieser Sache rauszukommen. Aber mir fällt einfach kein Fluchtplan ein, der nicht damit endet, dass ich im Gefängnis sitze – sei es wegen Drogenhandels oder Mordes. Also schalte ich einen Gang hoch und sehe kurz zu der kleinen hawaiianischen Hulafigur mit Kokosnussbikinioberteil, rotem Bastkleid und bunter Blumenkette, die auf dem Armaturenbrett klebt und der dieser Wagen seinen Namen verdankt: Lola.
»Na, hast du eine Idee, wie wir uns vor dieser kleinen Spritztour jetzt noch drücken können?«
»Na, hast du eine Idee, wie wir uns vor dieser kleinen Spritztour jetzt noch drücken können?«
Sie strahlt mich zufrieden hüftschwingend an.
»Nichts? Keine Idee?«
Kurz meine ich, sie würde mir aufmunternd zuzwinkern.
»Was? Du willst dich gar nicht drücken?«
Lolas Hüftschwung scheint einen Zahn zuzulegen.
»Verräterin. Hör auf damit!«
Doch Lola wackelt fröhlich weiter vor sich hin.
»Lass das! Ich kann das nicht wirklich machen. Das ist doch verrückt. Und wahrscheinlich kriminell. Und was ist, wenn sie morgen früh merken, dass die Kaiser fehlt, und die Polizei rufen? Wenn sie eins und eins zusammenzählen? Wenn wir von Interpol steckbrieflich gesucht werden? Na, was machen wir dann?«
Darauf hat Lola natürlich keine Antwort, aber was kann man schon von einem hawaiianischen Urlaubsmitbringsel erwarten?
Als ich drei Minuten später die schwach beleuchtete Bushaltestelle vor mir sehe, bleibe ich in einiger Entfernung am Straßenrand stehen, versteckt hinter einem wuchtigen Kastenwagen. Ich schubse die Hulatänzerin mit dem Finger an, und sofort schwingt sie wie wild die Hüften.
Dieser Wagen ist eigentlich schon zu alt für einen Roadtrip ins Ausland. Immerhin hat Lola bereits über dreißig Jahre auf dem Buckel und gilt damit offiziell als Oldtimer, auch wenn sie wirklich gut in Schuss ist. Ich hoffe, dass es nicht die letzte Reise für die alte Dame ist. Also für Lola, nicht für die Kaiser. Die kann von mir aus für immer bei ihren Freunden bleiben.
Abgesehen von Frau Geiger, habe ich niemandem Bescheid gegeben, dass ich in den »Urlaub« fahre. Sollte ich mich vielleicht doch noch irgendwo abmelden, wenn ich die nächsten paar Tage unauffindbar bin? Nur, um keinen unnötigen Verdacht oder eine Vermisstenanzeige bei der Polizei zu riskieren? Schnell hole ich mein Handy heraus, scrolle durch meine wenigen Kontakte und finde niemanden, bei dem ich mich abmelden müsste: mein Zahnarzt, mein Hausarzt, mein Sushi-Lieferdienst, die Zentrale der Pinie, längst verblasste Bekanntschaften aus einem anderen Leben. Meine Eltern würden wahrscheinlich eher misstrauisch werden, dass ich mich freiwillig bei ihnen melde, um sie an meinem Leben teilhaben zu lassen, und Geschwister habe ich keine. Frau Kaiser hat recht: Mich wird niemand vermissen.
Klack! Der Zeiger meiner Uhr springt lautstark auf die Zwölf, und ich zucke erschrocken zusammen.
Mitternacht.
Zeitgleich öffnet sich beim Seniorenheim das Gartentor, das ich nach Feierabend nicht abgeschlossen habe. Eine dunkel gekleidete Gestalt tritt in den schwachen Lichtkegel der Straßenlaterne. Die Kaiser. Unbewusst halte ich den Atem an, als würde ich darauf warten, dass die Geiger gleich hinter ihr herstürzen, die alte Dame überwältigen, sie zurück in die Schattige Pinie zerren und ihre Pläne damit ruinieren würde.
Aber niemand hält sie auf.
Stattdessen spaziert die Kaiser in aller Seelenruhe mit einem Koffer in der Hand und Selena unter dem Arm über die Straße auf die Haltestelle zu. Als würde sie auf den nächsten Bus warten, studiert sie den Abfahrtsplan und nimmt dann auf der Bank Platz. Heute Nacht trägt sie einen für sie vollkommen untypischen dunklen Jogginganzug, der sie wie einen in die Jahre gekommenen Ninja aussehen lässt, dazu rote Turnschuhe, die der einzige Farbklecks ihres Outfits sind. Wenn man von Selena mal absieht. Was will sie denn eigentlich mit der Pflanze?