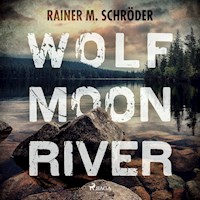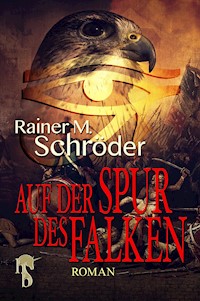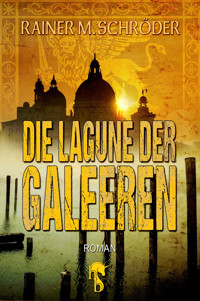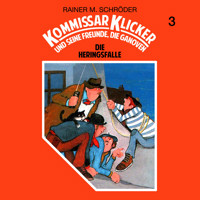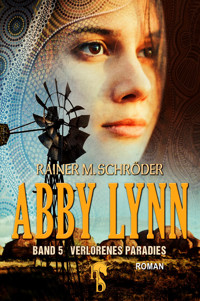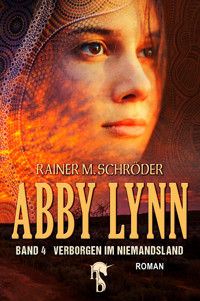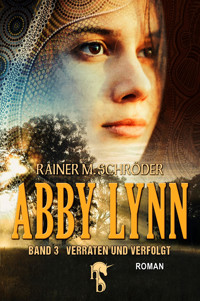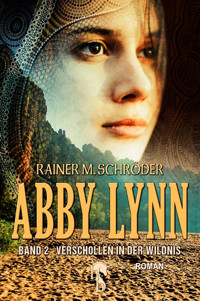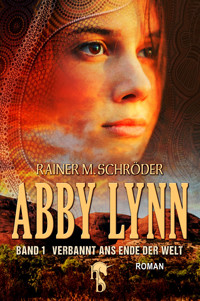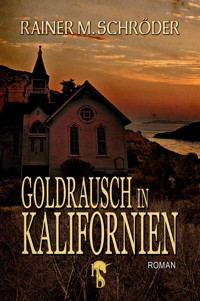
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Eine sensationelle Nachricht verbreitet sich im Februar des Jahres 1848 über Telegraphen in die ganze Welt hinaus: In Kalifornien wurden unermessliche Goldlager entdeckt. Johann August Sutter hat die fruchtbaren, nur von Indianern bewohnten Täler Kaliforniens mit harter Arbeit in eine blühende Siedlung verwandelt, nachdem er vor fünf Jahren wie ein Verbrecher bei Nacht und Nebel seine Heimat in der Schweiz verlassen musste. Nun suchen Tausende ihr Glück als Goldgräber in Kalifornien, fallen raubend und plündernd über das Sacramento-Tal her und zerstören damit Johanns Lebenswerk: Arbeiter, Soldaten, Diebe, Mörder und Abenteurer. Sie alle werden vom Goldfieber gepackt. Und jeder Einzelne träumt davon, möglichst schnell als reicher Mann wieder in seine Heimat zurückkehren zu können …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Rainer M. Schröder
Goldrausch in Kalifornien
Roman
1
Gierig leckten die meterhohen Flammenzungen an den knochentrockenen Stämmen hoch und verwandelten die Baumkronen innerhalb von Sekunden in rot flackernde Feuerpilze. Die mehrere hundert Meter breite Flammenwand fraß sich durch die Wälder des weiten, fruchtbaren Sacramentotals im Norden Kaliforniens.
Der gewaltige Gluthauch, der dem lodernden Feuer vorauseilte, reichte aus, um die Farnmeere und Buschdickichte zwischen den Bäumen in Flammen aufgehen zu lassen. Die Feuersbrunst vernichtete alles Leben, das nicht schnell genug fliehen konnte.
Ein zufriedenes Lächeln lag auf dem Gesicht des hageren, großen Mannes, der von einem hoch gelegenen Hügel aus das Inferno aus Flammen und wabernden Rauchwolken beobachtete. Johann August Sutter war der Name des siebenunddreißigjährigen Mannes, der ruhig im Sattel seines prächtigen Hengstes Wild Bill saß. Die sehnigen Hände ruhten auf dem Sattelknauf. Mit hellen, wachsamen Augen verfolgte er den Weg des gigantischen Feuers, das er und seine Männer angezündet hatten.
Hufschlag erklang hinter ihm. Ein stämmiger Reiter mit kantigen Gesichtszügen und pechschwarzem Haar zügelte neben Sutter sein Pferd.
»In der Hölle kann es nicht schlimmer aussehen«, sagte Ted Sullivan lachend und tätschelte beruhigend den Hals seines Rotfuchses. Der rote, zuckende Lichtschein des Feuers ängstigte das Tier.
»Aus dieser Flammenhölle wird das Paradies entstehen«, antwortete Johann Sutter mit fester, entschlossener Stimme. Er nahm seinen Blick nicht von der Feuersbrunst, die immer höher in den Himmel wuchs. Der Wind, der aus Nordosten von den hohen Bergen der Sierra Nevada wehte, frischte auf. Rauchwolken trieben über den breiten Sacramentostrom, der das fruchtbare Tal durchzog. »Aus der Asche werden blühende Felder und Äcker wachsen!«
»Zuerst einmal hoffe ich, dass das Feuer an den Ufern des Sacramento und des American River zum Stehen kommt«, erwiderte Ted Sullivan trocken. Er war Anfang dreißig und früher Lagerverwalter in Missouri gewesen, bevor er sich vor einem Jahr Sutters Treck nach Kalifornien angeschlossen hatte.
»Es wird so kommen, wie ich es sage!«, versicherte Johann Sutter im Brustton der Überzeugung.
Ted Sullivan zog seinen Tabaksbeutel hervor und drehte sich eine Zigarette. Das Zündholz riss er am Sattelknauf an. »Hat Tom übrigens das Fuhrwerk vor den Flammen retten können?«, fragte er interessiert.
Johann Sutter stutzte und runzelte die Stirn. »Wieso fragen Sie mich das, Ted? Er müsste doch schon längst bei Ihnen oben im Lager angekommen sein!«
Ted Sullivan sah den hageren, energiegeladenen Treckführer verwundert an. »Oben im Lager ist er nicht«, stieß er mit heiserer Stimme hervor. »Wir dachten, Sie hätten ihn sofort zum American River geschickt, damit er dort die Nordflanke des Feuers beobachtet.«
Johann Sutter fluchte laut. »Zum Teufel, da haben wir beide das Falsche gedacht. Ich habe ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen, seit er in die Senke hinuntergeritten ist.«
Ted Sullivan schluckte schwer. Entsetzen trat in seine grauen Augen, die unter buschigen schwarzen Brauen lagen. »Aber dann … befindet er sich ja immer noch da unten!« Seine Stimme klang wie ein aufgeregtes Krächzen.
»Ja, das ist anzunehmen«, sagte Johann Sutter. Die Gedanken jagten sich hinter seiner sonnengebräunten, von tiefen Linien durchzogenen Stirn.
Tom war mit seinen zwanzig Jahren der Benjamin des Trecks. Thomas Wedding lautete sein vollständiger Name. Vor zwei Jahren war er aus Deutschland ausgewandert. Den Grund dafür kannte keiner. Und hier in Amerika fragte auch keiner danach. Für die Menschen, die den weiten, beschwerlichen Weg über den Atlantik zurückgelegt hatten, zählte nicht die Vergangenheit, sondern nur der Mensch und das, was er leistete. Fast jeder, der ins Land der unbegrenzten Möglichkeiten auswanderte, führte ein Geheimnis mit sich. Auch Johann Sutter.
»Wir müssen etwas unternehmen!«, rief der Treckführer und sein Blick glitt über die gewaltige Feuerwand nach Süden. Kurz bevor sie das Feuer entfacht hatten, war ein Fuhrwerk in einer Bodensenke mit zersplitterten Räderspeichen liegengeblieben. Tom Wedding, der handwerklich sehr geschickt war, war zurückgeblieben, um die Reparatur auszuführen. Ein Fuhrwerk in dieser Wildnis, fernab von der nächsten Siedlung, zu verlieren bedeutete einen großen Verlust.
»Es ist zu spät! Niemand kann ihm jetzt noch helfen, Mister Sutter. Das Feuer hat ihm den Weg abgeschnitten. Er ist verloren.«
»Wir müssen es zumindest versuchen!«, erwiderte Johann Sutter entschlossen. Tom Wedding war schon seit Beginn des langen, gefährlichen Trecks nach Kalifornien dabei. Er konnte ihn jetzt nicht seinem Schicksal dort in der Flammenhölle überlassen.
»Sie wissen, dass ich wahrlich kein Feigling bin!«, antwortete Ted Sullivan mit erregter Stimme. Hektische Flecken übersäten sein Gesicht. »Aber in das Flammenmeer hineinzureiten ist heller Wahnsinn!«
»Dann versuche ich es eben allein!« Johann Sutter gab seinem Hengst die Sporen und kümmerte sich nicht um die beschwörenden Worte von Ted Sullivan.
Wild Bill machte einen jähen Satz nach vorn und galoppierte den Hügel hinunter. Das Vertrauen des Pferdes zu seinem Reiter war grenzenlos. Im gestreckten Galopp jagten Pferd und Reiter auf das Feuer zu.
Je näher sie dem tosenden Inferno kamen, desto lauter wurde das Prasseln und Brausen. Mit ohrenbetäubendem Krachen stürzten mächtige Einsiedlereichen zu Boden. Glühende Holzstücke flogen gefährlich wie Pistolenkugeln durch die Luft, begleitet von einem Funkenregen. Das Ende der Welt konnte nicht anders sein.
Johann Sutter duckte sich im Sattel und trieb den Hengst an. Noch hatten die südlichen Ausläufer des Feuers die Bodensenke nicht erreicht. Aber das bedeutete nicht viel. Beißende Rauchwolken und glühend heiße Winde brachten den Tod genauso schnell wie die gierigen Flammen.
»Lauf!«, schrie Sutter seinem Hengst zu. »Lauf! Zeig, was in dir steckt!« Das Donnern der Hufe ging im Tosen des Feuers unter.
Die ersten Rauchschwaden erreichten sie. Johann Sutter zog das Halstuch vor Mund und Nase. Viel Schutz bot es jedoch nicht. Jetzt kam es vor allem darauf an, dass es blitzschnell ging.
Johann Sutter kniff die Augen zusammen, die unter der Raucheinwirkung sofort zu tränen begannen. Viel Zeit blieb ihm nicht. Funkenflug ging nieder. Tausend kleine Nadeln schienen Pferd und Reiter zu stechen.
Wild Bill scheute nun doch. Mit schrillem Wiehern stieg er vorn hoch. Sutter bekam ihn wieder unter Kontrolle. Die Rauchschwaden ließen alle Umrisse in einem nebligen Schleier zerfließen.
»Tom! Tom!«, brüllte Sutter. Die Luft war heiß wie Wüstenwind und brannte in den Lungen. Der Gluthauch machte das Atmen zur Qual.
»Tom!?… Wo bist du?«
Keine Antwort.
Sutter presste die Lippen zusammen, riss an den Zügeln und drang noch ein wenig tiefer vor. Er wusste jedoch, dass er in spätestens zehn, fünfzehn Sekunden seine Rettungsaktion abbrechen musste, wollte er nicht selbst den Tod finden. Der Wind hatte nämlich etwas gedreht und trieb das Feuer nach Süden.
Plötzlich entdeckte er einen dunklen Schatten links von sich. Er trieb Wild Bill darauf zu. Im nächsten Moment waren die Umrisse eines Mannes, der mit dem Gesicht zur Erde lag, zu erkennen. Es war Tom Wedding!
Eine wilde Freude durchfuhr Sutter, begleitet jedoch von der Angst, Tom könnte schon tot sein. Er brachte den Hengst zum Stehen und sprang aus dem Sattel. Mit der linken Hand hielt er die Zügel fest umklammert, damit Wild Bill nicht in panischer Angst davonjagte. Ohne Pferd hatten sie nicht den Hauch einer Chance, lebend aus dieser Flammenhölle herauszukommen.
Sutter beugte sich zu Tom Wedding hinunter, packte ihn an der Schulter und drehte ihn mit einem Ruck auf den Rücken. Das Gesicht des jungen deutschen Auswanderers wirkte leblos. Eine blutige Schramme zog sich von der rechten Schläfe bis zum Wangenknochen hinunter. Rußpartikel hatten sich im blonden, von der Sonne gebleichten Haar festgesetzt. An der Stelle, wo die Schramme an seiner Schläfe begann, war der Haaransatz angesengt.
Sutter sah, dass sich Weddings Brust hob und senkte. Er lebte also noch und war nur bewusstlos! Vermutlich war er vom Pferd gestürzt oder von einem brennenden Holzstück getroffen worden.
»Wedding!«, schrie Johann Sutter und versuchte das Prasseln des Feuers zu übertönen. Der Wind trieb das Flammenmeer immer näher heran. Die Hitze wurde unerträglich. »Kommen Sie zu sich! Wedding!«
Sutter wurde von einem heftigen Hustenkrampf geschüttelt. Die Augen brannten höllisch. Lange konnte er es nicht mehr aushalten. Wild Bill zerrte unruhig an den Zügeln und stampfte ängstlich mit den Hufen. Jeden Augenblick konnte er sich losreißen.
Um ihn schnell wieder zu sich zu bringen, schlug Sutter Wedding rechts und links ins Gesicht. Wedding schlug die Augen auf und krümmte sich sofort in einem Hustenanfall.
»Mister … Sutter …«, brachte Tom Wedding mühsam hervor und starrte den Treckführer ungläubig aus blutunterlaufenen Augen an.
»Wir müssen augenblicklich von hier verschwinden! Zum Teufel, kommen Sie endlich hoch, Wedding, sonst bleibt nur noch ein Häufchen Asche von uns übrig!«
Tom Wedding sah sich mit verständnislosem Blick um. In seinem Schädel dröhnte es. Mit Erschrecken sah er die atemberaubend hohe Feuerwand, die aus nördlicher Richtung auf sie zugerast kam. Nur ein paar lächerliche Meter trennten sie noch davon.
»Ich … ich kann nicht«, stöhnte Wedding verzweifelt.
»Verdammt, reißen Sie sich zusammen!«, fuhr Johann Sutter ihn grob an. Nur so vermochte er den jungen Deutschen von dem Schock zu befreien und seine letzten Reserven zu mobilisieren. »Benehmen Sie sich wie ein Mann, Wedding! Sollen die Strapazen und Gefahren der letzten Monate sinnlos gewesen sein? Wollen Sie jetzt, wo wir unser Ziel endlich erreicht haben, einfach aufgeben?«
Tom Wedding hustete, spuckte aus und stemmte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht hoch. »Nein!«, keuchte er. Wilde Entschlossenheit funkelte in seinen klaren, blauen Augen.
Sutter packte ihn an der ledernen Fransenweste und zerrte ihn hoch. Er half ihm in den Sattel. Wedding sank kraftlos nach vorn und umklammerte den Hals von Wild Bill. Sutter schwang sich hinter Wedding auf den Rücken des Pferdes.
»Und jetzt zeig noch einmal, was in dir steckt, Wild Bill! Bring uns aus dieser Hölle hinaus!«, feuerte Johann Sutter den Hengst an und legte seine Arme schützend um den noch benommenen Tom. Im gleichen Augenblick erzitterte der Boden, als mehrere mächtige Eichen krachend einstürzten. Haarscharf sauste ein armdicker glühender Ast an Sutters Kopf vorbei.
Wild Bill schoss wie der Blitz davon. Sutter hatte Mühe, um nicht abgeworfen zu werden. Er presste seine Beine in die Flanken des Tieres. In der linken Hand hielt er noch immer die Zügel.
Der Hengst fand mit sicherem Instinkt den Weg aus der Gefahrenzone heraus. Die Rauchschwaden lichteten sich und der Gluthauch des Feuers ließ spürbar nach.
Als Johann Sutter den klaren kalifornischen Nachmittagshimmel sah, löste sich die gewaltige innere Anspannung und ein befreiendes Lachen kam über seine pulvertrockenen Lippen. Rechts von ihm sah er den Sacramento als helles, schimmerndes Band. Links oben in den Hügeln lag das provisorische Lager, das Sutter mit seinen Leuten aufgeschlagen hatte, solange das Feuer hier unten in der Talebene tobte.
»Wir haben es geschafft!«, rief Sutter außer sich vor Freude und lenkte Wild Bill nach links die Hügel hinauf. Das Tosen des Feuers wurde langsam leiser. Der Hufschlag des galoppierenden Pferdes klang wie Musik in Sutters Ohren. Der frische Wind tat gut. Er atmete tief ein und neue Kraft durchströmte ihn.
Auch Tom Wedding fühlte, wie der letzte Rest Benommenheit von ihm wich. Er richtete sich im Sattel auf und drehte sich mit einem verlegenen Grinsen um.
»Danke, Mister Sutter!«, rief er und hielt sich am Sattelhorn fest. »Sie haben mir das Leben gerettet.«
Sutter fuhr sich mit der Hand über das rußgeschwärzte Gesicht. »Machen Sie nicht so große Worte um eine Sache, die selbstverständlich ist«, murmelte er. »Ich habe Sie aus reinem Egoismus gerettet, denn Sie sind jung und tatkräftig. Und ich brauche wirklich jede Arbeitskraft, um dieses Tal in eine blühende Kolonie zu verwandeln.«
»Trotzdem danke«, erwiderte Tom Wedding und fühlte sich noch stärker mit diesem Mann verbunden, dessen eisernen Willen er bewunderte und der von einer manchmal unheimlichen Unruhe vorangetrieben wurde. Auf dem langen Treck von Missouri nach Kalifornien hatte Johann Sutter bewiesen, dass er Hindernisse nicht akzeptierte. Hindernisse, gleich welcher Art, waren dazu da, um überwunden zu werden.
»Was ist aus dem Fuhrwerk geworden?«, wechselte Sutter nun geschickt das Thema, während er auf das Trecklager zuritt, das fünfhundert Meter entfernt auf einer Hügelkuppe lag.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Tom Wedding über die Schulter. »Irgendein glühendes Holzstück hat mich am Kopf getroffen und aus dem Sattel geschleudert. Noch nie in meinem Leben habe ich solch ein gewaltiges Feuer gesehen. Man könnte meinen, das ganze Tal stehe in Flammen. Hoffentlich macht es an den Ufern der beiden Flüsse auch Halt.«
Johann Sutter lachte selbstsicher. »Ted Sullivan hat dieselben Sorgen.«
»Sie nicht?«
»Nein, es besteht kein Grund dazu«, erklärte Sutter und ließ Wild Bill in eine ruhigere Gangart fallen. »Wir brauchen viel Land für unsere Farmen und Ranches. Und je mehr das Feuer an Wäldern und Dornendickichten niederbrennt, desto weniger Arbeit haben wir. Dieses Tal ist groß genug, um solch ein Feuer mit Leichtigkeit verkraften zu können. So, und jetzt genehmigen wir uns auf den Schreck einen Whisky.«
Das Lager tauchte vor ihnen auf. Ted Sullivan kam ihnen zusammen mit James Marshall entgegengeritten. James Marshall war ein Zimmermann aus New Jersey und gehörte der Glaubenssekte der Mormonen an.
»Sie sind ein Teufelskerl, Sutter!«, rief Ted Sullivan voller Bewunderung. »Ich hätte keinen Cent für Weddings Leben mehr gegeben. Für Ihres, nebenbei bemerkt, auch nicht.«
»Sie sehen, hier in Kalifornien ist alles möglich!«, erwiderte Johann Sutter spöttisch und glitt vom Pferd. »Dieses Tal wird noch Geschichte machen!«
Während Tom Wedding seinen Kopf in einen Kübel kalten Wassers eintauchte, blieb Sutter vor dem Lager stehen und blickte ins Tal hinunter …
Vor fünf Jahren, man schrieb damals das Jahr 1834, hatte er seine Schweizer Heimat wie ein Verbrecher bei Nacht und Nebel verlassen müssen.
Ein bitterer Zug huschte über Sutters Gesicht. In den Augen der Bewohner von Aarau war er vermutlich auch ein Verbrecher. Denn hatte er den traditionsreichen Druckereibetrieb nicht in den Bankrott geführt? Über fünfzigtausend Franken hatte seine Schuld betragen – und betrug sie immer noch. Im letzten Augenblick hatte er sich damals der Verhaftung entziehen können. Er hatte seine Frau und seine zwei Kinder in der Schweiz einem ungewissen Schicksal überlassen müssen.
Johann August Sutter dachte nicht gern daran. Gewissensbisse quälten ihn, obgleich seine Frau ihn zu diesem Schritt ermutigt hatte. Nur hier in Amerika, dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, konnte er ein neues Vermögen schaffen. Eines Tages würde er seine Schulden auf Heller und Pfennig zurückzahlen und seine Familie nachkommen lassen. Es würden aber noch Jahre vergehen, bis es so weit wäre.
Über ein Jahr hatte er allein gebraucht, um vom Fort Independence nach Kalifornien zu kommen, das bis auf ein paar schäbige Küstensiedlungen und Missionsstationen noch unerforschtes und nur von kriegerischen Indianerstämmen bewohntes Land war. Die lange, entbehrungsreiche Reise hatte viele Todesopfer gefordert.
Das Schicksal trieb ihn und die wenigen Getreuen wie Ted Sullivan und Tom Wedding, die trotz aller Strapazen und Gefahren bei ihm blieben, zuerst hoch in den Norden nach Vancouver und anschließend für mehrere Monate auf die im Pazifik liegenden Hawaii-Inseln.
Sutter und seine Leute verlebten eine paradiesische Zeit, verloren jedoch nie ihr Ziel aus den Augen. Sie wollten nach Kalifornien, das war ihre fixe Idee. Und niemand konnte sie davon abhalten.
Um das nötige Geld für die teure Expedition nach Kalifornien zusammenzubekommen, begann Johann Sutter auf Hawaii mit Kopra, Perlmutt und Schildpatt zu handeln – mit viel Erfolg. Sehr schnell wurde er zu einem vermögenden Mann, dem einfach alles gelang.
Doch anstatt sein Handelsunternehmen auf Hawaii weiter auszubauen und sich dort für immer niederzulassen, investierte er sein gesamtes Vermögen in die Ausrüstung für seine Kalifornienexpedition. Er kaufte nicht nur Werkzeuge, Munition, Lebensmittel und Waffen, sondern warb auch hundertfünfzig Eingeborene als Arbeiter an, die ihm beim Urbarmachen des Landes und beim Bestellen der Äcker und Felder helfen sollten.
Als er endlich an der Küste Kaliforniens landete, besaß er nicht eine Handbreit Boden. Deshalb suchte er den mexikanischen Gouverneur Juan Bautista Alvarado auf, der in dem kleinen, verschlafenen Hafenstädtchen Monterey mehr schlecht als recht residierte. Kalifornien gehörte zwar zu Mexiko, doch die Mexikaner hatten niemals den ernsthaften Versuch unternommen, das riesige Land zu kolonialisieren.
Gouverneur Alvarado wollte zuerst nicht recht glauben, dass es Johann Sutter mit seinem Vorhaben ernst war. »Sie riskieren nicht nur Ihr gesamtes Vermögen, Capitano Sutter. Sie setzen auch das Leben Ihrer Männer aufs Spiel. Wenn Sie tiefer ins Land vordringen, werden Sie vor den Indianern nicht mehr sicher sein.«
Johann Sutter, der sich dem Gouverneur als ehemaliger Hauptmann der eidgenössischen Armee vorgestellt hatte, ließ sich von seinem Plan nicht abbringen.
»Ich bin monatelang durch Indianerland gezogen«, erwiderte er selbstbewusst. »Ich werde mit den Indianern verhandeln, Frieden schließen und ihnen Arbeit auf meinen Farmen und Ranches geben. Es ist Platz für uns alle da.«
Juan Alvarado musterte den hochgewachsenen, sehnigen Mann nachdenklich und lächelte schließlich. »Ich habe Sie gewarnt, Capitano. Aber vielleicht schaffen Sie es wirklich. Meinen Segen dafür haben Sie. Wie viel Land brauchen Sie?«
Johann Sutter zögerte nicht eine Sekunde. »Fünfzigtausend Morgen!«, verlangte er.
Der Gouverneur zog überrascht die Augenbrauen hoch. »Fünfzigtausend? Das ist ja groß genug für ein Fürstentum, Capitano!«
Sutter hielt seinem Blick stand. »Mit Kleinigkeiten gebe ich mich gar nicht erst ab, Exzellenz. Wenn ich schon mein Vermögen und mein Leben riskiere, dann muss es sich auch lohnen!«
Der Gouverneur war von der eisernen Zielstrebigkeit und der Energie, die dieser Mann ausstrahlte, beeindruckt. Er überlegte nicht lange.
»Sie sollen Ihre fünfzigtausend Morgen bekommen, Capitano!«, sagte er und rief nach dem Schreiber.
In Monterey warb Sutter noch Handwerker an. Mit ihnen und der Landverschreibung über fünfzigtausend Morgen Land im Sacramentotal kehrte er nach San Francisco zurück, das im Jahre 1839 nur aus einem Dutzend baufälliger Hütten bestand.
Nun endlich konnte es losgehen. Sutters eindrucksvolle Karawane aus zwei Dutzend Weißen und hundertfünfzig Eingeborenen von Hawaii, dreißig schweren Fuhrwerken und fünfzig Pferden, Mauleseln, Kühen und Schafen machte sich auf den Weg ins weite, fruchtbare Sacramentotal.
Und dort, wo der aus den Bergen der Sierra Nevada kommende American River in den Sacramento fließt und die Landschaft terrassenförmig ansteigt, beschloss Sutter die erste Siedlung zu gründen.
Das Feuer sollte dafür Raum schaffen.
Sutter schreckte aus seinen Gedanken hoch, als Tom Wedding mit einem Glas Whisky zu ihm vor das Lager trat.
»Ihr Drink, Captain.«
Sutter nahm das Glas und hob es gegen das Feuer. »Auf Neuhelvetien!«, rief er, denn so hatte er seinen Landbesitz getauft.
»Und auf Sutters Fort!«, fügte Tom Wedding hinzu. Diesen Namen sollte die erste Siedlung hier am Zusammenfluss des Sacramento und des American River tragen.
»Sobald das Feuer erloschen ist, beginnen wir mit der Arbeit«, sagte Johann Sutter und konnte es gar nicht erwarten. Sein Lebenstraum ging hier in Erfüllung. Er ahnte jedoch nicht, dass er als schrecklicher Alptraum enden würde …
2
Das Feuer tobte die ganze Nacht. Der Flammenschein tauchte das Tal in ein unheimliches, rötliches Licht. Der Funkenflug schien Löcher in die samtene Schwärze des Nachthimmels zu brennen. Es war ein faszinierendes Schauspiel.
Kurz vor dem Morgengrauen drehte der Wind und trieb die Flammenwand auf die Flussufer zu. Im ersten Licht der Morgensonne bäumte sich die Feuersbrunst noch einmal an den Ufern auf, versuchte verzweifelt, über den Strom zu springen. Die kühlen Fluten jedoch stellten ein unüberwindliches Hindernis dar. Dampfwolken stiegen auf, als die Flammen im schlammigen Ufersand in sich zusammenfielen.
Die Feuerwoge hatte ganze Arbeit geleistet. Nur hier und da reckte sich der verkohlte Stamm einer Eiche oder eines Einsiedlerbaumes empor.
»An die Arbeit, Männer!«, rief Sutter, als die Sonne über den Bergspitzen der Sierra Nevada aufstieg.
Das provisorische Lager wurde abgebrochen und unten am Ufer des American River wieder aufgebaut. Tom Wedding und der Schreiner James Marshall zogen zusammen mit zwei Eingeborenen los, um Bäume zum Bau der ersten Blockhütten zu fällen.
Ted Sullivan überwachte indessen das Abladen der Fuhrwerke. Die Kisten und Säcke wurden zuerst einmal in Zelten untergebracht. Es würde noch einige Zeit dauern, bis die ersten Schuppen und Magazine standen.
Johann Sutter explodierte fast vor Energie. Unablässig ritt er mit Wild Bill von einer Arbeitskolonne zur anderen. Er gab Ratschläge und packte auch selbst mit an, wenn irgendwo Hilfe benötigt wurde.
Der erste Brunnen wurde gegraben. Die Standorte für die Schuppen, Hütten und Magazine legte Sutter fest. Er fertigte einen Plan von dieser Region an und plante genau, wo das Dorf für die Eingeborenen und wo die Gehege für die Schafe und Kühe liegen sollten. Er wollte nichts dem Zufall überlassen. Vor seinem geistigen Auge sah er schon ganz genau, wie das Tal in einem Jahr aussehen würde.
Die Luft war erfüllt vom Hämmern, Graben und Sägen der Männer. Die ersten Äcker wurden umgepflügt und Saat ausgestreut, kaum dass die Asche abgekühlt war.
Am frühen Nachmittag kehrten Tom Wedding und der Mormone James Marshall mit ihrer Arbeitskolonne aus den Wäldern zurück. Sie brachten zwei Dutzend Baumstämme mit, die zu Brettern und Balken zersägt werden sollten.
»Captain!«, rief Tom Wedding, als er Sutter auf seinem prächtigen Hengst durch das Lager reiten sah.
Sutter lenkte sein Pferd zu Tom Wedding. »Ich habe es schon gesehen, Tom. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Wir machen Fortschritte.«
»Wir werden beobachtet, Captain!«, sagte der junge deutsche Auswanderer mit gedämpfter Stimme Er wollte nicht, dass außer John Sutter jemand hörte, was er sagte.
Der Captain glitt aus dem Sattel und winkte einen Eingeborenen heran, dem er das Pferd übergab. Dann wandte er sich an Tom Wedding.
»Indianer?«, fragte er leise.
Wedding nickte. »Mindestens ein Dutzend«, berichtete er und hatte Mühe, seine Unruhe nicht allzu sichtbar werden zu lassen. »Drüben am Nordrand des Waldstückes lauern sie. Zwei der Indianer habe ich deutlich gesehen, als sie über eine kleine Lichtung huschten.«
»Waren sie bewaffnet?«, fragte Sutter knapp.
»Ja.«
Johann Sutter legte unwillkürlich die Hand auf den Revolver, den er an der rechten Hüfte im Holster trug. »Damit habe ich gerechnet, Tom.«
»Werden die Indianer angreifen?«, wollte Tom Wedding wissen. »Ich meine, immerhin sind wir ein ziemlich großer Trupp und zählen an die hundertachtzig Männer.«
»Die Männer aus Hawaii zählen nicht«, erwiderte Sutter sachlich. »Die meisten wissen überhaupt nicht, wie sie mit einem Gewehr umgehen sollen. Nein, wenn es zum Kampf kommt, werden sie keine große Hilfe sein.«
»Wir müssen etwas unternehmen, Captain!«, drängte Tom Wedding. »Die Männer müssen gewarnt werden!«
Sutter nickte. »Das wird auch geschehen. Sag Ted Sullivan und Cliff Bradley Bescheid. Sie sollen in mein Zelt kommen. Sie natürlich auch, Wedding. Wir besprechen dann alles Weitere.«
»In Ordnung.« Tom Wedding entfernte sich, um den beiden Männern Bescheid zu sagen.
Wenige Minuten später saßen die erfahrenen Westmänner in Sutters Zelt um einen Klapptisch, auf dem die Lageskizze lag, die Sutter am Morgen schon angefertigt hatte.
»Bin gar nicht so traurig darüber, dass die Wilden sich schon jetzt blicken lassen. Hoffentlich lassen sie sich mit dem Angriff nicht so viel Zeit. Je eher sie losschlagen, desto besser können wir sie davon überzeugen, dass es nichts bringt, sich mit uns anzulegen. Wir werden ihnen höllisch einheizen!«, meinte Cliff Bradley mit erregter Stimme und funkelnden Augen.
Cliff Bradleys Alter zu schätzen musste sogar einem erfahrenen Menschenkenner Kopfzerbrechen bereiten. Er konnte ebenso gut Ende dreißig wie auch Mitte fünfzig sein. Niemand wusste es. Bradley womöglich auch nicht. Ein dichter, rötlicher Bart überwucherte sein lederhäutiges Gesicht, das von zwei hellen, klaren Augen beherrscht wurde. Mund und Nase verschwanden fast im roten Bartgestrüpp.
Bradley war von kleiner, stämmiger Gestalt und kleidete sich wie ein kanadischer Trapper. Auf seinem runden Schädel saß ein speckiger, breitkrempiger Hut, von dem er sich niemals trennte. Bradley hatte der US-Armee jahrelang als Scout gedient und sich Sutters Treck angeschlossen, als dieser von Fort Independence aufgebrochen war.
Johann Sutter konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken. »Wir wissen, dass Sie ein rauer Bursche sind und so manche Indianerschlacht geschlagen haben«, sagte er. »Es geht mir jedoch nicht darum, den Rothäuten eine vernichtende Niederlage beizubringen.«
Cliff Bradley schob den Hut in den Nacken und musterte den Captain, wie die Männer Sutter in einer Mischung von Zuneigung und Respekt nannten, verblüfft. »Worum geht es Ihnen dann?«
»Ich möchte mich mit den Indianern arrangieren, Bradley«, erklärte Sutter. »Und das ist möglich, wenn der Hass auf uns sie nicht daran hindert, vernünftigen Argumenten gegenüber aufgeschlossen zu sein.«
Ted Sullivan nickte zustimmend. »Der Captain hat völlig recht, Bradley. Wir können uns einen Krieg mit den Indianern nicht erlauben.«
Cliff Bradley sah grimmig in die Runde. »Alles schön und gut«, knurrte er. »Aber mit frommen Sprüchen werden wir sie nicht davon abhalten können, uns nach dem Skalp zu trachten. Greifen die Rothäute erst einmal an, bleibt wenig Zeit für ruhige Gespräche«, fügte er mit beißendem Spott hinzu.
»Wir werden den Angriff abschlagen, das ist selbstverständlich!«, sagte Johann Sutter nun mit einem leicht unwilligen Unterton in der Stimme. »Und wir werden ihnen auch den notwendigen Respekt einbläuen. Eines jedoch darf auf keinen Fall geschehen – ein Massaker nämlich!«
Cliff Bradley zuckte mit den Achseln. »Sie haben hier das Kommando, Captain«, brummte er.
Sutter sah ihn mit durchdringendem Blick an. »Sehr richtig«, bekräftigte er. »Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das nie vergessen würden.« Sutter wusste nur zu gut, dass Bradley für Rothäute nur Verachtung übrig hatte.
Ein wütender Blick traf Sutter. »Ich werde Ihre Ermahnung nicht vergessen, Captain!«, sagte er eisig. Und Sutter wusste in diesem Moment, dass er sich Bradley zum Feind gemacht hatte.
Ted Sullivan versuchte zu vermitteln. Cliff Bradley jedoch erhob sich abrupt und verließ das Zelt mit den Worten: »Ich nehme an, Sie werden nachher noch zu den anderen sprechen. Dann erfahre ich ja auch, wie Sie vorgehen wollen.« Ohne eine Antwort abzuwarten, schlug er die Zeltplane zurück und entfernte sich.
»Für so empfindlich hätte ich ihn nicht gehalten«, sagte Tom Wedding verwundert.
»Das hätte er nicht tun dürfen«, meinte auch Ted Sullivan unangenehm berührt.
Captain Sutter wischte das Thema mit einer Bemerkung vom Tisch. »Lieber mache ich mir Bradley zum Feind, als dass ich jahrelang einen verlustreichen Kleinkrieg gegen die Indianer führe.« Damit war die Angelegenheit für ihn erledigt. Er erläuterte ihnen anhand einer Skizze, wie er sich die Verteidigung des Lagers dachte.
Zwanzig Minuten später war die Lagebesprechung beendet. »Lassen Sie Waffen und Munition ausgeben, Sullivan«, sagte Sutter und trat mit ihnen vor das Zelt. »Die Arbeit geht normal weiter.«
Die Nachricht, dass Rothäute um das Lager schlichen, machte schnell die Runde. Kaum jemand war ernstlich beunruhigt. Zumindest zeigte das niemand. Waffen und Munition wurden an die Leute ausgegeben.
Captain Sutter hielt eine kurze Rede und schickte dann alle wieder an die Arbeit. Er selbst schwang sich in den Sattel und ritt das Lager ab. Quer über dem Sattel lag seine schussbereite Doppelflinte.
Sutter beobachtete den nahen Waldrand und das Dornengestrüpp, das dem Feuer nicht zum Opfer gefallen war. Auf den ersten Blick war nichts Verdächtiges zu entdecken. Seinen scharfen Augen entging jedoch nicht, dass sich hier und da in den Büschen etwas regte. Einmal sah er sogar Metall aufblinken.
Die Indianer bereiteten ihm mehr Kopfzerbrechen, als er zugab. Wenn er dieses Tal in ein blühendes Land verwandeln wollte, musste er in Frieden mit den Indianern leben. Doch zuerst würde es zu Blutvergießen kommen. Doch Sutter hoffte, bald Verhandlungen mit den Stämmen aufnehmen zu können. Für Männer wie Cliff Bradley, die nur einen toten Indianer für einen guten Indianer hielten, mochte das zwar eine lächerliche Illusion sein. Aber hatte man nicht schon über ihn gelächelt, als er von Fort Independence aufbrach, um Kalifornien mit Pflug und Saatschaufel friedlich zu erobern?
Die Stunden verrannen. Kein Indianer ließ sich blicken. Und trotzdem spürten alle Männer im Lager, dass sich etwas um sie herum zusammenbraute. Die Bedrohung konnten sie fast körperlich spüren.
Die Anspannung wuchs.
Wachen patrouillierten um das Lager.
Allmählich senkte sich die Sonne dem westlichen Horizont entgegen. Sutter ließ die Fuhrwerke zu einer Wagenburg rund um die Zelte aufstellen. Hinter den schweren Wagen konnten die Männer bei einem Angriff Schutz finden.
Der Glutball verschwand hinter den Bergzügen. Der Himmel schien zu glühen. Ein unheimliches Zwielicht legte sich über das Tal. Alle Gegenstände verloren ihre festen Konturen.
»Das ist die ideale Zeit für einen Angriff«, meinte Ted Sullivan mit sorgenerfüllter Stimme.
»Aufgeregt, Sullivan?«, fragte Sutter spöttisch.
Der ehemalige Lagerverwalter verzog das Gesicht zu einem schiefen Grinsen. »An dieses verfluchte Warten kann ich mich einfach nicht gewöhnen, Captain. Sollen die Rothäute bloß angreifen. Dann weiß ich wenigstens, was ich zu tun habe.«
»Das ist die Taktik der Indianer, Sullivan«, sagte Sutter und blickte über den Rand eines der schweren Fuhrwerke zum Wald hinüber, der die Schatten aufzusaugen schien und sich scheinbar in eine undurchdringliche schwarze Wand verwandelte. »Sie wollen uns zermürben und werden dann angreifen, wenn wir es gar nicht erwarten.«
Ted Sullivan spuckte einen Strahl Kautabaksaft aus. »Uns werden die Skalpjäger nicht überrumpeln, Captain. Ich passe schon auf, dass die Wachen die Augen aufhalten.«
»Halten Sie auch ein Auge auf Bradley«, riet Sutter ihm.
Ted Sullivan folgte dem Blick des Captains und sah den bärtigen Cliff Bradley vor einem der Zelte seine Waffen säubern. In aller Seelenruhe nahm er Gewehr und Revolver auseinander und prüfte alle Teile auf ihre Funktionstüchtigkeit.
»Himmel, der Scout hat wirklich Nerven«, brummte Sullivan mit einer Spur Bewunderung in der Stimme.
»Gerade das meine ich ja.«
Sullivan sah Sutter verständnislos an. »Tut mir Leid, Captain, aber da komme ich nicht mit.«
Johann Sutter deutete mit dem Kopf zu Bradley hinüber. »Bei allem, was man gegen ihn einwenden kann, ist und bleibt er nun mal ein erfahrener Armeescout, Sullivan. Schade nur, dass er nicht bereit ist, sich den neuen Umständen anzupassen. Wir sind nicht hier, um einen Feldzug gegen die Ureinwohner dieses Landes zu führen, sondern um Farmen und Ranches aufzubauen.« Ein träumerischer Ausdruck trat kurz auf Sutters Gesicht, im nächsten Augenblick jedoch blickten seine Augen wieder klar und nüchtern. »Was Bradley nun betrifft, so besitzt er den sogenannten Indianerriecher, Sullivan. Wenn er mit einem Angriff der Rothäute rechnete, würde er jetzt kaum so gelassen vor seinem Zelt sitzen und jede Schraube einzeln prüfen. Deshalb sollen Sie ihn im Auge behalten.«
Ted Sullivans Gesicht hellte sich auf und er lachte leise. »Sie meinen also, Cliff Bradley ist so etwas wie ein Gefahrenbarometer?«
Sutter nickte ernst. »Wenn Bradley sich irgendwo hinter den Fuhrwerken eine günstige Schussposition sucht, dann können Sie sicher sein, dass der Angriff der Indianer nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Bradley sieht mehr als wir beide zusammen, doch er wird uns seine Beobachtungen nicht mitteilen. Sein gekränkter Stolz verbietet es ihm, uns zu warnen.«
»Sturer Hund!«, knurrte Sullivan.
»Wir werden schon auf der Hut sein.«
»Bradley wird von jetzt an nicht eine Sekunde mehr unbeobachtet bleiben«, versicherte Ted Sullivan. »Ich werde mich mit zwei Freunden abwechseln.«
»Tun Sie das, Sullivan, aber machen Sie sich nicht allzu viel Gedanken. Wir haben schon ganz andere Situationen gemeistert«, sagte Sutter aufmunternd.
Ted Sullivan nahm halb aus Spaß und halb aus Ernst Haltung an. »Jawohl, Captain!«
Johann Sutter setzte seine Runde durch das Lager fort. Er sprach mit jedem seiner Leute und stellte fest, dass die Stimmung trotz nervlicher Anspannung ausgezeichnet war. Auch Tom Wedding zeigte sich sehr zuversichtlich.
»Sie werden sich blutige Köpfe holen«, sagte er im Brustton der Überzeugung. »Diese Wagenburg können sie unmöglich stürmen, Captain.«
»Möglich ist alles«, dämpfte Sutter seine Siegesgewissheit. Er blickte nach Westen. Ein letztes, schwaches Glimmen am Himmel kündete die Nacht an. Und niemand wusste, ob die Indianer nicht auch bei völliger Dunkelheit angriffen. Im Schutze der Nacht konnten sie sich gefährlich nahe an das Lager heranschleichen.
»Nur eins stört mich«, sagte Tom Wedding und riss Sutter aus seinen Überlegungen.
»Und das wäre?«
»Dieses monotone Geplapper der Mormonen!«, gestand Tom Wedding mit ärgerlichem Tonfall.
James Marshall hatte sich mit drei weiteren Glaubensbrüdern in eines der Zelte zurückgezogen und murmelte nun inbrünstige Gebete. Sie hatten es abgelehnt, sich an der Verteidigung mit der Waffe zu beteiligen. Sie wollten die drohende Gefahr durch Gebete abwenden.
»Niemand kann sie zwingen, Wedding«, sagte Sutter verständnisvoll und lächelte. »Außerdem können Gebete wirklich nicht schaden.«
»Aber weshalb haben Sie diese Sektierer überhaupt mitgenommen?«, wollte der junge deutsche Auswanderer wissen.
»Weil sie ausgezeichnete Handwerker sind, Wedding. Und das wird bald mehr zählen als gute Schießkünste«, sagte Johann Sutter mit sanfter Zurechtweisung in der Stimme.
Tom Wedding errötete unwillkürlich. Zum Glück war es schon so dunkel, dass niemand es bemerken konnte. »Natürlich«, murmelte er verlegen und packte sein Gewehr fester.
»Dennoch bin ich froh, dass ich Leute wie Sie habe, Wedding, die nicht nur handwerklich geschickt sind, sondern auch noch mit einem Gewehr umzugehen wissen«, fügte Sutter hinzu.
Die Nacht brach herein. Stille senkte sich über das Lager. Die Tiere in den Gehegen unten am Fluss verhielten sich ruhig. Nur ab und zu war das Schnauben eines Pferdes zu hören.
Keiner vermochte in dieser Nacht ein Auge zuzutun. An Schlaf war nicht zu denken. Die Stunden verrannen zäh. Das Warten zehrte an den Nerven. Sogar Sutter hatte Mühe, seine Unruhe unter Kontrolle zu halten.
Die Mondsichel tauchte das Tal in ein diffuses, silbriges Licht. Wolkenfelder trieben wie milchige Schleier über den sternenübersäten Nachthimmel.
Nichts geschah.
Die Gefahr jedoch blieb greifbar nahe.
Die Müdigkeit kroch allmählich in die Körper der von den Strapazen des Tages erschöpften Männer. Manch einer glaubte, die Indianer trauten sich nicht anzugreifen oder aber hätten sich zurückgezogen. Die Aufmerksamkeit ließ nach, je näher der Morgen kam.
Als im Osten ein schwacher grauer Streifen die Schwärze der Nacht aufbrach, schlichen sich die Indianer ans Lager heran. Lautlos und gelenkig wie die Schlangen krochen sie vorwärts.
Immer näher kamen sie. Ihre scharfen Augen durchbohrten die Dunkelheit. Wie schwarze, versteinerte Büffel ragten die schweren Fuhrwerke vor ihnen aus dem Boden. Die Indianer witterten große Beute.
Plötzlich zerriss ein peitschender Gewehrschuss die trügerische Stille. Ein gellender Schrei vor dem Lager folgte. Einen Atemzug darauf brachen die angreifenden Indianer in ein fürchterliches Geheul aus. Mit ihrem markerschütternden Schlachtruf auf den Lippen stürmten sie nun auf die Wagenburg zu.
Die Hölle brach los.
»Die Indianer!«, schrie jemand mit sich überschlagender Stimme und feuerte seinen Revolver auf die heranstürmenden Schatten ab.
Grelle Mündungsblitze jagten den Indianern entgegen und brachten den Tod. Das Krachen der Gewehre und das dumpfe Wummern der Revolver erfüllten das Tal.
Johann Sutter rannte zur Südseite des Lagers, wo der Kampf am heftigsten tobte. Er ging direkt neben Cliff Bradley in Stellung und legte seine Doppelflinte an. Mit einem donnernden Krachen entluden sich beide Läufe.
Pfeile sirrten durch die Luft und bohrten sich mit zitternden Schäften in das Holz der Fuhrwerke oder in den Boden. Ein Speer durchbrach die Seitenwand des Wagens und verfehlte Sutters Schulter nur um eine Handbreit.
Der Captain duckte sich und lud sein Gewehr hastig. »Der erste Schuss kam doch von Ihnen, nicht wahr, Bradley?«, fragte er wütend.
Der ehemalige Armeescout verzog das Gesicht zu einem verächtlichen Lächeln und schoss genau in dem Augenblick, als ein besonders mutiger Indianer zum Sprung ansetzte. Er wurde in der Luft tödlich getroffen und schlug mit einem hässlichen Geräusch vor den Kisten auf, hinter denen Cliff Bradley in Deckung gegangen war.
»Wer sonst hätte den Angriff auch bemerken sollen?«, beantwortete er Sutters Frage nun geringschätzig.
»Wenn Sie uns eher gewarnt hätten, hätten wir den Angriff schon aus größerer Entfernung abschlagen können!«, fuhr Sutter ihn wütend an.
»Zum Teufel mit den Rothäuten!«, schrie Bradley und schoss zur Bekräftigung seiner Worte.
»Wir sprechen uns noch«, murmelte Johann Sutter erbost und feuerte auf einen Trupp angreifender Bogenschützen. Er zielte auf die Beine.
Die geballte Feuerkraft der Weißen warf die Indianer zurück und fügte ihnen eine vernichtende Niederlage zu. An der Nord- und Ostflanke des Lagers zogen sich die Indianer schon zurück. Nur an der Südflanke tobte der Kampf noch. Da auf dieser Seite des Lagers viele verkohlte Stämme lagen, hinter denen die Indianer ausreichend Deckung fanden, sammelte sich hier der Rest der Krieger.
Ihr Anführer gab noch einmal das Zeichen für einen Angriff. Todesmutig stürmten drei Dutzend mit Streitäxten, Speeren und funkelnden Messern bewaffnete Krieger auf die Wagen zu. Es war ein Schrecken erregendes Bild.
Und das Unglaubliche geschah.
Einem halben Dutzend Indianern gelang es, den Schutzwall aus Fuhrwerken und Kistenstapeln zu überwinden.
»Nicht töten!«, schrie Sutter seinen Männern zu. »Setzt sie außer Gefecht, verwundet sie, aber bringt sie nicht um!«
Im gleichen Augenblick flog ein dunkler Schatten von links auf ihn zu. Zu Tode erschrocken wirbelte er mit der Doppelflinte in der Hand herum und wollte schießen.