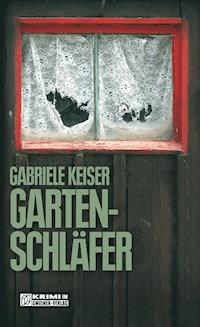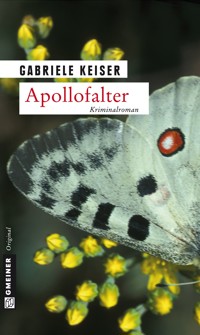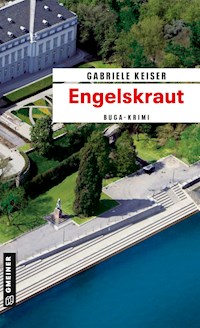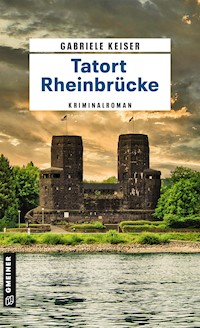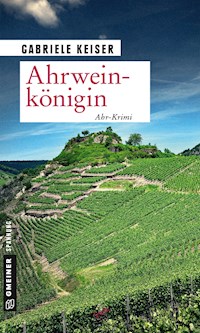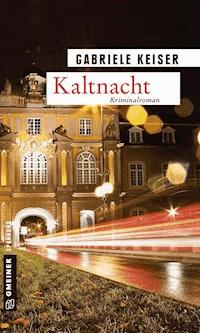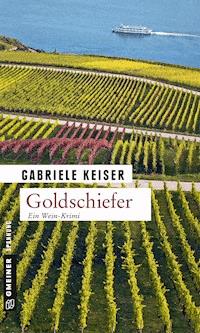
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Franca Mazzari
- Sprache: Deutsch
In der Nähe eines malerischen Weinortes am Mittelrhein wird das Skelett einer jungen Frau gefunden. Handelt es sich um die im Jahre 1984 verschwundene 19-jährige Mary Lou? Laut Polizei war sie damals von zu Hause weggelaufen. Anlass genug gab es dazu: Ihr Vater, der ihr das Leben zur Hölle machte. Oder Winzersohn Rudolf Freyung, von dem sie schwanger war und den sie unbedingt heiraten wollte. Wird nun endlich das Rätsel um ihr Verschwinden gelöst?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele Keiser
Goldschiefer
Kriminalroman
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Vulkanpark (2013), Engelskraut (2011), Gartenschläfer (2008)
Apollofalter (2006), Puppenjäger (2006, mit Wolfgang Polifka)
Heinz-Erhardt-Zitat auf S. 41
© Aus: »Das große Heinz Erhardt Buch«,
2009 Lappan Verlag Oldenburg
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
E-Book: Benjamin Arnold
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Udo Kruse / Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4622-1
Prolog – Leutesdorf, 7. November 1984
Die junge Frau wirft einen vorsichtigen Blick über die Schulter, bevor sie den angerosteten Riegel zurückschiebt. Mit einem Ruck stemmt sie sich gegen die hölzerne Tür, die sich mit einem knarzenden Geräusch öffnet. Ein Schwall Moder, vermischt mit dem betäubenden Geruch nach Gärung, dringt ihr entgegen. Sie bückt sich, hebt den bereitliegenden Holzkeil auf, den sie in den Spalt zwischen Tür und Boden zwängt, um die Tür vor dem Zufallen zu hindern.
Im vorderen Raum des Kellergewölbes lagern Holzfässer mit unterschiedlichem Fassungsvermögen. In den tönernen Gärtrichtern auf der Oberseite der Fässer blubbert das Wasser, die austretenden Gase bringen die Aufsätze zum Tanzen. Jeder einzelne dieser Trichter, so scheint es, erzeugt seine eigene Melodie. Es klingt fast wie bei einem modernen Orgelspiel, wobei der Organist sich eine große Freiheit in der Klangmischung herausnimmt.
Mit tastenden Schritten wagt sie sich tiefer in das Halbdunkel des Gewölbes, an das sich ihre Augen allmählich gewöhnen. Der Weinkeller ist in mehrere Räume unterteilt, in denen eine konstant kühle Temperatur herrscht. Etwas weiter hinten liegen die Flaschenweine der letzten Jahrgänge. Rivaner. Spätburgunder, Weißburgunder. Und vor allem Riesling.
Der hinterste Kellerraum ist durch ein schmiedeeisernes Gittertor abgetrennt. Hier, wo sich die eigentlichen Schätze befinden, ist der Geruch der Gärgase schwächer als im vorderen Bereich des Kellers. Spinnweben vernetzen die Regale, in denen unter einer Staubschicht edle Tropfen lagern. Sie sind zwar etwas unansehnlich, aber, wie sie weiß, einiges wert.
Vieles auf dem Weingut findet sie altmodisch und verstaubt wie diesen Keller hier. Es ist an der Zeit, dass ein wenig frischer Wind durch die alten Gemäuer streicht. Dafür wird sie sorgen, wenn sie erst mal mit Boogie verheiratet ist.
Wo er bloß bleibt? Sie hält ihre Armbanduhr in die Nähe einer der brennenden Kerzen, die überall aufgestellt sind. Um vier Uhr waren sie verabredet, und nun ist es schon eine Viertelstunde über der Zeit.
Auf einmal hört sie Schritte die steinernen Treppenstufen herunterkommen. Endlich. Ihr Herz weitet sich und klopft stärker.
Sie lächelt, als sie an das werdende Leben in ihrem Leib denkt. Zärtlich streicht sie über das sanft gerundete Bäuchlein. Eigentlich ist es viel zu früh für ein Kind, das ist ihr bewusst, aber sie hat es darauf ankommen lassen. Na und? Sie weiß schließlich, was sie will. Und bisher hat sie noch immer bekommen, was sie will.
»Boogie«, ruft sie leise, »ich bin hier. Hier hinten.«
Sie lauscht angestrengt, aber die Schritte kommen nicht näher. Sollte jemand anderes in den Keller gekommen sein? Sie vernimmt ein schabendes Geräusch, dann fällt die schwere Holztür ins Schloss. Ein leiser Schrecken durchfährt sie. Schnell läuft sie in den vordersten Raum, doch dort kann sie kaum etwas außer dem Kerzengeflacker ausmachen.
Sie tastet sich bis zur Tür vor und drückt die Klinke herunter. Nichts bewegt sich. Was bedeutet das? Hat jemand die Tür geschlossen, ohne zu ahnen, dass sie hier drin ist? Oder – bei diesem Gedanken wird ihr ganz heiß – hat sie jemand absichtlich eingesperrt? Nein, das kann nicht sein. Wer sollte so etwas tun? Das ist ganz unmöglich.
Mit aller Kraft stemmt sie sich gegen die Tür und hofft, dass sie vielleicht nur klemmt. Dann rüttelt sie daran, doch wie sehr sie sich auch abmüht, sie gibt keinen Zentimeter nach.
Ruhig, sagt sie sich. Boogie kommt gleich. Er wird alles richten. Noch nie hat er sie versetzt. Er ist die Zuverlässigkeit in Person.
Mit klopfendem Herzen bleibt sie stehen und lauscht. Unangenehm wird sie sich der stetig aufsteigenden Gärdämpfe bewusst. Das Wasser blubbert fortwährend in den Gäreinsätzen. Die Orgelpfeifen spielen weiter ihre dissonanten Klänge. Sie versucht, flach zu atmen, weil sie sich an Fälle erinnert, dass Menschen durch das Einatmen von Gärgasen erstickt sind.
Die Zeit verstreicht. Das Warten kommt ihr endlos vor. Sie kann kaum einschätzen, wie lange sie sich bereits in diesem Keller aufhält. Vom Boden steigt Kälte auf. Sie beginnt zu frieren. Zwar trägt sie die gefütterte Jacke über dem Strickpullover, aber die Strumpfhose unter dem bunt gemusterten Flatterrock ist dünn, ebenso wie die Sohlen der Stiefeletten. Unruhig läuft sie wieder nach hinten, um dort ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, doch die Dunkelheit macht ihr Angst.
Langsam wird ihr das Ganze unheimlich. In ihrem Kopf wirbeln tausend Gedanken durcheinander wie umherirrende Schafe. Sie ruft laut um Hilfe, obwohl sie weiß, dass niemand sie hören kann. Wenn die Person, die vorhin hier unten war, auch die vorderen Klappen geschlossen hat, trennen sie zwei Türen und eine steile Treppe dazwischen von der Außenwelt.
Wie wild beginnt sie gegen das Holz zu trommeln, ihre Zähne klappern, sie zittert am ganzen Körper. Die Knöchel beginnen zu schmerzen und scheuern auf, doch sie will nicht aufgeben. Nochmals ruft sie laut um Hilfe. Vielleicht hört sie doch jemand da draußen.
Aber nichts geschieht.
Erschöpft lässt sie sich zu Boden sinken. Sie fühlt sich aus der Welt gedrängt und versteht nichts mehr. Was ist nur geschehen?
Kälte durchdringt ihren Körper, immer heftiger werdende Schauer rieseln über ihren Rücken. Das Engegefühl in ihrer Brust und der dumpfe Druck in ihrem Kopf verstärken sich von Minute zu Minute. Der Gärgeruch macht sie benommen und lässt ihren Blick verschwimmen. Tränen laufen ihr über die Wangen. Sie wagt kaum noch zu atmen, will die bösen Gedanken wegdrängen, die langsam überhandnehmen.
Denk an etwas Schönes, befiehlt sie sich und legt die Hand auf ihren kleinen Bauch. Mit einem Mal glaubt sie wie aus weiter Ferne Gitarrenklänge zu hören, dazu Boogies Stimme, wie er ihr Lied singt – das Lied von Mary Lou, die er so sehr liebt.
Boogie, wo bleibst du denn? Wieso bist du nicht hier?
Die Fässer und Gegenstände um sie herum sind nur noch als schwache Silhouetten zu erkennen. Die Augen drohen ihr zuzufallen. Nein, sie darf nicht einschlafen. Sie muss wach bleiben.
Noch einmal rafft sie sich auf. Hämmert kraftlos gegen die verriegelte Tür. Rutscht wieder herunter auf den kalten Lehmboden, wo sie sitzen bleibt. Sie kommt nicht mehr gegen das alles beherrschende Wattegefühl in ihrem Kopf an. Ein Gedanke, gegen den sie sich zu wehren versucht, nimmt immer konkretere Gestalt an.
Am Rande ihres Bewusstseins spürt sie, dass sie im Begriff ist, ihr Leben zu verlieren, wenn nicht bald etwas geschieht. Sie hat nicht ans Sterben gedacht. Wieso auch? Sie ist doch erst 19 Jahre alt. Was sie empfindet, ist kein Schmerz. Es ist etwas anderes, für das sie keine Worte hat. Sie weiß nur, es ist fremd und geheimnisvoll.
Wie im Nebel ziehen Gedankensplitter vorüber, die zu undeutlichen Bildfetzen werden und mit einem fernen Echo in ihrem Kopf zusammenfließen. Fragmente voller Glück, umhüllt von einem weichen goldgelben Schimmer. Eine kleine Familie. Vater. Mutter. Kind. Sie wandern durch sonnenbeschienene Weinberge. Liebevolle Hände schwingen das Kind in ihrer Mitte vor und zurück, heben es in die Luft. Engelchen flieg …! Der Himmel ist eine blaue Kuppel und spiegelt sich im Fluss tief unten. Himmelsblau und Flussblau vermischen sich. Es gibt keine Grenzen mehr … über die Sieg. Über den Rhein … Die Luft flirrt. Sie fühlt sich auf angenehme Weise aufgehoben. Schwerelos … in den Himmel hinein.
Noch einmal versucht sie, Atem zu holen. Für einen kurzen Moment beschleunigt sich ihr Pulsschlag, ein letzter verzweifelter Kampf gegen die Apathie, die ihren Körper längst im Griff hat. Immer dichter wird der Nebel in ihrem Kopf, drängt die Farbe aus den Bildern und die Klänge aus den Melodien. Alles verliert sich im Nichts.
Auf einmal sieht sie Lichtpunkte tanzen. Irgendwo in deren Mitte nimmt sie einen leuchtend hellen Fleck wahr wie einen Stern. Dann ist auch der Stern erloschen, und in ihrem Kopf ist nichts mehr als dunkle Stille.
September 2013 – Hammerstein am Rhein
1. Kapitel
Über der spitzzackigen Silhouette der Fichtengruppe zogen Wolken, deren Farben zwischen Perlmutt und Weißgrau changierten, wie locker hingeworfene, am Rand verschmutze Muscheln. Dazwischen zeigte der Himmel ein wenig von seinem üblichen Blau, jedoch wurde das meiste von den schnell ziehenden Wolkenformationen verdeckt.
Helga wandte sich wieder dem Fotoalbum auf ihrem Schoß zu, blätterte die pergamentartigen, wie Spinnweben gemusterten Zwischenseiten um und betrachtete die einzelnen Bilder, deren Anblick ihr seit Jahren vertraut war. Bald war Mary Lous Geburtstag. 48 Jahre alt würde sie in diesem Jahr werden – wenn sie noch lebte. Wenn. Eine Antwort darauf wusste jedoch niemand. Dieser ziehende Schmerz in der Herzgegend, wenn sie an das rätselhafte Verschwinden ihrer Schwester vor fast 30 Jahren dachte, war nicht schwächer geworden, obwohl man immer sagte, die Zeit heile alle Wunden.
Seit diesem Novembertag im Jahr 1984 hatte sich ihr ganzes Leben verändert. Zwar hatte Helga gelernt – wie alle anderen Familienangehörigen auch – mit dem plötzlichen Verlust zu leben, doch nur allzu gern hätte sie eine Antwort auf all ihre drängenden Fragen gehabt. Jedes Mal, wenn sie fürchtete, dass die Erinnerung an die jüngere Schwester blasser zu werden drohte, ihr Gesicht nur noch ein Schemen ohne rechte Konturen war, holte sie das Fotoalbum hervor.
Wieder und wieder hatte sie sich die damaligen Ereignisse durch den Kopf gehen lassen, doch sie fand keine Antworten.
Was war passiert? Hatten sie Mary Lou nicht richtig gekannt? Helga hatte nie daran geglaubt, dass sie von zu Hause abgehauen war, vielleicht um in Holland eine Abtreibung machen zu lassen, wie man ihrer Familie lange Zeit hatte einreden wollen. Dann sei sie dort geblieben, um ein neues Leben anzufangen. Das war einfach absurd. Mary Lou hatte sich auf das Kind gefreut, sie wollte heiraten. Sie war nicht der Mensch, der einfach weglief, ohne irgendjemandem Bescheid zu geben und sich danach nie wieder zu melden.
Immerhin war es aber eine Variante, die ein Hoffen zuließ. Die andere mögliche Erklärung war, dass ihr jemand Gewalt angetan, sie entführt oder, im schlimmsten Fall, sie getötet und irgendwo verscharrt hatte, wo man sie niemals wieder finden würde. Diese Möglichkeit verbot sich Helga jedoch, in Details auszumalen.
Anfangs war sie hin und her gerissen gewesen zwischen Hoffen und Bangen. Hoffen darauf, dass Mary Lou eines Tages vor der Tür stehen würde, dass es eine Erklärung gab für das bisher Geschehene. Doch eine andere Stimme tief in ihr drin, die sie auf die Vergeblichkeit dieses Wunsches hinwies, überwog inzwischen. Trotzdem, das Leben an sich war voller Überraschungen, und solange keine Leiche gefunden war, bestand Hoffnung, wenn auch nur eine winzig kleine.
Wie ihre Schwester heute wohl aussah? Das hatte Helga sich schon oft gefragt. Ob sie immer noch so hübsch war wie damals? Oder ob man auch in ihrem Gesicht die Spuren des Älterwerdens fand? Helga lachte auf. Sicher hatte sie das Alter gezeichnet wie alle Menschen. Wieso sollte ausgerechnet ihre kleine Schwester davon verschont geblieben sein?
Helga betrachtete das Bild, auf dem Mary Lou besonders vorteilhaft aussah. Aufgenommen war es in einem Fotostudio. Sicher, der Fotograf hatte hie und da etwas retuschiert und ein paar Linien weicher gezeichnet. Dennoch gab das Bild Mary Lou wieder, so wie sie Helga im Gedächtnis hatte.
Helga war immer der Meinung gewesen, dass ihre Schwester viel hübscher war als sie. Die kastanienbraunen langen Locken, die sie meist zum Pferdeschwanz gebunden trug, fielen ihr weich auf die Schultern. Helga hatte nie verstanden, weshalb sie ihre Sommersprossen zu bleichen versuchte. Mary Lou behauptete, es seien hässliche Flecken, die es auszumerzen galt, dabei verliehen doch gerade diese kleinen Unregelmäßigkeiten ihrem ansonsten perfekten Gesicht einen besonderen Reiz.
Das Faszinierendste an Mary Lou waren jedoch ihre leicht schräg stehenden braungrünen Augen, die ihrem Blick eine seltsame Mischung von Verwegenheit und Verträumtheit gaben.
Es war nicht zu leugnen: Verglichen mit Mary Lou, wirkte Helga eher gewöhnlich. Das hatte sie bereits als kleines Mädchen zu spüren bekommen. Mit dieser Tatsache hatte sie sich früh abgefunden, auch damit, dass die jungen Männer, die sie interessant fand, nur Blicke für ihre jüngere Schwester hatten. Sie wusste selbst, dass ihr hellbraunes dünnes Haar sie blass und farblos machte, ihre zu knollige Nase das schmale Gesicht dominierte, die Art, wie sie sich kleidete, bieder wirkte.
Mary Lou hatte stets exotisch anmutende Röcke, Blusen und Pullover bevorzugt. Je auffälliger, je lieber, das entsprach ihrem gesamten Wesen. Sie stand gern im Mittelpunkt. Ihr gefiel es, wenn die Männer sie mit diesen besonderen Blicken anschauten. Dass Helga neben Mary Lou einfach übersehen wurde, hatte ihr so manchen Stich versetzt, aber schließlich war sie von klein auf daran gewöhnt und sie hatte sich redlich darum bemüht, niemanden diese Gefühlsregungen merken zu lassen.
Inzwischen färbte Helga ihr Haar, zu sehr trat das Grau darin hervor und ließ sie älter aussehen als sie war. Die Sommersprossen – die sie mit ihrer Schwester gemein hatte – waren blasser geworden mit der Zeit. Auch hatte sie an Gewicht zugelegt. Das blieb nicht aus, wenn man jeden Tag herzhaft kochte. Edgar, ihr Mann, mochte ihre rundliche Figur. Das behauptete er jedenfalls. Doch er gab ihr eigentlich keinen Grund, am Wahrheitsgehalt seiner Aussage zu zweifeln. Sie führten eine ruhige, aber gute Ehe. Jedenfalls in Helgas Augen.
Sie schlug eine weitere Seite des Fotoalbums um. Erinnerte sich daran, wie die Geschwister früher herumgealbert hatten: Kannst du dir vorstellen, jemals alt zu sein? Nee, du? 50 Jahre – das war noch eine Ewigkeit hin. Teenager waren sie damals in diesem letzten gemeinsamen Sommer gewesen, 19 und 21 Jahre jung, an der Schwelle des Erwachsenenlebens.
Bis zu Mary Lous Verschwinden hatten sich die Schwestern ein Zimmer geteilt, das ebenerdig lag. Eine kleine Kostbarkeit war ein weinroter Dual-Plattenspieler, in dessen Deckel ein Lautsprecher eingebaut war. Das Gerät hatte Mary Lou sich von ihrem Gehalt als Arzthelferin gekauft, darauf spielte sie ihre Platten. Schwarze Vinylscheiben, auf die man vorsichtig die Diamantnadel auflegen musste, dann ertönte die Musik.
Mary Lou kannte die Texte der meisten Lieder auswendig und sang gern lauthals mit.
Wie oft war die Mutter dann ins Zimmer gekommen. »Nicht zu laut, ihr wisst doch, dass euer Vater schimpft!« Was Mary Lou dazu veranlasste, die Lautstärke nur minimal zu reduzieren.
Oftmals waren sie beide abends an den Wochenenden gemeinsam losgezogen. Heimlich, wenn die Eltern dachten, sie seien schon schlafen gegangen, kletterten sie aus dem Fenster und ließen den Flügel angelehnt, damit sie wieder unbemerkt zurück ins Haus kommen konnten. Dass das gefährlich war und eine Einladung für Einbrecher sein könnte, daran hatten sie nie gedacht. Jung und unbeschwert, wie sie waren, hatten sie alle Gefahren ausgeklammert. Und es war ja auch nie etwas passiert. Jedenfalls nichts, was Einbrecher betraf.
Sie waren eine normale Familie gewesen, der Vater war vielleicht ein wenig zu streng mit seinen Töchtern gewesen, während die Mutter stets versuchte, zwischen den Mädchen und ihrem Vater zu vermitteln, wenn er, was manchmal geschah, zu heftig reagierte. Das war immer dann der Fall, wenn er zu viel getrunken hatte und seine Kumpel ihn in der Kneipe ordentlich aufhetzten. Sie wussten genau um seine Schwachstellen und kannten keine Gnade, wenn es darum ging, Salz in Wunden zu streuen. Oskar Schönborn wollte seine Töchter so lange wie möglich zu Hause behalten, sie vor den Männern schützen – und darauf ritten seine Kumpels gern herum.
»Oskar, ich hab deine Mädels gesehen. Die gehen ja ordentlich ran, besonders deine Kleine, die Marie Louise, die ist vielleicht ein heißer Feger. Auf die solltest du besser aufpassen.«
Helga konnte sich gut vorstellen, wie die Stimmung in der Kneipe immer hitziger wurde durch den Bierkonsum und das ständige Sprücheklopfen der sogenannten Freunde ihres Vaters. Sie stachelten sich gegenseitig an, jeder versuchte, den anderen zu übertreffen, solange, bis ihr Vater alles für bare Münze hielt und wutentbrannt nach Hause rannte, um seine Töchter lautstark zur Rede zu stellen.
Wenn er so in seinem Wahn war, war er keinem rationalen Argument zugänglich. Und Mutter hockte jedes Mal zitternd in der Ecke und traute sich kaum, etwas zu sagen, auch weil es in solchen Situationen vorkommen konnte, dass er handgreiflich wurde. Einmal hatte ihre Mutter es gewagt, sich zwischen die Mädchen und ihren Vater zu stellen, weil sie die Anschuldigungen für vollkommen absurd hielt und sie ihrem Mann klarmachen wollte, dass an den Lügenmärchen seiner Kumpels nichts dran war, aber auch gar nichts. Das Resultat war verheerend.
Aber auch in nüchternem Zustand hatte Oskar Schönborn an jedem jungen Mann etwas auszusetzen, der sich seinen Töchtern auch nur näherte. »Tanzen gehen? Kommt gar nicht infrage, ihr seid viel zu jung!«, war seine stereotype Antwort. Da nutzte es auch nichts, ihn darauf hinzuweisen, dass man in ihrem Alter überhaupt nicht mehr um Erlaubnis bitten müsse, da könne man selbst entscheiden, ob man ausging und wie lange man wegblieb.
»Solange ihr eure Füße unter meinem Tisch ausstreckt, wird gemacht, was ich sage.« Sein Lieblingsspruch, den er auch ihrem jüngeren Bruder Reinhard gegenüber äußerte, der aber wiederum von bestimmten Freiheiten profitierte, um die die Mädchen hart hatten kämpfen müssen.
Helga dachte daran, wie oft Mary Lou davon gesprochen hatte, dass sie so schnell wie möglich weg von zu Hause wollte. »Ich halte das nicht mehr lange aus«, hatte sie Helga zugeflüstert, wenn es mal wieder Krach gab und Vater seinen Zorn an ihr ausließ, indem er sie mit schlimmen Bezeichnungen bedachte. »Ich will weg von hier. Einfach nur weg. Und mir von niemandem mehr reinreden lassen. Von niemandem, hörst du?«
Diese Worte klangen Helga jedes Mal im Ohr, wenn sie an Mary Lous plötzliches Verschwinden dachte, und nährten die kleine Hoffnung ein wenig, dass sie tatsächlich nur weggelaufen war, um woanders ein neues Leben anzufangen.
Die Fronten hatten sich weiter verhärtet, je älter Mary Lou wurde. Schließlich kam nach heftigen Wortgefechten die Zeit, dass sie kein Wort mehr mit ihrem Vater sprach und nur noch eisiges Schweigen zwischen den beiden herrschte, was sich besonders unangenehm auswirkte, wenn die Familie gemeinsam beim Essen saß. Die Mutter bat sie stets, doch einzulenken. Aber Mary Lou blieb stur. Eine Eigenschaft, die sie durchaus von ihrem Vater geerbt hatte. Für alle war offensichtlich, dass beide, sowohl Mary Lou als auch ihr Vater, unter dieser angespannten Situation litten, aber niemand machte den ersten Schritt zur Versöhnung. Bis es zu dieser hässlichen Szene kurz vor ihrem Verschwinden kam.
Helga blätterte weiter und betrachtete ein Foto aus dem Sommer 1984. Ihr letzter gemeinsamer Sommer. Zwei Mädchen mit wehenden langen Haaren, die lachend in die Kamera sahen. Reinhard hatte fotografiert. Am Bildrand war der kleine Mischlingshund zu erkennen, Asta. Mary Lous weißer Pudel, um den sie sich liebevoll kümmerte. Das Tier hatte sehr getrauert damals, als sein Frauchen verschwunden war. Es hatte herzzerreißend gefiept und gewinselt, bis der Vater ihm zum Entsetzen aller einen Tritt versetzt hatte.
Einen Ausflug zur Brombeerschenke hatten die drei Geschwister damals gemacht. Sie erinnerte sich, dass es einer der wenigen schönen Tage in einem vollkommen verregneten Sommer war. Sie hatten draußen auf der Terrasse gesessen und konnten sich nicht entscheiden, welche der angebotenen Brombeerspezialitäten sie essen sollten, so vielfältig war das Angebot. Schließlich hatten sie sich alle drei für den Brombeerkuchen entschieden. Nie wieder war Helga seit Mary Lous Verschwinden dort gewesen, obwohl das hoch über den Rheinhöhen gelegene Restaurant zu einem der schönsten Ausflugsziele der Umgebung zählte. Sie seufzte. Vielleicht sollte sie mal wieder dorthin wandern. Zusammen mit ihren Enkeln einen Ausflug machen. Schließlich tat sie Mary Lou keinen Gefallen, wenn sie diesen Ort mied, an dem sie damals so viel Spaß hatten.
Reinhard hatte das Foto mit seiner guten Kamera aufgenommen. Ihr jüngerer Bruder war der Fotograf der Familie, der bei jeder sich bietenden Gelegenheit Bilder schoss. Um die Fotos entwickeln zu können, hatte er sich im Keller ihres Elternhauses eine Dunkelkammer eingerichtet.
Reinhard war ein ewiger Junggeselle geblieben. Sie konnte sich nicht erinnern, dass er jemals eine Freundin hatte. Er lebte noch immer bei der Mutter in seinem Jugendzimmer, dessen Einrichtung er nicht wesentlich verändert hatte. Auch heute noch fotografierte er gern, inzwischen mehr mit einer modernen Digitalkamera. Aus den früheren Zeiten stapelten sich in einem Kellerraum Unmengen an Bildern in Schuhkartons und Pappschachteln. Vielleicht sollte ich die Fotos einmal durchsehen, dachte Helga. Sicher finden sich da einige Schätze, an die niemand mehr denkt. Nachdem Mary Lou verschwunden war, hatte sie aufgehört, Fotos ins Album zu kleben.
Noch ein Jahr. Dann war der Fall für die Polizei erledigt. Das hatte ihr ein Polizist kürzlich erklärt, als sie nachfragte, ob man ihre Schwester denn ganz vergessen habe. Der Fall sei doch immer noch nicht aufgeklärt.
»Nach 30 Jahren werden die Akten von Vermissten vernichtet. Tut mir leid. Aber so lautet die Vorschrift.«
Sie hatte es nicht fassen können! Was für eine Welt. Von Anfang an war die Polizei davon ausgegangen, Mary Lou sei aus freien Stücken weggegangen. Abgehauen, wie das eben viele Jugendliche taten.
»Sie werden sehen, bald steht sie wieder vor Ihrer Tür.« Noch immer hatte sie die Stimme des Polizisten im Ohr. »Spätestens, wenn sie merkt, dass es zu Hause doch nicht so schlecht war und es mit der angeblichen Freiheit nicht allzu weit her ist. Sie glauben gar nicht, wie oft wir das erleben.« Aber Mary Lou kam nicht wieder, und niemand hatte eine plausible Erklärung dafür, was passiert war.
Dass etwas passiert sein musste, wurde allen spätestens klar, als dieser Anruf kam. Helga hatte den Hörer abgenommen, als ein Mann mit einem fremd klingenden Akzent etwas sagte, das sie nicht sofort verstand. Der Mann, der sprach wie einer der polnischen Saisonarbeiter, die auf den Weinbergen ringsum regelmäßig aushalfen, stammelte etwas von »Keine Polizei«, »Geld« und »Amsterdam«. Und dass er sich wieder melden würde.
Aber er hatte sich nicht mehr gemeldet. Natürlich hatte sie der Polizei sofort von diesem Anruf berichtet, jedoch sämtliche Nachforschungen waren ergebnislos geblieben.
»Oma, ich hab Durst.«
Ihr Enkel Max war zur Tür hereingekommen. Er mochte es, früh am Morgen rauszugehen auf die Schaukel und auf die Rutsche, die Edgar im Garten für ihn und seine kleine Schwester aufgestellt hatte. Max’ Gesichtchen war von Röte überzogen, er war total verschwitzt, die dunklen Locken hingen ihm feucht und wirr ins Gesicht.
Sie lächelte nachsichtig. Ein kleiner Rabauke, der seiner Mutter, ihrer Tochter, schon manchen Nerv geraubt hatte, weil er gar so wuselig war. Eigentlich müsste er dringend zum Friseur, aber Jennifer hatte für solche Nebensächlichkeiten mal wieder keine Zeit. Also würde Helga selbst bald zur Schere greifen müssen, bevor der kleine Kerl gar nicht mehr aus den Augen sehen konnte. Sie stand auf und nahm eine Flasche Traubensaft aus dem Kühlschrank, goss ein halbes Glas voll und füllte es mit Mineralwasser auf. Traubensaftschorle war Max’ Lieblingsgetränk. Sofort nahm er das Glas und stürzte den gesamten Inhalt hinunter.
»Nicht so schnell«, wollte sie mahnen, doch es war bereits zu spät.
»Noch!«, bat er, leckte sich über die Lippen und stellte das leere Glas auf den Tisch. Lächelnd goss sie nach. Ihr hatte man als Kind verboten, zu viel zu trinken. Heute wusste man, wie wichtig ausreichend Flüssigkeit für den Körper war. Vielleicht hatte man das ja damals auch schon gewusst, aber diese Erkenntnis war nicht bei ihren Eltern angekommen.
Die Wolkendecke draußen war aufgerissen und hatte einem milchigblauen Himmel Platz gemacht, der von der Sonne beleuchtet wurde. Ein mildes Licht, das sie besonders mochte, weil von ihm Ruhe und Wärme ausging.
Max trat an ihre Seite und schmiegte sich an sie. Sie umarmte das Kind, beugte sich zu ihm hinab und sog seinen Duft ein, diesen süßen kindlichen Geruch, dem noch so gar nichts von verschwitzter Männlichkeit anhaftete. Neugierig betrachtete er das aufgeschlagene Album. »Was machst du, Oma? Guckst du Bilder?«
Sie nickte. »Fotos von früher.«
»Wer ist denn da drauf?«
»Mary Lou und Onkel Reinhard und ich.«
»Mama nicht?«
»Deine Mama war damals noch gar nicht auf der Welt. Die ist erst später geboren.«
»Da war Tante Mary Lou schon weg, ich weiß.« Das klang ein wenig altklug. Er sah sie treuherzig an. »Kann die mich nicht leiden?«
»Ach, mein Kleiner.« Helga drückte ihren Enkel an sich. »Sie wäre sicher stolz auf so einen tollen Neffen wie dich.«
»Und warum kommt sie mich nicht besuchen?« Seine Augen waren weit aufgerissenen. Ein kindlich-neugieriger Blick.
»Weil wir nicht wissen, wo sie ist.« Helga seufzte. »Eines Tages war sie einfach verschwunden.«
»Habt ihr denn nicht nach ihr gesucht?«
»Doch. Du glaubst gar nicht, wie sehr wir nach ihr gesucht haben. Wir, die Familie und ganz viele Helfer.«
Doch das war erst ein paar Tage später gewesen. Noch heute plagten Helga deshalb Schuldgefühle, weil sie sich viel zu spät eingestanden hatte, dass etwas Schlimmes mit ihrer Schwester vorgefallen sein musste.
»Mary Lou ist noch nicht da«, hatte die Mutter mit leicht hysterischer Stimme gesagt, als Helga an diesem verhängnisvollen Mittwoch von der Arbeit kam. »Sie müsste längst zu Hause sein. Weißt du etwas?«
Helga hatte genervt die Augen verdreht. Immer diese Kontrollsucht. Sie und ihre Schwester waren schließlich beide volljährig. Wieso musste man bloß in dieser Familie über jeden Schritt Rechenschaft ablegen? Und dann kam auch schon gleich der nur allzu bekannte Satz, den Helga nicht mehr hören konnte: »Was mach ich nur, wenn Vater nach Hause kommt, und sie ist immer noch nicht da?«
Auch das war typisch. Mutter machte sich eigentlich keine Sorgen um ihre Tochter, sondern nur um die Reaktion ihres Mannes, der seine Brut im Griff haben wollte. Manchmal hasste sie ihre Mutter für deren Unterwürfigkeit. Sie wusste doch selbst, dass es einmal mehr einen lautstarken Krach zwischen Vater und Mary Lou gegeben hatte und seitdem zwischen den beiden Funkstille herrschte. Die Türen hatten mächtig geknallt, und wahrscheinlich war ihm auch wieder die Hand ausgerutscht, wie so oft in letzter Zeit. »Ich schlag dich tot, du Luder!«, hatte er so laut geschrien, dass es durchs ganze Haus hallte.
Danach war Mary Lou schluchzend in ihr Zimmer gekommen und hatte sich in ihrem Bett verkrochen.
»Hast du ihm gesagt, dass du schwanger bist?«, hatte Helga beklommen ins Dunkel gefragt. »War er deshalb so wütend?« Doch auf diese Frage hatte sie keine Antwort mehr bekommen. Weder an diesem Abend noch später.
»Und ihr habt sie nicht gefunden?«, hörte Helga die Stimme ihres Enkels.
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, wir haben Mary Lou nicht gefunden.«
2. Kapitel
Draußen, im hellen Sonnenlicht, flog die Welt im Eiltempo vorüber. Gesine bemühte sich, die vorbeirauschenden Landschaftsbilder einzufangen und festzuhalten, was ihr nur für sekundenkurze Bruchteile gelang. Entlang der Bahnlinie fokussierte sie hauptsächlich Gebüsch, das kurz auftauchte und wieder verschwand. Dahinter reihten sich weitläufige Pferdekoppeln an norddeutsche Bauerngehöfte aus rotbraunem Klinker, Baumreihen verdichteten sich zu Laubwäldchen, deren Blätter sich sanft zu färben begannen.
Sie war allein im Abteil des IC nach Köln.
In Norddeich Mole war sie in den Zug eingestiegen, nachdem sie mit der Fähre von ihrer Heimatinsel Juist übergesetzt war. Noch immer hallten die Klänge des Akkordeonstücks Biscaya in ihren Ohren, mit dem die Feriengäste von der Insel verabschiedet werden. Eine Melodie, in die die Schwingungen des Meeres und der Klang der Wellen eingefangen sind, die wie keine andere Sehnsucht ausdrückt, wie sie fand. Sehnsucht nach dem Anderswo, der Ferne, dem Ich-weiß-nicht-was.
Nun war Gesine der Sehnsucht gefolgt, aber was sie an ihrem Ziel erwartete, konnte sie nicht so recht einschätzen.
Auf ihrem Schoß lag eine Zeitschrift, in die sie bis jetzt noch nicht hineingeschaut hatte. Den Titel schmückte eine verträumt aussehende, junge weibliche Schönheit mit flatterndem Haar. »Wie Sie die Liebe Ihres Lebens finden«, lautete einer der Leitartikel, der ihr ins Auge gesprungen war und sie zum Kauf animierte. Dabei hatte sie bereits die Liebe ihres Lebens gefunden …
Zu Hause auf Juist war sie sich dessen sicher gewesen. Die letzten Tage vor der Abreise waren ihr schier unerträglich geworden, auf fast schmerzhafte Weise verlangten ihr Körper und ihre Seele danach, so schnell wie möglich bei ihrem Liebsten zu sein, ihn zu spüren, sich seiner Gegenwart zu vergewissern. Doch je weiter sie sich aus ihren vertrauten Sphären entfernte, umso unsicherer wurde sie.
Wie Leonhard sie wohl in seinem Heimatort aufnehmen würde? Ob er ihr in Gegenwart seiner Eltern zurückhaltender begegnen würde als auf Juist, wo sie über weite Strecken vollkommen allein und unbeobachtet miteinander Zeit verbringen konnten? Eine Urlaubssituation war nun einmal ein vollkommen anderer Zustand als der tägliche Alltagstrott, bei dem die Arbeit im Vordergrund stand.
Wie würden seine Eltern auf sie reagieren? Charlotte und Rudolf Freyung kannte sie nur aus Leonhards Erzählungen und aus ein paar gemailten Familienfotos. Wiederholt hatte Leonhard Gesine versichert, dass alle sich auf ihren Besuch freuten: Er, seine Eltern, seine Schwester Franzi und selbstverständlich auch die Großeltern, die in einer separaten Wohnung auf dem Weingut lebten. Alle ließen Grüße bestellen.
Gesine versuchte, den Kloß, den sie immer deutlicher in ihrem Hals spürte, hinunterzuschlucken. Immer konkreter bildete sich eine einzige bange Frage in ihrem Kopf, die vollkommen von ihrem Denken Besitz nahm: Was, wenn ich die Erwartungshaltung nicht erfüllen kann, weder die von Leonhard selbst noch die von seinen Eltern? Dazu gesellte sich die Befürchtung: Was, wenn alles ganz anders ist, als ich mir das vorstelle?
Die Tür ging auf, eine freundliche Schaffnerin wollte ihre Fahrkarte sehen. Dann wurde die Tür wieder zugeschoben.
Gesine sah auf die Uhr. Etwa ein Drittel des Weges lag jetzt hinter ihr.
Sie lehnte sich zurück, schloss die Augen und dachte daran, wie sie Leonhard kennengelernt hatte. Er war nach Juist gekommen, wo er mit seinem Weinsortiment einen neuen Kundenkreis gewinnen wollte. Den dortigen Hoteliers stellte er die Weine des familienbetriebenen Weinguts am Mittelrhein vor, so auch Gesines Eltern, die auf der Insel ein kleines Hotel betrieben. Die Nordseeinsel mit ihren Tausenden Touristen pro Sommer betrachtete er als eine lukrative Region, zusammen mit den Nachbarinseln Norderney und Borkum, die er ebenfalls besuchte.
Sein souveränes und selbstbewusstes Auftreten hatte ihr von Anfang an imponiert. Er machte deutlich, dass er dem Trend entgegen wirken wolle, Billigweine aus dem Discounter zu kaufen, die mit ihren Dumping-Wettbewerben die Preisspirale immer weiter nach unten trieben. Das sei Massenware, an der so lange herummanipuliert werde, bis sie einigermaßen schmecke. Er dagegen setze auf Qualität, auf ein Know-how, das auf eine lange Tradition zurückblicken konnte und das es stetig weiter zu entwickeln galt.
»Besonders in Zeiten von Genmanipulation und Food Design ist die authentische Kunst des Winzers gefragt, die die Komplexität des Weins herausarbeitet. Wir achten darauf, der Eigendynamik der natürlichen Reifeprozesse genügend Raum zu lassen«, hatte er erklärt. »Das nennen wir ›Terroir‹. Ein Begriff, der sich auf den besonderen Charakter des Weines bezieht. Wenn der Winzer dem Wein seine Eigenheiten lässt, kann man seine Herkunft schmecken. Insofern kann man sagen, dass der Wein ein geschmackliches Spiegelbild der Region ist, in der er gewachsen ist.«
Bei der Präsentation seiner Weine gab Leonhard kurzweilige Geschichten zum Besten. Er erzählte von den Römern, die einst die Trauben an den Rhein brachten, ein seit jeher begehrtes Handelsgut. Auf humorige Weise berichtete er davon, dass Wein schon immer als ein Getränk der Götter angesehen wurde, und dass kein anderes Getränk so oft in der Bibel erwähnt worden sei.
»Wein ist ein Kulturgut und aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Das erkennen Sie beispielsweise auch an der Tatsache, dass noch heute in den Kirchen Messwein ausgeschenkt wird, allerdings nicht immer die beste Qualität, wie ich einräumen muss. Jedoch ist die stärkende und heilende Wirkung des Weins unbestritten, und dies schon seit der Antike. In Wein getauchtes Brot galt als gutes Frühstück, und die Ärzte empfahlen zur Erhaltung der Gesundheit mindestens zweimal im Monat einen ordentlichen Rausch. Nicht die schlechteste Empfehlung«, wie er schmunzelnd erklärte. Einer neueren Studie zufolge könnten Weintrinker klarer denken. Dies hätten sogenannte Kognitionstests bewiesen, bei denen Weintrinker deutlich besser abschnitten als diejenigen, die Schnaps oder Bier oder auch gar keinen Alkohol tranken.
Seine Ausführungen, die nie todernst, sondern immer von einem Quäntchen Humor begleitet waren, fesselten die Zuhörer wesentlich mehr als die trickreichen Wortspiele von der eleganten Frische und vom harmonischen Abgang oder sonstigen blumigen Beschreibungen, wie sie üblicherweise von Vertretern seines Gewerbes zum Besten gegeben wurden. Beurteilungen, die Gesine nie hatte nachvollziehen können und die ihrer Meinung nach mehr Illusionen vorgaukelten, als tatsächlich aus den Weinen herauszuschmecken war.
Er schenkte einen Riesling ein – den besten des Weinguts Freyung, wie er betonte – und hob sein Glas hoch. »Wein genießt man mit allen Sinnen«, sagte er. »Man kann ihn sehen«, er schwenkte das Glas auf Augenhöhe. »Man kann ihn riechen und schmecken. Nur hören kann man ihn nicht. Das ist der Grund, weshalb man miteinander anstößt. Prost.«
Alle hatten ein Lächeln auf den Lippen, als die Gläser klangen.
Nicht nur Gesine, auch ihr Vater war sichtlich beeindruckt von Leonhards Präsentation und natürlich auch vom Geschmack der Rheinweine, sodass er mehrere Kisten des Weinguts Freyung aus Leutesdorf orderte.
Von diesem Ort hatte Gesine noch nie gehört, obwohl er, wie Leonhard sagte, das älteste und größte Weindorf im unteren Mittelrheintal sei. Der Bildband, den er ihrer Familie vorlegte, zeigte eine verträumte Ortschaft direkt am Ufer des Rheins gelegen, umgeben von steil ansteigenden Rebenhängen, die zum Rheinischen Schiefergebirge gehörten. Alles wirkte anheimelnd und einladend. Schmale Fachwerkhäuschen schmiegten sich aneinander, umgeben von efeubewachsenen Gartenmauern aus Bruchstein, es gab ein altes Kloster, und das Weingut Freyung, eines der ältesten Weingüter in Leutesdorf, war ebenfalls abgebildet.
Später, als alle noch ein wenig beisammensaßen, hatte Gesine an seinen Lippen gehangen. Er berichtete von seinem Heimatort, in dessen Kirche eine Stumm-Orgel stand, ein sehr wertvolles Instrument aus der Barockzeit. Seine Großmutter, die in früheren Jahren Organistin gewesen sei, habe dieses Instrument mit Leidenschaft bespielt, aber diese Zeiten seien natürlich vorbei. Inzwischen sei sie hauptsächlich mit der Pflege des kränkelnden Großvaters beschäftigt.
»In unserer Familie sind eigentlich alle musikalisch. Mein Vater hat in seiner Jugend in einer Band gespielt. Meine Schwester spielt Saxophon, nur ich habe von diesen Genen nichts abbekommen«, hatte Leonhard lachend erklärt. »Als ich anfing, auf einer Blockflöte herumzutröten, hat sich der Lehrer die Ohren zugehalten. Das war’s dann für mich mit der Musik.«
Wenn er von seiner rheinischen Heimat erzählte und von seiner Familie, konnte Gesine die Verbundenheit spüren, sein Zugehörigkeitsgefühl zu diesem Stück Erde und auch die Begeisterung für den Winzerberuf.
Sie hatte durchaus gemerkt, dass er während seines Vortrags öfter ihren Blick gesucht hatte, was sich bei dem geselligen Beisammensein danach verstärkte. Sie fand ihn gut aussehend mit seinen kurz geschnittenen braunen Haaren und den hellbraunen Augen. Auch hatte ihr sein Lächeln gefallen, bei dem er eine Reihe gerader, gepflegter Zähne zeigte.
Gesine war immer neugieriger geworden. Auf den Wein, aber noch mehr auf den charmanten jungen Mann, der ihr geduldig die Unterschiede zwischen Riesling und Grauburgunder erklärte, während sie mit jedem Glas, das sie kostete, ein wenig mehr in Weinseligkeitslaune kam. Irgendwann zu späterer Stunde hatten sie beide allein im Restaurant gesessen und sich tief in die Augen gesehen. Als seine Hand wie zufällig die ihre berührte, spürte sie einen regelrechten Funkenschlag. Bereits an diesem ersten Abend hatte sie geahnt, dass diese Begegnung richtungweisend für ihre Zukunft war.
Die Räder des Zuges ratterten gleichmäßig über die Schienen. Die Sonne produzierte ein irritierendes Hell-dunkel-Geklimper. Gesine ließ den Blick wieder nach draußen schweifen, auf die vorüberziehende Landschaft, wo sie Hochspannungsmasten ausmachte, deren Leitungen die Welt miteinander verbanden. Abgeerntete Felder wechselten sich ab mit sattgrünen Wiesen, denen der kürzlich gefallene Regen offenbar gut getan hatte.
Nun verlangsamte der Zug sein Tempo und fuhr in Lingen ein, wo er sich nach kurzem Halten wieder in Bewegung setzte. Eine Birkenallee säumte den Bahndamm, deren markante schwarz-silberne Baumstämme an die gefleckten Felle von Dalmatinern erinnerten.
Unwillkürlich dachte sie daran, was ihre Eltern jetzt taten in diesem Augenblick. Wahrscheinlich deckte die Mutter den Mittagstisch für die Hotelgäste ein – viele waren es um diese Jahreszeit nicht mehr, die Saison auf der Insel ging langsam dem Ende zu – und der Vater war wie jeden Morgen mit Einkäufen oder sonstigen Besorgungen beschäftigt.
Ihren Eltern war nicht verborgen geblieben, was sich zwischen den beiden jungen Menschen entwickelte. Ernst genommen hatten sie die Liebelei zunächst nicht, wie sie ihr später gestanden, als Leonhard abgereist war. Leutesdorf am Rhein war nicht nur Festland, sondern sehr weit von Juist entfernt. Irgendwann würde das aufhören, hatten sie geglaubt. Aus den Augen, aus dem Sinn. Doch Gesine wusste es besser.
Die paar Tage, die Leonhard und sie miteinander verbracht hatten, schienen beiden äußerst kostbar. Sie weihte ihn in die Besonderheiten von Töwerland ein, wie die Juister ihre Insel nennen, was nichts anderes heißt als Zauberland, was im Zusammensein mit Leonhard eine vollkommen neue Bedeutung erhielt.
Im Lüttje Teehuus bestellten sie Waffeln mit heißen Kirschen, dazu Ostfriesentee, wobei sie ihm erklärte, wie man diesen stilecht trinkt: Erst kommen ein paar Kluntje in die Tasse, dann der Tee darüber. Dabei muss man auf die knackenden Geräusche achten, wenn der Kandis birst – ein Tröpfchen Sahne gibt dem Ganzen den gewissen Pfiff, aber man darf niemals umrühren.
Barfuß waren sie durchs Wattenmeer gestapft, die Beine bis zu den Knien mit grauem Schlick beschmiert. Den Krebsen und den Wattläufern hatten sie zugeschaut, wie sie vor ihnen flüchteten. Immer weiter waren sie hinausgewandert, Hand in Hand, dicht aneinandergeschmiegt, begleitet vom Geschrei der Möwen. Bis sie zur Rückkehr mahnte, weil die Flut kam. Als echtes Friesenmädchen hatte sie ein ausgeprägtes Gefühl für die Gezeiten entwickelt.
Leonhard überließ sich gerne ihrer kundigen Führung. Sie hatte ihm berichtet, wie oft Touristen die Schnelligkeit unterschätzten, in der sich das Meer das Land zurückholte. Weil zuerst nur die Priele vollliefen, war leicht zu übersehen, wie schnell das Wasser den Weg zum Strand abschneiden konnte. Wenn man dann lediglich mit nassen Klamotten zurückkam, hatte man Glück gehabt. Es kam jedoch auch immer wieder zu Todesfällen, weil Menschen sich nicht mehr retten konnten und ertranken.
Am schönsten in Erinnerung geblieben waren ihr die abendlichen Strandspaziergänge um das Billriff. Dort, wo die Insel zu Ende war, schienen sie vollkommen allein auf der Welt. Irgendwo zwischen Dünen und Strandgras ließen sie sich nieder, sahen eine Weile dem Spiel der Wellen zu, saßen einfach da, eng aneinandergekuschelt. Jedes Mal, wenn sie ihn ansah, platzte sie fast vor Stolz, dass dieser Mann ihr zugetan war, dass er aus all den schönen Frauen und Mädchen, die es auf dieser Welt gab, ausgerechnet sie, Gesine, ausgewählt hatte.
Wenn er sich dann zu ihr hinbeugte, sein Atem ihr Gesicht streifte und sie in seinen Augen diese Zärtlichkeit erkannte, die ihr allein galt, begann ihr Herz zu vibrieren. Sie hätte alles gegeben, diese magischen Momente festzuhalten, wenn sie das Spiel ihrer Zungen äußerst intensiv empfand, kleine Stromstöße, die bis in die äußersten Nervenenden drangen. Die Zärtlichkeit seiner Hände auf ihrer Haut schien Spuren zu hinterlassen wie sein gesamter warmer Körper, der sich immer enger an den ihren drängte und schließlich in diesem wunderbaren Gefühl der Verschmelzung endete, eins zu sein mit dem Mann, den sie für immer behalten wollte.
Nachdem er abgereist war, hatte sie sich bisweilen wie amputiert gefühlt. Oft hatte sie sich gefragt, ob Leonhard in seinem Zuhause ebenfalls am Morgen so traurig erwachte wie sie, weil er allein in seinem Bett lag und seine Liebste sehr weit weg war. Ob er wie sie diese ziehende Sehnsucht verspürte, wenn er in seinen Erinnerungen all das nochmals durchlebte, das sie miteinander geteilt hatten.
Zum Abschied hatte ihr Leonhard ein Silberkettchen mit einem Bernsteinanhänger geschenkt, orangebraun mit dunklen Einsprengseln, von dem er behauptete, er habe genau die Farbe ihrer Augen.
»Der Stein soll dich immer an mich erinnern, aber vor allem soll er dir Glück bringen«, hatte er ihr ins Ohr geflüstert, als er ihr die Kette um den Hals legte. Sie hatte geantwortet: »Uns, Leonhard. Uns soll er Glück bringen.«
Nach seiner Abreise hatten sie jeden Tag gemailt, gesimst oder miteinander telefoniert. Sie beschworen in immer neuen Worten ihre Erinnerungen herauf, die sie miteinander teilten, ergötzten sich an den kleinen Weißt-du-nochs und nahmen Anteil am Leben des anderen.