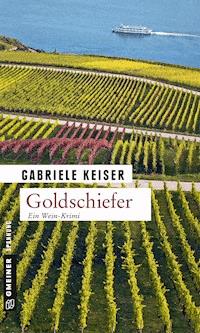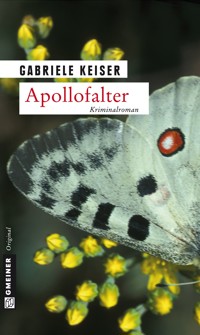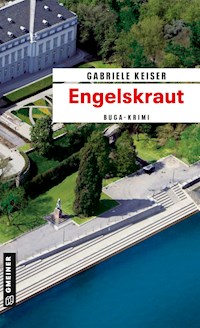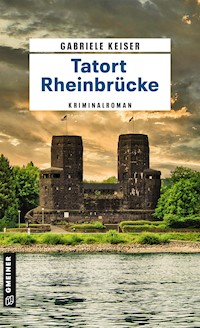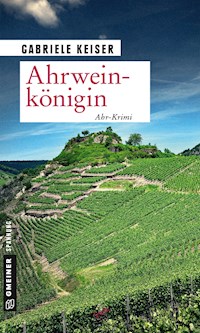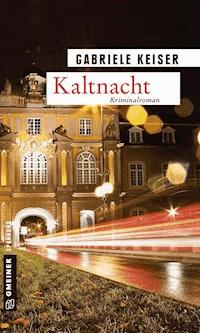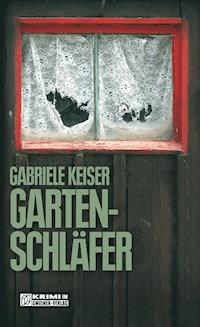
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Franca Mazzari
- Sprache: Deutsch
Unter einer Steinbrücke im Andernacher Schlossgarten wird die Leiche eines jungen Mannes gefunden. Der 18-jährige Mario Reschkamp wurde mit zahlreichen Messerstichen regelrecht niedergemetzelt. Die Koblenzer Kommissarin Franca Mazzari und ihr Kollege Bernhard Hinterhuber übernehmen den Fall. Vieles deutet auf ein Verbrechen im Drogenmilieu hin, denn das Opfer war als Dealer in den einschlägigen Kreisen gut bekannt. Befragungen in Marios Freundeskreis bringen weitere interessante Details ans Tageslicht. Offenbar hatte er eine Schwäche für okkulte Praktiken. Und für Frauen. Eine seiner vielen Freundinnen weckt Francas besonderes Interesse: Davina Kayner. Das sensible Mädchen, das allein bei seiner Großmutter lebt, hat offensichtlich das spurlose Verschwinden seiner Mutter nicht verwunden ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele Keiser
Gartenschläfer
Der zweite Fall für Franca Mazzari
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von Pixelio.de
ISBN 978-3-8392-3064-0
Widmung
Für meine Eltern, die mir Wurzeln und Flügel gaben
Zitat
Ich bin bewohnt von einem Schrei.
Nachts flattert er aus.
Und sieht sich, mit seinen Haken,
um nach etwas zum Lieben.
Sylvia Plath, »Ariel«
Und was verschwand, wird mir zu Wirklichkeiten.
Johann Wolfgang von Goethe, »Faust«
Prolog
April 1997
»Du bist ein böses Mädchen«, raunte eine Stimme, die das Kind aus seinen Träumen aufschreckte. Es riss die Augen auf und lauschte in die Dunkelheit. Die Worte schwebten im Raum und hinterließen ein Echo, das sich beharrlich einen Weg vom Inneren des Kopfes bis tief ins Herz hinein bahnte.
Das Mädchen blieb starr auf dem Rücken liegen, bewegte nur die Augäpfel hin und her. Im Zimmer war grauschwarze Nacht. Fremde Schatten tanzten im fahlen Widerschein des Mondlichtes, das durch das einen Spalt breit geöffnete Fenster hereindrang. Weder Gardinen noch eine Jalousie schlossen die Eindrücke von draußen aus.
Einen Moment lang wusste das Mädchen nicht, ob die dunkle, raunende Stimme zu seinem Traum gehörte oder ob sie aus dem Zimmer nebenan kam. Das einzige Geräusch, das es vernahm, war das laute Klopfen seines Herzens. Dann hörte es ein schnelles Trippeln von kleinen Füßen über sich, ein Knispern und Raspeln, ein kratziges Schlurfen und Schaben, das an- und abschwoll. Dort oben die kleinen Geister waren wieder wach und veranstalteten ein Wettrennen. Ein Lächeln glitt über sein Gesicht. Gartenschläfer konnten nicht sprechen. Sie konnten keckern und muckern und zwischen Decken und Wänden hin- und herflitzen. Sie konnten sogar ziemlich laut pfeifen, aber sprechen konnten sie nicht.
Erleichtert drehte es sich auf die Seite, um weiterzuschlafen.
»Du weißt ja, dass man bösen Mädchen ordentlich den Hintern versohlen muss.«
Da war sie wieder, diese fremde, tiefe Stimme, und jetzt konnte das Kind deutlich die Richtung bestimmen, aus der die Worte kamen: Im Zimmer nebenan sprach jemand. In Mamas Schlafzimmer.
Das Mädchen schluckte hart. Sein Herz verwandelte sich augenblicklich in einen Presslufthammer, der ratternd gegen seine Brust schlug. Gedämpft antwortete eine hellere Stimme drüben im anderen Zimmer. Obwohl das Mädchen sich anstrengte, konnte es nicht verstehen, was gesagt wurde. Zu laut waren das Herzklopfen und das Rauschen des Blutes in seinen Ohren. Das leise Frauenlachen, die dunkle, fremde Männerstimme und das Geräusch der trippelnden Gartenschläfer über ihm verwoben sich zu einem Klangteppich, den es nie mehr vergessen sollte.
Vorsichtig schob es seine Hand unter der Bettdecke hervor. Die Finger griffen ins Leere. Für den Bruchteil einer Sekunde setzte sein Herz mit dem Schlagen aus.
Belli, wo bist du?
Es tastete suchend weiter bis nah an die Wand. Gott sei Dank, da war er! Die Fingerchen des Mädchens krallten sich fest in den Plüsch. Es zog den Stoffhund, dem ein Glasauge fehlte, zu sich heran. Steckte die Nase in das weiche Fell und atmete tief ein. Das Mädchen liebte diesen Geruch nach Geborgenheit, nach Märchen und geheimen Träumen. Und ein klein wenig roch Belli noch nach Mamas Parfüm, mit dem es den Stoffhund vor Tagen eingesprüht hatte. Obwohl Mama jedes Mal mit ihm schimpfte, weil das Parfüm so teuer war. Der schwache Duft legte sich wie ein Gazeschleier über den süßlichen Rauch, der jetzt zusammen mit einem zweistimmigen Lachen durch die Türritzen quoll und die Form eines hässlichen Dämons annahm. Das Ungetüm tanzte um sein Bett herum und schien das Mädchen auszulachen.
Belli fest an sich gepresst, zog es die Bettdecke über den Kopf. Es wünschte sich, dass der hässliche Geist zurückfliegen möge in das Nebenzimmer. Es mochte keine tanzenden Dämonen. Es mochte überhaupt keine Dämonen.
Nach einer Weile schlug es die Decke wieder zurück, weil es glaubte, darunter ersticken zu müssen.
»Diese Viecher da oben sind ganz schön laut«, raunte die fremde Stimme im Zimmer nebenan.
»Es ist Paarungszeit«, antwortete Mama. »Bald wird der Lärm noch größer sein.«
»Und warum legt ihr kein Gift aus?«
»Weil man das nicht darf. Gartenschläfer stehen unter Naturschutz.«
»Das wäre mir herzlich egal. Aber gut, mich geht es ja nichts an.«
Die Stimmen verebbten, gingen über in ein leises Stöhnen. Etwas knarrte, etwas wurde geschoben. Dann klirrte etwas wie Glas, das auf die Erde fiel und zerbrach.
Jedes Mal, wenn das Mädchen solche Geräusche aus Mamas Schlafzimmer hörte, dachte es an zerspringendes Glück und an schlimme Schmerzen. Wenn es dann am Morgen danach Mamas Gesicht mit den Augen nach verräterischen Spuren abtastete, waren jedoch keine Kratzer oder blauen Flecken zu sehen. Wie immer stand sie in ihrem roten Kimono mit den bestickten Rändern am Herd, um Honigmilch zu wärmen. Sie summte ein Lied, ihre Augen leuchteten. Mit beiden Händen fuhr sie sich durch die braunen Wuschellocken und sagte: »Guten Morgen, meine Zigeunerprinzessin. Na, gut geschlafen?«
Ein heftiges Atmen drang jetzt aus dem Nebenzimmer. Harte, zischende Worte fielen, deren Sinn das Kind nicht verstand. Eine unbestimmte Ahnung beschlich es, dass dieses Mal vielleicht doch alles ganz anders war. Es krallte sich an Belli fest und hoffte so sehr, dass es sich täuschte. Sicher würde Mama morgen früh wie gewöhnlich am Herd stehen, fröhlich summend, um in einem silberfarbenen Stieltopf Honigmilch zu wärmen.
Die Geräusche nebenan wurden immer lauter. Soldaten im Krieg stöhnten so, wenn sie verwundet waren. Das wusste das Kind aus dem Fernseher.
Wie erstarrt lag es da mit Belli im Arm und wagte nicht, zu blinzeln. Seine weit aufgerissenen Augen brannten ein Loch in die Dunkelheit. Wie es sich auch anstrengte, das Gefühl, dass diesmal alles anders war, ging nicht weg. Das Mädchen hatte furchtbare Angst um seine Mama. Sein Körper hörte nicht mehr auf zu zittern, sein Herz war ein furchtsames Tier, das umherirrte wie die Gartenschläfer über ihm in den Wänden und Zwischenböden.
Nur mit Mühe unterdrückte es einen Impuls, hinüberzulaufen in das andere Zimmer, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung war, vielleicht auch, um Mama zu Hilfe zu eilen. Doch es traute sich nicht. Einmal, als es unvermittelt neben dem Bett gestanden hatte, in dem Mama mit einem fremden Mann zu ringen schien, war sie furchtbar böse geworden und hatte mit dem Kind geschimpft. Seitdem hatte es sich nie wieder getraut, zur Nachtzeit sein Bett zu verlassen. Auch wenn die Angst, dort drüben könne etwas Schlimmes passieren, noch so groß war.
Ein Klumpen saß in seinem Hals, fest und kalt wie Eis. Ein Kloß, der sich nicht hinunterschlucken ließ.
Bilder kamen auf es zugesegelt und nisteten sich in seinem Kopf ein. Hässliche Fratzen, die in böses Gelächter ausbrachen, sich aufblähten und verzerrten und es zu erdrücken drohten.
Es schluckte und schluckte. Im Raum war ein Wabern und Sirren. Silhouetten formierten sich, zerflossen im Dunkel der Nacht, um an anderer Stelle wiederaufzutauchen. Über allem lag ein drohendes Flimmern.
Weg. Nur weg von hier! Schon streckte es den Fuß unter der Bettdecke hervor, da gellte ein Schrei. Ein vielstimmiger Schrei, der sich klagend in die Länge zog.
Dann war es plötzlich still. Auch die Gartenschläfer konnte man nicht mehr hören. Die Stille war jedoch viel unheimlicher und erschreckender als die lauten Geräusche zuvor.
Mit dem Schrei war der Klumpen Eis in seinem Hals zerborsten. Es blinzelte heftig und versuchte, den schillernden Splittern nachzusehen, die auch dann noch durch die Luft tanzten, als es die Augen wieder geschlossen hatte. Es wartete eine Weile, jeden Moment damit rechnend, dass die Stimmen wieder ertönten. Aber im Nebenzimmer regte sich nichts mehr. Alles blieb ruhig, und allmählich normalisierte sich sein Herzschlag.
Irgendwann in dieser Nacht hatte es zu regnen begonnen. Das Mädchen hörte, wie die Tropfen auf Büsche und Blätter fielen. Der Regen klopfte an die Fensterscheiben, malte leise, gleichmäßige Lautmuster. Es mochte das Geräusch der Regentropfen, von deren Klang etwas Beruhigendes ausging. Durch den gekippten Fensterflügel drang der Geruch von nasser Erde zu ihm ins Zimmer.
Seine Lider wurden schwer. In das Rauschen des fallenden Regens mischte sich eine vertraute Klaviermelodie und Mamas Stimme, die ein Lied in einer fremden Sprache sang. Es war ein Lied, das Mama schon oft gesungen hatte. Hinter den geschlossenen Lidern sah es die unterschiedlichsten Blautöne – Türkis, Lapislazuli, Saphir – mit goldenen Funken darin. Ein nächtliches Sternenglitzern wie aus einem arabischen Märchen. Farben und Klänge verschlangen sich ineinander zu einer wundersamen Nachtmelodie. Gedankenfetzen, schön und schwer, lullten es ein und trugen es auf sanften Armen fort, hinein in einen wunderschönen Traum.
Am Morgen begannen die Vögel früh zu singen. Die Luft war klar und seidig. Der Regen hatte Blätter und Büsche vom Staub befreit. Der Himmel war ein blank gewaschenes Blau, von dem eine strahlende Sonne leuchtete.
Dennoch ließ das Mädchen eine innere Unruhe sofort nach dem Wachwerden aus dem Bett springen. Zuerst sah es in Mamas Schlafzimmer nach. Das leere Bett war zerwühlt, ein schwerer Geruch hing im Raum.
Auf bloßen Füßen rannte es hinunter in die Küche. Niemand stand am Herd und wärmte Milch. Das dumpfe Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht in Ordnung war, wurde übermächtig. Mit klopfendem Herzen stieß es die Tür zum Wohnzimmer auf. Sein Blick streifte das Klavier mit dem heruntergeklappten Deckel. Der Hocker war umgefallen. Der Teppich darunter schlug Wellen.
Das Mädchen lief treppauf, treppab. Im ganzen Haus suchte es nach seiner Mutter, doch sie war nirgends zu finden. Aus seinen Augen sprangen Tränen. Alles Klagen und Heulen nützte nichts. Seine Mama war verschwunden.
Das, was ihm blieb, waren sehnsüchtige Bilder im Kopf. Und ein Loch im Herzen. Eine offene Wunde, die sich einfach nicht schließen wollte.
Erster Teil
1. Kapitel
Januar 2007
Karim war gegangen. Sie wusste es sofort, als ihre Hand neben sich im Bett ins Leere fasste. Panik überfiel sie. Warum tat er das? Er wusste doch, dass sie ihn brauchte. Alles fiel in sich zusammen, wenn er nicht da war. Ihr Herz begann heftig zu klopfen. Ein eiserner Ring legte sich um ihre Brust, der ihr schier die Luft zum Atmen nahm. Sie drehte sich auf den Rücken und starrte in die Dunkelheit. Tränen krochen ihre Wangen hinunter wie kleine Käfer.
Lilly verstand nicht, warum es immer so endete. Sie verstand noch nicht einmal, warum sie beide sich jedes Mal mit dieser Heftigkeit stritten. Ihre Streitereien verschlimmerten sich im gleichen Maße, wie die Anlässe nichtiger wurden. Weshalb hatten sie sich eigentlich diesmal gestritten? Wahrscheinlich war es wieder einmal darum gegangen, dass sie sich von Karim kontrolliert fühlte. Dass er ihr sagen wollte, was sie zu tun und zu lassen hatte. Etwas, das sie sich einfach nicht bieten lassen konnte.
Böse Worte waren gefallen.
Hure.
Scheißtyp.
Schlampe.
Du kotzt mich an.
Und du mich noch viel mehr.
Sie schämte sich, wenn sie darüber nachdachte, was für ein Vokabular sie sich im Umgang miteinander angewöhnt hatten. Dabei liebten sie sich doch.
Oder nicht?
Ein Wort war dem anderen gefolgt. Mit schrillen Stimmen geäußerte Vorwürfe waren wie Pingpongbälle hin und her geflogen. Ein Aufschlag heftiger als der andere. Die Gesichter in hässliche Fratzen verwandelt.
Natürlich hatte sie gewusst, dass es falsch war, so zu reden, sich so heftig anzuschreien. Doch sie hatte nichts dagegen tun können. Wie eine Welle überrollten sie manchmal Wut und Zorn, eine mächtige Woge, die nicht mehr zu stoppen war. Und zum Schluss versuchte jeder nur noch, den anderen zu übertrumpfen.
Ihr Mund war ausgedörrt. Beim Schlucken tat ihr die geschwollene Zunge mit dem kleinen Fremdkörper darin weh. Die Entzündung dauerte schon viel zu lange.
Sie lag eine Weile wach und grübelte. Vielleicht hätte sie doch nachgeben sollen? Vielleicht hatte Karim ja recht, und die Schuld lag wirklich bei ihr. Aber er wusste doch genauso gut wie sie, dass sie einander brauchten. Dass sie aufeinander angewiesen waren. Zwei Gestrandete, die sich in ihrer Verzweiflung aneinanderklammerten. Da brauchte sie sich gar nichts vorzumachen.
Was willst du nur mit diesem Karim?, höhnte eine Stimme in ihrem Inneren. Such dir einen anderen, der mit sich im Reinen ist. Nicht so einen unfertigen, kleinen Macho, der alles besser weiß und dir vorschreiben will, was du zu tun und zu lassen hast.
Es ist leider so, dass Mädchen dazu neigen, sich immer wieder ihren Vater als Partner auszuwählen. Die Stimme einer der Psychotanten, bei denen sie sich Hilfe erhofft hatte, hallte in ihr nach wie ein verzerrtes Echo.
Lilly hörte ihr eigenes Lachen.
Glauben Sie wirklich, ich wäre so blöd?
Das Lachen wurde immer lauter.
So blöd, mir so einen zu suchen wie den, der mich malträtiert und schikaniert hat, nur weil ich kein Junge geworden bin?
So ein Quatsch! Was diese Seelenklempner sich alles einfallen lassen. Welche Ähnlichkeit sollte wohl mein Vater mit Karim haben?
Ihr Vater war ein kleiner, weißhaariger Mann, der seinen gewölbten Bauch wie eine Trommel vor sich hertrug. Der Blick aus tief liegenden Augen unter buschigen Brauen sollte der Welt verkünden, dass er der Stärkere war.
Karim war das genaue Gegenteil. Er sah gut aus, war groß und drahtig, kein Ansatz von Fett. Außerdem hatte er dunkles Haar.
Die ketzerische Stimme in ihrem Inneren jedoch wollte nicht schweigen.
Karim tut dir nicht gut. Du solltest weg von hier. Weg von Karim, von diesem ganzen beschissenen Leben. Fang von vorn an, bevor es zu spät ist.
Vielleicht wäre es wirklich besser, sich was Neues zu suchen.
Du schaffst das ja doch nicht, meldete sich schon wieder die böse Stimme. Wo willst du denn hin? Du hast nichts, und du kannst nichts. Scheiße bauen und dann abhauen. Den Kopf in den Sand stecken. Das ist das Einzige, was du kannst.
Das Dröhnen in ihrem Hinterkopf verstärkte sich.
Wann hörst du endlich auf, vor allem wegzulaufen?
Diese blöden Stimmen.
Weg mit euch. Weg!
Tief in ihr war eine Sehnsucht nach Ruhe und Frieden, nach Entspannung. Nach Geborgenheit.
Ach, warum war nur alles so kompliziert? Das ganze Leben und überhaupt.
Sie schaffte es nicht allein.
»Karim!«, rief sie verzweifelt. »Karim.«
Ihre Gedanken liefen in verschiedene Richtungen davon. Einzelne Fetzen trieben in die Vergangenheit, andere in die Zukunft. In ihrem Kopf tobte ein Kampf. Da waren so viele Fragen, die ohne Antwort blieben, und der eiserne Ring in ihrem Inneren schob sich enger und enger zusammen.
Sie zog die Beine an, umklammerte sie wie ein Embryo. Sie konnte kaum noch atmen. Die Angst wurde langsam unerträglich.
Reiß dich zusammen, Lilly. Du darfst dich dieser Angst nicht hingeben. Du darfst dich nicht aufgeben!
Karim wird zurückkommen. Dann ist alles wieder gut. Es war noch jedes Mal so. Und er wird so tun, als ob nichts gewesen wäre.
Sie konzentrierte sich auf ihren Atem, versuchte, den heftigen Herzschlag, so gut es ging, zu ignorieren. Sagte sich auswendig gelernte Sätze vor.
Tief einatmen.
Ich habe keine Angst. Mir geht es gut.
Ich lasse mich nicht unterkriegen.
Sätze, die manchmal halfen.
Konzentriere dich auf etwas Schönes.
Lilly versuchte, sich in den Moment hineinzufühlen, wie es war, in Karims Armen zu liegen. Seine Nähe zu spüren, seinen schmalen Körper an den ihren gepresst, und seinen Atem an ihrem Ohr zu hören. Ihre Hand tastete streichelnd ihren Arm entlang, hoch zu den Schultern und dann nach vorn über die Brüste. Sie spürte, wie ihre Brustwarzen sich aufrichteten. Ihr Streicheln war Karims Streicheln. Ihre Hand, die jetzt auf ihrem Bauch lag und weiter ihren Körper hinabwanderte, war Karims Hand.
Eine Weile gelang es ihr, sich dem Spiel ihrer Hände hinzugeben und den nagenden Gedanken, die am Rand ihres Bewusstseins lauerten, den Zutritt zu verwehren. Die Tränen waren versiegt. Sie spürte, wie die Anspannung in ihrem Körper nachließ. Sie lag da mit geschlossenen Augen, regelmäßigem Herzschlag und mit schönen Erinnerungen im Kopf. Der Schmerz und die Unruhe waren nicht mehr als eine Ahnung. Mit diesem Gefühl glitt sie zurück in den Schlaf.
2. Kapitel
Der Spielplatz vor dem Mariendom lag verlassen. Die Schaukeln an den Ketten bewegten sich sacht hin und her. Kein fröhlicher Kinderlärm ertönte vom Sandkasten oder von der Rutsche. Im Garten auf der gegenüberliegenden Seite des Doms blühte ein Forsythienbusch. Es waren tatsächlich Forsythien und nicht die gelben Blüten von Winterjasmin, die den Forsythien täuschend ähnlich sehen und die eher in diese kalte Jahreszeit gepasst hätten. Dazu zwitscherten die Meisen.
Die Natur spielte verrückt. Täglich meldete der Wetterbericht viel zu hohe Temperaturen für den Monat Januar. Keine Wetterkapriolen könnten die in erschreckendem Maße zunehmende Erderwärmung entschuldigen, hieß es. Alles hausgemacht. Allein der Mensch sei an der Klimakatastrophe schuld.
In diesem Winter war noch keine einzige Schneeflocke gefallen. Wo sonst um diese Jahreszeit alles kahl und verdorrt war, blühten Rosen und Ringelblumen, sogar Veilchen mit ihren violetten Blüten hatte sie gesehen. Dies verstand, wer wollte. Veilchen waren Frühlingsboten, frühestens dem Monat März vorbehalten. Noch nie in ihrem Leben hatte Helene Kayner Veilchen im Januar gesehen. Und dieses Leben dauerte nun schon über siebzig Jahre.
Jedoch an diesem frühen Morgen war trotz Erderwärmung und Klimakatastrophe von Wärme nichts zu spüren. Nebelschwaden krochen durch die Stadt, umhüllten Gebäude, Bäume und Sträucher, und über allem lag ein undurchsichtig trüber Himmel.
Sie fand, dass es die übliche Kälte war, die ihr, wie stets um diese Jahreszeit, das Leben schwer machte. Vielleicht war es auch das trostlose Grau, das sie die Kälte in all ihren Knochen spüren ließ. Eine feuchte Kälte, die durch den Körper drang bis tief in die Seele hinein. Die teure, wollene Unterwäsche, die sie sich kürzlich geleistet hatte, nützte kaum etwas.
Ein wenig wehmütig dachte sie daran, wie sie früher als Kind die kalten Winter genossen hatte. Damals konnte sie es kaum erwarten, nach dem ersten Schneefall den Schlitten aus dem Schuppen zu holen und dick eingemummt mit Wollhandschuhen und tief ins Gesicht gezogener Mütze auf den Krahnenberg zu stapfen, wo sie sich mit den anderen Kindern zum Schlittenfahren traf. Zu viert oder fünft bildeten sie dann eine Kette, indem sie die Holzschlitten mit Kordeln aneinanderbanden. Und wenn alle bei der Talfahrt in den Schnee purzelten, gab es lautes Gelächter.
Sie war ein fröhliches Kind gewesen, das gern lachte. Nicht nur ihre Erinnerung, auch die Kinderbilder in ihrem Album bezeugten dies. Schwarz-Weiß-Fotos mit gezackten Rändern, die glückliche Augenblicke eingefangen hatten. Ein lachendes Kind mit roten Wangen inmitten einer Sommerwiese am Ufer der Nette oder auf dem neuen Fahrrad, um das alle sie beneidet hatten.
Wie flüchtig das alles war und wie lange her. Eine halbe Ewigkeit. Damals war sie eine von ihnen gewesen. Heute, da sie wusste, was es mit diesem Leben auf sich hatte, war sie zu einem Fremdling geworden. Ein trauriges, irres Schaf, das sich nicht mehr der Herde zugehörig fühlte. Eine alte Frau mit dicken Brillengläsern vor den trüben Augen und einem bitteren Geschmack auf der Zunge. Eine Frau, die sich mit dem restlichen Leben, das ihr noch verblieb, schwertat.
Seufzend lehnte sie ihren fülligen Körper gegen das massive Holzportal, das nur widerwillig nachgab. Nachdem sie den Vorraum betreten hatte, fiel hinter ihr die Tür zu und schloss die Geräusche von draußen aus. Durch eine Glastür betrat sie eine andere, stille Welt. Fahles Licht fiel durch die bunten Glasfensterscheiben. Eine Wohligkeit umfloss sie, als sie den vertrauten Duft von Weihrauch und Kerzenwachs roch. Sie war allein in der Kirche, jedoch in der Stille der hohen Räumlichkeit vermeinte sie, den leisen Widerhall von Tausenden Gebeten und Litaneien zu hören.
Der Mariendom, das war ihre Kirche. Hier konnte sie Einkehr halten. Sobald sie dieses Gebäude mit seiner bewegten und in vielen Kunstschätzen dokumentierten Geschichte betrat, spürte sie Ruhe über sich kommen. Eine Ruhe, die zumindest zeitweise die Kälte aus ihren Knochen vertrieb und die ihr Herz wieder in einem regelmäßigen Takt schlagen ließ. Sie tauchte zwei Finger in das Weihwasserbecken und bekreuzigte sich. Je weiter sie in das Innere der Kirche schritt, umso deutlicher spürte sie seine Nähe. Diese Zugehörigkeit zu Gott, dem Vater aller Lebewesen.
Ihre Gedanken flogen zurück. Kurz erinnerte sie sich daran, wie sie als junge Frau während eines Parisbesuchs die Kirche Notre-Dame betreten hatte. Wie beeindruckt sie gewesen war von der gewaltigen Dimension und Schönheit des Gotteshauses, in dem sie sich so klein und unbedeutend fühlte. Ein Mädchen, das dachte: Wenn es tatsächlich einen Gott gibt, dann ist das hier seine Wohnung. Inzwischen zweifelte sie nicht mehr an der Existenz eines Gottes. Sie hatte am eigenen Leib erfahren, wie er schützend die Hand über seine Menschenkinder hielt, nachsichtig und voller Gnade, bereit, ihre kleinen und größeren Sünden zu vergeben.
Wir sind alle Sünder und werden einst wieder Staub sein. Gedenke, Mensch, dass du Staub bist – und zum Staub kehrst du zurück.
Stand es nicht so in der Bibel?
Hinter sich hörte sie ein Geräusch. Kurz darauf Schritte.
»Guten Morgen, Frau Kayner«, sagte eine männliche Stimme.
Sie nickte kurz und ging ohne ein Wort an dem Mann vorbei. Sie spürte, wie der ältere Herr, den sie flüchtig kannte, sich umdrehte und ihr nachsah.
Doch sie wollte nicht gestört werden, und sie hatte auch keine Lust, sich zu unterhalten. Aus ihrem Portemonnaie nahm sie ein Fünfzigcentstück und warf es in den Opferstock. Dann zündete sie eine Kerze an. Ein Lichtchen, das für sie leuchten sollte in dieser unverständlichen Welt.
Ihre Augen wanderten zwischen dem Segen spendenden Jesus und den darunter züngelnden Kerzenflammen hin und her. Kleine Feuerblumen, dachte sie.
»Ein Licht auf deinem Wege.«
Wer hatte das gesagt? Sie sah sich um, doch in ihrer unmittelbaren Nähe war niemand zu sehen. Der Herr, der sie gegrüßt hatte, saß viel weiter hinten in sich versunken auf einer der Bänke.
Eine Weile verharrte sie hier, dann ging sie nach vorn zum Altarraum und betrachtete die Jungfrau Maria mit ihrem Kind im Strahlenkranz, umgeben von Engeln.
Sie setzte sich in die vorderste Bankreihe und faltete andächtig die Hände. Dieser Anblick rührte sie stets aufs Neue. Maria, wie sie das Kind betrachtete, mit einem eigentümlichen Lächeln im Gesicht, das Stolz ausdrückte und vielleicht auch schon das Wissen um die späteren Schmerzen ihres einzigen Sohnes.
Auch ihr war nur ein einziges Kind vergönnt gewesen. Kein Sohn. Eine Tochter. Der Augenblick kam zurück, die übermächtige Empfindung, die sie durchströmte, als sie ihr Neugeborenes in den Armen hielt. So winzig und so zerbrechlich. Die Haut fast durchscheinend, der zarte Flaum auf dem Kopf. Damals hätte sie zerspringen können vor Glück. Es war einer jener seligen Momente, den sie ihr Leben lang nicht vergessen würde.
Sie ächzte beim Aufstehen, schwankte kurz und hielt sich an der Kirchenbank fest. Die Knie taten ihr weh. Sie sollte zum Arzt gehen. Manchmal wurden die Schmerzen schlimmer, je weiter der Tag voranschritt.
Beim Hinausgehen verharrte sie einen Augenblick vor dem Ungarnkreuz. Ihr Blick wanderte über den geschundenen Männerkörper, der über und über von Blut bedeckt war. Durch die Hände Nägel getrieben von Menschenhand. Der Kopf mit der Dornenkrone war auf die Brust gesunken. Das Gesicht schmerzentstellt.
Einen flüchtigen Moment lang dachte sie über den Lauf der Dinge nach, welche Zeitspanne und welche besonderen Ereignisse zwischen dem Kind auf dem Arm seiner Mutter und dem erwachsenen Mann am Kreuz lagen und wie sich alles veränderte. Und dann dachte sie noch, dass es einer von den Seinen war, der ihn verraten hatte.
Aber er ist um unsrer Missetat willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen.
Gottes Sohn, seit über zweitausend Jahren tot, rührt uns noch immer durch seine Menschwerdung. Menschwerdung, heißt das nicht: Schmerzen und Verluste ertragen und erdulden können? Egal, was einem angetan wird. Bereit sein, zu vergeben und Gnade walten zu lassen.
Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Ein wahrhaft tröstlicher Gedanke.
Doch die Toten belasten uns nicht durch ihre plötzliche Abwesenheit, sondern durch das, was ungeklärt geblieben ist zwischen ihnen und denjenigen, die sie zurücklassen. Ist es nicht so?
Sie brauchte sich nichts vorzumachen. Sie hatte keinen Frieden, und ihre Wunden waren nicht geheilt.
Als sie das Kirchenportal aufdrückte, trafen Regentropfen, scharf wie Nadelspitzen, ihr Gesicht. Sie zog den Kragen ihres Mantels hoch und bedauerte, keinen Schirm mitgenommen zu haben. Dann musste sie unwillkürlich lächeln. Der Mensch hält so vieles aus. Was sind da schon ein paar Regentropfen?
Als sie eine Weile durch die Regenschnüre gelaufen und einigen Pfützen ausgewichen war, die aussahen wie graue, kleine Spiegel, dachte sie: Gut, dass ich nicht daran glaube, dass das Leben mit dem irdischen Dasein ein Ende nimmt.
3. Kapitel
Beim Aufwachen spürte sie das Zittern von innen heraus. Dumpfes Pochen kroch langsam in ihre Glieder. Die andere Betthälfte war noch immer leer. Ein Juckreiz überfiel sie. Lilly spürte, wie die Unruhe in ihr wuchs. Das anfängliche Streicheln ihrer Hände auf ihrer Haut verwandelte sich in ein schmerzhaftes Kratzen. Immer intensiver verlangte ihr Körper nach etwas, das sie ihm noch nicht geben wollte.
Ich bin stark … ich habe keine Angst …
Die Selbstbeschwörungsformeln halfen nicht mehr.
Sie spürte, wie ihr der Schweiß ausbrach. Etwas drückte hart auf ihre Brust. Weltschmerz, Selbsthass und Zorn bildeten eine explosive Mischung, die sich schließlich in der Wut auf Karim Bahn brach. Wie sie es hasste, wenn er ging, ohne etwas zu sagen. Und sie nicht wusste, wohin er gegangen war.
Scheißtyp, soll er doch bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Sie schlug die Augen auf. Die toten Augenhöhlen des Skeletts an der gegenüberliegenden Wand waren auf sie gerichtet. Lilly starrte zurück.
Cycle of life and death supposedly …
Killers are quiet like the breath of the wind.
Von irgendwoher drang Musik. Harte, dissonante Klänge, die, zusammen mit dem Druck auf der Brust, etwas aus dem Dunkel in ihrem Innern an die Oberfläche spülten.
Ein kleines Mädchen im dünnen Hemd. Vor dem Kind stand ein großer Mann.
Sie spürte den Schwindel, der die blitzartig aufflackernden Erinnerungsfetzen begleitete.
Nicht schon wieder, bitte nicht!
Flashbacks hieß so was, hatte ihr mal eine Psychologin erklärt, eine von den Seelenklempnerinnen, die sich vergeblich an ihr abgearbeitet hatten. Die ihr versucht hatten, zu erklären, warum sie so tickte, wie sie tickte. Pff, alles Quatsch. Weil ja doch niemand eine Ahnung hatte, wie sie wirklich tickte.
Nein, nicht dran denken. Das Mädchen im dünnen Hemd war eine Märchenfigur. Sterntaler. Den Blick zum Himmel gerichtet. Damit es den Mann nicht sehen musste.
Sie wollte den Mann nie wieder sehen.
Heute, das ist das Leben. Und was gestern war, ist vorbei. Morgen, das ist deine Zukunft.
Das musst du dir immer wieder vorsagen. Wie ein Gebet!
Morgen wird alles besser. Du musst nur dran glauben. Wer glaubt, ist stark. Glaube kann Berge versetzen, so heißt es doch.
Ihre Erinnerung war ein Patchworkteppich aus verschieden gemusterten Flickstücken, die lose aneinandergeheftet waren. In den bunten Flickstücken waren Risse und Löcher, durch die ihre Vergangenheit hindurchschimmerte. Unvollständig und mit der Zeit blass geworden.
Man musste sich nicht an alles erinnern. Das war auch gut so.
Doch diese andere Stimme gab keine Ruhe. Die Stimme, die tief aus ihrem Inneren kam.
Mach dir doch nichts vor.
Das Mädchen im dünnen Hemd bist du. Das ist kein Märchen. Das ist die nackte Wahrheit!
Quatsch. Das Mädchen im Hemd ist eine Märchenfigur. Sterntaler hat alles Glück der Welt in seinem dünnen Hemdchen gesammelt.
Glück? Weißt duüberhaupt, was Glück ist?
Ihr Mund war ausgetrocknet, ihre Glieder schmerzten. Sie rollte die geschwollene Zunge mit dem Metallkügelchen darin, obwohl das den Schmerz verstärkte. Bildfetzen zuckten wie helle Blitze durch ihren Kopf. Sie hielt sich die Hand vor die Augen, presste die Lider zusammen.
Nichts mehr sehen wollen.
Es nützte nichts. Obwohl sie es nicht wollte, sah sie deutlich ein kleines Mädchen, das in Hemd und Höschen Turnübungen machte.
»Die Beine auseinander, gestreckt!«
Das Mädchen bemüht sich, den Befehlen zu gehorchen, die ein Mann erteilt, den es Vater nennen soll.
»Du dummes Ding, das soll ein Spagat sein? Wann kapierst du endlich, wie das geht?«
Sätze in russischer Sprache. Das verängstigte Mädchen versucht, die Beine zu einer geraden Linie auszustrecken. Das rechte Knie gehorcht. Doch das linke Knie beult immer wieder, will nicht unten auf der Erde bleiben, weil es so wehtut. Dann trifft es der andere Schmerz mit unglaublicher Wucht. Er kommt von einem Stock, den der Mann in der Hand hält. Ein Rohrstock, der hart auf sein Knie schlägt.
»Wollen doch mal sehen, ob wir dir nicht Zucht und Ordnung beibringen können!«
Brutal zieht der Mann das Mädchen hoch, streift ihm das Höschen herunter. Der Rohrstock klatscht auf seinen nackten Hintern. Das Kind heult Rotz und Wasser. Schreit und jammert.
Mama, wo bist du?
Karim, warum bist du weggegangen?
War sie das, die eben geschrien hatte? Verdammt! Wieso musste sie immer wieder an früher denken? Das war doch längst vergessen und vorbei. Sie war in Deutschland. Nicht mehr in Kasachstan.
Aber warum hörte dann das verdammte Zittern nicht auf?
… goes ’round and ’round yet it stops with me…
Die lauten Rhythmen der Musik, die aus einem der Nebenzimmer drangen, verschmolzen mit weiteren Erinnerungsfetzen, die sich in ihrem Kopf sammelten und dort herumwirbelten. Ihr wurde kalt, dann heiß und sofort wieder kalt. Sie zitterte und drückte die Lider so fest zusammen, dass sie Sterne im Dunkeln glühen sah. Dem Schwindel ausweichen. Diese unsägliche Unruhe abstellen. Ausschließen, alles, was dich belastet, ausschließen.
Glorious hunter of my faith I have sinned.
Sie versuchte, sich auf die Musik zu konzentrieren. Töne, die aus allen Ecken drangen und auf sie einströmten. Ihre Lippen wollten die Liedzeilen formen, doch der Gesang war schneller.
Dann begann das Hämmern und Dröhnen, das in ihren Kopf schoss und ihren Schädel zu zersprengen drohte. Ihre Zähne schienen sich selbständig zu machen. Die Hände kleine Motoren, die nicht stillstehen wollten.
Sie konnte nicht mehr ausweichen. Schweiß rann ihr in die Augen, der beim Blinzeln brannte wie Feuer. Alles tat ihr weh. Das Herz, der Körper, die Seele.
Mühsam stand sie von ihrem Bett auf und schleppte sich ins Bad. Dort hatte sie deponiert, was sie in solchen Momenten brauchte.
Sie öffnete das schmale, silberne Briefchen und konzentrierte sich auf ihre Aufgabe. Auf dieses einzige Mittel, welches das Chaos in ihrem Kopf und in ihrem Körper überlisten konnte. Das Mittel, das den Schmerz und das Zittern wegzauberte.
Es war das letzte Pac. Sie musste bald für Nachschub sorgen. Wieder im Bett, suchte sie ihren Arm ab. Fand eine Vene. Setzte die Nadelspitze an. Drückte. Injizierte eine Dosis Glück.
Jaaaa. Das tat gut. So gut. Wie eine heiße Welle floss das Zeug durch ihre Adern, durchdrang ihren Körper bis an die äußersten Spitzen. Sponn einen weichen Kokon, der sie einhüllte und vor der Welt dort draußen schützte.
Echt der Wahnsinn, dieses Gefühl.
Entspannt lehnte sie sich zurück. Hier war sie sicher. Niemand konnte ihr mehr etwas antun. Sie behielt das Skelett an der Wand im Auge, das mit einem Mal zu tanzen begann.
Der Tod ist dein Freund, hast du das nicht gewusst?
Ein seliges Lächeln machte sich auf ihrem Gesicht breit.
Sie schloss die Augen, war nur noch schwebende Materie. Alles um sie herum löste sich auf. Farben, Formen, Geräusche. Ihre Glieder wurden schwer und gleichzeitig weich. Weich und angenehm war sie in ihrer Zwischenwelt gelandet, in der nichts mehr zählte außer diesem Kick.
Ein geiles Gefühl, tausend Mal besser als Sex.
Was brauchte sie Karim, wenn sie Dope hatte?
Behaglich räkelte sie sich in ihrem Bett. Sie roch weder den bitteren Schweiß, der in der Bettwäsche haftete, noch nahm sie die Flecken wahr, die das Laken übersäten. Was aber am wichtigsten war: Die Angst war weg. Die Drecksangst, die ihr das Leben verpestete.
Wohlig kuschelte sie sich in die schmutzige, zerschlissene Bettdecke wie in die Arme einer liebenden Mutter.
4. Kapitel
Konzentriert blickte er auf den Bildschirm und knetete sich die Hände warm. Zunächst kaufte er seine Standardausrüstung, um sich für den Kampf zu wappnen. Die AK-47 kostete siebenhundertfünfzig Dollar. Reeller Preis. Immerhin feuerte das Ding sechshundert Schuss pro Minute. Pistolen, Schrotflinten, Granaten gehörten ebenfalls zur Ausstattung. Die Kevlarweste war notwendig, wollte man nicht ungeschützt in den Kampf ziehen.
Nun konnte es losgehen. Stephans rechte Hand begann auf die Maus einzutrommeln, die linke hackte auf die Tastatur. Sein Kämpfer bewegte sich behände um eine Ecke herum, flitzte zur nächsten Hauswand und verfolgte den Gegner. Stephan zielte. Doch bevor er schießen konnte, schlug neben ihm eine Blendgranate ein. Er versuchte, sich noch mit einer schnellen Drehung zu schützen. Aber es war zu spät.
Mist! Ich seh nichts mehr.
Wild fing er an, zu ballern, doch er konnte nichts erkennen, weder wo seine Ziele waren, noch ob er genügend gedeckt war. Da nützte auch die Kevlarweste nichts. Aus. Er wurde derbe weggefetzt.
Scheiße!
In der nächsten Runde würde er es besser machen. Wozu hatte er seine Fähigkeiten im Messerstechen perfektioniert? Das Töten mit Pistole oder MG hatte zwar durchaus seinen Reiz, aber er schwor auf gute Handarbeit. Die war beim Kampf mit dem Messer wesentlich mehr gefordert als beim Abknallen mit einer Schusswaffe. Da kam es viel mehr auf seine Geschicklichkeit an.
Er beschloss, ein wenig zu cheaten und mit einem Trick durch die Wand zu laufen. Er war es schließlich, der das Spiel bestimmte. Nur er allein.
Nun schlich er sich mit dem Messer in der Hand von hinten an den anderen heran. Blitzschnell stach er zu. Der andere krümmte sich vor Schmerz.
Immer schön rein in die Eier!
Stephan spürte, wie er von einem Rausch erfasst wurde. Wie Adrenalin in ihm hochschoss, als er stach und stach.
Der war erledigt und würde nicht mehr aufstehen. Der nicht mehr.
Da war noch einer. Wo kam der denn plötzlich her?
Na warte, Freundchen. Der andere duckte sich.
Hältst dich wohl für besonders schlau, ja? Aber dich krieg ich auch noch!
Diesmal war Stephan auf seine Deckung bedacht. Schließlich hatte er den anderen so weit. Der war so angeditscht, dass er absolut keine Chance mehr hatte. Wie er versuchte, seine Niederlage hinauszuzögern. Lachhaft.
Nützt dir alles nichts mehr, Freundchen!
Wieder mutierte Stephans Hand zur Waffe. Blut spritzte, als der Mann auf dem Bildschirm endlich zusammenbrach.
»Sauber!«, rief Stephan laut aus. »Geil.«
Er machte eine Pause und ging die Treppe hinunter in die Küche, um sich etwas zu trinken zu holen. Im Flur wich er seinem Spiegelbild aus. Seit diese furchtbare Akne sein Gesicht entstellte, mochte er sich gar nicht mehr ansehen. Und alle Mittelchen, die er bisher ausprobiert hatte, hatten nichts genützt. Die Pickel blühten, entzündeten sich und bildeten dicke Eiterknubbel. Und wenn man sie ausdrückte, hinterließen sie tiefe Krater in der Haut.
Seine Mutter war schon frühaus dem Haus gegangen. Er hatte ihr gesagt, dass er erst zur dritten Stunde in die Schule musste. Aber das hätte er sich sparen können. Es interessierte sie sowieso nicht, wann er Schule hatte und ob irgendwelche Stunden ausfielen.
Früher, ja, da hatte sie ganz genau Bescheid gewusst. Da hatte er ihr nie etwas vormachen können. Nach dem Unterricht hatte sie stets mit dem Essen auf ihn gewartet und sich an den Tisch gesetzt, um sich mit ihm über Gott und die Welt zu unterhalten. Einfach nur ein bisschen reden. Wie es so war mit den anderen Kindern und den Lehrern. Das hatte ihm gefallen. Für seine Hefte hatte sie sich auch interessiert, die sah sie sich aufmerksam an. Er hatte sie ihr gern gezeigt. Auf seine guten Noten war er stolz gewesen.