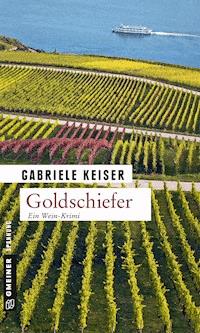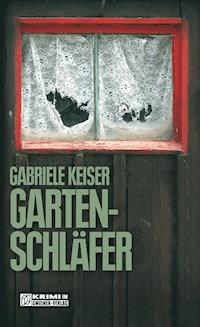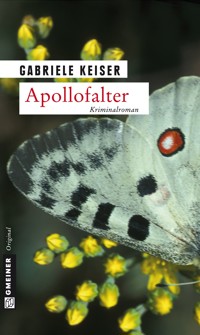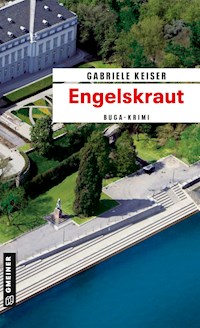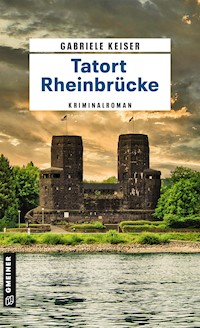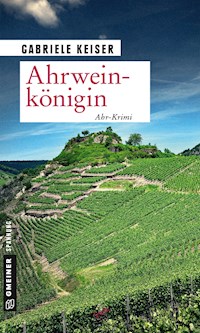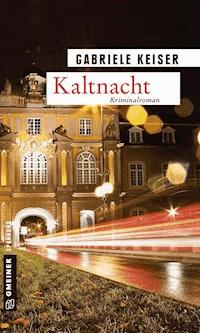Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissarin Franca Mazzari
- Sprache: Deutsch
Der idyllische Rauscherpark am Rande der Vulkaneifel ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Groß ist das Entsetzen, als im Flüsschen Nette ein Müllsack mit einem toten Jungen gefunden wird. Was wurde dem Kind angetan? Müssen weitere Verbrechen gefürchtet werden? Kommissarin Franca Mazzari und ihr Team fischen lange im Trüben …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriele Keiser
Vulkanpark
Kriminalroman
Zum Buch
Lähmender Schrecken Der idyllische Rauscherpark in der Osteifel ist ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Gewaltige Vulkanausbrüche formten einst diese Landschaft. Groß ist das Entsetzen, als im Flusslauf der Nette ein Müllsack mit einem toten Jungen gefunden wird. Der Fall bringt alle Beteiligten an den Rand des Erträglichen. Sämtliche Ermittler sind hoch motiviert, auch die Öffentlichkeit zeigt große Hilfsbereitschaft. Kommissarin Franca Mazzari und Bernhard Hinterhuber haben Verstärkung bekommen: Clarissa, vormals Praktikantin im Koblenzer Polizeipräsidium, ist inzwischen zur Jungkommissarin avanciert. Akribisch wird Spur um Spur abgearbeitet, modernste Fahndungsmethoden werden eingesetzt, und die Polizei scheut auch vor unkonventionellen Maßnahmen nicht zurück. Auch ein Profiler wird hinzugezogen, doch bis eine Auflösung in Sicht ist, gilt es etliche Zweifel und Irrtümer auszuräumen …
Gabriele Keiser, 1953 in Kaiserslautern geboren, studierte Literaturwissenschaften und lebt heute als freie Schriftstellerin, Lektorin und Volkshochschuldozentin in Andernach am Rhein. Ihre Krimis um die sympathische Koblenzer Kriminalkommissarin Franca Mazzari sind eine gelungene Kombination von Spannung und Wissensvermittlung, denn es geht immer um mehr als nur um die Frage nach dem Täter. Gabriele Keiser ist Mitglied im »Syndikat«, der Vereinigung deutschsprachiger Krimiautoren, und war etliche Jahre Vorsitzende des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS) in Rheinland-Pfalz. Im Jahr 2014 erhielt sie den Kulturförderpreis des Landkreises Mayen-Koblenz.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © MMchen / photocase.com
ISBN 978-3-8392-4110-3
Zitat
Das größte Geheimnis ist der Mensch sich selbst.
Novalis
Prolog
Er hatte geglaubt, der Alte sei längst tot. Umso erstaunter war er über den Anruf aus dem Pflegeheim gewesen. Er sortierte die Bilder in seinem Kopf und versuchte, sie mit den Gegebenheiten in Übereinstimmung zu bringen, die er vor sich sah, und begann sich zu fragen, weshalb in drei Teufels Namen er bloß hierhergekommen war. In dieses Zimmer, wo es nach Desinfektionsmitteln und Siechtum roch.
Vater befiehlt und der Sohn gehorcht. Die alten Mechanismen schienen noch immer zu funktionieren, nach so langer Zeit. Hatte sich wirklich gar nichts verändert?
Der Greis schaute mit starrem Blick an ihm vorbei. In sich zusammengefallen, hing er mehr als er saß im Rollstuhl. Unter dem zerschlissenen Frottee-Bademantel trug er einen gestreiften Pyjama. Zahlreiche geplatzte Äderchen durchzogen wie ein rotmaschiges Netz sein ledriges, von vielen Falten schraffiertes Gesicht. Sein kahler Kopf sah aus wie ein verschrumpelter, von braunen Flecken verunzierter und vergessener Apfel, den niemand mehr haben wollte. Er trug kein Gebiss. Sein Mund war eingefallen, eine tiefe, unergründliche Höhle.
Nichts hatte er mehr gemein mit dem Vater, der einmal stark und mächtig gewesen war. Viel eher erinnerte er den Sohn an eines der präparierten Tiere im Arbeitszimmer, die ihn fasziniert und zugleich abgestoßen hatten.
Eigentlich sieht er völlig harmlos aus, dachte der Sohn verwundert. Aufrecht stand er vor dem alten Mann und sah auf ihn herab. Er hätte sich auf einen Stuhl setzen können, um seinem Vater in Augenhöhe zu begegnen, aber das tat er nicht. Er blieb stehen.
Ein Bild hatte sich in sein Gehirn eingebrannt, das nicht mehr auszulöschen war: Er war derjenige, der saß – zusammengekauert auf einem Kinderstühlchen – und sein Vater stand vor ihm. Groß, erhaben, drohend. Der Vater fragte Wissen ab. Das kleine Einmaleins. Abziehen. Zusammenzählen. Erbarmungslos prasselten Aufgaben und Kommentare auf das Kind nieder.
Sieben mal neun. Herrgott, das ist doch nicht so schwer … Wo hast du bloß deine Gedanken? Wird’s bald?
Aus Vaters Mund hagelten weitere Zahlen. Die Stimme wurde immer schriller und blockierte alle Gedankengänge. Der Sohn, das Kind, suchte verzweifelt nach Antworten. Er wollte so gern dem Vater gefallen. Dafür hatte er stundenlang geübt. Aber alles, was er vorher gewusst hatte, war wie weggeblasen. Hilflos bewegte er die Lippen, nicht die einfachste Lösung fiel ihm ein. Darüber war er genauso frustriert gewesen wie sein Vater.
Am liebsten hätte er seinen Vater jetzt gefragt: 98 minus 45. Na, was ist? Wo hast du bloß deine Gedanken? Wie fühlt man sich, wenn der andere groß und mächtig vor einem steht, und man selbst so hilflos ist wie ein kleiner Junge auf einem Kinderstühlchen?
Natürlich beherrschte er sich, wie er sich immer in Gegenwart seines Vaters beherrscht hatte, eines Mannes, der kaum Fragen stellte, sondern gewohnt war, Ansagen zu machen oder Befehle zu erteilen. Bravsein war die Maxime seiner Erziehung gewesen. Ein gutes Kind gehorcht geschwind. Ein stiller Duckmäuser war erwünscht. Kein Kind, das herumzappelte, und schon gar keines, das in der Lage war, selbstständig zu denken und dies in irgendeiner Weise auch noch zu äußern.
Kurz dachte der Sohn an seine Mutter, die in ihrer eigenen Welt gelebt hatte, einer Parallelwelt, die mit der Realität nur wenig übereinstimmte. Für die Sorgen des Kindes hatte sie kein Gespür gehabt. Vielleicht, weil ihre eigenen Nöte so übergroß gewesen waren, dass sie sie wegzuträumen und mit Medikamenten wegzuschlucken versuchte.
Im Grunde war das hier alles nur armselig.
Plötzlich fragte er sich, warum er sich nicht erhaben vorkam, wie er da vor seinem Vater stand und auf ihn herabblickte, groß, aufrecht, gesund. Warum dieses Gefühl von Macht und Triumph ausblieb. Flau war ihm im Magen, im Kopf. Ob seinem Vater jemals in den Sinn gekommen war, dass er etwas falsch gemacht hatte? Ob er sich jemals darüber Gedanken gemacht hatte, dass die Dinge nicht einfach passierten, sondern dass es für alles einen Grund gab?
Der alte Mann wandte den Kopf und suchte den Blick des Sohnes, ein Speichelfaden troff aus seinem Mund, vor dem sich der jüngere ekelte. Er musste sich zwingen, diesem Anblick standzuhalten.
Zusammenhängend sprechen konnte der Vater nach dem Schlaganfall nicht mehr. Bestenfalls lallen. Zittrig bewegte er die welken Lippen. Auf einmal kam Bewegung in ihn, mit einem Ruck hob er eine Hand. Unwillkürlich zuckte der Sohn zusammen. Diese Bewegung löste noch immer Alarm in ihm aus: Er ertappte sich dabei, wie er sofort den Arm hochriss, um seinen Kopf zu schützen. Gleichzeitig brachen blitzartig Gefühle und Gedanken aus den Tiefen seines Unterbewusstseins hervor, von denen er geglaubt hatte, dass er sie längst hinter sich gelassen hatte.
Schnell ließ er den Arm wieder sinken.
Es war zu lächerlich. Der Alte konnte nicht mehr schlagen. Dazu hatte er keine Kraft mehr. Abgesehen davon, dass die Distanz zwischen Vater und Sohn keine Berührung welcher Art auch immer zuließ.
Sein Vater war 98 Jahre alt. Hatte man da nicht lange genug gelebt? Und genug Unheil angerichtet?
Die alte Hand, deren Haut dünn war wie Pergament und von zahlreichen Altersflecken bedeckt, zitterte. Der Greis beugte sich vor, er versuchte, etwas zu artikulieren.
Wieder fiel dem Sohn der Vergleich mit den präparierten Tieren ein. Ein Fuchs mit rötlichem Fell und Augen aus Glas, ein Habicht mit ausgebreiteten Flügeln, der in seinen Krallen ein lebloses Kaninchen trug. Wesen, die tot waren, die jedoch durch spezielle Verfahren den Anschein erweckten, ewig zu den Lebenden zu gehören. Der Unterschied lag allein in den Augen. Während die der gejagten Tiere gläsern und leer gewesen waren, leuchtete aus den wässrigen Augen des Vaters Panik.
Der Alte hat Angst, schoss es dem Sohn durch den Kopf. Sieh mal einer an. Seinen Mund umspielte ein Lächeln.
»Hast du Durst, Vater? Soll ich dir was zu trinken holen?«, fragte er höflich.
Eine unwirsche Bewegung mit der Hand. Begleitet von einem heftigen Kopfschütteln.
»Schlecht …«, verstand der Sohn, »… ganz schlecht.«
»Was ist ganz schlecht, Vater?«
»Alles … will nicht mehr.«
Schrill und hoch drangen die Töne aus der dunklen Höhle des zahnlosen Mundes. Unartikuliert. Begleitet von Speicheltropfen und einem Pfeifen und Schnaufen. Wie bei einem Trinker. Einem Menschen, der nicht bei sich war, der nicht mehr kontrollieren konnte, was er von sich gab.
»Was meinst du?« Der Sohn kniff die Augen zusammen, in seinem Hinterkopf begann es zu klopfen. Er war nicht sicher, ob er richtig verstanden hatte. »Was willst du mir sagen, Vater?«
Er dachte daran, wie er als Kind in Vaters Arbeitszimmer zitiert wurde, einen düsteren Raum mit zahlreichen Büchern in Glasvitrinen, den sämtliche Familienmitglieder nur nach Aufforderung betreten durften. Zuvor ging es durch den langen Flur mit den Geweihen an der Wand. Sein Vater war stets effektiv im Sammeln von Trophäen gewesen. Beim Schießen und beim Schlagen bewies er eine sichere Hand.
Vom Sohn wurde erwartet, dass er nach dem Eintreten einen Diener machte. Vater war ein Herr der alten Schule, der auf Manieren achtete. Wenn der Sohn etwas besonders gut gemacht hatte, durfte er sich eines der Himbeerbonbons nehmen, die rosarot und verführerisch in einem Glas auf dem Schreibtisch standen.
Hatte er jemals ein Bonbon bekommen? Er konnte sich nur daran erinnern, dass er sich einige Male heimlich in das Büro geschlichen hatte, um eines zu stehlen.
»Mach … tot«, krächzte der Alte.
»Bitte?« Sein Herz begann zu hämmern. Er hielt die Hand hinter sein Ohr. So wie es Vater immer gemacht hatte, wenn er glaubte, sich verhört zu haben.
»Mach tot … weg … aus … vorbei.« Der Alte wedelte mit den Händen. Wieder fühlte sich der Sohn an früher erinnert, an das ungeduldige Fuchteln, das ein endgültiges Schneiden durch die Luft abschloss. Begleitet von einem gezischten »Basta!«, dem niemand zu widersprechen wagte.
Der Mann, der ihn gezeugt hatte, bettelte darum, umgebracht zu werden? War es das? Hatte er das richtig verstanden?
»Vater, ich glaube, es ist besser, du legst dich wieder hin. Ich gehe jetzt.«
Unruhe erfasste den alten Mann, er versuchte, den Sohn aufzuhalten. Mit unartikulierten Worten, mit heftigen Gesten.
Nun stellte sich doch so etwas wie ein Triumphgefühl bei ihm ein. Wie er es genoss, bestimmen zu können! Keinem väterlichen Befehl mehr gehorchen zu müssen. Er drehte seinem Vater den Rücken zu und fasste entschlossen an die Türklinke, ignorierte das verzweifelte Gebrabbel, das ihn zum Bleiben verurteilen wollte.
Ein Lächeln umspielte seine Lippen, als er die Tür hinter sich zuzog.
1
Schützt uns dieser Staat noch vor Verbrechern? Die Überschrift des Artikels stach gut sichtbar ins Auge. Die überregionale Ausgabe einer bekannten Tageszeitung lag aufgeschlagen in der Mitte des Tisches. Aus aktuellem Anlass hatte der Chef zu einer außerordentlichen Sitzung im Besprechungszimmer des Kriminalkommissariats 11 im Koblenzer Präsidium am Moselring gebeten.
»Schön, dass Sie alle gekommen sind.« Anton Osterkorn nickte in die Runde. Als sein Blick die Kriminalhauptkommissarin Franca Mazzari streifte, hellte sich seine Miene um eine kleine Nuance auf. Sie hatte seit Tagen eine heftige Erkältung, erschien aber tapfer auf ihrer Dienststelle. Inzwischen brachte sie kaum noch einen Ton heraus, allenfalls ein rostiges Quietschen, und war derart heiser, dass ihre Tochter Georgina sich zu der Bemerkung veranlasst gesehen hatte , sie habe eine Stimme wie eine Puffmutter. Halsbonbons halfen nur wenig. Ebenso das abendliche Gurgeln mit frisch gebrühtem Salbeitee.
Anton Osterkorn nahm die getönte Hornbrille ab und rieb sich die Nasenwurzel.
»Lassen Sie mich gleich zur Sache kommen: Dass das Gesetz zur nachträglich verhängten Sicherungsverwahrung eine einzige Flickschusterei ist, brauche ich Ihnen nicht zu erklären. Insofern war es überfällig, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die nachträglich angeordnete Sicherungsverwahrung infrage stellte. Freiheitsentzug kann nun mal nicht nach einem Gesetz verlängert werden, das zum Zeitpunkt des ersten Urteils noch nicht in Kraft war.«
»Der Chef klingt wie ein Anwalt, der mit allen Mitteln seinen Mandanten verteidigt«, raunte Clarissa Franca zu. Die ehemalige Praktikantin hatte inzwischen ihr Studium mit Bestnoten beendet und war als Jungkommissarin ins Koblenzer Präsidium zurückgekehrt.
»Wollen Sie damit sagen, dass die Straßburger Richter mit diesem Urteil mehr Rechtssicherheit geschaffen haben?«, fragte Francas jüngerer Team-Kollege Bernhard Hinterhuber.
Osterkorn nickte nachdrücklich. »Im Kern beruft man sich doch auf den römischen Rechtsgrundsatz ›nulla poena sine lege‹: Keine Strafe ohne Gesetz, was zweifellos eine tragende Säule unseres Rechtsstaates ist, verankert in Artikel 103 des Grundgesetzes, wie Sie alle wissen.«
Unter den Anwesenden brach Gemurmel aus.
Der Chef hob beschwichtigend die Hände. »Dennoch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass wir seither mit einer Reihe von zusätzlichen Problemen konfrontiert wurden – und noch konfrontiert werden«, räumte Osterkorn ein.
Davon konnte jeder der Anwesenden ein Lied singen. Der allgemein grassierende Sparwahn, der auch vor der Polizei nicht haltmachte, bescherte sowieso schon eine Menge zusätzlicher Probleme. Deshalb fanden viele, dass das Straßburger Urteil allem die Krone aufsetzte.
»›Freiheitsorientiertes und therapiegerichtetes Gesamtkonzept‹ nennt man das«, merkte Hinterhuber an. »Klingt eigentlich nicht schlecht. Doch viele Kollegen fragen sich, ob nicht aus Straßburg die falschen Signale gesetzt werden. Ich meine, zu Recht.«
»Das Urteil ist bindend für uns, das wissen Sie«, wandte Osterkorn ein. »Und wir müssen damit umgehen.«
»Daher weht der Wind«, flüsterte Clarissa. »Auch Chefs müssen Kompromisse machen. Warum gibt er das denn nicht zu?«
Franca wandte den Blick und betrachtete die junge Kollegin. Clarissa war wie immer top gestylt, neu war ein Piercing unterhalb der Lippen. Sie trug ein eng anliegendes rotes T-Shirt, das so gar nicht mit dem grellen Hennaton ihrer frisch gefärbten Haare harmonierte.
»Das heißt doch nichts anderes, als dass die Rechte dieser Verbrecher über die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung gestellt werden. Es ist zum Kotzen«, gab Roger Brock, einer der jüngeren Kommissare, seiner Verärgerung Ausdruck. »Das Grundrecht auf Freiheit wird verletzt, dass ich nicht lache. Die so was festschreiben, sind doch alles Schreibtischhengste, die von der Realität überhaupt keine Ahnung haben. Ich möchte mal sehen, wie die reagieren würden, wenn in ihre Nachbarschaft ein entlassener Sexualstraftäter einzieht, dem ihre Kinder tagtäglich begegnen müssen. Aber es ist ja alles Recht und Gesetz!« Mit einer heftigen Geste warf er seinen Stift auf den Schreibtisch, der weiterrollte und auf den Boden fiel.
Clarissa bückte sich, hob ihn auf und legte ihn mit einem nachsichtigen Lächeln wieder auf seinen Platz. Allen war bewusst, warum Brock besonders empfindlich auf das angesprochene Thema reagierte.
Roger Brock, der gerade mal die geforderte Mindestgröße maß und schmal war wie ein Handtuch, wurde von den Kollegen früher Bröckchen genannt. Bröckchen war umgänglich, jedermann mochte ihn. Doch vor einiger Zeit hatte sich sein Charakter vollkommen verwandelt. Ihn hatte es hart getroffen, als ein von ihm und seinem Kollegenteam unter Bewachung stehender Straftäter nur drei Tage, nachdem die Einstellung der Observation angeordnet worden war, einen weiteren Mord begangen hatte. Der Fall hatte großes Aufsehen erregt. Der sensible, nachdenkliche Kommissar hatte sich quasi über Nacht in einen Zyniker verwandelt, der eine undurchdringliche Mauer um sich gezogen hatte und bisweilen Unerträgliches von sich gab. Seitdem hieß er nur noch Brocken. Ganz böse Zungen nannten ihn auch Kotzbrocken.
»Konkret geht es, wie Sie wissen, um Johann Lomack«, fuhr Osterkorn fort. Lomack war ein Mehrfachtäter, der sich wiederholt an Kindern vergangen hatte. Fast 20 Jahre seines Lebens hatte er mit nur kurzen Unterbrechungen hinter Gittern verbracht. Zuletzt wurde er zu sechs Jahren Haft verurteilt. Eine Sicherungsverwahrung wurde nachträglich angeordnet. In einem der zahlreichen Gutachten, die über ihn verfasst wurden, hatte es geheißen, er sei ein Mann mit Bedürfnis nach Nähe und Geborgenheit, aber in besonderen Krisen weise seine Sexualität deviante Anteile und Impulse auf. In einer weiteren Beurteilung wurde die Behauptung aufgestellt, dass die Frage nach einer medizinisch definierten sexuellen Perversion zu verneinen sei – was nicht nur viele der Anwesenden infrage stellten.
»Jetzt sieht er seine große Chance und hat einen Eilantrag gestellt. Wenn der Richter im Sinne des Straßburger Urteils entscheidet, kommt Lomack schon in den nächsten Tagen frei«, fuhr Osterkorn fort.
»Wie das ausgeht, kann sich jeder an fünf Fingern abzählen«, schnaubte Brock. »Alle wissen es, und wenn’s dann wieder passiert, schreien sie auf.«
»Das ist die Reaktion der Presse auf ähnliche Fälle!« Osterkorn schlug mit der flachen Hand auf die Zeitung vor sich. »Und es handelt sich hier um ein seriöses Blatt. Was die mit den großen Buchstaben schreiben, brauch ich Ihnen nicht im Einzelnen darzulegen.«
»Das heißt, wir werden gezwungen, einen Straftäter auf die Menschheit loszulassen, obwohl man davon ausgehen kann, dass er weiterhin eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt«, stellte Clarissa fest. Es wirkte, als könne sie nicht glauben, was sie da eben gehört hatte.
»Man kann es zumindest nicht ausschließen.« Hinterhuber strich sich die dunklen Locken aus der Stirn. »In der Tat werden wir uns die Frage gefallen lassen müssen, was daran gerecht sein soll.«
»Der kriegt auch noch eine Entschädigung dafür, dass er so lang angeblich zu Unrecht im Gefängnis gesessen hat«, stieß Brock hervor. »Ein Schlag ins Gesicht eines jeden Opfers und dessen Familie. Und das nennt man dann juristisch korrekt. Ich frag mich wirklich, wo wir hier eigentlich leben.«
Franca lag einiges auf der Zunge, doch sie hielt sich mit Kommentaren zurück, nicht zuletzt deswegen, weil ihre krächzende Stimme den Ernst der Aussage wahrscheinlich etwas herabgemindert hätte. Auch sie hielt das Straßburger Urteil für äußerst problematisch. Menschen wie Lomack waren nun mal am besten hinter Gittern aufgehoben, wo sie kein weiteres Unheil anrichten konnten, auch wenn die Sicherungsverwahrung erst nachträglich angeordnet worden war.
»Wir müssen mit den Gegebenheiten umgehen, ob wir wollen oder nicht.« Mit undurchdringlicher Miene schob Osterkorn die vor ihm liegenden Blätter zu einem Stapel zusammen. »Vielleicht tun wir Lomack ja Unrecht. Seine Sozialprognosen gelten als gut.«
»Vielleicht kommt der Papst in die Hölle«, murmelte Roger Brock.
Der Chef konnte ein Grinsen nicht unterdrücken. »Auch das liegt nicht in unserer Hand.«
»Ich sage euch, der Lomack schnappt sich das nächste Kind, sobald sich die Gelegenheit bietet. Dazu braucht man kein Hellseher zu sein. Ich kenn doch diese Typen«, trumpfte Brock auf. Franca blätterte in Lomacks Aktenkopien, die vor ihr auf dem Tisch lagen. Ein Foto zeigte ihn als rundlichen Mann mit angegrauten, schütteren Haaren, der erstaunt in die Welt blickte und aussah, als ob er keiner Fliege was zuleide tun könne. Immer wieder hatte er sich Mädchen genähert, Kindern im Alter zwischen neun und zwölf Jahren, hatte sie mit einem Messer bedroht und gezwungen, sich auszuziehen, um sich danach an ihnen zu vergehen. Ein Druck tief in seinem Inneren sei daran schuld, dem er sich hilflos ausgesetzt sehe, hatte er behauptet.
»Ich habe mir die Akte genau angesehen«, äußerte Hinterhuber. »Der Mann hat die Hälfte seines Lebens fast ununterbrochen im Gefängnis gesessen, Therapien hat er zwar angefangen, aber nach kurzer Zeit immer wieder abgebrochen. Das heißt, da hat überhaupt keine Aufarbeitung stattgefunden. Folglich ist er in keiner Weise auf ein Leben in Freiheit vorbereitet.«
In der JVA war der Tagesablauf geregelt, den Insassen wurde vorgeschrieben, was zu tun und was zu lassen war, es gab eine klare Struktur. In dem Moment, in dem ein Täter freikam, musste er seinen Tagesablauf selbst regeln, er wurde mit Problemen und Versuchungen konfrontiert, vor denen er während seines Gefängnisaufenthaltes abgeschirmt war. Das war schon manchem zum Verhängnis geworden.
Franca hob den Kopf und betrachtete Roger Brock, der düster vor sich hinstarrte. Im letzten Jahr war er stark gealtert, markante Falten gruben sich um Augen und Mund. Sie hatte mehrmals versucht, mit dem jüngeren Kollegen über den damaligen Vorfall zu reden, der ihn derart aus dem Gleichgewicht gebracht hatte, doch er blockte jedes Mal ab.
»Haben Sie irgendwelche brauchbaren Vorschläge?«, fragte Osterkorn in die Runde, wobei er einen Blick auf Brock vermied.
»Sowohl offene als auch verdeckte Observation ist schwierig zu handhaben, ganz einfach, weil uns die Leute fehlen«, merkte Hinterhuber an. »Wo sollen wir denn bei unserer dünnen Personaldecke die zusätzlichen Beamten hernehmen?«
Für eine einzige Rund-um-die-Uhr-Überwachung waren ungefähr 25 Beamte notwendig. Praktisch hieß das, dass auf die einzelnen Bediensteten trotz Überbelastung enorme Mehrarbeit zukommen würde. »Wir können doch schon so manchmal nicht mehr sein als Kontrolleure, die lediglich ein paar Stichproben machen«, fuhr Hinterhuber fort.
Franca war gespannt, was Osterkorn zur Lösung dieses Problems vorschlagen würde, denn der Aufwand, den Lomacks Freilassung verursachen würde, war in der Tat kaum zu bewältigen. Ganz davon abgesehen, dass die Polizisten, die man für dessen Bewachung einsetzen musste, an anderen Stellen fehlen würden.
Osterkorn nickte bedächtig. »Es ist nicht zu leugnen, dass jeder Einzelne von Ihnen wesentlich mehr Aufgaben stemmen muss als früher«, räumte er ein.
»Da wird dann schon mal in Kauf genommen, dass wir alle Burn-out kriegen oder der eine oder andere Kollege frühzeitig an einem Herzinfarkt abkratzt«, murmelte Brock. »Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo mir der Kopf steht.« Mit einem listigen Grinsen wandte er den Kopf. »Ich finde, wir sollten ein paar Tage verdeckt observieren, der Typ soll sich in Sicherheit wiegen. Wenn er sich dann an ein Kind ranmacht und wir ihn auf frischer Tat ertappen, ist er ratzfatz wieder da, wo er hingehört.«
Franca konnte nicht mehr länger an sich halten.
»Sei nicht so zynisch«, krächzte sie kopfschüttelnd mit zusammengezogenen Augenbrauen. »Das ist ja nicht zum Aushalten.«
»Ist doch wahr«, konterte Brock.
»Ich frage mich, wie lang so eine Überwachung gehen soll«, hakte Clarissa nach. »Eine Woche? Einen Monat? Oder tatsächlich so lang, bis er wieder was anstellt?«
»So lang wie nötig.« Osterkorn stand auf. Offenbar war die Unterredung für ihn beendet. »Sie kümmern sich drum, ja?«, sagte er in Francas Richtung. »Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Sie entschuldigen mich.« Damit zog er die Tür hinter sich zu.
»Was war das denn?«, krächzte Franca fassungslos.
»Sisyphus lässt wieder einmal grüßen«, ließ Hinterhuber vernehmen. »Und wir dürfen’s ausbaden.«
Einen Moment herrschte ungläubige Stille im Raum. Sogar Brock hatte es die Sprache verschlagen.
»Warum lassen wir uns nicht einfach klonen?«, meinte Clarissa grinsend. »Wäre doch mal ’ne Super-Idee.«
2
»Bin wieder da!« Andrea Liebermann fegte zur Tür herein, voll bepackt mit Einkaufstüten. Hastig stellte sie alles auf dem Küchentisch ab, rief: »Konny? Hilfst du mir mal?«, während sie schnell das Notwendigste im Kühlschrank verstaute. Draußen herrschten Temperaturen um die 30 Grad, da galt es, zügig zu handeln. Als keine Antwort kam, lief sie zu der Zimmertür ihres Sohnes und steckte den Kopf hinein.
»Oh, Entschuldigung!« So hastig, wie sie die Tür geöffnet hatte, schloss sie sie wieder.
Ein überraschtes Lächeln machte sich auf ihrem Gesicht breit. Es kam nicht oft vor, dass Konny Besuch mitbrachte, ohne ihr vorher Bescheid zu sagen. Und es war noch nie vorgekommen, dass sie ihn beim Knutschen erwischte. Im Nachhinein ärgerte sie sich ein wenig über sich selbst, dass sie ohne anzuklopfen in sein Zimmer geplatzt war. Immerhin war er 17 und alt genug. Sie war eigentlich kein neugieriger Mensch. Natürlich interessierte sie, was ihr Sohn so trieb, aber das blieb in einem gesunden Rahmen, wie sie fand. In ihrer Familie herrschte Offenheit bei gleichzeitigem Respektieren der Intimsphäre des anderen.
Hoffentlich nahm er ihr das nicht übel. Schließlich war hauptsächlich sie diejenige gewesen, die ihrem Sohn Anstandsegeln beigebracht hatte. Allerdings war sie sicher, sie würden drüber reden können. So wie sie über alles reden konnten.
Andrea packte die restlichen Einkäufe in die Küchenschränke und in den Keller. Als sie die Treppe wieder hochkam, stand Konny in der Küche. Plötzlich nahm sie ihn mit ganz anderen Augen wahr. Er hatte ordentlich Muskeln bekommen, seit er in diesem Fitnessstudio trainierte. Und von den Pickeln, die bis vor Kurzem sein Gesicht verunziert hatten, war kaum noch einer übrig. Das lag sicher auch an seiner ausgiebigen Pflege. Im Bad brauchte er für seine Tiegel und Fläschchen mehr Platz auf dem Kosmetikregal als sie. »Dein Besuch kann ruhig zum Essen bleiben«, sagte sie lächelnd.
»Ist nicht mehr da.«
»Hab ich sie etwa vertrieben?«
Er lachte auf. »So schreckhaft ist Britta nicht. Sie wollte sowieso gehen. Kann ich dir was helfen?«
»Gern. Paprika und Möhren putzen und schnippeln.«
Sie beobachtete ihn aus den Augenwinkeln, wie er das Gemüse unter den Wasserhahn hielt und gründlich abwusch. Danach nahm er sich ein Schneidebrettchen sowie ein Messer und begann, sorgfältig alles klein zu schneiden.
Ein Glücksgefühl durchströmte sie. Sie war so froh, dass sie ihn hatte. Gern hätte sie eigene Kinder gehabt. Aber das war nicht möglich. Woran es lag, konnte niemand so genau sagen, und eine Zeit lang hatte sie große Schwierigkeiten mit diesem Gefühl gehabt, nur eine halbe, eine minderwertige Frau zu sein, ein Gefühl, das sich tief in ihr drin verankert hatte, das aber nicht von ihrem Mann geschürt wurde. Er verhielt sich stets sehr verständnisvoll. Schließlich hatten sie und Rainer beschlossen, ein Baby zu adoptieren, aber elternlose Babys gab es damals keine. So beschlossen sie, zu warten. Sie waren ja noch jung. Eines Tages kam Rainer, damals noch Vikar, von einem Besuch in einer Unterkunft für drogensüchtige Frauen und Mädchen zurück und erzählte ihr von einem zweijährigen blonden Jungen, dessen Mutter nicht mit ihm zurechtkam. Ob Andrea ihn sich nicht mal ansehen wolle?
Das Herz war ihr übergelaufen, als sie den Jungen zum ersten Mal sah, ein abgemagertes Kerlchen mit verfilzten honigblonden Locken, das nur mit einer Windel bekleidet in seinem Gitterbettchen stand und mit großen blauen Augen den fremden Menschen entgegensah.
Rainer war von Anfang an fest entschlossen gewesen, das Kind in Pflege zu nehmen. Sie wurden eindringlich gebeten, sich diese Pflegschaft sehr gründlich zu überlegen. Drogenbabys seien nicht gerade einfach zu handhaben, das wussten sie aber beide ohnehin.
Eigentlich hätte Andrea lieber ein Mädchen gehabt, weil sie glaubte, dass die Bindung zwischen Mutter und Tochter enger sei als die zwischen Mutter und Sohn. Aber Rainer hatte immer einen Jungen gewollt. Für ihn gab es kein Zögern.
»Wer weiß, was wir uns damit antun«, hatte Andrea halbherzig versucht, einzuwenden, doch ihr Mann war davon überzeugt, dass dies ihr Kind sei. Ein Kind Gottes, von Ihm geschickt. Dass der Kleine Konstantin hieß wie Rainers früh verstorbener Bruder, hielt er für ein Zeichen.
»Ich meine, wir sollten es mit ihm versuchen«, sagte Rainer fest. »Hat nicht jedes Kind eine Chance verdient?«
Insgeheim hatte sie in der Folgezeit auf negative Zeichen gewartet, die auf Traumata in Konnys Vergangenheit hindeuteten, hieß es doch gemeinhin, die ersten Jahre eines Kindes seien prägend. Konstantin war nicht einfach, das nicht. Aber welches Kind war schon einfach? Besonders am Anfang hatte er viel geweint. Er war mit sämtlichen Fähigkeiten im Rückstand und zeigte die typischen Auffälligkeiten eines vernachlässigten Kindes. Als er ein wenig älter wurde, hatte er sich oft aggressiv verhalten, wobei auch manch wertvolles Stück in der Wohnung zu Bruch ging. Eine Meißener Vase, ein Erbe von ihrer Großmutter, hatte er während eines Wutanfalls einfach beiseite geschoben, sie war auf den Boden gefallen und in tausend Scherben zerbrochen, das hatte sie ihm lange nicht verziehen.
Dennoch begegnete sie diesem Kind mit viel Geduld, denn tief in ihrem Herzen hatte sie den Jungen als ihr Kind angenommen. Dass sie ihn adoptieren würden, stand außer Frage.
Man konnte förmlich beobachten, wie er sich entwickelte und aufblühte, wie er nach und nach sie beide als seine Eltern akzeptierte. Innerhalb kürzester Zeit holte er sämtliche Defizite auf. Sie konnten stolz sein auf sich und auf Konny. Dieses Gefühl dauerte bis heute an.
Im Nachhinein gesehen war dies die beste Entscheidung ihres Lebens gewesen. Wenn man von ein paar Dummejungenstreichen absah, wie sie im Grunde jedes Kind ausheckt, hatte Konstantin ihnen keine größeren Probleme bereitet. Und heute war er ein hübscher junger Mann, der auf sein Äußeres achtete und mit Erfolg das Gymnasium besuchte. Ein noch nicht ganz fertiger Mann, der sensibel war und sich gut in andere einfühlen konnte. Sein Haar war ein wenig dunkler geworden, und seine Locken waren vollkommen herausgewachsen. Er war hilfsbereit und zuvorkommend und war genau der Sohn, den Andrea sich gewünscht hatte. Was machte es da schon, dass er nicht ihr eigen Fleisch und Blut war?
Sie glaubte fest daran, dass Konny es im Leben zu etwas bringen würde. Und nun hatte er eine Freundin. Sie freute sich für ihn.
»Ist es mit dem Mädchen was Ernstes?«, fragte sie.
Er grinste sie ein wenig frech an. »Ach, Mama. Was du alles wissen willst.« Dann schwieg er wieder und widmete sich weiter dem Gemüse.
Sie holte den Wok aus dem Schrank.
»Britta bekommt ein Kind«, sagte er plötzlich, dennoch klang es beiläufig.
Ihr fiel fast der Wok aus der Hand. »Was? Von dir?«
Wieder lachte er. »Das hab ich mir gedacht, dass du das sofort fragst. Nein, nicht von mir. Aber vielleicht ist es dann doch meins, sozusagen. Ich stell mir das jedenfalls schön vor, für so ein kleines Würmchen zu sorgen.«
Sie stellte den Wok auf die Herdplatte und setzte sich zu ihm an den Tisch. »Weißt du, was du dir da auflädst, Konny?«
Obwohl ihr sehr vieles durch den Kopf ging, hielt sie sich mit moralisierenden, warnenden Kommentaren zurück.
Er sah kurz zu ihr auf und hob die Schultern. »Ich liebe sie.«
»Und seit wann?«
»Zwei Monate. Vielleicht auch drei. Wir kennen uns schon länger.«
»Und wie weit ist die Schwangerschaft?«
»Vierter Monat.«
Sie atmete tief durch. Bloß vernünftig bleiben, sagte sie sich. Sachlich argumentieren. Damit kommt man weiter als mit unbedachten Emotionen. »Du bist 17«, sagte sie. »Du hast weder einen Schulabschluss noch eine Ausbildung. Du hast das Leben noch vor dir. Willst du dich wirklich mit einer schwangeren Frau belasten, die zudem das Kind eines fremden Mannes austrägt?«
Er sah ihr tief in die Augen. »Das habt ihr doch auch gemacht, euch mit einem fremden Kind belastet. Und, hat’s geschadet?«
»Wir waren nicht 17.«
»Wenn das Kind auf die Welt kommt, bin ich volljährig.«
Sie ahnte, bei seinem Dickschädel war momentan jede Argumentation zwecklos. Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, zog er es kompromisslos durch. Auch wenn es offensichtlich nicht zu seinem Besten war. Also blieb ihr vorläufig nichts anderes übrig, als seine Entscheidung zu akzeptieren. Vielleicht würde er mit der Zeit vernünftig.
3
Er setzte sich in seinen Wagen und starrte auf das Fenster der Wohnung im ersten Stock, in der er sich bis vor Kurzem aufgehalten hatte. Es begann zu nieseln. Winzige Tröpfchen bildeten nach und nach einen Schleier auf der Windschutzscheibe.
Ohne dass er es wollte, hörte er das Kind schreien. Ich will nicht weg. Schick mich nicht weg, bitte, bitte. Ich will hier bleiben, bei euch. Ich mach’s auch nie wieder. Ich verspreche dir alles. Ich tu alles, was du von mir verlangst.
Weg damit. Bloß weg damit. Das Echo in seinem Kopf dröhnte überlaut. Er presste beide Handflächen gegen seine Ohren, rieb sich die Schläfen. Diese verdammten Kopfschmerzen. Und dieses anschließende Gesumme, das ihn immer dann überfiel, wenn er es am wenigsten erwartete.
Er starrte durch den Nieselschleier hindurch auf die menschenleere Straße. Wo waren denn alle? Es war helllichter Tag. Sollte da nicht wenigstens eine Menschenseele sichtbar sein? Heftig überfiel ihn das Gefühl, von allem Vertrauten getrennt zu sein. Überflüssig, weggeschoben. Dagegen musste man sich wehren.
Scharf zog er die Luft durch die Nase.
Plötzlich war der Gedanke aufgetaucht. Das, was stillgelegt und eingezäunt tief in seinem Inneren ruhte, erwachte zu neuem Leben. Genährt durch Bilder von Menschen, die seine Familie waren, und von einem Kind, das in einsamen Nächten laut vor sich hinschluchzte. Das war in einem anderen Leben. Um nichts in der Welt hatte er sich daran erinnern wollen.
Seine Gesichtsmuskeln waren angespannt. Seine Kiefer mahlten. Wieso wurde er das einfach nicht los?
Hatte er zu spät erkannt, dass das gewaltsam herbeigeführte Vergessen nichts anderes war als eine Selbsttäuschung?
Schon früh hatte er geahnt, dass er anders war. Anders als andere Kinder. Unruhiger, nervöser. Und natürlich hatte er gemerkt, dass er überall aneckte, nicht nur zu Hause. Er hatte sich redlich bemüht, so zu sein, wie er glaubte, dass es von ihm erwartet wurde. Er hatte eine Rolle gespielt. Und das andere, von dem man ihm zu verstehen gab, dass es nicht richtig war, versuchte er, tief in sich zu verschließen. Es wegzudrängen, wenn es die Oberhand zu gewinnen trachtete. Nicht immer funktionierte diese Strategie, auch, weil dieses andere, von dem man sagte, es sei das Dunkle, Böse, ihm stets strahlend erschien. Heller, wirklicher, faszinierender als das sogenannte Gute. Doch das hätte er nie im Leben irgendjemandem mitgeteilt.
Wie lange konnte man eine Rolle spielen? Sich als Schauspieler gebärden? Warum musste er gerade jetzt daran denken?
Er war sich nicht sicher, ob diese aufwühlenden Gedanken und das Gefühl der Einsamkeit etwas mit Jessica zu tun hatten. Vielleicht war sie nur der berühmte Tropfen, der genügte, um das Fass zum Überlaufen zu bringen.
Er sah ihr ernstes Gesicht vor sich. Reden wollte sie. Über ihre Beziehung. Wie es weitergehen solle mit ihnen beiden. Wie er sich das alles vorstelle. Wie lang soll ich noch warten?Wann willst du dich endlich entscheiden?Ich bin dieses Hinhalten so leid.
Im Grunde war es immer dasselbe mit den Weibern. Dieses Gequatsche von Hochzeit, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich und zufrieden. Wusste er doch nur zu gut, wie solche Dinge wirklich endeten.
Unwillkürlich lachte er auf, als er daran dachte, was aus seiner Wunschvorstellung von einem entspannenden Vormittag mit erregenden Spielchen geworden war. Reden! Noch nicht einmal Sex hatten sie gehabt.
Was hatte er von Jessica erwartet? Sie war eine Rassefrau, unabhängig, so hatte er angenommen. Anders als andere Frauen. Ihm ebenbürtig, ein raffiniertes Weib, das sich nicht getreu nach der Norm verhielt. Das zirpte und flötete und genau wusste, wie man ihn in Ekstase versetzte. Das bereit war, sich an Grenzen zu wagen, Neuland zu betreten. Und ihn ansonsten in Ruhe ließ und keine Forderungen stellte.
Wie eine Fremde war sie ihm heute vorgekommen mit ihren kleinbürgerlichen Träumen.
Ich stell es mir so schön vor, ein Kind mit dir zu haben.
Augenblicklich hatte er zugemacht. Doch sie ließ nicht locker. Ihm war gar nichts anderes übrig geblieben, als ihr ein Märchen zu erzählen und den Spieß umzudrehen. Seine Frau bekäme ein Kind, hatte er behauptet. Insofern sei seine Entscheidung längst gefallen. Worauf ihn Jessica fassungslos angesehen hatte. Dann hatte sie ihre ganze Wut herausgelassen und getobt. Richtig außer sich war sie.
»Du hast mich die ganze Zeit nur benutzt!«, hatte sie ihm entgegengeschleudert. »Und ich Idiotin habe geglaubt, du meinst es ernst.«
Ein Weib, das zur Hyäne wurde. Wieder mal. Er hätte es wissen müssen.
Er öffnete das Handschuhfach und suchte nach einer Kopfschmerztablette, fand aber nur einen leeren Blister.
Mist!
Jemand klopfte an die Scheibe, machte ein Zeichen, er solle das Fenster herunterlassen. Was will der Depp von mir? Er schüttelte unwillig den Kopf, sah auf die Uhr. Schon so spät. Längst sollte er auf dem Weg zur Arbeit sein. Ohne den alten Mann weiter zu beachten, drehte er den Schlüssel im Zündschloss um, trat aufs Gas und brauste davon.
4
Mit einem spitzbübischen Lächeln streckte Elias den Fuß aus, und prompt fiel seine kleine Schwester hin. Das Geschrei, das danach folgte, war markerschütternd.
»Elias! Du sollst deine Schwester nicht ärgern!« Dorothee steckte den Kopf zum Zimmer herein. Sie war gerade beim Essenkochen. Diese Kinder! Sie seufzte. Manchmal waren sie wie kleine Welpen. Übermütig, man wusste nie, wann es noch Spaß war und wann alles in Ernst umschlug. Schließlich konnte sie ihre Augen nicht überall haben.
»Ich hab sie nicht geärgert.« Elias verschränkte die Arme vor der Brust.
»Doch!«, schrie Lucia, krebsrot im Gesicht.
Dorothee ging zu der Kleinen hin, hob sie auf und küsste ihr sanft die dicken Tränchen von den Wangen. »Ist ja gut«, murmelte sie. »Mama kocht dir was ganz Leckeres.«
»Eli soll nix kriegen«, motzte sie und zog einen Flunsch.
Dorothee lachte auf. »Willst du denn, dass dein Bruder verhungert?«
Trotzig nickte die Kleine.
»Nun komm mal mit in die Küche. Willst du mir zugucken?«
Sofort veränderte sich Lucias Gesichtsausdruck. Eifrig folgte sie ihrer Mutter mit Trippelschrittchen in die Küche.
Dorothee setzte sie in den Hochstuhl. Sie hörte, wie ihr Sohn den Fernseher im Wohnzimmer einschaltete. Normalerweise protestierte sie. Aber gut, sollte er die kurze Zeit, bis sie mit dem Essen fertig war, fernsehen.
Schnell briet sie das Hackfleisch an, gab klein geschnittene Zwiebeln, Knoblauch und Gemüse dazu. Tomatenmark, frische Kräuter und etwas Brühe rundeten das Ganze ab. Dazu Reis. Das war das Lieblingsessen der Kinder. Das gab es mindestens einmal in der Woche.
»Elias, komm. Essen ist fertig.«
Der Junge kam in die Küche geschlurft.
»Hunger«, sagte Lucia und trommelte auf ihr Tablett.
»Du brauchst erst das da.« Elias band seiner Schwester ein Lätzchen um. »Damit du dich nicht schmutzig machst«, erklärte er mit ernster Miene. Dann setzte er sich auf seinen Platz.
Er kann so fürsorglich sein, dachte Dorothee. Und im nächsten Augenblick bringt er mit seinem Verhalten seine Schwester zur Weißglut. Aber so waren Geschwister nun mal. Jeder in ihrer Bekanntschaft bestätigte ihr, dass dies vollkommen normal sei.
So ganz konnte Dorothee da nicht mitreden, sie war als Einzelkind aufgewachsen. Viele Freunde hatte sie nicht gehabt und nicht selten fühlte sie sich als Außenseiterin. Michael war ebenfalls ein Einzelkind, doch er war derjenige von ihnen beiden, der viele Kinder wollte. Sie lächelte, als sie daran dachte, dass er von einer kleinen Fußballmannschaft gesprochen hatte. Das wusste sie wohl zu verhindern. Ihr hätte eines genügt. Zwei waren auch ganz nett. Aber nun war Schluss.
Lächelnd schöpfte Dorothee Reis und Hackfleischsoße auf die Teller. »Guten Appetit.« Alle begannen zu essen.
»Schmeckt gut«, sagte Elias, und Lucia nickte eifrig. Ihr Mund war von rötlichen Essensspuren umrandet. Auch auf ihrem Lätzchen war einiges hängen geblieben.
Zum Nachtisch schälte Dorothee Äpfel und verteilte die Schnitze.
Dann schickte sie die Kinder hinaus in den Garten. Das Wetter war so schön, da war es eine Schande, wenn man den ganzen Tag im Haus blieb. Im Garten hatte Michael eine Schaukel und einen Sandkasten gebaut. Seit es die letzten Tage so heiß war, hatten sie ein aufblasbares Planschbecken aufgestellt. Ein richtiges kleines Paradies, dachte sie. Was hätte ich darum gegeben, hätte ich als Kind nur ein kleines Stückchen davon gehabt.
Eine Taube auf dem Nachbardach gurrte. Vielleicht ist das ein Liebesruf, dachte sie lächelnd. Durch die hohen Bäume schimmerte das Wasser der Mosel, in dem sich die Sonne spiegelte. Mit lautem Motorengeräusch fegte ein Schnellboot heran. Am Uferweg führten Spaziergänger ihre Hunde aus. Blieben stehen, hielten ein Schwätzchen.
Dorothee liebte dieses friedliche, beschauliche Leben. Nur einen Katzensprung vom Fluss entfernt. Oft ging sie mit den Kindern spazieren, sie fütterten Enten und Möwen und winkten den Ausflugsschiffen. Was für ein Segen, dass sie dieses Haus gefunden hatten, das einigermaßen erschwinglich war.
Sie und ihre Familie wohnten noch nicht lange hier, aber schon jetzt konnte sie sich nicht mehr vorstellen, in einem der Wohnblocks zu leben, mit maroden Spielplätzen auf magerem Rasen und aufgereihten Mülltonnen an den hinteren Hauswänden. Sie war so froh, hierher gezogen zu sein. Stadtnah und dennoch fast wie auf dem Land. Hier konnten die Kinder unbehelligt spielen. Man musste sie nicht auf Schritt und Tritt bewachen. Das war ihr wichtig gewesen.
Sie selbst war in der Stadt groß geworden, in einer engen Dreizimmerwohnung ohne Balkon und Garten. Umso mehr genoss sie den großzügigen Raum, der ihr jetzt zur Verfügung stand.
Eigentlich war es Michaels Idee gewesen, dieses Haus zu kaufen. Aber sie hatte sich in dem Moment, als sie es gesehen hatte, sofort vorstellen können, hier zu leben. Sie taten sich zwar ein wenig schwer mit den hohen Kreditraten, zumal Michael in seinem Beruf als Altenpfleger nicht allzu viel verdiente und sie nicht mehr arbeitete, seit die Kinder da waren. Sie versuchte, ihren Beitrag zu leisten, indem sie die Anzeigenblätter, die kostenlos ins Haus flatterten, nach Sonderangeboten durchforstete und so sparsam wie möglich haushaltete. Später, wenn die Kinder etwas größer waren, konnte sie sicher wieder halbtags als Krankenschwester arbeiten. Wir werden es schon irgendwie schaffen, hatte sie gedacht.
»Guten Tag«, rief die Nachbarin vom Zaun her. »Ist es nicht wunderschön heute?«
»Ja«, bestätigte Dorothee. Auch das war nett: dieser unkomplizierte Umgang miteinander. Bianca Zöllner lebte mit einem dunkelhäutigen Mann zusammen, der Arzt an einem der hiesigen Krankenhäuser war. Dorothee wusste nicht, ob sie verheiratet waren. Jedenfalls standen zwei unterschiedliche Namen an der Klingel. Aber das war schließlich deren Sache. Die 17-jährige Tochter des Mannes, ein sehr nettes, aufgeschlossenes Mädchen, hatte sich zum Babysitten angeboten. Heute Abend sollte Georgina zum ersten Mal beweisen, ob sie mit den beiden zurechtkam.
Dorothee wollte gerade auf die Nachbarin zugehen, da hörte sie das Telefon klingeln. Sie wies bedauernd auf die Terrassentür. »Ich muss rein!«
Die letzten Meter rannte sie. Atemlos riss sie den Hörer von der Gabel und meldete sich.
»Hallo, mein Schatz«, sagte Michael. »Wo hab ich dich denn hergeholt? Du klingst ja ganz außer Atem.«
»Ich war draußen im Garten. Was gibt’s denn?«
»Ich wollte nur sagen, dass ich heute Abend in Ochtendung bin«, sagte er.
»Was machst du denn in Ochtendung?«, fragte sie verdattert.
»Da wohnt doch der Dieter. Er will heute seinen Geburtstag nachfeiern. Da hat er mich und noch ein paar andere Kollegen eingeladen.«
»Och nein!«, rief sie enttäuscht. »Nicht ausgerechnet heute. Wir wollen doch ins Theater.«
Endstation Sehnsucht. Sie hatte regelrecht darauf gebrannt, das Stück auf der Bühne zu sehen, das sie früher in der Schule durchgenommen hatten, und von dem sie damals so begeistert gewesen war.
»Oh. Das hab ich ganz vergessen.« Er klang zerknirscht. »Kann man die Karten nicht umtauschen? Ich meine, ich hab’s dem Dieter jetzt versprochen.«
»Ich weiß nicht, ob das geht. Dann muss ich ja auch noch der Babysitterin absagen.«
»Hm. Das tut mir wirklich leid.«
»Musst du da unbedingt dabei sein?« Sie konnte sich nur vage an einen Arbeitskollegen namens Dieter erinnern. Viel erzählt hatte Michael von ihm nicht. Aber das hieß nichts. Er war überhaupt ein stiller, zurückhaltender Mensch.
»Schatz. Du weißt doch, wie das ist. Jedes Mal klappt es nicht, weil immer einer nicht kann. Und heute können endlich alle.«
»Außer dir.«
»Ist das Theater denn so wichtig?«
»Du weißt, wie sehr ich mich drauf gefreut hab. Wo wir doch kaum weggehen.«
»Kannst du nicht jemand anderen mitnehmen?«
»Heißt das etwa, du hattest gar nicht vor, mit mir ins Theater zu gehen?«
»Jetzt mach mal halblang. Normalerweise wäre ich mitgekommen. Aber da der Dieter jetzt feiert …«
»Ja, schon gut. Dann feier eben.« Sie legte auf. Die beschwingte Stimmung war schlagartig umgekippt. Wieso hatte er nicht gleich gesagt, dass er eigentlich nicht ins Theater wollte? Dann hätte sie erst gar nicht die Karten besorgt und die Babysitterin bestellt. So dicke hatten sie es auch wieder nicht.
Von draußen ertönte Geschrei. Lucia war hingefallen. Seufzend lief sie auf die Kleine zu. »Hast du damit was zu tun?«, fragte Dorothee ihren Großen. Der tat entrüstet. »Die ist ganz allein von der Schaukel runtergefallen.«
»Aua!«, schniefte Lucia und zeigte auf ihr Knie. Es war nur ein Kratzer. Dorothee beugte sich darüber und blies über die Wunde. »Heile, heile Gänschen«, sang sie. »Wird bald wieder gut. Kätzchen hat ein Schwänzchen …« Lucia lachte und vergaß ganz schnell ihren Schmerz.
Die Nachbarin hielt sich noch immer im Garten auf. Mit ihrer Tochter auf dem Arm ging Dorothee bis an den Zaun.
Bianca Zöllner sah hoch. »Na, du kleine Maus«, sagte sie. »Freust du dich, dass die Gina nachher kommt?«
»Tja«, sagte Dorothee, »mein Mann hat mir grade abgesagt. Ich glaube, Gina braucht nicht zu kommen.«
»Wie? Du hattest dich doch so auf den Theaterabend gefreut.«
Dorothee zuckte mit den Schultern. »Es ist ihm was dazwischengekommen. Eine Feier mit Kollegen. Ich bin ganz schön sauer.«
Bianca betrachtete Dorothee nachdenklich. »Also, wenn du eine Begleitung brauchst: Ich komm gern mit. Ich hab heute Abend nichts vor.«
»Ehrlich?« Dorothees Gesicht hellte sich auf. »Damit würdest du mir einen sehr großen Gefallen tun.«
»Aber gern doch. Und selbstverständlich übernehme ich den Preis für die Karte.«
Dorothee spürte, wie sie rot wurde. War es so offensichtlich, dass sie sparen musste? »Nein, nein«, wehrte sie ab. »Ich bin ja froh, dass jemand mit mir kommt.« Sie wollte noch etwas hinzufügen, doch dann schüttelte sie den Kopf und lächelte.
5
Sein Mund war wie ausgetrocknet. Die Anspannung hatte nicht nachgelassen. Der ganze Tag war stressig gewesen. Er hatte sein Bestes gegeben. Hatte seine Rolle gespielt wie immer. Doch nun war endlich Feierabend. Er riss die Autotür auf und setzte sich hinters Steuer.
Das elende Luder spukte ihm noch immer im Kopf herum. Er verstand selbst nicht, wie es Jessica gelungen war, ihn derart durcheinanderzubringen. Sogar während der Dienstzeit hatte sie angerufen, immer dann, wenn es am allerwenigsten passte. Mehrmals war er einfach nicht ans Telefon gegangen und als er einmal doch abnahm, hatte sie ihn übel beschimpft. Die gab überhaupt keine Ruhe mehr. Was hatte er sich da nur für eine Laus in den Pelz gesetzt? Die Kopfschmerzen hatten auch nicht nachgelassen. Er fühlte sich beschissen.