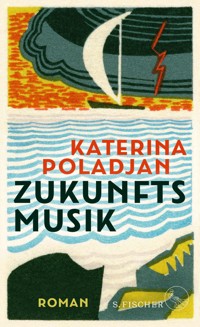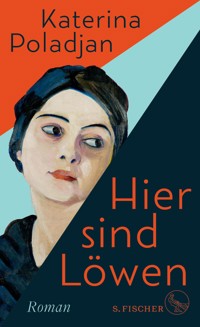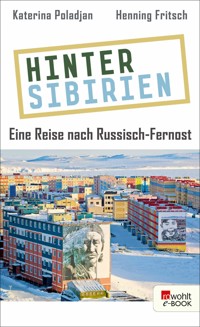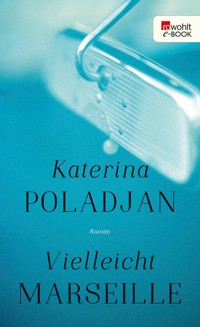19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein alternder Filmregisseur, eine bröckelnde römische Villa und eine Psychoanalyse, die aus dem Ruder läuft: In Katerina Poladjans neuem Roman »Goldstrand« erzählt ein Mann um sein Leben An der bulgarischen Schwarzmeerküste entsteht in den 1950er Jahren ein Ferienort: Goldstrand, geplant als Platz an der Sonne für alle. Auf der Baustelle wird Eli gezeugt. Sechzig Jahre später hat er seine größten Erfolge als Filmregisseur längst gefeiert und liegt auf der Couch seiner Dottoressa in Rom. Er mutmaßt und fabuliert seine Familiengeschichte, die durch ein ganzes Jahrhundert und quer über den europäischen Kontinent führt, von Odessa über Konstantinopel und Warna in Bulgarien bis nach Rom.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Katerina Poladjan
Goldstrand
Roman
Über dieses Buch
An der bulgarischen Schwarzmeerküste entsteht ab den 1950er Jahren ein Ferienort: Goldstrand, geplant als leuchtende Vision eines erreichbaren Platzes an der Sonne für alle. Auf der Baustelle wird Eli gezeugt. Sechzig Jahre später liegt er auf der Couch seiner Analytikerin in Rom. Er erinnert, mutmaßt und fabuliert seine Familiengeschichte, die durch ein ganzes Jahrhundert und quer über den europäischen Kontinent führt. Was also tun mit den uneingelösten Versprechen der Vergangenheit?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Katerina Poladjan lebt als Schriftstellerin in Berlin. Ihre Prosa wurde vielfach ausgezeichnet und ist in zahlreiche Sprachen übersetzt. Der Roman »Hier sind Löwen« war nominiert für den Deutschen Buchpreis und wurde mit dem Nelly-Sachs-Preis und dem Trophées littéraires des Nouvelles d’Árménie ausgezeichnet. Der Roman »Zukunftsmusik« war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und erhielt den Rheingau Literatur Preis sowie den Chamisso-Preis. Katerina Poladjan war Stipendiatin der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom. »Goldstrand« ist ihr sechster Roman.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Für diese Ausgabe:
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Heilmann Andreas und Hissmann Gundula, Hamburg
Coverabbildung: Jane McDevitt/Maraid Design
ISBN 978-3-10-491659-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
I
II
III
IV
V
VI
VII
Anmerkung
Danksagung
Für Helge
I
Also. Es beginnt in Odessa am frühen Morgen eines Herbsttages des Jahres 1922. Eine junge Frau, ein Mann und ein kleiner Junge kommen die Potemkinsche Treppe herunter. Der Junge geht an der Hand der Frau und nimmt jede Stufe mit einem Sprung. Schnitt. Wir sind an Deck eines Passagierdampfers. Die junge Frau löst sich von der Hand des Kindes, gibt dem Mann ein Zeichen und drängt durch die Menge zur Reling. Silbrig und ruhig ist das Meer. Möwen kreisen. Lichter blinken im Morgennebel. Auf der Reede liegen seriöse Dampfer, verständigen sich mit Leuchtsignalen. Die Kamera folgt der jungen Frau auf dem Schiff achtzig Minuten lang. Der Tag vergeht, und es wird Abend. In der Kabine wechselt die junge Frau auf dem Schiff einige Worte mit dem Mann, wünscht dem Jungen eine gute Nacht, geht dann in den Salon. Es wird gestritten, getrunken, geweint, gelacht. Die junge Frau tritt wieder hinaus. Auf dem Achterdeck ist sie allein, schaut auf den weißen Schaum des Kielwassers, dann in die Dunkelheit, wo die Lichter von Odessa längst verschwunden sind. Sie legt die Hände auf die Reling, schwingt ein Bein darüber, der Fuß findet Halt. Dann das andere Bein. Sie zögert. Sie springt. Das Stampfen der Dampfmaschine dröhnt, dumpfer als noch Augenblicke zuvor. Sie taucht auf. Das Dröhnen ist nun leiser, verschwindet dann ganz. Was bleibt, ist sanftes Plätschern. Das ist der Film.
Das ist der ganze Film?
Ich habe Preise dafür bekommen.
Haben Sie eine Erklärung, warum die junge Frau ins Wasser gesprungen ist?
Eskapismus, würde ich sagen. Aber das ist nur eine Vermutung.
Und sie war Ihre Tante?
Vera, ja.
Ihr kleiner Bruder Felix erwachte am nächsten Morgen und verstand gar nicht, was vor sich ging. Passagiere und Mannschaft waren in Aufruhr, und als Felix seinen Vater Lew nach der Schwester fragte, ließ der ihn einfach stehen, setzte die Suche nach Vera fort vom Maschinenraum bis zur Messe. Dabei stand ihm das letzte Bild vor Augen, das er von seiner Tochter hatte, wie sie ihn lächelnd an der Schulter berührte und sagte, sie gehe nach oben an Deck, es sei ihr in der Kabine zu stickig, sie brauche frische Luft.
In Konstantinopel angelangt, bezogen Vater und Sohn eine schäbige Absteige. Stunde um Stunde brütete Lew über Seekarten. Er zog eine gerade Linie über das Schwarze Meer von Odessa nach Konstantinopel und markierte den Küstenbereich, der dieser Linie am nächsten lag. Er rechnete sich aus, dass dies die Gegend sein musste, die Vera nach einem Sprung ins Wasser am ehesten erreicht haben könnte. Sie wurde abends gegen elf Uhr zuletzt gesehen. Im Salon.
Woher wissen Sie das?
Das stelle ich mir so vor. Und ich habe recherchiert. In einem deutschen Baedeker-Reiseführer von 1905 werden für die 844 Seemeilen lange Passage von Odessa nach Konstantinopel rund dreißig Stunden veranschlagt. Abfahrt von Odessa am Morgen. Nach fünfzehn Stunden Fahrtzeit, um elf Uhr am Abend, wurde Vera noch einmal gesehen. Und die Hälfte der Strecke liegt ungefähr auf Höhe des markierten Bereichs, die Gegend um die Stadt Warna in Bulgarien. Dort wollte Lew seine Tochter suchen. Er würde seine Tochter finden, und wenn sie tot wäre, würde er sie bestatten und an ihrem Grab um sie weinen. Dieser Plan ließ ihn weiteratmen, während er nächtelang schlaflos dalag, sein Sohn Felix an seine Seite geschmiegt und ringsum das Ächzen und Wimmern der anderen Exilierten in der Gemeinschaftsunterkunft. Viele hofften, bald zurückkehren zu können, denn der Irrsinn musste ja irgendwann ein Ende haben. Doch je mehr Zeit verstrich, je düsterer die Nachrichten waren, die aus der Heimat zu ihnen drangen, umso mehr schwand die Hoffnung.
Wenn Lew sich über Karten beugte, saß Felix zu seinen Füßen und spielte mit kleinen Steinen. Am Abend vor der Abreise hatte er ein Stück Zuckerbrot geschenkt bekommen, das ihm über den Abschied von Haus und Freunden hatte hinweghelfen sollen. Teilst du mit mir, hatte Vera ihn gefragt. Felix aber hatte den Kopf geschüttelt, sich das ganze Zuckerbrot auf einmal in den Mund gestopft und sich daran verschluckt. Das geschieht dir recht, hatte Vera lachend gesagt, worauf Felix sie zur Hölle wünschte. Er stampfte mit dem Fuß und schrie: Piff! Paff! Hinfort mit dir für immer! Töricht, wie Kinder sind, sah er nun die Schuld an Veras Verschwinden bei sich, konnte aber seine Seelenqual nicht mit dem Vater teilen, zu groß war seine Angst, dass dieser ihn seinerseits zur Hölle schicken würde.
Doch selbst, wenn Felix versucht hätte, mit dem Vater zu sprechen, wäre er kaum zu ihm durchgedrungen, denn die Suche nach seiner Tochter besetzte Lews Geist derart, dass sie wenig später wieder ein Schiff bestiegen, um von Konstantinopel nach Warna zu gelangen. Das Gepäck und den kümmerlichen Rest seiner Bibliothek hatte Lew an Landsleute verkauft und mit dem Erlös einen Beamten bestochen, der ihm und Felix auch ohne gültige Pässe einen Platz auf dem Dampfer verschafft hatte. Von Warna aus gingen sie zu Fuß weiter – Lew kräftig ausschreitend, Felix mit seinen kurzen Beinen tapfer hinterher – entlang der Küste nach Norden. Lew hatte einen Seesack mit dem Nötigsten geschultert, Felix trug ein Bündel mit den wenigen Büchern, von denen Lew sich niemals trennen würde, und hatte sich Veras Sommerhut mit dem blauen Band aufgesetzt. Lew konnte den Anblick schwer ertragen, aber als er versuchte, dem Kind den Hut abzunehmen, schrie und heulte Felix, also ließ Lew ihn gewähren. Sie schliefen am Strand. Wenn es kalt wurde, machte Lew ein Feuer. Bis zum Winter würden sie eine Unterkunft finden. Bis zum Winter war es noch eine Ewigkeit. Wenn Felix an feuchten Herbstabenden über die Kälte klagte, fragte Lew: Wie viele Jahrtausende schon leben Menschen in der Natur und mit der Natur? Wie viele Jahrtausende bedecken wir unsere Körper mit Häuten und Rinden? Darauf hatte Felix keine Antwort. Er fürchtete sich vor dem Vater, der vollständig verwandelt war. Lew reckte die Arme zum Himmel und rief: Wer bin ich? Was bin ich geworden? Felix betrachtete ihn und war still.
Schließlich errichteten sie eine einfache Hütte in einem Wäldchen, gelegen an einem einsamen Strand. Diese Arbeit entfachte ungeahnte Kräfte in Felix, mit Feuereifer half er beim Sägen und Schichten, sammelte Schilfgras für das Dach, und mehr als einmal verhinderte er mit wachem Blick folgenschwere Fehler des zerstreuten Vaters.
Wenn sie in der Hütte abends auf ihren Matten lagen, hörten sie das Meer. Wenn sie morgens erwachten, sahen sie das Meer. Jeden Tag unternahmen sie Expeditionen entlang der Küste, mal nach Norden, mal nach Süden. Mit einem Stock, den Lew immer bei sich trug, hob er gestrandete Fischernetze an, rollte Steine beiseite, stocherte in Vertiefungen im zerklüfteten Fels, wo sich Wasser gesammelt hatte. Dabei fanden sie allerhand Nutzloses und Nützliches, bleiche Knochen von Seevögeln, ein Brett mit starken Eisennägeln. Wen sie auch fragten, so viele Steine Lew auch umdrehte, nirgends fand sich ein Hinweis auf Vera.
Lew begann, Fische zu fangen und Körbe zu flechten. Die Körbe verkauften sie auf dem Markt in der Stadt. Im Wald fanden sie eine aus dem Nest gefallene Eule, nahmen sie mit und zogen sie auf. Als die Eule kräftig genug war, flog sie davon, kam aber Nacht für Nacht wieder, saß auf dem Baum vor der Hütte. Felix sprach viel mit der Eule und bildete sich ein, sie wäre seine verschwundene Schwester, die in veränderter Gestalt zu ihnen zurückkehrte.
Felix musste Schreiben, Lesen und Rechnen lernen. Lew unterrichtete ihn jeden Tag bis zum Mittag. Mit sieben Jahren beherrschte Felix Grundlagen der Algebra, malte kyrillische und lateinische Buchstaben und spielte passabel Schach. Sie unterhielten sich über die Planeten, das Universum und die Philosophie der Verzweiflung, die Lew zuerst verlacht hatte, die er aber angesichts der Erfahrungen, der schicksalhaften Verbiegung ihres Lebensweges in den vergangenen Monaten, neu für sich entdeckte. Der Mensch könne nicht aufhören, sich mit nutzloser Metaphysik und anderen garstigen Fragen zu quälen, etwa der Frage, warum Gott seine treuesten Knechte martert, wie der Fall Hiob zeige. Der Mensch werde aber diese Paradoxie niemals auflösen können und bleibe schlussendlich staunend darüber zurück, dass nur in der Absurdität das Sein zu erklären sei.
Wenn Lew Felix unterrichtete, fühlte er sich wieder wie der Professor im Hörsaal, der sich über mangelnde Leistungen ärgert, sich über Scherzworte und Fortschritte der Studenten freut. Die Jugend war aus Lews Gesicht gewichen, und sein Bart war zu einer stattlichen Länge gewachsen, er sah aus wie ein Eremit. Wenn ich zu kauzig werde, musst du mich schütteln, ermahnte er seinen Sohn ein ums andere Mal.
Mehr als zwei Jahre lang führten sie dieses karge und einsame Leben. Der Kampf ums Dasein zwang sie unweigerlich, die Suche nach Vera zu vernachlässigen, Woche um Woche wurden ihre Expeditionen kürzer.
Der Strand lag ungefähr auf halber Wegstrecke zwischen zwei Städten, denen die alten Griechen die Namen Odessos und Dionysopolis gegeben hatten. Odessos hieß zu jener Zeit Warna – wie auch heute wieder, nachdem es für einige Jahre opportun erschienen war, die Stadt Stalin zu nennen. In Warna lernte Lew an einem Markttag einen Mann kennen, der sich an seinen Körben interessiert zeigte. In einem seltsam kehligen und singenden Russisch setzte der Mann Lew auseinander, er brauche nicht einen oder zwei Körbe, sondern dreißig, und fragte, wie schnell Lew diese liefern könne. Lew erschrak, denn die geforderte Menge überstieg seine Kapazitäten bei weitem, dennoch überließ er Felix die Aufsicht über den kleinen Marktstand und ging mit dem Herrn in ein Café, um den Handel zu besprechen. Dort stellte der sich als Jules vor, er sei Schweizer und ehemaliger Gartenarchitekt des russischen Zaren und habe nun von der rumänischen Königin den Auftrag erhalten, im nahen Baltschik, der Stadt des griechischen Weingottes, einen Garten rund um ein neu zu errichtendes Sommerschloss anzulegen. Die Königin habe einen extravaganten Geschmack, das Schloss werde orientalische und balkanische Züge tragen, und an die Ausstattung des Gartens habe sie entsprechend exklusive Ansprüche. Nun sei ihm beim Anblick der schönen Körbe, die Lew feilbot, in den Sinn gekommen, die kapriziösen Setzlinge exotischer Pflanzen darin zu ziehen, um sie im Falle allzu starker Sonnenstrahlung oder heftigen Regens leicht an einen sicheren Ort verbringen zu können.
Lew war längst überzeugt, dass er es mit einem Aufschneider oder Verrückten zu tun hatte, und hob abwehrend die Hände, es sei ihm leider unmöglich, in angemessener Zeit eine solche Menge von Körben anzufertigen. Der Schweizer lehnte sich zurück, nestelte an seiner Uhrenkette und betrachtete Lew. Sie sind ja auch kein Korbflechter, sagte er schließlich mit feinem Lächeln.
Ich habe Philosophie gelehrt.
Und wo wohnen Sie jetzt?
Wir leben in einer Hütte am Strand.
Und der Junge?
Ist mein Sohn.
Geht er zur Schule?
Ich unterrichte ihn.
Ist er klug?
Der Klügste.
Der Schweizer beugte sich vor. Kommen Sie mit mir. Ich habe in Baltschik ein großes Haus zur Verfügung, Sie gehen mir zur Hand und der Junge geht zur Schule.
Um seine neue Stelle als Korbflechter und Hilfsgärtner der rumänischen Königin in Baltschik anzutreten, mussten Lew und Felix erneut eine Landesgrenze überschreiten, denn die Gegend nördlich von Warna, die südliche Dobrudscha, gehörte damals zu Rumänien.
Ohne Pässe?
Der Schweizer wird sich um Pässe gekümmert haben.
Und Lew hat diese neuerliche Wendung in seinem Leben, die doch bedeutete, die Suche nach seiner Tochter vollends aufzugeben, umstandslos hingenommen?
Er tat es um der Zukunft seines Sohnes willen. Vielleicht hoffte er auch, an der Küste der Dobrudscha auf eine Spur zu stoßen.
Gut, fahren Sie fort.
Das Zimmer, das Lew und Felix im Haus des Architekten bewohnten, war klein, aber es hatte französische Fenster, es gab ein Bad, und die Küche stand ihnen offen. Nach dem entbehrungsreichen Leben am Strand schwelgten sie im Reichtum. Felix ging zur Schule, nachmittags half er dem Vater im Garten, wenn dieser ihm nicht bestimmte Lektüren auferlegte, weil er die Schulbildung als unzureichend erachtete. Dann beschnitten sie gemeinsam Bäume und Sträucher, zupften Unkraut, lockerten den Boden, säten, wässerten, legten Früh- und Winterbeete an oder assistierten bei der Pflanzung neuer Bäume, wie der eines Kolchischen Buchsbaums, der umständlich und mit exzentrischem Aufwand verbunden vom Kaukasus nach Baltschik transportiert worden war. Abends führte Lew Felix in die Grundlagen von Latein und Altgriechisch ein. In den wenigen Mußestunden, die dem Jungen blieben, nahm er Stift und Papier und zeichnete: Pflanzen, Bäume, die Küstenlinie, das Schloss von allen Seiten und aus allen Perspektiven. Mal zeichnete Felix am Hang sitzend das Bauwerk schräg von oben, dann von unten, gesehen von der Uferpromenade, das Schloss hoch aufragend. Ein andermal zeichnete er es halb verdeckt, wenn er sich hinter Buschwerk verborgen hielt und die geometrischen Konturen des Gebäudes mit dem zittrigen Wirrwarr der Blätter rahmte.
Als Felix vierzehn Jahre alt wurde, zeigten sich Veränderungen in seinem Wesen. Er scheute die gemeinsamen Abende, war missgestimmt, wenn Lew Vorträge über die Sophisten hielt. Gewisse Gewohnheiten des Vaters konnte er kaum mehr ertragen, wenn der sich zum Beispiel den Zeigefinger ins Ohr bohrte, als wolle er etwas eindrehen. Auch die Furchen auf der Stirn des Vaters lösten bei Felix Gefühle aus, die ihm unheimlich waren. Wo kam nur diese Scham plötzlich her, wer hatte sie ihm eingehaucht? Manchmal ging Felix die Strandpromenade entlang und schämte sich – einfach nur, weil es ihn gab. Das Schwarze Meer ertrug geduldig, wenn er wütend Steine ins Wasser warf.
Eines Tages erklomm er im weitläufigen Schlossgarten eine Steineiche und versteckte sich im dichten Blätterwerk. Er beschloss, nie wieder auf die Erde hinabzusteigen.
Die Königin nannte den Garten ihr stilles Nest, und in den Abendstunden wandelte sie oft allein zwischen exotischen Pflanzen und labyrinthisch angelegten Hecken. Ihr Gatte, König Ferdinand I. von Rumänien, war vier Jahre zuvor gestorben, und seither verbrachte sie viel Zeit mit ihrem Liebhaber im Sommerschloss.
Felix erblickte sie, und die Königin erblickte ihn zwischen den Zweigen, ließ sich die Entdeckung aber nicht anmerken. Sie trug eines ihrer selbst entworfenen Kleider, ein schlichtes weißes Gewand und einen Turban nach Art der Beduinen. Wie zu sich selbst sprach sie: Bäume sind so fest, so ruhig, so selbstsicher.
Ich steige nie wieder herab, entfuhr es Felix.
Und wenn ich Ihnen eine Montgolfière schicke?
Was ist eine Montgolfière?
Das ist ein Heißluftballon, aber ich finde Montgolfière klingt viel schöner. Sie könnten ein herabhängendes Halteseil ergreifen und sich davontragen lassen. Würden Sie das wollen, für immer auf und davon?
Ich weiß nicht. Wie wollen Sie das überhaupt machen, eine Montgolfière schicken?
Ich bin die Königin, sagte die Königin.
Das klingt etwas märchenhaft, meinen Sie nicht?
Stört Sie das?
Eigentlich nicht. Fahren Sie fort.
Felix stieg vom Baum herunter, fügte sich in sein Leben und wuchs zu einem jungen Mann heran. Mit Vollendung seines achtzehnten Lebensjahres schloss er die Schule ab, und nun galt es, in die Welt zu gehen und dem Vater Lebewohl zu sagen. Felix wollte in die große Stadt, er wollte nach Sofia an die Universität, um Architektur zu studieren.
Er wohnte in einem Studentenwohnheim und meinte, nun, da er der väterlichen Traurigkeit entronnen war, könnte er sich selbst begegnen. Die Begegnung mit sich selbst war ihm aber weniger fruchtbar als erhofft, und ihm kam der Verdacht, dass es zur Selbstbegegnung der Begegnungen mit anderen bedurfte. Statt sich jedoch an geselligen Runden zu beteiligen, versenkte er sich in Lektüre zur Architekturgeschichte und Übungen im technischen Zeichnen. Es gab ein peinliches Missverhältnis zwischen ihm und der Welt.
Zwei Jahre nachdem Felix zum Studium nach Sofia aufgebrochen war, starb die rumänische Königin, und weitere zwei Jahre später wurde die Gegend mit dem Vertrag von Craiova an Bulgarien zurückgegeben. Die Welt um Lew geriet ein weiteres Mal ins Wanken und zerbrach. Er verlor seine Arbeit und sein Obdach. Nach sechzig Lebensjahren, von denen er die letzten zehn mit schwerer körperlicher Arbeit zugebracht hatte, fürchtete er sich vor der Rückkehr in die Strandhütte, und doch war es ihm lieber, dort allein zu hausen, als ein Außenseiterdasein in der Stadt zu führen.
Die Hütte stand also noch?
Sie wird in den Jahren etwas gelitten haben.
Und Felix?
Zufall, geschicktes Lavieren, laut verkündete Neutralität, wechselnde Allianzen – die schwer zu entwirrenden Fäden der Zeitläufte – führten dazu, dass Felix sein Studium im Jahr 1942 bravourös abschließen konnte, ohne dass Bulgarien oder Felix bis dahin vom Krieg sonderlich in Mitleidenschaft gezogen worden waren. Mit dem Diplom in der Tasche bekam Felix eine Stelle in einem Büro für statische Berechnungen, das er allerdings am 11. Januar 1944 von einer Fliegerbombe zertrümmert vorfand. Er entfloh der Bedrohung, die der Krieg nun doch zu bedeuten schien, und zog wieder zum Vater an den Strand. Obwohl er längst an das Leben in der Stadt gewöhnt war, fand er bald wieder in den alten Rhythmus der Gemeinsamkeit mit dem Vater zurück, ein Rhythmus, der von den Stimmungen des Vaters und vom unberechenbaren Taktstock der Winde und des Wetters dirigiert war. Während die Welt und Europa im Begriff waren unterzugehen, lauschten Lew und Felix auf den Regen oder saßen an langen Sommerabenden vor der Hütte und spielten Schach.