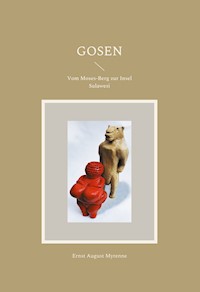
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ein religionshistorisches Sachbuch, das sich im Grenzbereich zwischen Gläubigkeit und genesiskritischer Erörterung bewegt und ferner die Höhlenmalerei auf der Suche nach einer Gottesidee beschreibt und interpretiert. Es versucht die Entstehung der Göttlichen Welt auf historische Füße zu stellen. Gosen ist ein Land im Nildelta, in dem sich Ereignisse von Weltrang abspielten. Hier beginnt der Auszug der Israeliten aus Ägypten. Damit ist es ein Kristallisationspunkt der biblischen Kulturgeschichte. Dass Gott viel älter als die Bibel ist, lässt sich einfach belegen. Dazu gehört die hypothesenreiche Erörterung über die historisch nicht belegbare Schöpfungsgeschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Einleitung
Schöpfergott – verschiedene Religionsverständnisse
Schöpfung als Evolution
Grundlagen
4.1 Glaubwürdigkeit der Geschichtszahlen
4.2 Das Fehlen von frühen Schriftzeugnissen
Entwicklung der abrahamitischen Religionen
5.1 Der Geburtsort von Abraham
5.2 Abrahams frühe Wege
5.3 Wo lag das Paradies?
Entwicklungen in Ägypten
6.1 Die Hyksos
6.2 Echnaton
6.3 Die Wirkung von Echnatons Aton-Religion
6.4 Moses
6.5 Auszug aus Ägypten
6.6 Jahwe, der Gott der Israeliten
Einfluss der Zeit vor Abraham
7.1 Städte in Anatolien – Entwicklung der Genesis
7.2 Sintflut und Vulkanismus
7.3 Exkurs zu den frühen Kulturen Anatoliens
7.4 Göbekli tepe
7.5 Zuschüttung der Tempelstadt am Göbekli tepe
Religion und Kunst in der Steinzeit
Steinzeitkulturen in Europa
9.1 Die großen Epochen der Steinzeit
9.2 Die Entdeckung der Steinzeithöhlen in Europa
9.3 Jäger und Sammler
9.4 Schöninger Speerfunde
9.5 Wohnplatz Bilzingsleben – Leben um 400.000 bis 350.000
9.6 Neandertaler und Homo sapiens
Wichtige Marginalien
10.1 Astronomische Bedingungen der Eiszeit
10.2 Schmuckbedürfnis der Steinzeitmenschen
10.3 Beispiel Venus von Willendorf
10.4 Steinzeitliche Vorformen der Musik
10.5 Skulpturale Steinzeitkunst
10.6 Behausungen des Homo sapiens
10.7 Bedeutung der Höhlen
10.8 Stellenwert der Sexualität
Deutungen
11.1 Sind Konflikte in Religionen immanent?
11.2 Schamanismus in der Steinzeit
11.3 Darstellung eines Schamanen in der Höhle von Lascaux
11.4 Bildanalysen
11.5 Religiöse Einflüsse in der Höhlenkunst
Afrika
12.1 Entwicklungen in Afrika und Indonesien
12.2 Felsbildkunst in der Sahara
12.3 Die Tuareg im Tassili-n-Ajjer
12.4 Felsbilder im Gilf-n-Kebir
12.5 Ausstrahlung der Felsbild-Kunst von der Sahara nach Brasilien
12.6 Einfluss des afrikanischen Homo sapiens auf Südwesteuropa
12.7 Ist Marokko die Wiege unserer Kultur?
Epilog
Literatur
1 Einleitung
Es geht um die Entwicklung des Menschen, um seinen prähistorischen und frühbiblischen Frühling. Man nimmt an, dass die Erde vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden ist. Der Zeitpunkt der Entstehung der Sonne, die wir umkreisen und von der die Erde ihre Energie hat, ist durch Modelle der Astrophysik erklärbar. Das Phänomen des Urknalls hat der Theologe Georges Lemaître erstmals 1927 formuliert. Die Wissenschaft geht dabei von einem Zeitpunkt des Big-Bang-Ereignisses um 13.8 Milliarden aus. Kongenial hat der amerikanische Astronom Edwin Hubble erklären können, dass sich der gesamte Kosmos nach dem Big Bang auch heute noch ständig ausdehnt.
Der nachfolgende Text soll weniger eine Erörterung, sondern ein religionsgeschichtliches Sachbuch über die prähistorischen und frühbiblischen Kulturen sein. Es möchte keineswegs die physische Welt betrachten, sondern die frühen Gottesideen in den abrahamitischen „Biblischen Geschichten“ und weiter zurück in der Höhlenmalerei.
Es soll erkennbar werden, dass Gott viel älter ist als die Bibel. Aus dem Blickwinkel der abrahamitischen Religionen gilt die Idee, das konkrete Alter von Gott aufspüren zu wollen, als eine unzulässige Fragestellung. Die Bibel erklärt unverrückbar und abschließend, dass Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit existiert und keinen Anfang und kein Ende hat. In der Sure 112 des Korans heißt das sinngemäß: „Allah ist nicht gezeugt und Allah zeugt nicht.“
Es geht nicht um ein konkretes Alter unseres christlichen bzw. abrahamitischen Gottes, es geht um den Beginn der Suche nach einer Gottesidee. Wir können uns heute mithilfe der archäologischen Funde erstes Leben in der Altsteinzeit vor vielen Millionen Jahren vorstellen, aber wir kennen in unserer westlichen Welt nur den Gott, den Abraham um 2500 bis 2000 vor Chr.= bc in unsere Geschichte eingeführt hat. Es geht um die These, dass es lange vor ihm Gottesideen gegeben haben muss.
Nach dem Stand der Wissenschaft gibt es keinen Beleg über Abraham. Wir behandeln aber in diesem Beitrag getreu der Heiligen Schrift die biblische Figur Abraham, als ob sie einen historischen Kern hätte. Jedenfalls gingen die hebräischen Gelehrten eineinhalb Jahrtausende nach Abraham im Rahmen der ersten gründlichen Überarbeitung des Pentateuchs, der fünf Bücher Moses, im babylonischen Exil auch von einer glaubhaften Historizität des Erzvaters aus. Das soll heißen, sie nahmen dieses mit einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit an. Der Theologe und Historiker John Barton dagegen ordnete in seinem Werk „Die Geschichte der Bibel“ (2019) zum Beispiel sogar die großen Taten von David und Salomo als „ziemlich romanhafte Ausschmückungen“ und weniger als „echte historische Informationen“ ein.
Der erste Teil dieses Buches skizziert den Komplex der alttestamentarischen Religionsgeschichte von Abraham bis in die Jetztzeit. In den weiteren Kapiteln werden die Höhlenmalereien und die Suche nach möglichen Spuren einer Gottesidee thematisiert, nicht nur in den Bildern und Skulpturen, sondern auch in den Symbolen und Zeichen. Neben den religiösen Implikationen in den Höhlenbildern werden die altsteinzeitlichen Funde von Schöningen und Bilzingsleben in das Thema einbezogen. Es gibt dort Zeugnisse von frühen Steinzeitmenschen, die höchstwahrscheinlich auch schon von einer uns unbekannten Gottesidee mitgeprägt wurden.
Am Schluss wird versucht, eine Brücke zu schlagen zu den Felszeichnungen in Afrika, speziell zu den gemalten oder gravierten Felsbildern in der Sahara. Ferner dürfen wir die jüngsten Entdeckungen in der indonesischen Inselwelt nicht unerwähnt lassen. Sie geben erste deutliche Hinweise auf die besondere Wichtigkeit für die Jagd von großen, aber ungefährlichen Tieren für die frühen Menschen.
2 Schöpfergott – verschiedene Religionsverständnisse
Gab es bei der Entstehung unseres Planeten einen Schöpfergott, der die Erde mit ihren komplexen physikalischen und biologischen Gesetzen geschaffen sowie dem Menschen Geist und Leben eingehaucht hat, der auch für alle Geschöpfe verantwortlich ist und der, so man diese prinzipiell akzeptiert, die Evolution gesteuert hat?
War der Gott unserer Erde ein Urgott oder eine Urgöttin? In den drei abrahamitischen Religionen (Judentum, Christentum, Islam) war Gott ein „Herr“-Gott, obwohl man in Abrahams Stammland zwischen Euphrat und Tigris eine Frau, die Urmutter Inanna, für die Schöpferin der Welt gehalten hat. Inanna war die Göttin der Liebe und Fruchtbarkeit sowie die weibliche Zentralfigur der sumerisch-mesopotamischen Götterwelt. Ihre Ausstrahlung dürfte wohl eher von sanfter Natur gewesen sein. Auch in der griechischen Theogonie, der Entstehung der Götter nach Hesiod (geboren um 700 bc) wird die Erdgöttin Gaia als die Urmutter der Götter eingeführt. Es gab jedoch sogar schon in vorgriechischer Zeit, ein halbes Jahrtausend vor Hesiod eine Urmutter, die Kornmutter Demeter, deren Kult im 13. Jahrhundert bc in Mykene beheimatet war.
In der Frühgeschichte wurde wahrscheinlich eine Götterwelt bei den meisten Völkern als zwar existierend, aber nicht fassbar angenommen. Wir müssen erklären, was wir unter Gott oder dem Göttlichen verstehen. Nach dem Theologen und Publizisten F.P. Schaller können wir „Gott als ein übernatürliches Wesen, das über eine naturwissenschaftlich nicht beschreibbare und transzendente Macht verfügt“ verstehen. „Das Göttliche ist nicht die Summe der Eigenschaften Gottes. Das Göttliche können wir als religiösen Namen für den transzendenten Horizont der menschlichen Erfahrung und Erkenntnis“ verstehen („Die Evolution des Göttlichen“, 2006). Transzendenz bedeutet hier das, was jenseits der Erfahrung, des Kognitiven und des Gegenständlichen vorstellbar ist. Gottesidee meint die geistige Vorstellung bzw. das Urbild von einer nicht real erklärbaren, transzendenten Macht.
Aufgabe der Religion ist es, den Menschen das Unergründbare und das Unbedingte von Gott zu vermitteln. Die Religion soll die unterschiedlichen Weltanschauungen, deren Grundlage der jeweilige Glaube an bestimmte transzendente Kräfte ist, einbeziehen.
Einleitend sollen in diesem Beitrag die biblische Schöpfungsgeschichte, die Genesis und der Exodus kritisch hinterfragt werden. Die Mitglieder anderer religiöser Welten, wie die Kreationisten mit all ihren unterschiedlichen Facetten oder die vielen Anhänger der evangelikalen Konfessionen mögen einiges davon anders sehen. Es lässt sich nicht vermeiden, dass man dabei die Menschen, die fest an die buchstäbliche Wahrhaftigkeit und Exaktheit der biblischen Schöpfungsgeschichte glauben, zu heftigem Widerspruch provoziert. Doch nicht zuletzt hat der große christliche Kirchenlehrer Augustinus (354 bis 430) schon früh auf eine kritische Betrachtung der Genesis Wert gelegt.
Wenn Wissenschaftler vertreten, dass Teile des Alten Testaments „ziemlich romanhafte Ausschmückungen enthalten“ (J. Barton), dann sollte man sich einer Entzauberung dieser biblischen Schriften nicht verschließen.
Ein frühes Zeugnis einer buchstäblichen Auslegung der Bibel ist die zeitliche Fixierung der biblischen Geschichte durch den irischen anglikanischen Primas James Ussher. Er hat um 1655 ausgerechnet, dass die Welt am 5. Oktober 4004 bc erschaffen worden sei. Die Arche Noah hätte am 5. Mai 2348 bc auf dem Berg Ararat aufgesetzt.
Diese Daten der Welterschaffung für wahr zu halten ist heute in der von der Wissenschaft dominierten Welt nicht vertretbar. Die Schöpfung gilt als ein langer und bis heute anhaltender Prozess. Man kann die Erkenntnisse der Aufklärung und die bahnbrechenden wissenschaftlichen Leistungen zum Beispiel der Paläoanthropologen oder genialer Physiker wie Einstein nicht durch die falsch interpretierten Welterklärungsversuche der Bibel wegwischen.
Bischof Usshers Rechnung über die Welterschaffung ist völlig jenseits aller heutigen Geschichtskenntnisse. Die Jahreszahl der Landung der Arche Noah kommt zwar keineswegs der Wahrheit, jedoch anderen Berechnungen relativ nahe. Mittels der Bibeldaten errechnet Paul G. Zint in seinem Werk von 2016 zur „Chronologie der Bibel“, dass das Ende der Sintflut mit 2578 bc anzunehmen ist. Auch dieses Datum wurde nur auf Grund der Bibeldaten errechnet und ist nicht durch andere Ereignisse, auch nicht ansatzweise, belegbar. Die Sintflut der Bibel und ihre Vorgeschichte hat es so nicht gegeben, sie ist nur metaphorisch zu verstehen. Mittlerweile weiß man, dass eine Vielzahl von ähnlichen Mythen und Legenden in anderen Ländern und zu anderen Zeiten aufgetaucht sind.
3 Schöpfung als Evolution
Gott, das Göttliche, wie auch die Religionen sind Evolutionen. Ein Wesensmerkmal der Evolution ist es, dass zur selektiven Weiterentwicklung der belebten Natur (das Beste überlebt) ein weiteres Element gehört. Zusätzlich greift die Evolution in ihrem Prozess durch nicht vorhersehbare Mutationen, d.h. durch dauerhafte Veränderungen des Erbguts, in den Fortschritt ein. Der große Kirchenlehrer Pierre Teilhard de Chardin (1881 bis 1955) vertrat die These, dass die Schöpfung noch nicht abgeschlossen sei. Gott hätte demnach als Creator Spiritus den Rahmen geschaffen, innerhalb dessen sich die Evolution vollzog. Die Evolution ist als Methode der Schöpfung zu verstehen.
Es stellt sich die Frage, ab wann es für die Frühmenschen, d.h. für Menschen ab dem Homo erectus, eine Idee von einem Gott gab. Es muss einen Anfang für einen mythologisch-religiösen Überbau des Lebens gegeben haben.
Ab wann gab es Menschen, die mehr als kognitiv denken konnten und deren Gedanken sich nicht nur mit dem alltäglichen, notwendigen Daseinskampf beschäftigten? Für die wichtige Fähigkeit, Emotionen zu entwickeln, brauchte der Frühmensch ein bestimmtes Gehirnvolumen. Er musste sich folglich weiterentwickeln. Geistige Fähigkeiten und Emotionalität sind Voraussetzung für eine Gottesidee. Als Frühmenschen kann man sich Wesen vorstellen, die immerhin schon Werkzeuge herstellen und das Feuer beherrschten konnten.
Der Homo erectus musste den aufrechten Gang annehmen, um die lebensbedrohlichen Feinde, die sich im Gras der Savannen anschlichen, rechtzeitig wahrnehmen zu können. Nur dann hatte er eine Chance zur Flucht oder um sich für einen Überlebenskampf zu wappnen.
Anthropologen haben festgestellt, dass die dem Menschen am nächsten liegenden Wesen, die Schimpansen, beim Anblick von Feuer nicht wie andere Tiere blindlings davonrannten, sondern ein besonnenes Verhalten zeigten und das Feuer beobachteten, um über die Fluchtwege zu entscheiden. Das war ein großer Schritt von der Angst hin zur genaueren Erfassung von Gefahren und dem Erkennen von Möglichkeiten, die das Leben retten konnten.
Der Homo erectus, wahrscheinlich auch seine Vorgänger, kannten schon die adrenalinausschüttenden, lebensbedrohlichen Konfrontationen, die ihm Todesangst bereiteten und ihn dann blitzschnell hoffen ließen, dass es etwas unerklärbar Großes, eine Macht gäbe, die seinen Tod verhindern konnte.
Wir sollten bei der Erforschung der Anfänge und des frühen Weges der abrahamitischen Religion die Ideen und das Wirken des ägyptischen Pharaos Amenophis IV, besser bekannt als Echnaton, einbeziehen. Mit ihm beginnt ein konstitutioneller Monotheismus, der bis heute unsere Religionen wesentlich bestimmt. Ferner interessieren uns die aus Kanaan und Syrien in Ägypten eingewanderten Völker der Hyksos. Sie bereiteten den Boden vor für Moses und den Auszug des Volkes der Israeliten aus Ägypten. Damit beginnt die Geschichte des Volkes der Hebräer.
Besonders grundlegend wäre es, etwas über das Gottesbild der Generationen zwischen Noahs Sohn Sem und Abraham zu erfahren sowie über Kulturen und Lebenswelt der vorbabylonischen Völker. Dort können wir versuchen, Einflüsse auf die kulturell-religiöse Entwicklung des Patriarchen zu finden.
Das Thema Schöpfung als Evolution verlangt über den Ursprung der Evolution zu forschen. Die Genesis beginnt mit einem Szenario von der Welt. Es könnte entwickelt sein von einem Kreis um Abraham, vielleicht gemeinsam mit einer Gruppe von weisen Denkern und Erzählern.
Aus diesem Szenario in der Genesis erfahren wir, dass die Welt wüst und leer war und der Geist Gottes über den Wassern schwebte. Das ist ein großartiges literarisches Bild (1.Moses 1,2). Es sollte von Ewigkeit zu Ewigkeit gelten.
4 Grundlagen
4.1 Glaubwürdigkeit der Geschichtszahlen
An dieser Stelle ist ein Hinweis auf die Glaubwürdigkeit und Qualität der frühen Jahreszahlen und Zeiträume erforderlich. Die prähistorischen Geschehnisse müssen, wenn auch nicht exakt belegbar, so doch mindestens glaubhaft, das heißt mit hoher Wahrscheinlichkeit wahr sein. Einige halbwegs gesicherte Jahreszahlen kann man durch Vergleiche mit geschichtlich belegten Ereignissen in benachbarten Völkern oder Königreichen ermitteln, so wie sich z.B. die Jahreszahlen der biblischen Figur Moses auch mit der ägyptischen Geschichte korrelieren lassen.
Es gibt ein erstes, in Stein gemeißeltes Zeugnis über das Volk Israel auf dem 2 m hohen und 45 cm breiten „Schwarzen Obelisken“, der aus der Zeit des Assyrerkönigs Salmanassar III stammt, welcher von 858 bis 824 bc regierte. Der Stein wurde in Nimrud im nördlichen Irak gefunden. Ein ähnlich alter nichtbiblischer Hinweis auf die Existenz des Volkes Israel wurde in einer Siegesinschrift des Pharao Merenptah auf einer ägyptischen Stele gefunden, die aus dem 9. Jahrhundert bc stammt.
Die Daten gewinnt man u.a. mittels der C14-Kohlenstoffisotopen-Bestimmung: Jede organische Substanz von Pflanzen, Menschen und Tieren hat zu Lebzeiten das Kohlenstoffisotop C14 aufgenommen. An dem Verfall dieses Isotops kann man den Tod dieser organischen Substanz feststellen. Das gilt auch für die kleinsten organischen Holzkohle- und Farbreste aus den Steinzeithöhlen.
Seit 2012 ist man in der Lage, für die Datierung von Stalaktiten aus Höhlen oder von Calcit-Überzügen der Höhlenbilder die Uran-Thorium-Datierung einzusetzen. Die hat den radioaktiven Zerfall von Uran-Isotopen messbar gemacht. Mittlerweile gibt es in diese Richtung weitere Verfahren von Isotopenbestimmungen.
Ferner kann man durch eine Thermolumineszenz-Datierung bei gebrannten Artefakten (Keramik, gebrannter Ton, Ziegel) in einem physikalischen Verfahren das Alter näherungsweise bestimmen. Dabei wird durch die Messung der Veränderung der Farbe von Wärmestrahlen beim Erhitzen des Materials ermittelt, wann die letzte starke Erhitzung stattgefunden hat. Man kann diese Methode auch anwenden bei den Steinen, die im oder nahe beim Feuer in Steinzeithöhlen oder an Felsüberhängen (Abris) gelegen haben.
Um die C14-Kohlenstoffisotopen-Bestimmungen und andere Datierungen sicherer zu machen und zu kalibrieren, benötigt man noch weitere Vergleichsverfahren, wie etwa die Dendrochronologie (Baumringdatierung). Dabei vergleicht man die unterschiedlichen Entwicklungen der Jahresringe bei den Holzfunden und wertet sie digital aus.
Die steinzeitlichen Daten können selten punktgenau sein, sie beziehen sich auf Zeitabschnitte oder Epochen. Ferner sind seit einiger Zeit Altersermittlungen auf Grund der Herstellungsverfahren von Steinwerkzeugen und Waffen möglich. Aus der Art der Herstellung von gefundenen Werkzeugen oder Artefakten – besonders aus der Altsteinzeit – können Rückschlüsse auf den Bearbeitungszeitpunkt gezogen werden - ferner lassen sich bei Metallen, wie bei Bronze, Eisen und Gold aus der Zusammensetzung recht genaue Fundorte und Bearbeitungsdaten ablesen.
Mittlerweile kann man mit Hilfe anderer Wissenschaften weitere Daten ermitteln. Durch Verfahren der Geologie oder der Biologie werden eine Reihe von resistenten Mikroresten in Stäuben und Sedimenten sichtbar gemacht, zum Beispiel von Mikrofossilien, Pollen, Pilzsporen oder versteinerten Tier-Exkrementen. So können Wissenschaftler aus den Pollendiagrammen die Entwicklungen von Leben oder Klimaperioden ableiten.
Durch eine ganze Palette von überzeugenden Datierungsmöglichkeiten kann man die Daten großer Ereignisse aus längst verflossenen Kulturen zeitlich zuordnen. Die ständig wachsende Genauigkeit ermöglicht es, die Geschichtszahlen aus dem für den Nichthistoriker oft nebulös erscheinenden Geschichtsraum in eine reale vergleichbare Welt zu überführen und glaubhaft zu machen.
ZEITTAFEL





























