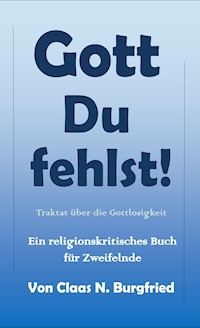
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Sind Sie gläubig? Diese Frage wurde mir von meinem Pfarrer kurz vor meiner Einsegnung gestellt. - Sie wurde natürlich allen in der Runde gestellt. - Die meisten sagten "ja". Als ich an der Reihe war, konnte ich nur "ich weiß nicht" antworten. Meine Antwort wirkte noch einige Zeit nach. Und eigentlich bis heute. Im Nachhinein vielleicht gar keine so schlechte Antwort. Auch wenn ich mit ihr damals recht alleine dastand. Aber kann denn jemand mehr sagen, als ´ich weiß nicht´? Ob es Gott gibt oder nicht, fragen sich sicherlich viele Menschen. Letzte Antworten kann niemand geben, denn weder seine Existenz, noch seine Nichtexistenz ist beweisbar - so eine anerkannte These. Und nun? Kann man in dieser scheinbar unentscheidbaren Situation etwas Überzeugendes und Annehmbares schreiben? Das Buch versucht es! Es sucht nach Anhaltspunkten, die es wahrscheinlicher erscheinen lassen, dass Gott eher ein Geschöpf des menschlichen Geistes ist, als dass es eine real existierende Kraft ist, die unsere Geschicke beeinflusst oder gar lenkt, denn wir tun das wohl eher selbst! Der Autor setzt sich mit einem humorigen Augenzwinkern mit diesem so persönlichen Thema auseinander und zieht einige durchaus überraschende Schlussfolgerungen. Vielleicht aber braucht man etwas Mut bei der Auseinandersetzung mit den eigenen Überzeugungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Claas N. Burgfried
Gott, Du fehlst!
Über das Buch
Sind Sie gläubig?
Diese Frage wurde mir von meinem Pfarrer kurz vor meiner Einsegnung gestellt. - Sie wurde natürlich allen in der Runde gestellt. - Die meisten sagten „ja“. Als ich an der Reihe war, konnte ich nur „ich weiß nicht“ antworten. Meine Antwort wirkte noch einige Zeit nach. Und eigentlich bis heute.
Im Nachhinein vielleicht gar keine so schlechte Antwort. Auch wenn ich mit ihr damals recht alleine dastand. Aber kann denn jemand mehr sagen, als ´ich weiß nicht´?
Ob es Gott gibt oder nicht, fragen sich sicherlich viele Menschen. Letzte Antworten kann niemand geben, denn weder seine Existenz, noch seine Nichtexistenz ist beweisbar – so eine anerkannte These.
Und nun?
Kann man in dieser scheinbar unentscheidbaren Situation etwas Überzeugendes und Annehmbares schreiben?
Das Buch versucht es!
Es sucht nach Anhaltspunkten, die es wahrscheinlicher erscheinen lassen, dass Gott eher ein Geschöpf des
menschlichen Geistes ist, als dass es eine real existierende Kraft ist, die unsere Geschicke beeinflusst oder gar lenkt, denn wir tun das wohl eher selbst!
Der Autor setzt sich mit einem humorigen Augenzwinkern mit diesem so persönlichen Thema auseinander und zieht einige durchaus überraschende Schlussfolgerungen.
Vielleicht aber braucht man etwas Mut bei der Auseinandersetzung mit den eigenen Überzeugungen.
Claas N. Burgfried
Gott, Du fehlst!
Traktat über die Gottlosigkeit
Ein religionskritisches Buch für Zweifelnde
Internetportal: https://www.Buch-Gott-du-fehlst.info
E-Mail: [email protected]
Facebook: Facebook.com/Claas.Burgfried
Mit 5 Abbildungen
© 2019 Claas N. Burgfried
1. Ausgabe
Umschlaggestaltung: Klaus Bergfeld
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44,
22359 Hamburg
ISBN Taschenbuch: 978-3-7497-9086-9
ISBN Hardcover: 978-3-7497-9087-6
ISBN e-Book: 978-3-7497-9088-3
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Heute mach ich mir mal kein Abendbrot, heut mach ich mir Gedanken!
Wolfgang Neuss (Kabarettist)
Gewidmet meiner Familie
Inhalt
Vorwort
Zum Aufbau des Buches
Einführung
Teil I
Das Interview
Einleitung
Überlegungen mit 15
Gottesbeweis?
Gott als Idee
Weg zur Wahrheit
Zu Titel und Untertitel
Wunsch nach Gott
Bibel und Unwissenheit
Limbus
Ockhams Rasiermesser
Atheistisches Christentum
Jesus und „Stille Post“
Wahre Bibel
Wegeners Eisbohrkerne
Bibel mit freundlichen Interpreten
Behinderung und Homosexualität
Glauben-Wissen-Tod
Lebenssinn
Seele
Zufall
Glauben wollen
Irritierende Wahrnehmung
Begrenzte Götterwelten
Glaubensweitergabe
Darwin und Zufall
Macht des Zufalls
Religion: Nur Zufall
Lebensentwürfe und Werte
Immer nur ein Mensch
Religion ist gut und böse
Konstruktivismus
Abschließendes zum Interview
Teil II
Was sich sonst noch ergab
Es geht um Wahrscheinlichkeiten!
Gott sagt
„Den Beistand Gottes erbeten“
Prolog
Beispiele
Was nun?
Wetten um Gott (Blaise Pascal)
Es ist ein Kreuz!
Schulmedizin und Religion?
Die eigene Meinung
Gedichte und Gedankenschnipsel
Blasphemie
Leider
Bitte mit Vorsicht!
Sokratische Überlegungen
Nahrung finden
Gott ist alles!
Und der Himmel weint nicht
Ich glaube!
Ungläubige Semantik
Vaterunser (ökumenische Fassung)
Ein weltliches „Vaterunser“
Assoziation
Zitat
Gott
Die Seele - 1
Die Seele - 2
Bedachte Konstruktion
Am Ende zählt nur die Überzeugung
Essenz
Demokratie-Index
Teil III
Schlussbemerkungen
Drei Bücher und Ockhams Handwerkszeug
Anhang
Personenregister
Stoff für Zweifelnde
Anmerkungen
Vorwort
Jetzt ist es doch ein Buch geworden, wenn auch ein kleines!
Ab 2010 fing ich an, meine Gedanken aufzuschreiben. In Abständen, oft in großen Abständen. So, wie es der Alltag zuließ - ich muss ja damit kein Geld verdienen – und wie es sich durch Anregungen gelesener Bücher, durch Gespräche im Freundeskreis, durch Kommentare in Zeitungen und Zeitschriften, durch Filme oder Berichte im Fernsehen ergab.
Einerseits tat ich das für mich, um die kreisenden Gedanken endlich aus dem Kopf zu bekommen und die inneren Dialoge zu verringern. Andererseits schon mit dem Gedanken, dass es auch für andere anregend und interessant sein könnte, darüber zu lesen, denn darüber machen sich viele Menschen Gedanken, egal, ob sie nun gläubig sind oder nicht, ob sie in einer Kirche organisiert oder irgendwann einmal ausgetreten sind. – Auch, wenn hinter den Zeilen kein bekannter und angesehener Autor steckt! Was sicherlich eine große Hürde für ein unbekanntes Buch ist.
Und was beschäftigte mich nun so stark, dass es mich bis heute nicht loslässt?
Gott – oder eben auch nicht Gott! … Ein bisschen verrückt, oder? …Was ist mit „Ihm“1?
- Gibt es ihn? - Gibt es ihn nicht? - Was machen Menschen mit ihm? Was macht dieses so flüchtige Wesen mit den Menschen? Immer wieder diese Fragen. Immer wieder: Kann das denn überhaupt sein? Zumal, wenn Milliarden von Menschen teils mit tiefer Inbrunst, teils mit mehr innerem Abstand daran glauben!
Warum stellen sich mir diese Fragen? Gute Frage! Ich weiß es nicht. Es könnte mir doch eigentlich egal sein!
Aber es schwirrten mir dazu in regelmäßigen Abständen Gedanken durch den Kopf: Im Kindesalter, als Jugendlicher oder dann im Erwachsenenalter! Der Impuls kam wohl am ehesten aus den Zweifeln - emotional, aber auch verstandesmäßig. Ich blieb dem ganzen Thema gegenüber immer ungläubig.
Während andere Menschen aus ihrem Glauben Halt und Sicherheit gewinnen, ja sogar detaillierte Leitlinien für ihr Verhalten im Alltag ableiten konnten, behielt ich ob der Grundlagen dieser Gefühle und Handlungsanweisungen immer meine Skepsis: Auf dieser Basis konnte ich meine Haltung, meine Emotionen und Werte nicht aufbauen.
Dabei darf man nicht verkennen, dass mit diesem Thema durchaus Angst einflößende Aspekte verbunden sind. So bleibt im Unklaren, welche Macht auf dieser immer unsichtbaren anderen Seite vorhanden sein kann: Die Einen reden von der unauslöschlichen und unerschütterlichen Liebe, die uns Menschen durch Jesus, als Gottes Sohn, entgegengebracht wird. Die Anderen schließen nicht aus, dass sie der Zorn Gottes in irgendeiner Form ereilen könnte, wenn sie sich nicht richtig, also gottesfürchtig und bibeltreu, verhielten. Wenn fehlendes Wissen und ein begrenzter Zugang zu Informationen hinzukommen, erhöht sich das Gefühl von Unsicherheit gegenüber dieser unbestimmbaren Macht umso mehr.
So empfand auch ich anfänglich Unsicherheit - jedoch nie Furcht - bezüglich der vermeintlichen und unsichtbaren Möglichkeiten, den unkalkulierbaren Einflussnahmen und unklaren Fähigkeiten dieses Geschöpfes. Oder sollte ich sagen, …dieses menschlichen Geschöpfes, nach dem es mir mehr und mehr auszusehen scheint?
Das ist mein Thema!
Sofern mich jemand auf dem Weg durch das Labyrinth der vielen Argumente, die dafür oder dagegen angeführt werden, begleiten möchte, dem biete ich dieses Büchlein an. Es behandelt das Thema ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Aneinanderreihung von Bibelstellen, aber mit vielen unterschiedlichen Aspekten sowie einem persönlichen Blick. Es pflegt keinen akademischen Diskurs, sondern orientiert sich in der Darstellung mehr an leicht nachvollziehbaren Formulierungen und Überlegungen und ist hoffentlich unterhaltsam.
Kommen Sie mit?
Oder auch Du?
Es würde mich freuen!
Das Buch orientiert sich nicht an Vorlagen.
Es ist, was es ist!
Claas N. Burgfried, Berlin 2019
Zum Aufbau des Buches
Hier folgt ein einleitender Text u.a. mit einigen etwas provokant formulierten Fragen, die im Interview zum Traktat und den Schlussbemerkungen behandelt werden.
Falls Sie schon die Informationen auf der Buchrückseite gelesen haben sollten, wissen Sie, dass es mit Interview und Traktat eine besondere Bewandtnis hat.
Im dann folgenden Teil mit der Überschrift „Was sich sonst noch ergab“ finden sich unterschiedliche Textformen, u.a. kleine Gedichte, glossenartige Texte, Aphorismen, Gedankenschnipsel, ein Gespräch zwischen zwei Zweiflern, dem einleitend einige Zeitungszitate vorangestellt sind, und der Versuch einer Bewertung von unterschiedlichen Glaubensansätzen durch weltliche Kriterien (Demokratie-Index).
Dieser Abschnitt wurde beim ersten Diskutieren im Familien- und Freundeskreis kritisch gesehen, weil er zu vieles Unterschiedliches nebeneinander stellt. Ich habe mich aber trotzdem dafür entschieden, die Texte im Buch zu belassen, gerade weil sie Einzelstücke sind. Sie haben sich über die Jahre ergeben und sind Ergebnisse der Auseinandersetzung mit dem Thema. Mir ist es lieber, das Eine oder Andere wird kritisiert, als dass ich auf diese Gedanken verzichten möchte.
Jeder Teil kann für sich gelesen werden.
Einführung
An einem schönen warmen Tag im Sommer 2015 heiratete meine ältere Tochter in einer spirituell inspirierten Zeremonie unter einem schattigen Baum in Brandenburg. Es war sehr feierlich, alle waren elegant gekleidet und die Pfarrerin hielt eine bewegende Rede.
Wir kennen uns schon recht lange. Sie hat über die Jahre traurige und erfreuliche Familienereignisse mit ihrer abwägenden Art zu predigen begleitet. Dieser Art der Glaubensauslegung konnte ich immer gut folgen, denn sie war undogmatisch.
So sagte sie am Ende ihrer Predigt bei unserer Familienfeier, dass es verständlich sei, wenn man Zweifel gegenüber dem Glauben habe - sie seien wichtig. Jedoch stehe am Ende dieser Zweifel – zumindest bei ihr – immer Gott.
Bei den vielen Glaubensfragen, die sich mir schon immer stellten, handelte es sich, so, wie ich ihre Predigten verstanden hatte, um ähnliche oder vergleichbare Fragen und Zweifel: Wie sind wir Menschen – unsere Art - entstanden? Wie die Welt? Was wird mit uns nach dem Tod geschehen? Was ist die Seele? Gibt es sie überhaupt?
Diese Fragen und die damit verbundenen Zweifel führten jedoch bei mir erst vage, dann mit den Jahren mit mehr Deutlichkeit in die entgegengesetzte Richtung. Vielleicht könnte man in der Zusammenschau beider Positionen von einer argumentativen Patt-Situation sprechen. Diese Überlegungen werden dadurch bestärkt, dass die Existenz Gottes wissenschaftlich nicht beweisbar ist: Weder seine Existenz, noch seine Nichtexistenz, da es grundsätzlich nicht möglich ist, etwas nicht Existierendes zu beweisen.
Trotzdem sollte damit die Diskussion über das Für und Wider der beiden Sichtweisen zu diesem Thema nicht beendet sein. Denn die Glaubensseite, so die religiösen Institutionen und deren Anhänger, bietet ein fast unüberschaubares Angebot an Darstellungen, Stellungnahmen und eben auch Behauptungen, die dazu anregen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen oder sie infrage zu stellen.
Wenn ein wissenschaftlicher Beweis nicht möglich ist, bleibt der Weg, die Auseinandersetzung über Wahrscheinlichkeiten zu führen. Dies eröffnet neue Chancen, sich dem Problem zu nähern: Wie wahrscheinlich ist Gott? Wie wahrscheinlich ist seine Existenz? Ist es möglich, dass allein der Glaube an Gott, ohne dass er tatsächlich existiert, eine hinlängliche Wirkung für Menschen haben kann?
Bei der in diesem Buch darüber geführten Auseinandersetzung sollen Anschaulichkeit und das Exemplarische der Darstellung im Vordergrund stehen.
So werden u.a. folgende Fragen behandelt:
• Wie viele Religionen und Glaubensrichtungen verträgt ein Gott?
• Können Eisbohrkerne die religiöse Zeitrechnung widerlegen?
• Kann ein Rasiermesser, in Gedanken verwendet, Fehler vermeiden?
• Ist die These, dass alles vorbestimmt sei, auch dann erträglich, wenn damit nicht nur Gutes, sondern ebenso alles Schlechte gesteuert würde? Und von wem?
• Ist das Leben ohne Gott sinnlos?
• Kann Darwins „Große Zahl“ die Schöpfung ersetzen?
• Hat das Beten einen Einfluss auf die Geschicke der Welt? Oder ist es möglicherweise eine Art autogenes Training?
• Können mit dem Spiel „Stille Post“ Erkenntnisse über das Leben von Jesus Christus gewonnen werden?
• Kann ein Placebo Gott widerlegen?
• Sind Religionen boshaft? Oder sind sie gut?
• Ist es sinnvoll, am Lebensende mit Pfeil und Bogen auf ein Schiff zu warten?
• Ist der Zufall ein Faktor, mit dem man rechnen sollte?
• Was hat Hitler mit meiner Existenz zu tun?
Trotz dieser etwas provokant formulierten Fragen soll die Achtung vor dem Glauben nicht infrage gestellt sein. Aber ist die Glaubwürdigkeit der religiösen Institutionen und der Geistlichen als deren Vertreter nicht von mannigfaltigen Skandalen erschüttert?
Der Missbrauch innerhalb der katholischen Kirche gehört zwar dazu, jedoch ist das kein Schwerpunkt dieses Buches. Die verlorengegangene Glaubwürdigkeit ist weniger in einem moralischen Sinne, als in einem logischen gemeint: Durch die Jahrhunderte gab es zu den Fragen der Menschen immer nur eine Begründung, egal, welchen Bereich es betraf: Gott ist die Ursache aller Dinge und Verhältnisse, so beispielsweise für die Entstehung der Erde und des Weltalls, der Natur und der Naturphänomene, für die Entstehung des Menschen und der Tiere, für das Verhältnis von Mann und Frau oder für die Situation nach dem Leben.
Jeder mögliche Einwand, jede kritische Bemerkung konnte mit einem Adjektiv beendet werden: Es ist „gottgewollt“.
Ist aber die Strahlkraft dieser Standard-Begründung für alles und jedes nicht über die Zeit verblichen, und die Begründung sogar oftmals widerlegt? Kann man an diesem „Gottgewollt“ immer noch festhalten und ist dieser Erklärungsansatz überhaupt noch dazu in der Lage, irgendetwas in der Welt ernsthaft verständlich zu machen? Oder scheint nicht - in einer zugespitzten Formulierung - die Würde des Glaubens eher verloren gegangen zu sein?
Mehr und mehr Anerkennung erhielten hingegen die Erkenntnisse der Natur- und auch der Geisteswissenschaften. Die tief im Religiösen verankerten Wissenschaftler z.B. der Renaissance mussten ihre göttlichen Glaubenssätze über Bord werfen, da diese scheinbar unumstößlichen „Wahrheiten“ im Widerspruch zu naturwissenschaftlichen Erkenntnissen standen und damit unhaltbar geworden waren. Durch diesen Umstand konnte jedoch auch etwas Neues entstehen: Denn hier, wo es um Wissenwollen, um die Suche nach Erkenntnis geht, kann belegt, aber auch verworfen werden. Es gibt eine Freiheit des Denkens: So kann Überkommenes durch Besseres ersetzt werden.
In der Religion scheint dies ausgeschlossen, da neue Erkenntnisse eher auszuschließen sind. Nur, wenn der Glaube Erkenntnisse der Wissenschaften zulässt, kann er sich erweitern - auch Kreationisten werden daran nichts ändern.
Wenn man sich mit dem Thema Glauben auseinandersetzt, gelangt man immer wieder zu ähnlichen Fragen. Eine von ihnen ist sicherlich, inwiefern die unterschiedlichen Religionen tatsächlich im Besitz der „letzten Wahrheiten“ über Leben und Tod sind? Halten sie einer kritischen Prüfung stand, oder sind sie bloße Behauptungen?
Viele Menschen haben den Wunsch, zu glauben, wenn es denn für sie überzeugend ist. Aber kann man dies „guten Gewissens“ noch tun? Denn man erwartet von einem gläubigen Menschen “Übernatürliches“ als wahr anzunehmen und - sich auch danach zu verhalten! Setzt das nicht aber unbedingt voraus, dass ein angemessenes Maß an göttlicher Authentizität der Bibelinhalte und anderer heiliger Schriften gewährleistet werden kann?
Ist das möglich, wenn man weiß, dass die Inhalte des Alten Testaments über Jahrhunderte nur mündlich überliefert worden sind und häufig sogar Inhalte aus älteren Kulturen, z. B. der Sumerer, verwendet wurden? Leider geben die Bibelschreiber diese Texte auch noch als bibeleigene Erzählungen aus. Heute nennt man das Übernehmen fremder Texte ohne Anmerkung zur Quelle ein Plagiat! Welche Gründe hatten die Urheber der heiligen Worte, so etwas zu tun?
Leider setzen sich diese Unklarheiten im Neuen Testament fort: Über Jahrhunderte der Recherche und Forschung haben es christliche Wissenschaftler bis heute nicht geschafft, ein vollständiges, historisch allgemein gültiges Bild von Jesu´ Leben entstehen zu lassen: Über seine Jugend weiß man nichts. Der Geburtsort ist unklar. War es Nazareth oder Bethlehem? Stimmt das Geburtsjahr tatsächlich mit den Angaben unserer Zeitrechnung überein? Oder war es 4 Jahre davor? Oder nochmals 3 Jahre früher? Unsere Zeitrechnung: ein Irrtum? Die Kreuzigung scheint gut dokumentiert. Aber die Auferstehung? Wurde er möglicherweise aus seinem Grab einfach entnommen und war nur „weg“, um weiter zu predigen? Dazu finden sich ausführliche Überlegungen im letzten Teil.
Bei meinen Recherchen zum Buch stieß ich auf einen Artikel des SPIEGEL von 1958, in dem der berühmte Theologe und Arzt Albert Schweitzer mit den Worten zitiert wird: „…Jesus von Nazareth, der als Messias auftrat,… hat nie existiert. Es ist eine Gestalt, die vom Rationalismus entworfen, vom Liberalismus belebt und von der modernen Theologie in ein geschichtliches Gewand gekleidet wurde.“ Dies schrieb er 1906 in seinem Standardwerk über die schon ca. 300 Jahre währende Forschung zum Leben Jesu. Schweitzer leugnet damit nicht Jesus’ Existenz, die ist belegt, jedoch das Bild, das von ihm entworfen wurde: Bleibt Jesus nur noch als eine Kultfigur bestehen?
Ich war von diesen Ergebnissen überrascht. Mit einer solchen Eindeutigkeit der Aussage hatte ich selbst nicht gerechnet. Aber wie reagieren Christen darauf? Kann man diese Informationen leugnen, ignoriert man sie, sagt man: „Stimmt schon, aber trotzdem…!“, oder gibt es eine Deutung, die in eine ganz andere Richtung weist?
Die Beantwortung dieser Fragen wäre sehr interessant, denn aus meiner Perspektive muss ein gläubiger Mensch recht viel hinnehmen, um seinen Glauben erhalten zu können!
Wäre nicht eine Überarbeitung und Aktualisierung auch im religiösen Sinne dringend geboten? Hilfreich könnte z.B. eine Theophanie sein, also eine direkte Ansprache eines Gottes an die Menschen, bei der alle Widersprüche und Ungereimtheiten aufgelöst werden würden! Aber kann das überhaupt geschehen? Zumal, wenn man nicht ohne weiteres ausschließen kann, dass Jesus nur eines natürlichen Todes gestorben sein könnte und damit die Wiederauferstehung nur noch in der Form einer wunderbaren Erzählung überlebt?
So sind wir weiterhin bei dem Für und Wider in Glaubensfragen von – man muss das wohl so sagen – fehlenden, unvollständigen bzw. fehlerhaften Unterlagen abhängig. Deren Vermittlung, egal in welcher Religion, ob Christentum, Judentum oder Islam, nur durch Menschen geschieht, die darüber reden. In absoluter Ausschließlichkeit!
So geht es bei diesen Überlegungen um die Frage, wer die Heiligen Schriften tatsächlich geschrieben hat? War es Gott selbst? Wurde Gott nur indirekt aktiv und führte die Feder der Verfasser oder waren es ausschließlich Menschen, die aus ihrem historischen Umfeld - und wohl durchaus auch mit religiösem Kalkül - in diesen Schriften ihre Gedanken, Hoffnungen und Absichten niedergeschrieben haben?
Dieses Problem wird an mehreren Stellen im Buch, zum Beispiel im Interview und den Abschlussbemerkungen, aufgegriffen. Weiter werden Themen wie William von Okhams „Rasiermesser“ und der Atheismus, der Einfluss des sozialen Umfeldes auf den Glauben, die Bedeutung des Konstruktivismus zur Erklärung religiöser Phänomene sowie das Verhältnis von Empathie und Moral auf der einen Seite und dem Atheismus auf der anderen behandelt.
Im Buchteil „Was sich sonst noch ergab“ finden sich Überlegungen, Gedichte und Gedanken zum Umgang mit Altgläubigen in Russland, zu Erkenntnissen der Schulmedizin und der möglichen Bedeutung für die Religion, einem weltlichen „Vaterunser“ und zum Versuch einer Gotteserklärung.
Das Buch wendet sich an „Zweifelnde“. Gemeint sind die Zweifelnden beider Seiten der imaginären Trennlinie von Gläubigen und Nichtgläubigen, die sich fragen: Kann es denn sein, dass Gott wirklich existiert? Die Einen mehr bejahend, die Anderen eher verneinend.
Ob das Thema selbst und die vielleicht eher unterhaltende und durchaus einmal mit einem „Augenzwinkern“ verbundene Art der Darstellung darüber hinaus auch Menschen interessieren kann, die sich bisher noch keine Gedanken dazu gemacht haben oder machen wollten, bleibt dabei eine offene Frage.
Mein Ziel war es, ein Buch zu schreiben, das nicht vorzeitig aus der Hand gelegt wird, weil es der jeweils eigenen Position des Lesers nicht entspricht, auch wenn von mir eine religionskritische Haltung vertreten wird.
Es ist mir bewusst, dass niemand einfach seine Meinung zu Glaubens- oder weltanschaulichen Fragen ändert, denn sie beruht auf eigenen Lebenserfahrungen, starken Impulsen aus dem sozialen Umfeld, so der eigenen Erziehung, oder auf tiefgreifenden Problemen, bei denen durch den Glauben eine Stabilisierung des eigenen Lebens ersehnt wird.
Trotzdem versucht meine Darstellung die Chance zu erhöhen, die Existenz eines Gottes als eher unwahrscheinlich anzusehen. Am Ende sollte also die Überzeugung mehr Raum bekommen können, dass uns Religion – trotz aller guten Worte und Geschichten - weniger erklären kann, als diesseitig orientierte Überlegungen und Erkenntnisse. Denn es scheint nicht gerade wenig dafür zu sprechen, dass wir auf dem Weg weitergehen können, der auch ohne einen Gottesglauben auskommt. Der Besuch von Kirchen, Moscheen oder Synagogen muss dem nicht entgegenstehen. Aber man sollte nicht ausschließen, dass die am Kreuz dargestellte Figur des Christentums zwar ein Symbol für viele respektable Werte sein kann, jedoch eher nicht mit übernatürlicher und göttlicher Kraft ausgestattet sein wird.
Das Führen eines glücklichen, emotional befriedigenden und ethisch und moralisch einwandfreien Lebens hängt nicht von einer Religion ab.
So stellt sich auch durchaus die Frage: Wäre es denn eine völlig abwegige, ja, verrückte Idee, wenn man sich die gesamte menschliche Entwicklung ohne tatsächlich existierenden Gott vorstellen würde, mit der Folge, dass alles auf der Welt schon immer ohne das Zutun eines Gottes geschah? Lässt sich das ausschließen? Würde die Welt heute anders aussehen, wenn es so wäre?
Ich hoffe, ich konnte Sie für das Weiterlesen des Buches interessieren und Sie zum Weiterblättern animieren!
Schreiben Sie mir gerne, wie Sie die Art finden, in der das Thema von mir behandelt wird.
Teil I
Das Interview
Einleitung
Vor kurzem hat eine Streitschrift für ein gewisses Aufsehen gesorgt, die belegen will, dass Gott nicht existieren kann. Circa ein Jahr nach der Veröffentlichung des Buches von Richard Dawkins (Der Gotteswahn) versucht der Autor - gekleidet in die Form eines Traktates – Argumente gegen die Existenz eines Gottes zu präsentieren. Unser Redaktionsmitglied Carl-Marten Fels führte für „thesen, syntax, perspektiven“ (tsp) ein ausgiebiges Gespräch mit dem Autor, der den Text unter seinem Pseudonym veröffentlicht hat.
tsp: Zuerst erlauben Sie mir eine Frage zu ihrer Person. Warum das Geheimnis um Ihren Namen?
Autor: Nun, es hat weniger mit dem Versuch einer unangemessenen Mystifizierung zu tun, als vielmehr mit der Unsicherheit, was passiert, wenn die Schrift tatsächlich in einer größeren Öffentlichkeit diskutiert würde. Dann bestünde das Risiko, dass man nicht mehr Herr der Abläufe ist und sich Ohnmacht breitmachen kann. Dieses Gefühl mag ich überhaupt nicht!
Dann sind Sie eher ein scheuer Mensch?
Das würde ich nicht sagen, aber man gibt doch etwas von sich preis und stellt es in die Welt, ohne noch beeinflussen zu können, wie jemand anderes darauf reagiert und wie er sich dazu verhält. Das hat generell etwas Beängstigendes. Finden Sie nicht?
Durchaus. – Aber noch einmal zu Ihrer Person. Wenn man die Archive durchstöbert, wird man keine Spuren von Ihnen finden. Selbst, wenn man weiß, wie Ihr wirklicher Name lautet (Anm.: der Name ist der Redaktion bekannt), sind keinerlei Hinweise über Veröffentlichungen von Ihnen zu finden. Wie kommt das?
Nun, ich kann nicht behaupten, dass mir in meinem Leben irgendetwas Wesentliches gefehlt hätte. Sowohl mein Beruf als Lehrer, als auch mein privates Leben mit meiner Frau, den erwachsenen Kindern und nunmehr sogar Enkelkindern waren so ausgefüllt, dass ich kein Bedürfnis danach gehabt hatte, mich in dieser Weise zu exponieren. Aber Themen wie: Gibt es einen Gott? Oder: Gibt es ein Leben nach dem Tode? beschäftigten mich jedoch mein Leben lang. Es sind Fragen, die ich mir in unterschiedlicher Form seit meinem zehnten Lebensjahr und verstärkt zwischen fünfzehn und sechzehn immer wieder gestellt habe und wo ich auch damals schon nur eine verneinende Antwort fand.
Überlegungen mit 15
Gut, dann lassen Sie uns doch darüber sprechen. Können Sie sich denn noch genauer an Ihre damaligen Überlegungen erinnern?
Ja, sehr gut. Sie sind mir auch durch die Streitschrift wieder sehr bewusst geworden. Es gab zwei grundlegende Aussagen, die sich damals entwickelten. Erstens, ich brauche nicht den Umweg über einen Gott, um zum Menschen (d. h. zum Mitmenschen) zu kommen. Und zweitens, was nicht existiert, kann nicht bewiesen werden. Diese Überlegungen spielten natürlich mit zehn Jahren noch keine Rolle, diese Gedanken kamen mir erst mit ca. 15 Jahren. Mit zehn war mir nur die Endlichkeit meines Lebens bewusst geworden.
Der erste Satz mag von einem liberalen Christen tolerierbar sein, macht Sie der zweite Satz aber nicht sehr leicht angreifbar, dass nicht bewiesen werden kann, was es nicht gibt? Oder ist das nur eine jugendliche Überlegung gewesen?
Ich gebe zu, er wirkt auf den ersten Blick äußerst plakativ und undifferenziert. Der Satz besitzt jedoch erst einmal eine unumstößliche Richtigkeit: Wie will ich etwas beweisen, das es nicht gibt? Natürlich gehört dazu ein weiterer wichtiger Gedanke, den ich damals so deutlich nicht mitgedacht hatte und der ihn stark relativiert. Es ist klar, dass die Wahrnehmung des Menschen begrenzt ist. Wir merken in allen Bereichen, z. B. in der Forschung, dass nach der Klärung einer Frage und dem Zuwachs an Wissen neue Fragen entstehen. Da sich aber nie alle Fragen klären lassen, eröffnet sich theoretisch sicherlich die Möglichkeit eines existierenden höheren Wesens. Jedoch wird der schon erwähnte Satz „Was nicht existiert, kann man nicht beweisen!“ dadurch nicht falsch oder widerlegt. Ich möchte sogar so weit gehen und behaupten, dass diese plakativ wirkende Aussage keine geringere Aussagekraft besitzt als die Versuche auf christlicher Seite mit „Gottesbeweisen“ der unterschiedlichsten Art seine Existenz zu belegen.
Gottesbeweis?
Wie meinen Sie das?





























