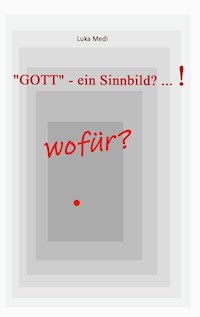
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Seit Tausenden von Jahren ist für die Menschheit das Sprechen und Denken von Gott ganz selbstverständlich gewesen. Die bestehenden Weltbilder harmonierten damit. Diese Harmonie ist in den letzten Jahrhunderten zunehmend zerbrochen. Welches Denken und Sprechen von Gott ist unserem heutigen Weltbild angemessen? Eine extrem reduzierte Geschichtsbetrachtung von Denkweisen, Weltbildern und Gottesvorstellungen führt zu umbrechenden Antworten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 74
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Seit Tausenden von Jahren ist für die Menschheit das Sprechen und Denken von Gott ganz selbstverständlich gewesen. Die bestehenden Weltbilder harmonierten damit. Diese Harmonie ist in den letzten Jahrhunderten zunehmend zerbrochen. Welches Denken und Sprechen von Gott ist unserem heutigen Weltbild angemessen? Eine extrem reduzierte Geschichtsbetrachtung von Denkweisen, Weltbildern und Gottesvorstellungen führt zu umbrechenden Antworten.
Die Autorin bzw. der Autor wünscht, dass eine Betrachtung des Inhaltes ausschließlich anhand des Textes erfolgt.
Ihre bzw. seine Biografie und Bekanntheit sollen dabei nicht die geringste Rolle spielen. Sie bleiben deshalb ungenannt.
Inhaltsverzeichnis
Vorfragen
Hinweise
Einführung
Vorkurs zu abstrakten Begriffen
Teil 1: Ein Zeitrahmen
Ein großer Sprung der Denkfähigkeiten
Die Sesshaftwerdung
Beginn der Jahreszählung
Die industrielle Revolution
Die Quantenphysik
Zusammenfassung des zeitlichen Rahmens
Teil 2: Evolution von Denkweisen
Denkweise nach "18 Jh Wiss-Techn-Ind"
Denkweise vor "18 Jh Wiss-Techn-Ind"
Denkweise vor "-100 Jh Sesshaft "
Denkweise vor "-700 Jh Denken"
Zusammenfassung Denkweisen
Teil 3: Evolution von Weltbildern
Altertümliches Weltbild
Ptolemäisches / geozentrische Weltbild
Das naturwissenschaftliche Weltbild
Das quantenphysikalische Weltbild
Zusammenfassung Weltbilder
Zusammenfassung Denkweisen (Wiederholung)
Teil 4: Evolution von Gottesvorstellungen
Kulte und Rituale
Geister und Götter
Griechische Antike
Der Ein-Gott-Glaube
Östliche Religionen
Der jüdische Wanderprediger Jesus von Nazareth
Der Beginn des Christentums mit Paulus
Der Islam
Wahrheitsansprüche
Zusammenfassung Gottesvorstellungen
Zusammenfassung Denkweisen und Weltbilder
Teil 5: Bilanz
Zusammenhänge und Konstanten
Konflikt Weltbild - Religion
Ein fortwährender Irrtum im Denken
Teil 6: Zukunft des Religiösen
Anforderungen aus der Zeit nach "18 Jh Wiss-Techn-Ind"
Das Sinnbild Kommunion / Abendmahl
Alles Religiöse ist sinnbildhaft
Goldene Regel
Feindesliebe
Goldene Regel PLUS
Vergleich der Botschaften von Jesus und Paulus
Zentrale Sinnbild-Deutungen
Abschließende Gedankensplitter
Wiederholung von Kernsätzen
Nachwort
Literatur
Vorfragen
Geister und Götter wurden seit mindestens 10.000 Jahren ganz selbstverständlich als Begleiter im menschlichem Leben gesehen. Die Welt galt als irgendwann einmal erschaffen und unveränderlich. Nach den Erkenntnissen in den letzten Jahrhunderten über die Entwicklung des Kosmos' und des Lebens auf der Erde hat sich diese Sichtweise der Welt grundlegend geändert. Haben damit auch die Vorstellungen von Gott ausgedient?
Wird hierzulande einer zufälligen Personengruppe die Frage gestellt, was für den Glauben von Christen besonders charakteristisch ist, dann kommen höchstwahrscheinlich Antworten wie solche: Sie glauben, dass Christus der Sohn Gottes ist. Sie glauben, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Sie glauben an ein ewiges Leben nach dem Tod. Etwas weniger wahrscheinlich sind Antworten wie: Sie glauben, dass Gott alle Menschen liebt. Sie glauben, dass der Kreuzestod von Jesus die Menschen von aller Schuld erlöst hat. Mit geringer Wahrscheinlichkeit ist die Antwort zu erwarten: Sie sind um Nächstenliebe bemüht. Ziemlich unwahrscheinlich wird sein: Sie versuchen, ihre Feinde zu lieben.
Ist das Christentum korrekturbedürftig? Andere Religionen auch?
Hinweise
Dieses Buch ist vorrangig für mich selbst verfasst. Es ist eine Selbstbetrachtung meines jetzigen persönlichen Glaubens, der über Jahrzehnte gewachsen ist. Eventuell wird dieses persönliche Denk-, Welt- und Glaubensmodell1 auch den einen oder anderen2 in mancher Weise zum Nachdenken anregen können.
Hier ist nun Aufhören oder Weiterlesen möglich.
Dort, wo ungewohnte Gedanken auftreten, oder wenn ungewohnt formuliert wird, sollten diese Abschnitte eventuell mehrmals gelesen und dabei eigene Formulierungen versucht werden. Bei Unklarheiten oder Interesse für Details sind auf jeden Fall eigene Recherchen zu empfehlen, zweckmäßigerweise im Internet - oder der Text wird alternativ einfach in die Ecke geworfen. Das schließt ja ein späteres Aufheben nicht aus.
Einführung
Alle Bestandteile von Zivilisationen, also von Kultur im weitesten Sinn, beeinflussen sich gegenseitig in den kulturell-zivilisatorischen Entwicklungen. Religionen waren in allen bisherigen Kulturen ein sehr wesentlicher Bestandteil. Werden sie das auch zukünftig sein? Wenn ja, auf welche Art?
Die Vergangenheit ist eindeutig festgelegt. Die Zukunft ist in vieler Hinsicht offen. Künftige Entwicklungen sind nie genau voraussagbar. Um den Trend von künftigen Entwicklungen wenigsten etwas abzuschätzen, ist die Kenntnis der Entwicklungsgeschichte unverzichtbar.
Dabei reicht es nicht, Religionen isoliert für sich zu betrachten. Von den vielen Teilbereichen der gesamten Zivilisationskultur haben Denkweise (in grundsätzlicher Art und grundsätzlichem Vermögen) und Weltbild wohl eine besonders enge Bindung zur Religion. Diese drei Bereiche sind deshalb Betrachtungsgegenstand.
Das Thema ist zweifellos tiefgreifend. Es berührt einen sehr großen Gefühls- und Wissensbereich. Eine umfassende Antwort ist damit sowieso unmöglich. Das Überlegen richtet sich auf "große Linien" der Entwicklungsprozesse. Geschichte als Ansammlung unendlich vieler und durchaus interessanter Details ist unter diesem Aspekt wenig hilfreich. Nur im Versuch des Auswählens vermutlich wesentlicher Elemente der Vergangenheit kann eine Chance entstehen, die Richtung des ausgesuchten Entwicklungsprozesses einigermaßen zutreffend abzuschätzen. Dem entsprechend wird versucht Details wegzulassen, die den Blick auf das Ganze eher verstellen würden. Falls trotzdem Details beschrieben werden, sind diese vielleicht unscharf oder entsprechen nicht der letzten Erkenntnis. Das dürfte wegen der Konzentration auf "große Linien" den Kern der Gesamtaussage aber kaum berühren.
Zuerst wird ein minimaler geschichtlicher Rahmen aufgezeichnet. Er enthält nur ganz wenige Ereignisse der Geschichte, die als wesentlich für den Problemkreis angesehen werden. In diesem Rahmen werden dann die bisherigen Entwicklungen von Denkweisen, Weltbildern und Gottesvorstellungen nacheinander eingefügt. Durch dieses Nebeneinander wird zwar einerseits etwas zerrissen, was zusammengehört, andererseits besteht jedoch der Vorteil, sich erst einmal auf den jeweiligen Teilbereich konzentrieren zu können. Danach kann eine Bilanz gezogen werden, auf welcher schließlich eine Richtung zur Beantwortung der aufgeworfenen Fragen angedeutet werden kann.
1 Modelle sind vor allem aus den Bereichen Wissenschaft und Technik bekannt. Religiöse Anschauungen als Modell zu bezeichnen, ist (noch) ungewöhnlich. Dabei ist der Modellbegriff für religiöse Vorstellungen besonders zutreffend.
2 es sind ganz selbstverständlich stets alle Geschlechtsformen gemeint
Vorkurs zu abstrakten Begriffen
Eingangs ist festzuhalten, dass Denken und Sprechen als Einheit angesehen werden. Mit den Begriffen, in denen gedacht wird, wird gesprochen. Und mit den Begriffen, in denen gesprochen wird, wird gedacht.
Jeder verwendet konkrete Begriffe, um Dinge zu bezeichnen, welche gesehen, berührt oder mit anderen Sinnen wahrgenommen werden können. Entsprechende Beispiele sind überflüssig. Im Gegensatz dazu werden abstrakte Begriffe unterschieden, und zwar auf zwei Arten.
Die erste Art abstrakter Begriffe bezeichnet Dinge, die nicht gesehen, nicht berührt und nicht mit unseren anderen Sinnen wahrgenommen werden können. Beispiele sind: Gefühle wie Freude oder Wut, Frieden, Gefahr, Gewalt, Wunder, Geist, Seele, Gewissen, Geister, Götter, Gott3.
Die zweite Art abstrakter Begriffe entsteht durch Weglassen von speziellen Eigenschaften konkreter Dinge mit gleichzeitiger Konzentration auf bestimmte wesentliche gemeinschaftliche Eigenschaften. Beispiel 1: Aus den konkreten Gewächsen Eiche, Linde, Kiefer usw. kann der abstrakte Begriff Baum gebildet werden. Beispiel 2: Aus den konkreten Gewächsen Bäume, Sträucher, Moose u.a. kann der abstrakte Begriff Wald gebildet werden. Bei dieser zweiten Art der Bildung abstrakter Begriffe gibt es also auch Mehrstufigkeit. Was dabei ein konkreter Begriff und was abstrakter Begriff ist, muss hier aus dem Zusammenhang erschlossen werden. Die Abstraktheit ist weniger eindeutig wie bei den abstrakten Begriffen der ersten Art.
3 Natürlich können Ursachen oder Auswirkungen bei einigen dieser Begriffe mit dem einem oder anderen Sinn wahrgenommen werden. Der Inhalt des Begriffs ist jedoch nicht den Sinnen zugänglich.
Teil 1: Ein Zeitrahmen
Ein großer Sprung der Denkfähigkeiten
Die sogenannten Vormenschen, unter anderem charakterisiert durch aufrechten Gang, bevölkerten die Erde vor ca. 7 Mio. Jahren bis vor ca. 1 Mio. Jahren. Vor ca. 2 Mio. Jahren bis vor ca. 400.000 Jahren (in Asien sogar bis vor ca. 30.000 Jahren) lebten die sogenannten Frühmenschen. Dann gab es den sogenannten Altmenschen von vor ca. 1 Mio Jahren bis vor ca. 30.000 Jahren, zu denen auch der Neandertaler gehörte. Der sogenannte moderne Mensch begann vor ca. 200.000 Jahren seine biologische Existenz.
Es gab also Zeiten, in denen die genannten Arten (übrigens mit vielen Unterarten) gemeinsam die Erde bevölkerten. Ob sich die Lebensräume unterschiedlicher Arten auch örtlich überschnitten, ist weitestgehend unbekannt. Nur von Begegnungen des Neandertalers mit modernen Menschen in Europa wissen wir inzwischen aus Genanalysen. Diese beweisen entsprechende Paarungen.
Vormenschen, Frühmenschen und Altmenschen zeigen wachsende Gehirnvolumen. Sprache und Denken waren aber noch nicht vorhanden. Erst der moderne Mensch entwickelt allmählich eine Sprache und damit Denken in zunächst archaischen Formen. Diese Ursprache dürfte ca. 200.000 Jahre alt sein, also gemeinsam mit dem Auftreten des modernen Menschen entstanden sein. Inhaltlich ausgefüllt war dieses Sprechen und Denken wahrscheinlich fast ausschließlich mit Problemen des Überlebens. Es war ein ausschließlich konkretes Denken auf primitive Art.
Diese Denk- und Sprach-Entwicklung erreichte dann vor ca. 70.000 Jahren4 ein Stadium, in welchem erstmals abstraktes Denken (der ersten oben beschriebenen Art) möglich und wirklich wurde. Das ganze war ein enormer Sprung im menschlichen Erkenntnisvermögen, eine sogenannte "kognitive Revolution".
Die neuen Fähigkeiten des Gehirns machten nun ganz neue Formen des Sprechens miteinander möglich. Neben der Weitergabe konkreter Sachinformationen war es nun auch möglich, allgemeine Vorstellungen zu entwickeln und diese in Erzählungen weiterzugeben.





























