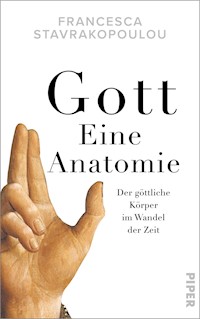
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In früheren Zeiten war Gott kein abstraktes Wesen, sondern hatte eine stark physische Komponente. Erst spät wurde die Lehre verbreitet, Gott habe keine Gestalt. Dieses Buch erzählt eine andere Geschichte: die des biblischen Gottes in all seinen körperlichen, unzensierten und skandalösen Formen. Indem es die theologische Fassade jüdisch-christlicher Frömmigkeit einreißt, offenbart es den göttlichen Körper, wie er einst gesehen wurde: übergroß und muskelbepackt. Denn die frühchristlichen Menschen versahen ihren Gott mit irdischen Leidenschaften und einem Hang zum Ungeheuerlichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Aus dem Englischen von Karin Schuler und Dr. Maria Zettner
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel God: An Anatomy bei Picador, Pan Macmillan, London
© Francesca Stavrakopoulou, 2021
All rights reserved including the rights of reproduction in whole or in part in any form.
Für die deutsche Ausgabe:
© Piper Verlag GmbH, München 2022
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Lukas - Art in Flanders VZW / Bridgeman Images
Karten: Überarbeitung für die deutsche Ausgabe von Peter Palm
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Motto
Vorbemerkung der Autorin
Karten
Prolog
Einleitung
1 Die Gottheit auf dem Seziertisch
Im Anfang
Lebenslauf
Teil I
Füße und Beine
2 Geerdet
Am Boden
3 Der Erde entrückt
Abgewandert
4 Empfindsame Füße
Fußfetisch
Teil II
Genitalien
5 Verhüllung
Schaut, was ich habe
6 Phallische Männlichkeit
Kulturelle Befruchtung
7 Die Vervollkommnung des Penis
Mannesalter
8 Göttlicher Sex
Teil III
Torso
9 Ein schöner Rücken kann auch entzücken
Ein Zeichen von Göttlichkeit
»Strahlend« weiß?
10 Umgestülpt
11 Vom Bauch in den Darm
Göttliche Gaumenfreuden
Göttlicher Unrat
Teil IV
Arme und Hände
12 Ein zupackender Gott
13 In Reichweite
14 Göttliche Berührung
15 Heilige Handbücher
Teil V
Kopf
16 Von Angesicht zu Angesicht
Gottesschau
Versteckspiel
17 Eigenwillige Schönheit
Eine Krone mit Hörnern
Sehnsucht nach dem Göttlichen
Göttliche Körperpflege
18 Profil
19 Alle Sinne beisammen
Selektives Hören
Das Auge des Betrachters
Weitsicht
20 Einmal kräftig schlucken
Göttliches Schnuppern
Schnauben und Schlucken
Lebensatem
Recycelte Luft
Epilog
21 Eine Autopsie
Dank
Glossar
Abkürzungsverzeichnis
Bibliografie
Anmerkungen
Bildteil
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Literaturverzeichnis
Register
»Es wäre mir lieb, wenn du nicht immer so plötzlich da und weg wärest: das macht einen ganz schwindelig.« – »Einverstanden«, meinte die Katze; und diesmal verschwand sie ganz allmählich – mit dem Schwanzende beginnend bis hin zum Grinsen, das noch einige Zeit in der Luft blieb, als der Rest schon verschwunden war.
»So etwas!«, dachte sich daraufhin Alice, »ich habe zwar schon oft eine Katze ohne Grinsen gesehen, aber ein Grinsen ohne Katze! Das ist doch das Allerseltsamste, was ich je erlebt habe!«
LEWIS CARROLL (1865)
(Aus: Lewis Carroll, Alice im Wunderland, Frankfurt am Main 1970)
Vorbemerkung der Autorin
In diesem Buch geht es um Orte, Völker und Gottheiten, die teilweise unter vielen verschiedenen Namen bekannt sind – von denen wiederum einige kulturell beziehungsweise politisch vorbelastet sind. Wann immer möglich, habe ich mich bemüht, neutrale oder allgemeine Begriffe zu verwenden, ohne dass es zulasten der historischen oder geografischen Genauigkeit ging. Insbesondere habe ich bewusst das üblichere Etikett »alter Orient« vermieden. Es spiegelt, offen gesagt, eine westliche Sicht wider und ist mit kolonialem Ballast überfrachtet (ähnlich wie sein älteres Metonym »der Orient«). Stattdessen verwende ich »antikes Südwestasien« oder »südwestliches Asien des Altertums«. Auch greift das Buch auf Primärquellen zurück, die in verschiedenen alten Sprachen verfasst sind. Im Interesse der Leserinnen und Leser wurden die Transliterationen in verständlichem Rahmen gehalten, auch mit Blick auf die Aussprache (etwa »Assur« statt »Aschschur« oder »Jahwe« statt »JHWH«). Gelegentlich habe ich auf strikte Einheitlichkeit zugunsten von Worten und Wendungen in ihrer gängigeren Schreibweise verzichtet. Die Bibelzitate folgen der New Revised Standard Edition und ihrer Versifikation, allerdings habe ich, wenn nötig, die (konfessionelle) Übersetzung modifiziert, vor allem bei den vorchristlichen Texten der Bibel.[1]
Prolog
Denken Sie mal zurück. Wann sind Sie das erste Mal mit einer Bibel in Berührung gekommen? Ich war fünf, vielleicht auch sechs Jahre alt, saß im Schneidersitz auf einem kratzigen beigen Teppich und hatte ein großes Bilderbuch auf dem Schoß. Das Buch war eine illustrierte Kinderbibel, und seine Seiten rochen köstlich – herb, wie Plakatfarbe, wenn auch ein bisschen muffig, wie die Leihbibliothek. Ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, was ich da alles sah. Abraham hatte seinen Sohn Isaak gefesselt auf etwas gelegt, das aussah wie ein noch nicht entzündetes Lagerfeuer. Er hatte ein Messer und war drauf und dran, ihn damit zu erstechen und dann zu verbrennen. Doch da wurde er plötzlich von einem Engelam Himmel gestoppt, einem Engel mit gelben Haaren und einem wallenden Gewand, der auf ein fettes, flauschiges Schaf zeigte. Es waren noch mehr Bilder in dem Buch: ein alter Mann auf einem Berg mit zwei großen Steintafeln in den Händen; ein anderer alter Mann in einem Streitwagen, der von zwei Pferden aus Feuer gezogen wurde. Ich blätterte weiter und weiter. Da war ein Mann, ganz mit Seetang überzogen, er saß im Bauch eines großen blauen Wals. Der kleine Jesus in einem Bett aus Stroh, um den sich Schafe, Kühe und ein Esel scharten, die ihn ansahen. Eine Frau, die mit Schals herumwirbelte, während sie vor einem Kopf auf einem Teller tanzte. Ich hielt kurz inne und schaute auf das Bild des Mannes, der an ein großes Holzkreuz genagelt war. Er war über und über mit Kratzern bedeckt, und an seinem Kopf tropfte Blut herunter.
Ich habe nie an Gott geglaubt, aber Religion hat mich immer fasziniert. Als ich aufwuchs, war sie allgegenwärtig, drängte sich in mein Blickfeld und strukturierte den Lebensablauf – von den täglichen Schulversammlungen und dem Fernsehprogramm am Sonntagabend bis zur freudigen Erwartung vor weihnachtlichen Krippenspielen und Ostereiersuchen. Doch erst die Familienausflüge ins Museum machten Religion für mich konkret. Riesige Steinstatuen von Göttern, rundlich, fleischig und machtvoll. In Tuniken gehüllte Götter mit Sandalen an den Füßen. Götter mit Zehennägeln, Ellbogen, Augenbrauen. In anderen Räumen standen farbenfroh bemalte Särge mit Leichnamen, die in schmutzige Stoffstreifen eingewickelt waren, umgeben von Göttern mit den Gesichtern von Tieren. Eine Katze. Ein Hund. Ein Vogel. Ein Krokodil. Einmal die Ecke rum, und da waren noch mehr Götter, dieses Mal in kleine polierte Steine geritzt; in langen Röcken saßen sie auf Thronen, hatten Hörner auf ihren Kronen und Ungeheuer zu ihren Füßen liegen. In Museen lernte ich, dass die Gottheiten aus Ägypten, Mesopotamien, Griechenland und Rom zu der größeren Welt gehörten, in der die Bibel entstand. Aber wo waren die Statuen vom Gott der Bibel selbst – der einzigen Gottheit, die bis in die heutige Zeit überlebt hat?
Als ich Theologie und Religionswissenschaft studierte, gingen Dozenten wie Studenten gleichermaßen davon aus, dass der Gott der Bibel keinen Körper besitzt. Es war ein gestaltloser, unsichtbarer Gott, von dem es kein Bild gab und der sich in der hebräischen Bibel (dem Alten Testament) in geheimnisvoll von Propheten gesprochenen Worten offenbarte und dann im Neuen Testament in Jesus Christus Fleisch wurde, um für die Sünden der Menschheit zu sterben, bevor er wiederauferstand und in den Himmel zurückkehrte. Doch als ich mir die Bücher, aus denen die Bibel besteht, einmal etwas genauer anschaute, konnte ich diesen körperlosen Gott nicht finden. Vielmehr beschworen die alten Texte ein überraschend leibhaftiges Bild von einem Gott in Menschengestalt herauf, der herumlief, redete, weinte und lachte. Einem Gott, der aß und schlief, Gefühle hatte und atmete. Und einem Gott, der eindeutig männlichen Geschlechts war.
Während meines Grundstudiums schien niemand ein Wort über den Körper des biblischen Gottes verlieren zu wollen – bis zu einer denkwürdigen Vorlesung, in der es um die Genderthematik in der modernen christlichen Theologie ging. Begeistert stellte ich fest, dass feministische Theologen sowohl auf jüdischer als auch auf christlicher Seite schon lange Widerspruch gegen den rein männlichen Gott in ihren heiligen Schriften erhoben. Doch stellte sich schnell heraus, dass sowohl feministische als auch traditionalistische Theologen dieses heikle Thema dadurch zu umschiffen gedachten, dass sie sich darauf zurückzogen, Gott könne unmöglich ein Geschlecht haben, denn Gott habe ja keinen Körper. Ich weiß noch genau, dass ich in der Diskussionsrunde am Ende der Vorlesung Protest einlegte. »Aber viele biblische Texte lassen den Schluss zu, dass Gott männlich ist und einen männlichen Körper hat.«
»Das Problem ist nicht Gott«, erwiderte der Professor, ein hoch angesehener christlicher Theologe und Geistlicher. »Problematisch wird es nur, wenn wir die Beschreibungen der Bibel zu wörtlich nehmen.« Dann führte er weiter aus, dass jene lästigen biblischen Darstellungen eines leibhaftigen, männlichen Gottes schlicht und einfach metaphorisch gemeint seien oder poetisch. »Wir sollten uns nicht zu sehr von Anspielungen auf seinen Körper ablenken lassen«, sagte er. Denn sonst würde man sich zu vereinfachend mit den biblischen Texten auseinandersetzen. Anscheinend sollten wir nicht nur auf die Texte schauen, sondern durch sie hindurch, um ihren theologischen Wahrheiten auf die Spur zu kommen.
Alle anderen im Raum schienen mit dieser Herangehensweise an den Gott der Bibel erstaunlich zufrieden zu sein, aber ich fand sie zutiefst frustrierend. Warum sollte ich an dem klaren Bild von Gott als riesenhaftem Mann mit einem schweren Schritt, Waffen in der Hand und einem Atem so heiß wie Schwefel vorbeisehen? Einem Gott, der es in einem physischen Kampf mit einem gewaltigen Seeungeheuer aufnahm – und siegte? Einem Gott, der in seinem himmlischen Garten und in den Friedhöfen seines Volkes herumlief? Einem Gott, der eine Frau nackt auszog und sie der Gruppenvergewaltigung und Verstümmelung preisgab? Einem Gott, der auf einem Thron in einem Tempel saß und sich am Aroma von verbranntem Tierfett erfreute, während er auf sein Abendessen wartete? Einem Gott, der nicht nur Kinder hatte, sondern auch noch bereitwillig und mutwillig seinen geliebten Sohn hergab, damit er den Opfertod erlitt? Wie konnte ich davon nicht abgelenkt werden? Hier war eine Gottheit, genau wie die, die ich als Kind in Museen besucht hatte – ein Gott aus alten Mythen, fantastischen Geschichten und längst verloren geglaubten Ritualen, ein Gott aus der fernen Vergangenheit, aus einer Gesellschaft so ganz anders als die unsere. Unter diesen Vorzeichen wollte ich ihm begegnen, nicht als distanziertes, abstraktes Wesen, sondern als Produkt einer bestimmten Kultur, zu einer bestimmten Zeit, nach dem Bild der Menschen gemacht, die damals lebten; ein Gott, den sie nach ihren eigenen physischen Gegebenheiten formten, nach ihrer Weltsicht – und nach ihren eigenen Vorstellungen.
Als ich da so in dem Hörsaal saß, kam es mir vor, als wäre diese kraftvolle Gestalt irgendwie wegtheoretisiert und ersetzt worden durch das abstrakte Wesen, mit dem wir heute vertrauter sind: einen Gott, den wir in unseren kulturellen Ritualen feiern, auf den unsere Politiker sich gerne berufen und der jeden Sonntag im Fernsehen gepriesen wird. Einen Gott, dem ich, nach Meinung vieler meiner Kommilitonen und Dozenten, Rechenschaft schuldig war, ob nun in diesem Leben oder im nächsten. Einen Gott, dessen angebliche Gebote unsere gesellschaftlichen und kulturellen Konventionen bezüglich Gender, Sex und Moral, Macht und sozialer Schicht, Leben und Tod geprägt haben. Und dann dämmerte es mir mit einem Mal. Alle anderen im Raum, mein Theologieprofessor eingeschlossen, zensierten die Bibel, desinfizierten ihren Gott, befreiten ihn von allen mythologischen, diesseitigen und verstörenden Merkmalen. Ich war enttäuscht von ihnen. Und sie taten mir leid.
Das hier ist das Buch, das ich gern gelesen hätte, als ich auf der Uni war. Es erzählt die Geschichte des wahren Gottes der Bibel in all seinen leiblichen, unzensierten, skandalösen Ausprägungen. Indem es die theologische Fassade über die Jahrhunderte angesammelter jüdischer und christlicher Pietät herunterreißt, befreit das Buch den Gott der Heiligen Schrift von seinen biblischen und dogmatischen Fesseln und bringt eine Gottheit hervor, die ganz anders ist als der Gott, der heute von Juden und Christen verehrt wird. Der in diesem Buch enthüllte Gott ist die Gottheit, als die seine Anhänger im Altertum ihn sahen: ein überdimensionaler, muskelbepackter, gut aussehender Gott mit übermenschlichen Kräften, irdischen Leidenschaften und einer Schwäche für das Fantastische und Monströse.
Einleitung
1 Die Gottheit auf dem Seziertisch
Im Juni 2018 veröffentlichten Nachrichtenplattformen in aller Welt eine Fotografie von Gott. »Zeigt DIESES Foto das wahre Gesicht Gottes?«, tönte eine Clickbait-Überschrift. »Die Wissenschaft enthüllt das Gesicht Gottes, und es sieht aus wie Elon Musk«, spottete eine zweite. Andere, darunter die Webseite von NBC, waren weniger effekthascherisch in ihren Aufmachern: »Das Gesicht Gottes liegt im Auge des Betrachters.« Das besagte Foto zeigte das unscharfe Schwarz-Weiß-Bild eines männlichen Weißen mittleren Alters mit einem weichen, runden Gesicht und dem Anflug eines Lächelns [Abb. 1][2]. Das Bild war von Forschern der University of North Carolina in Chapel Hill erzeugt worden, die einer demografisch repräsentativen Auswahl US-amerikanischer Christen eine Abfolge von computergenerierten Gesichtern vorgelegt hatten, in denen sich bestimmte kulturelle Stereotype von emotionalen, ethischen, sozialen und spirituellen Werten ausdrückten, und sie gebeten hatten, die herauszusuchen, die ihrem geistigen Bild von Gott am nächsten kamen. Einige dieser Gesichter hatten ein androgynes Aussehen, manche waren eher feminin, andere maskuliner. Alle waren sie grau, wie auf einer schwarz-weißen Fotokopie, doch hatten einige eine hellere Haut und andere eine dunklere. Manche Gesichter waren ausdrucksstark, andere eher nichtssagend. Doch jedes Gesicht war eine Leinwand, auf die die Teilnehmer an dem Experiment nach Belieben ihre eigenen Mutmaßungen projizieren konnten. Die Ergebnisse wurden ausgewertet und dazu genutzt, ein Phantombild von Gott zu erstellen. Wenig überraschend förderte die Studie zutage, dass in den USA Gott dem Bild eines weißen männlichen Amerikaners entspricht.[1]
Das Gesicht Gottes, wie es sich eine repräsentative Auswahl von amerikanischen Christen in einer kürzlich durchgeführten Studie vorstellte. Die Unschärfe des Bildes rührt von seiner zusammengesetzten Natur her. Das Fazit der Studie lautete, dass die Befragten sich Gott im äußeren Erscheinungsbild und in der Ethnie ihnen selbst ähnlich vorstellten. [1]
Psychologen und Sozialanthropologen haben schon lange erkannt, dass bei der Deutung des Göttlichen in menschlichen Gesellschaften ein hohes Maß an kognitiver Verzerrung zum Tragen kommt. Doch auch wenn moderne Studien wie die aus Chapel Hill uns etwas über die psychologischen und sozialen Prozesse sagen, die dieser Neigung zugrunde liegen, ist das nicht eben neu. Vor mehr als zweieinhalbtausend Jahren, im späten 6. beziehungsweise frühen 5. Jahrhundert v. Chr., war der griechische Denker und Abenteurer Xenophanes von Kolophon bereits zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelangt: »Wenn Kühe, Pferde oder Löwen Hände hätten und damit malen und Werke wie die Menschen schaffen könnten, dann würden die Pferde pferde-, die Kühe kuhähnliche Götterbilder malen und solche Gestalten schaffen, wie sie selber haben.« Für Xenophanes war die menschliche Neigung, sich Götter nach ihrem Ebenbild zu schaffen, ebenso sehr lokalen kulturellen Vorlieben geschuldet wie übergeordneteren, ambitionierten Idealen, was die Vielfalt von Gottheiten in seiner Welt nur bestätigte: »Die Äthiopen stellen sich ihre Götter schwarz und stumpfnasig vor, die Thraker dagegen blauäugig und rothaarig.« Was Xenophanes betraf, so war die weitverbreitete Annahme, die Götter hätten Körper wie die ihrer Anhänger, untrennbar mit der Vorstellung verbunden, Götter benähmen sich ganz so wie Menschen – und das war überaus problematisch, denn es entwertete unweigerlich die moralische Natur des Göttlichen. Beweise dafür ließen sich in den griechischen Mythen selbst finden: »Alles haben Homer und Hesiod den Göttern angedichtet, was nur immer bei den Menschen Schimpf und Schande ist: Stehlen, Ehebrechen und sich gegenseitig betrügen«, beklagte Xenophanes. Es war ein Einwand, der in seiner Philosophensicht wurzelte, dass ein Gott von Natur aus und zwangsläufig »weder an Aussehen den Sterblichen ähnlich [sei] noch an Gedanken«.[2]
Ähnliche Ideen wurden schon bald auch von anderen griechischen Denkern verfochten, vornehmlich von Plato (um 429–347 v. Chr.) und seinem Schüler Aristoteles (um 384–322 v. Chr.) sowie nachfolgenden Generationen ihrer elitären, gebildeten Anhänger in der griechisch-römischen Welt, die darüber spekulierten, dass die göttliche Macht, die letzten Endes das Universum trägt, zwangsläufig ohne Körper sein muss – ein körperloses, unsichtbares abstraktes Prinzip beziehungsweise eine entsprechende Macht oder ein Intellekt, ganz und gar jenseits und verschieden von der materiellen Welt. Nicht, dass solche abgehobenen Ansichten größere Auswirkungen auf das religiöse Leben der Durchschnittsmenschen gehabt hätten. Ob sie nun in Philosophie geschult waren oder nicht, und auch unabhängig davon, welche Gottheiten sie verehrten, die meisten der in der griechisch-römischen Welt lebenden Menschen stellten sich ihre Götter auch weiterhin als leibhaftige Wesen mit Körpern wie ihren eigenen vor – ganz wie eh und je.
Doch gegen Ende des ersten vorchristlichen Jahrtausends und bis in die frühen nachchristlichen Jahrhunderte hinein hielten diese gelehrten philosophischen Ideen allmählich Einzug in das Denken bestimmter jüdischer und christlicher Intellektueller, die ihre Vorstellung von ihrem Gott gründlich überdachten, bis er für sie zunehmend körperlos und immateriell wurde. Dabei machten sie immer feinere Unterschiede zwischen dem Himmlischen und dem Irdischen, dem Göttlichen und dem Menschlichen, dem Geistigen und dem Körperlichen. Das im Großen und Ganzen platonische Konzept von der Unterschiedenheit des Göttlichen von allem im Universum und darüber hinaus hat die formaleren theologischen Deutungen Gottes in der religiösen Vorstellungswelt des Westens entscheidend geprägt. Allerdings bauen diese Deutungen auf einem konzeptionellen Bezugsrahmen auf, der in großem Widerspruch zur Bibel selbst steht, denn in diesen alten Texten wird Gott auf verblüffend menschenähnliche Weise dargestellt. Dort haben wir eine Gottheit mit einem Körper.
Im Anfang
Der Hochgott hatte bereits mehrere Tage damit zugebracht, neue Wunder ins Dasein zu rufen – er hatte die urzeitlichen Wasser des Chaos in ein himmlisches und ein unterweltliches Reservoir aufgeteilt, trockenes Land geschaffen und es mit Obstbäumen und Feldfrüchten bepflanzt, hatte die Sonne angewiesen, den Tag, und den Mond, die Nacht zu erleuchten, und schließlich dem neu entstandenen Land, Meer und Himmel befohlen, Landtiere, Fische und Vögel hervorzubringen. Jetzt war er im Begriff, erneut das Wort zu ergreifen. »Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich«, sagt er zu den anderen Gottheiten in seinem Gefolge. Es ist eher eine Ansage als ein Vorschlag, aber dennoch eine gute Idee, denn die neuen Menschen werden die Aufgabe haben, in der neu geschaffenen irdischen Sphäre Ordnung zu halten. Und so formt der Hochgott den allerersten Menschen: »Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn.« Das neue Geschöpf – adam, was so viel bedeutet wie »Erdling« – weist große Ähnlichkeit mit seinem göttlichen Schöpfer auf und bekommt rasch eine weibliche Version an die Seite gestellt: »Männlich und weiblich erschuf er sie.« Ausgestattet mit Gott nachempfundenen Körpern werden die Menschen vor den übrigen neu erschaffenen Geschöpfen auf der Welt bevorzugt, über die ihnen die Herrschaft verliehen wird. Nachdem er die Menschen mit Fruchtbarkeit gesegnet hat, überträgt der Hochgott ihnen zwei Aufgaben: sich zu vermehren und zu herrschen. Sie sollen seine Welt mit ihrer Nachkommenschaft füllen und die übrigen Geschöpfe unter Kontrolle halten. Zufrieden mit seinem Werk entscheidet der Hochgott, dass seine Arbeit getan ist. Am folgenden Tag ruht er sich aus.
In akademischen Kreisen wäre wohl an dieser freien Wiedergabe der Eingangsgeschichte des Buches Genesis nichts auszusetzen. Die meisten Bibelwissenschaftler würden zustimmen, dass Gott, wenn er sagt: »Lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich«, die übrigen Mitglieder seiner »himmlischen Versammlung« anspricht – das Etikett, das die Bibel Gottes Rat aus niederen Gottheiten und göttlichen Wesen verpasst hat. Und die meisten würden auch unterschreiben (obgleich der eine oder die andere sich dabei ein wenig winden würde), dass die frisch geformten Menschen dadurch, dass sie nach dem Ebenbild der Götter gemacht wurden, eine sichtbare Ähnlichkeit mit ihren eigenen Gottheiten aufweisen, so, wie später in der Genesis von Adams Sohn Set gesagt wird, dass er wie »das Bild« seines Vaters sei, und wie in anderen biblischen Texten Götterstatuen das »Ebenbild« der Götter sind, die sie darstellen.[3] Die unsere heutige Bibel eröffnende Schöpfungsgeschichte, die um das 5. Jahrhundert v. Chr. verfasst wurde, jedoch auf ältere Mythen zurückgreift, zeugt von einer Zeit, als Jahwe – die Gottheit von Jerusalem, heutzutage besser bekannt unter dem Namen »der Herr« – erst noch in die Rolle des einzigen göttlichen Wesens im Universum hineinwachsen musste. Wie der babylonische Marduk oder der griechische Zeus war diese altbekannte Gottheit schon seit Langem als König des Alls gefeiert worden, war aber, wie diese beiden, bei Weitem nicht allein im Himmel. Vor allem war er noch mehrere Jahrhunderte von der immateriellen, körperlosen Abstraktion aus der späteren jüdischen und christlichen Theologie entfernt. Er war einfach wie jede andere Gottheit in der Welt des Altertums auch. Er hatte einen Kopf, Haare und ein Gesicht mit Augen, Ohren, einer Nase und einem Mund. Er hatte Arme, Hände, Beine und Füße, eine Brust und einen Rücken. Er war ausgestattet mit einem Herzen, einer Zunge, Zähnen und Genitalien. Er war ein Gott, der ein- und ausatmete. Hier hatten wir es mit einer Gottheit zu tun, die nicht nur aussah wie ein Mensch – wenn auch in weitaus imposanterem, glanzvollerem Umfang –, sondern sich auch noch sehr oft wie ein Mensch benahm. Er mochte gern Abendspaziergänge und herzhafte Mahlzeiten, er hörte Musik, schrieb Bücher und stellte Listen auf. Er war ein Gott, der nicht nur sprach, er lachte auch, schrie laut, weinte und führte Selbstgespräche. Er war ein Gott, der sich verliebte und raufte, ein Gott, der sich mit seinen Anhängern zankte und mit seinen Feinden kämpfte, ein Gott, der Freundschaften schloss, Kinder großzog, sich Ehefrauen nahm und Sex hatte.
Diese Darstellung Gottes wurde nicht von irgendwelchen obskuren, auf längst vergessene Tontafeln eingeschriebenen Mythen zusammengesucht. Sie stammt aus der Bibel selbst – einem Buch, so komplex wie die Gottheit, deren Werbetrommel sie rührt, nicht zuletzt, weil die Bibel eigentlich gar kein einzelnes Buch ist, sondern eine Sammlung von Büchern, die sich in zwei Teile gliedert. Der erste ist die hebräische Bibel, die im Judentum Tanach und im Christentum Altes Testament heißt. Sie ist eine Anthologie aus uralten Texten, die ursprünglich als Schriftrollen verfasst wurden. Die meisten dieser Texte sind selbst komplexe Zusammenstellungen unterschiedlicher literarischer Überlieferungen. Die Mehrzahl von ihnen wurde zwischen dem 8. und dem 2. Jahrhundert v. Chr. in Juda, einem kleinen, südlich gelegenen Staatswesen in der Levante verfasst, der Region, die wir heute als Palästina, Israel, Jordanien und Westsyrien kennen. Im 8. Jahrhundert v. Chr. wurde das Königreich Juda von den Assyrern erobert; zu Beginn des 6. Jahrhunderts widerfuhr ihm das Gleiche noch einmal, nur waren die Eroberer diesmal die Babylonier. Bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. war aus Juda eine persische Provinz geworden, um das Jahr 333 v. Chr. wurde es dem riesigen Reich Alexanders des Großen einverleibt. Einige Texte aus der hebräischen Bibel berichten von Judas wechselvollen politischen Entwicklungen, andere sind Geschichten über legendäre Helden und Mythen aus sehr weit zurückliegenden Zeiten. Bei einigen handelt es sich um Orakelsammlungen, die verschiedenen Propheten zugeschrieben werden, bei anderen um Zusammenstellungen von Gedichten, rituellen Gesängen, Gebeten und Lehren. Doch keiner dieser Texte ist uns in der »Originalfassung« überliefert. Vielmehr wurden an allen im Lauf der Zeit wiederholt sowohl inhaltlich als auch formal Überarbeitungen, Ergänzungen, Verbesserungen und Bearbeitungen vorgenommen, worin sich die wechselnden ideologischen Interessen ihrer Kuratoren spiegeln, die sie als heilige Schriften verstanden.
Es war dieser lange Prozess der schöpferischen Bearbeitung, der der biblischen Geschichte von Gottes Beziehung zu »Israel«, dem Volk, das er unter seine Fittiche genommen hat, narrative Form gegeben hat. Die ersten fünf Bücher der hebräischen Bibel erzählen von der Begründung und Verfestigung dieser Beziehung. Nach der Erschaffung der Welt und der Sintflut schließt Gott einen Bund (oder Vertrag) mit den Vorfahren der Israeliten – Abraham, seinem Sohn Isaak und seinem Enkel Jakob –, denen er zahlreiche Nachkommenschaft verspricht als Gegenleistung für ihren Gehorsam, den sie vor allem dadurch unter Beweis stellen sollen, dass sie nur ihn allein verehren. Als die Israeliten in Ägypten in Sklaverei geraten, befreit Gott sie und beauftragt Mose damit, sie ins »Gelobte Land« Kanaan zu führen und sie gleichzeitig in Gottes Lehren (tora) zu unterweisen – die Bestimmungen, die ihr weiteres Verhältnis zur Gottheit prägen werden, darunter auch Anweisungen für den prächtigen Tempel, den sie in dem ihnen von Gott geschenkten Heimatland errichten sollen. Zusammen genommen sind diese fünf Bücher – Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium – unter dem Namen Tora bekannt, und gemeinsam arbeiten sie die vermutlich rivalisierenden Überlieferungen über Vorfahren und Ursprünge der Israeliten zu einem weitgehend kohärenten Narrativ einer »israelitischen« Identität um.
Die Ausformung der Vergangenheit wird weitergeführt in den Büchern Josua, Richter, Samuel und Könige. Dieser zweite Block berichtet von der Inbesitznahme Kanaans und den Regierungszeiten der ersten israelitischen Monarchen: Saul, dann David, der Jerusalem zu seiner Hauptstadt macht, gefolgt von Salomo, der Gott dort einen Tempel baut. Weiter geht es in diesen Büchern um den Zerfall des Königreichs in zwei einzelne nach Salomos Tod: in Israel im Norden und Juda im Süden. Die Geschicke der beiden Reiche werden nachgezeichnet, von der zügigen Abhandlung des assyrischen Sieges über das Königreich Israel im 8. Jahrhundert v. Chr. bis zur babylonischen Eroberung Judas, der Zerstörung Jerusalems und der Verschleppung seiner Eliten nach Mesopotamien im 6. Jahrhundert v. Chr. – Ereignisse, die als Strafe Gottes für generationenübergreifendes religiöses Fehlverhalten geschildert werden. Die biblische Darstellung der Vergangenheit wird fortgeführt in den Büchern Esra und Nehemia, die das Augenmerk auf die Rückkehr der Verbannten im 5. Jahrhundert v. Chr. richten. Ungeachtet ihrer früheren Verstöße ist diese Gruppe nun der von Gott erwählte »geläuterte« Rest des einstigen Gottesvolkes – ein Gedanke, der ähnlich auch in einigen der auf diese Zeit datierten Prophetenbücher zum Ausdruck kommt. Wieder im Besitz der göttlichen Gunst und zurück im Heimatland bauen sie Jerusalem und seinen Tempel wieder auf und bekennen sich erneut zu der ihnen von Mose vermittelten göttlichen Lehre.
Historisch gesehen stimmen nur die späteren Episoden dieser biblischen Geschichte im Großen und Ganzen mit bekannten Gegebenheiten überein, was Abraham, Isaak, Jakob, Mose und sogar David und Salomo bestenfalls in den Bereich der Mythen und Legenden verweist – schlimmstenfalls als reine Fantasie brandmarkt. Doch archäologische Zeugnisse aus der Zeit ab dem 9. Jahrhundert v. Chr. deuten auf die Existenz der getrennten Königreiche Israel und Juda in der Eisenzeit und belegen die Namen von einigen ihrer Könige. Mesopotamische Aufzeichnungen bestätigen darüber hinaus die assyrische Eroberung Israels im späten 8. Jahrhundert v. Chr. und den babylonischen Sieg über Juda im frühen 6. Jahrhundert v. Chr. Mesopotamische Chroniken bezeugen zudem die erzwungene Abwanderung von einigen höhergestellten Gruppen aus beiden Königreichen – eine gängige imperiale Taktik mit dem Ziel, in den eroberten Gebieten lokale Aufstände zu unterbinden –, und es gibt genügend Anhaltspunkte für die Schlussfolgerung, dass einige Deportierte tatsächlich im 5. Jahrhundert v. Chr. aus Babylon nach Juda zurückkehrten.[4]
Doch kann nicht biblisches Material auch die Grenzen der biblischen Darstellung der Vergangenheit aufzeigen und uns warnen, dass man sie nicht als umfassendes oder verlässliches geschichtliches »Protokoll« ansehen sollte. In den Königs-Büchernbeispielsweise wird ein König des Nordreiches Israel aus dem 9. Jahrhundert v. Chr. namens Omri als eine verhältnismäßig unbedeutende Gestalt präsentiert, dessen einzige nennenswerte Leistung die Gründung einer neuen Hauptstadt, Samaria, war. Doch die Inschrift auf einer Stele, die der König des benachbarten Moab, Mescha, aufstellen ließ, feiert den Rückgewinn beträchtlicher moabitischer Territorien von »Omri, König von Israel« und seinem Nachfolger, die beide »Moab viele Tage [bedrängten]«. Die Nachhaltigkeit von Omris territorialem und dynastischem Erbe kommt auch in assyrischen Texten aus dem 9. und 8. Jahrhundert v. Chr. zum Ausdruck, in denen das Königreich Israel häufig als »Omri-Land« bezeichnet wird und seine diversen Könige als »Söhne Omris«. Die Möglichkeit, dass der judäische Verfasser der Königs-BücherOmris Bedeutung nicht nur heruntergespielt, sondern auch noch unterdrückt hat, klingt an in einem versteckten, flüchtigen Verweis auf »die übrige Geschichte Omris, seine Taten und die Erfolge, die er errang«.[5]
Die voreingenommene Perspektive der biblischen Autoren und Redakteure ist auch in der übergreifenden Beharrlichkeit zu erkennen, mit der der Jerusalemer Tempel zur einzigen »legitimen« Stätte der Jahwe-Verehrung erklärt wird. Andere Kultstätten werden zu bloßen Heiligtümern degradiert oder geringschätzig als götzendienerisch abgetan und sollen angeblich von besonders tugendhaften Königen von Juda geschlossen worden sein. Dennoch bestätigten archäologische Funde die Existenz von mehreren Jahwe-Tempeln während des gesamten 1. Jahrtausends v. Chr., darunter einer aus dem 8. Jahrhundert v. Chr. in einer staatlich geförderten Festungsanlage in Arad an Judas Südgrenze, ein weiterer, von judäischen Immigranten im 5. Jahrhundert v. Chr. auf der ägyptischen Insel Elephantine errichteter und noch einer, der vom 5. bis zum 2. Jahrhundert v. Chr. vom Garizim im heutigen Westjordanland aus wirkte. In Forscherkreisen ist man sich einig, dass die Realitäten der Jahwe-Verehrung sehr viel breiter gefächert waren und wesentlich weniger zentralisiert, als es die Bibel glauben machen will.
Im Klartext, die hebräische Bibel bietet eine hochgradig ideologische und nicht selten unzuverlässige Darstellung der Vergangenheit. Sie erzählt ihre Geschichte aus der Sicht jerusalemfreundlicher Autoren und Redakteure, denn ausgelöst wurden die literarischen Aktivitäten, aus denen die hebräische Bibel, wie wir sie heute kennen, hervorging, durch das Trauma der Eroberung Judas im 6. Jahrhundert v. Chr. und Jerusalems allmähliche Erholung in der persischen Epoche. Mit der Wiederherstellung des Tempels der Stadt, der als religiöses und gleichzeitig administratives Zentrum fungierte, begann eine Blütezeit für die Priester und die Schriftgelehrten der Stadt. Während dieser »Zeit des Zweiten Tempels« wurden alte Texte umgestaltet und neue literarische Werke verfasst – und ein Großteil dieser Literatur wurde durch die Linse von Exil, Rückkehr und Wiedererstarken betrachtet. Auch wenn diese Texte zumeist das Exil und die Rückkehr als alle Judäer betreffendes Ereignis darstellen, war das nicht der Fall. Nur die Eliten und einige aus den gebildeteren Kreisen waren nach Babylonien deportiert worden, und die Mehrzahl blieb dort.[6] Andere judäische Gruppen waren derweil bereits in den Jahren der politischen Unruhen nach Ägypten abgewandert, und viele weitere sollten noch in Städte entlang der florierenden Handelsrouten abwandern, die den östlichen Mittelmeerraum, Mesopotamien und die Levante durchzogen. Als sich die kulturellen Konturen im imperialen Gefüge nach Persien und dann nach Griechenland verschoben, wurden Aramäisch und Griechisch die vorherrschenden Sprachen in den jüdischen Gemeinden (wie die Menschen judäischer Abstammung inzwischen genannt wurden). Folglich lasen beziehungsweise hörten viele jüdische Gruppen außerhalb des römischen Palästinas zu Anfang der nachchristlichen Zeit ihre heiligen Texte in aramäischen und griechischen Übersetzungen.
Unter ihnen waren auch Mitglieder der Jesus-Bewegung – einer noch unbedeutenden jüdischen Sekte, deren Anhänger glaubten, dass ihr hingerichteter Meister von den Toten auferstanden sei und so die bevorstehende Ankunft des Gottesreiches und den damit verbundenen weltweiten Frieden und die weltweite Gerechtigkeit eingeläutet habe. Entstanden war die Bewegung im römischen Palästina, bekam aber auch Zulauf aus jüdischen und nicht jüdischen Gemeinden überall im Römischen Reich. Obwohl uns diese Bewegung besser bekannt ist unter dem Namen Christentum, blieb sie noch mehrere Generationen lang vordergründig eine jüdische Sekte, und ihre Mitglieder betrachteten ganz selbstverständlich die heute zur hebräischen Bibel gehörenden Texte als ihre heiligen Schriften.
Wie andere jüdische Gruppierungen brachten die frühesten Christen auch eigenes Schrifttum hervor, darunter die Texte, die am Ende das Neue Testament bildeten. Diese zwischen Mitte des 1. und dem frühen 2. Jahrhundert in griechischer Sprache verfassten Texte waren schnell im ganzen Römischen Reich in Umlauf. Die frühesten sind von Paulus Mitte der 50er-Jahre an christliche Gruppen in Städten im östlichen Mittelmeerraum geschriebene Briefe, zwei bis drei Jahrzehnte nach der Hinrichtung Jesu. Darin drängt Paulus seine Leser, sich bereit zu machen für bevorstehende wundersame Veränderungen. Die Evangelien von Matthäus, Markus und Lukas (als die man sie bald kannte) bieten vielfältige Darstellungen von Jesu Leben, übernatürlichen Kräften und Lehren. Sie wurden in den späteren Jahrzehnten des 1. Jahrhunderts verfasst, während das Johannesevangelium um das Jahr 100 datiert ist. Bis zum frühen zweiten nachchristlichen Jahrhundert waren auch die übrigen Texte, die wir heute im Neuen Testament finden, fertiggestellt, darunter auch einige, die fälschlich Paulus zugeschrieben werden, andere, die angeblich von Jüngern Jesu geschrieben worden waren, sowie der apokalyptische Bericht über die zu erwartende kosmische Umwälzung, die unter dem Namen Offenbarung des Johannes oder Geheime Offenbarung bekannt ist. Diese Texte waren bei Weitem nicht die einzigen verlässlichen Evangelien, Briefe und »Offenbarungen«, die unter christlichen Gemeinden in Umlauf waren, doch sollten sie die wichtigsten werden.[7] Bis zum 3. Jahrhundert wurden sie immer häufiger als neues »Testament« (oder neuer »Bund«) bezeichnet – ein Etikett, das auf ihren gehobenen Status als heilige Schriften verweist, die das alte »Testament« aus den jüdischen Ursprüngen des Christentums zugleich vervollständigten und in den Schatten stellten. Zusammen genommen auch unter dem Begriff »Heilige Schrift« (griechischta biblica) bekannt, wurde die Bibel das wohl bedeutendste Buch in der Geschichte der Menschheit – und seine Gottheit der Gott der westlichen Kultur.
Gott wird nirgendwo in der Bibel ein Körper abgesprochen. Er wird einfach vorausgesetzt – ob nun Sterbliche das Privileg hatten, einen Blick darauf zu erhaschen, oder nicht. Und den biblischen Texten zufolge hatten viele dieses Privileg. Nach ihrem Auszug aus Ägypten war eine Abordnung von israelitischen Ältesten auf den Sinai gestiegen und hatte zunächst Gottes Füße zu Gesicht bekommen und dann auch ihn selbst. Unter ihnen war natürlich Mose, der sich regelmäßiger Begegnungen mit Gott erfreuen konnte und mit ihm redete »von Angesicht zu Angesicht, wie einer mit seinem Freund spricht«.[8] Mose ist nicht der Einzige, der sich rühmen durfte, Gottes körperliche Gegenwart erfahren zu haben. In der Genesis geht Abraham ein Stück mit ihm, und Jakob trägt einen Ringkampf mit ihm aus. In den Büchern, die ihre Namen tragen, sehen Jesaja und Ezechiel jeweils Gott auf seinem Thron sitzen, während Amos ihn in einem seiner Tempel stehen sieht. Jesus rühmt sich in den Evangelien, Gott geschaut zu haben, und es wird berichtet, dass er sich nach seiner Himmelfahrt an seine rechte Seite setzte. Es ist eine kameradschaftliche Paarung, die mehrere Mitglieder der Jesus-Bewegung gesehen haben wollen, darunter ein redseliger junger Mann namens Stephanus in der Apostelgeschichte sowie der verzückte, wenn auch zu Tode erschrockene Autor der Offenbarung, bekannt unter dem Namen Johannes von Patmos. Beide sehen Gott im Himmel thronen, mit Christus sitzend beziehungsweise stehend neben ihm.[9] In all diesen biblischen Geschichten – und in noch vielen weiteren – war es schlicht eine gegebene Tatsache, dass Gott einen Körper besaß. Das Spektakuläre war nur, dass er es Menschen erlaubte, ihn zu schauen. Das war ein so seltenes Privileg, dass man in der Zeit des Zweiten Tempels mehr und mehr davon ausging, dass Gott seinen Körper lange vor der Welt verborgen gehalten hatte, was ihn den Blicken der meisten Sterblichen entrückt und damit unsichtbar gemacht hatte.[10]
Doch ist ein nicht gesehener Körper nicht dasselbe wie ein nicht existierender Körper. Der Entzogenheit Gottes lag eine religiöse Bestimmung zugrunde, die sich in frühere Versionen der Zehn Gebote aus der Zeit des Zweiten Tempels eingeschlichen hatte: »Du sollst dir kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde.«[11] Es ist ein bemerkenswerter Einschub, denn er legt nahe, dass konkrete Bildnisse von Gott in der israelitischen und judäischen Religion einmal eine Norm waren – andernfalls bestünde ja keine Notwendigkeit für ein Verbot.[12] Und darin unterschieden sich Israel und Juda auch nicht von ihren Nachbarn, denn neben weiteren sakralen Gegenständen spielten Statuen und Figürchen schon lange eine Rolle in den südwestasiatischen Religionen. Es bestand allgemeines Einvernehmen, dass die Götter zwar in ihrem »natürlichen« Lebensraum für gewöhnlich nicht zu beobachten waren. Doch sie konnten sich herablassen, sich in der irdischen Sphäre als konkrete Bildnisse in einer Kultstätte (einem Ort der Anbetung) zu offenbaren. Ein Kultbild war mehr als nur ein Symbol oder eine Repräsentation, es war eine materielle Manifestation göttlicher Gegenwart. Die Statue wurde nicht bloß mit der Gottheit identifiziert, sie war die Gottheit.
Nur allzu leicht möchte man dies als Kennzeichen für einfältige oder »primitive« religiöse Kulturen abtun. Doch das wäre eine Verkennung der Menschen früherer Zeiten – und ihrer Götter. Wir haben es hier mit einer Welt zu tun, in der die Wahrnehmung der Realität weder irgendwie eingeschränkt noch allein durch das Physische bestimmt war. Sie deckte vom Natürlichen bis zum Übernatürlichen ein breites Spektrum ab. Die kosmische Membran, die das Irdische vom Jenseitigen trennte, war äußerst porös und dehnbar, sodass das Göttliche in all seinen unzähligen Formen durchbrechen konnte in die Welt der Menschen, ob dies nun als eigenartiger Geruch im Wind, eine aus dem Augenwinkel flüchtig bemerkte Gestalt wahrgenommen oder an einer kraftvollen Stelle in der Landschaft gespürt wurde. Doch am greifbarsten war das Göttliche, wenn es sich in Bildnissen der Götter manifestierte. Im Zusammenwirken von Göttern und Gläubigen, unterstützt durch rituelles Fachpersonal, ging die irdische Substanz der Statue in eine andere Seinskategorie über. Wie Ritenexperten in Mesopotamien es ausdrückten, war die Statue »im Himmel geboren und auf der Erde gemacht«.[13] Als außerordentliche Wesen waren Götter demnach keinen Einschränkungen unterworfen. Sie konnten ungesehen und auf Distanz im Himmel bleiben und sich gleichzeitig als Sterne am Himmelszelt, Statuen in Tempeln, Figuren in Privathaushalten oder unbemerkte, aber spürbare Kräfte offenbaren, die die irdische Sphäre durchdrangen.[14]
Das biblische Bilderverbot wird oft als Zeichen für die körperlose Natur Gottes angesehen, was ihn deutlich aus dem Kreis aller anderen Gottheiten in der Welt des Altertums heraushebt – er lässt sich unmöglich in Ton, Metall, Holz oder Stein bannen. Doch die Propagierung von bilderloser Verehrung in der Bibel lässt auf nichts dergleichen schließen. Die Kulte diverser ägyptischer, assyrischer, babylonischer und phönizischer Gottheiten durchlebten ebenfalls Zeiten anikonischer Verehrung, obwohl sie als Gottheiten mit einem Körper galten.[15] Die Untersagung göttlicher Bildnisse in den Zehn Geboten weist vielmehr auf eine zunehmende Betonung der Entzogenheit von Gottes Körper hin, wie eine eng damit verbundene Überlieferung in Deuteronomium nahelegt. Hier erinnert Mose die Israeliten an ihre Begegnung mit Gott auf dem Weg ins Gelobte Land, als sie sich in der Wüste am Fuß des heiligen Berges versammelt hatten, um sich anzuhören, wie die Gottheit die Bedingungen für den Bund präzisierte. Nachdem er auf den Berggipfel herabgestiegen war, war Gott selbst den Blicken entzogen, alles, was die Israeliten sahen, waren das himmlische Feuer und die dunkle Wolke, die den Gipfel umhüllte. »Nehmt euch … gut in Acht!«, sagt Mose. »Denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tag, als der Herr am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch sprach. Lauft nicht in euer Verderben und macht euch kein Kultbild, das irgendetwas darstellt …«[16] Diesem Text zufolge sollte die bilderlose Gottesverehrung unbedingt Vorrang haben vor einer Statue einer Gottheit, die die Israeliten ja gar nicht gesehen, sondern nur reden gehört hatten.
Die aufkommende theologische Betonung der Verborgenheit Gottes sollte am Ende der abstrakten, körperlosen Gottheit im Judentum und im Christentum den Weg bereiten – einer Gottheit, die nicht länger von Feuer und Wolken verhüllt wurde, sondern nur noch ein wundersames, unergründliches Mysterium war. Doch sind Judentum und Christentum nachbiblische Religionen, und ihre entkörperte Gottheit ist eine spätere Neuinterpretation eines Gottes, der alles andere als rätselhaft war. Denn der Gott der Bibel hatte nicht nur einen Körper, sondern auch einen Namen, eine Vorgeschichte, eine Familie und jede Menge Gefährten im Himmel.
Lebenslauf
Gottes wirklicher Name ist Jaho. Oder Jahu. Vielleicht auch nur Jah. Genau lässt sich das unmöglich sagen, denn die ursprünglichen, Hebräisch sprechenden Anhänger dieses Gottes benutzten eine Schrift, in der es nur Konsonanten gab, ähnlich wie das moderne Hebräisch und Arabisch. Deshalb erscheint in alten Inschriften der Name des Gottes nur als »Jhw« »Jh« und »Jhwh«, und wir wissen nicht, wo wir die Vokale setzen sollen. In den alten hebräischen Texten in der Bibel findet sich häufiger die längere Form JHWH, doch obwohl viele dieser Texte im Gottesdienst laut vorgelesen wurden, ist kaum zu ermitteln, wie der Name ausgesprochen wurde, denn bis zum 3. Jahrhundert v. Chr. war er, nachdem man diesen Gott bereits seit Jahrhunderten verehrt hatte, für unsagbar erklärt worden – ein Name, zu gefährlich und machtvoll, als dass ein menschlicher Mund ihn aussprechen könnte. Spätere Gelehrte in der griechisch-römischen Welt hatten solche Skrupel nicht. Sie setzten ihre Vokale, und so wurde der Gott unter dem Namen Jahwe bekannt.[17] Aufgrund der gründlichen theologischen Überarbeitung der Schriften, die heute die hebräische Bibel bilden, wird Jahwe häufig als Einzelgänger gesehen ohne jegliche göttlichen Kollegen oder Familie. Doch die religiösen Gegebenheiten seiner frühen Biografie sahen ganz anders aus.
Als eine von vielen Gottheiten in der Levante der Späten Bronze- und Frühen Eisenzeit war Jahwe ursprünglich in einer polytheistischen Welt verwurzelt – und fühlte sich über weite Strecken seines frühen Werdegangs auch ganz wohl damit. Es war eine Welt, in der man sich die Götter als weitläufige Hausgemeinschaft vorstellte, die weitgehend die familiären Bande und gesellschaftlichen Strukturen ihrer menschlichen Anhänger widerspiegelte. In den meisten levantinischen Gesellschaften wurde dieses Pantheon angeführt vom betagten Stammvater des Kosmos, dem Gott El – ein Name, der sowohl als Eigenname wie auch als semitische Gattungsbezeichnung für »Gottheit« diente. Unter ihm rangierte eine jüngere Generation von Gottheiten, eine jede in der Verwaltung des Universums mit einem speziellen Ressort betraut – von Stürmen, Meeren, Sonnen- und Mondlicht bis hin zu Fruchtbarkeit, Geburt, Kriegführung und Tod. Sie standen sozusagen an vorderster Front und waren die prominentesten Götter der levantinischen Gesellschaften im Altertum. Gleichzeitig waren sie auch den politischen und territorialen Identitäten ihrer Anhänger am engsten verbunden.
Dank einer besonderen Fülle von Literatur aus dem 14. und 13. Jahrhundert v. Chr., die in den Überresten eines Stadtstaates an der syrischen Küste mit Namen Ugarit gefunden wurde, ist Els mehrstufige Hausgemeinschaft stärker ins Blickfeld gerückt. Er galt als der sanftmütige Vater der Götter, der sich, begleitet von seiner Gemahlin, der Mutter-Gottheit Athirat, aus dem Alltagsgeschäft heraus schon halbwegs aufs Altenteil zurückgezogen hatte. Miteinander hatten die beiden »Siebzig Söhne« – eine Sammelbezeichnung für die Gottheiten in der ersten Reihe. Zu denen gehörten Ugarits Schutzpatron, der mächtige Sturmgott Baal, und seine Schwester Anat, eine Furcht einflößende Kriegerin, ebenso wie der ungestüme Meeresgott Yam und der König der Unterwelt und Totengott Mot. Jeder von ihnen lebte in seiner eigenen Domäne am äußersten Rand der himmlischen Sphäre. Unter diesen waren die Gottheiten von geringfügigerer Bedeutung angesiedelt, die für die praktischen Fertigkeiten und die Künste zuständig waren, darunter Architektur, Heilkunst, Musik und Magie. Noch weiter unten folgte eine Ansammlung göttlicher Diener und Boten, die mal die Götter bedienten und mal zwischen der himmlischen und der irdischen Sphäre hin- und herpendelten. Trotz ihrer unterschiedlichen Ränge trafen die Götter unter dem Vorsitz Els in seiner Eigenschaft als höchster Gott im Götterrat beziehungsweise in der Götterversammlung zusammen, um über Götter und Menschen betreffende Angelegenheiten zu entscheiden.
Ugarits Pantheon war typisch für die levantinischen Religionen im späten 2. und frühen 1. Jahrtausend v. Chr., als sich frühe Formen der Jahwe-Verehrung herausbildeten. Gestalt und Zusammensetzung des Pantheons wurden bestimmt von der sehr menschlichen Vorstellung, dass ein Gott, der von allen anderen isoliert war, auch aller Vorzüge der Zusammenarbeit, des Prestiges und der Familienzugehörigkeit beraubt war. Kurzum, es bedeutete, gesellschaftlich gesehen ohnmächtig zu sein und damit, rundheraus gesagt, nutzlos für die Sterblichen. Vor diesem kulturellen Hintergrund erscheinen gewisse theologische Behauptungen, Jahwe sei immer schon ein Einzelgänger gewesen, gelinde gesagt wenig plausibel. Und dann offenbart ja auch die Bibel selbst, dass dieser Gott alles andere als alleine dastand.
Ein altes lyrisches Fragment im Buch Deuteronomium siedelt nicht nur Jahwe in einem Pantheon an, es enthüllt auch, wer genau sein Vater war. Geschildert wird die Trennung der Menschen in einzelne Gruppen (»Völker« beziehungsweise »Nationen«), und dann wird erklärt, warum jede Gruppe eine bestimmte Gottheit als Beschützer zugeteilt bekam. Die Gottheit, die diese Arbeitsteilung unter den Göttern überwacht, ist indes nicht Jahwe, sondern Elohim – ein Beiname Els, der seine Rolle als »höchster« Gott im Pantheon widerspiegelt:
Als der Höchste die Völker als Erbe verteilte,als er die Menschheit aufteilte,legte er die Gebiete der Völkernach der Zahl der Gottessöhne fest;der Herr [Jahwe] nahm sich sein Volk als Anteil,Jakob [Israel] wurde sein Erbteil.[18]
Hier taucht Jahwe als nur einer von Els vielen Gottessöhnen auf.[19] Auch andere alte Dichtungen in der Bibel klären uns über Jahwes frühen Werdegang auf. Auch sie verwenden mythische Motive, die den theologischen Prioritäten späterer biblischer Autoren und Redakteure zuwiderlaufen, was darauf schließen lässt, dass sie auf ältere Überlieferungen über die frühe Biografie des biblischen Gottes zurückgreifen. Weit davon entfernt, in Jahwe den höchsten Herrn und Schöpfer des Alls zu sehen, stellen sie ihn als einen untergeordneten, wenn auch hitzigen Sturmgott dar am Rand der bewohnten Welt, an einem uralten Ort, der mal Seir, mal Paran und mal Teman genannt wird – in der Bibel als gefährliches, bergiges Ödland ausgewiesen, dem Anschein nach südlich der Negev-Wüste gelegen, jenseits des Toten Meeres im heutigen südlichen Jordanien (früher Edom).[20]
Als Gott eines solchen Ortes weist Jahwe Ähnlichkeit zu einer Gruppe von Unruhe stiftenden Gottheiten auf, die in der südlichen Levante als die Schaddai-Götter bekannt waren, ein Name, der sie als Gottheiten der »Steppe« oder der »Wüste« ausweist. Und natürlich waren auch sie El untergeordnet. Eine bemerkenswerte Entdeckung in Deir’Alla im östlichen Jordantal, wo sich im Altertum eine Stadt befand, vermittelt uns einen, wenn auch nur flüchtigen, Eindruck von diesen göttlichen Wüstenbewohnern. In einem bei einem Erdbeben um das Jahr 800 v. Chr. zerstörten Gebäude fanden Archäologen mehrere Fragmente einer umfangreichen Inschrift, die einmal einen Wandverputz geschmückt hatte. Zusammengepuzzelt schildert sie eine Reihe von Visionen eines Sehers mit Namen Bileam ben Beor, der später einen Gastauftritt im biblischen Buch Numeri als Prophet Els haben sollte.[21] Aus der Inschrift erfahren wir, dass eine Abordnung von Gottheiten Bileam gewarnt hatte, dass die Schaddai-Götter sich gegen ihren Hochgott verbündet hatten und drohten, den Himmel mit dichten Wolken abzuriegeln und damit die Welt ins Chaos zu stürzen. »So wird es geschehen, mit keinen Überlebenden, niemand hat je gesehen, was du vernommen!«, verkünden die Götter dem in Panik erstarrten Seher.[22]
Während die himmlische Rebellion und das damit einhergehende kosmische Unheil typisch für südwestasiatische Mythen sind, fällt hier vor allem die Darstellung von El als Lehensherr der Schaddai-Götter ins Gewicht, denn das entspricht einem der wichtigsten Titel, die El in der hebräischen Bibel gegeben werden. In der Genesis wird der Gott der israelitischen Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob nicht mit dem Namen Jahwe bezeichnet, sondern als El Schaddai, worauf er selbst Wert legt: »Ich bin El-Schaddai«, sagt der Gott der Bibel zu Abraham. »Ich will einen Bund stiften zwischen mir und dir, und ich werde dich über alle Maßen mehren.«[23] Ein ähnliches Versprechen gibt er später Jakob: »Ich bin El-Schaddai. Sei fruchtbar und vermehre dich! Ein Volk, eine Schar von Völkern soll aus dir werden, Könige sollen aus deinen Lenden hervorgehen.«[24] Üblicherweise (allerdings fälschlich) mit »allmächtiger Gott« übersetzt, bedeutet El Schaddai so etwas wie »Gott der Wüste«. Es scheint der Name einer bekannten lokalen Erscheinungsform des großen Hochgottes El im Gebiet des heutigen Palästina, Israel und Jordanien gewesen zu sein. Es ist El, dem Abraham, Isaak und Jakob im Land Kanaan Altäre bauen und Opfer darbringen und es damit als Gebiet kennzeichnen, das ihre von Gott in Aussicht gestellten Nachfahren einmal erben werden. Und es ist auch El, den sogar diese biblischen Autoren als Gott ihrer mutmaßlichen Vorfahren erkennen.
In Wissenschaftskreisen wird schon lange vermutet, dass El und nicht Jahwe der ursprüngliche Gott des Volkes war, das in der Bibel als Israel bezeichnet wird. Sein Name erscheint nicht nur in den Überlieferungen über die Stammväter, er ist auch in dem Wort Israel selbst enthalten (jisra-el) und wird explizit genannt in dem Namen eines Tempels, den Jakob in der Stadt Sichem im Gebiet des heutigen Westjordanlands baut: »Dort errichtete er einen Altar und nannte ihn: El, Gott Israels.«[25] Erst nach und nach sollte Jahwe seinen Vater El verdrängen, indem er ihn als Oberhaupt des Pantheons ablöste. Doch wie genau das ablief, bleibt frustrierend unklar. Es wäre möglich, dass der Übergang mit den soziopolitischen Umständen zusammenhing, die zu Beginn des ersten vorchristlichen Jahrtausends zur Entstehung der Königreiche Israel und Juda Anlass gaben. Mit Königtum und Staatsführung gingen auch Ideologien von militärischer Macht einher – und die Notwendigkeit für Könige, sich als von Furcht einflößenden göttlichen Mitkämpfern unterstützte Krieger zu präsentieren. Als Sturmgott war Jahwe von Natur aus ein Kriegsgott, ausgestattet mit den Waffen Donner, Blitz und Regenwolken, und auf Jahwes persönliche Schutzherrschaft waren die Könige von Israel und Juda aus. Als Schutzgott dieser Könige wurde er automatisch auch Staatsgott in ihren kleinen Reichen und in den alten Tempeln und Heiligtümern innerhalb ihrer Grenzen, deren wirtschaftliches und rituelles Gewicht die Ausübung königlicher Macht weiter förderte, mehr und mehr hervorgehoben.[26]
Zwar könnte dies die Priorisierung Jahwes von staatlicher Seite und sogar auch noch seine Aneignung von einigen der überkommenen Rollen, Titel und Heiligtümer Els erklären, doch ist immer noch unbekannt, wie beziehungsweise wann genau Jahwe im allgemeinen Bewusstsein zum Oberhaupt des Götterhimmels wurde – und es lässt sich unmöglich sagen, ob diese Sicht des Götterhimmels von den ganz normalen Menschen in Israel und Juda geteilt wurde, für die die religiösen Ideologien der Staatsmacht keine sonderliche Bedeutung hatten. Mit größerer Gewissheit kann man sagen, dass im kulturellen Gedächtnis El in seiner traditionellen Rolle fortbestand, da er offensichtlich zu tief verwurzelt war, um aus den religiösen Überlieferungen getilgt zu werden, aus denen biblische Autoren und Redakteure in der Folge schöpften. Also bediente man sich einer anderen theologischen Strategie. In einer eklatant durchschaubaren Imagekampagne versuchten einige biblische Autoren, Jahwes offensichtliche Verdrängung seines mythischen Vaters herunterzuspielen, indem sie behaupteten, er sei von jeher El gewesen: »Ich bin der Herr [Jahwe]«, sagt er in Exodus zu Mose. »Ich bin Abraham, Isaak und Jakob als El-Schaddai erschienen, aber unter meinem Namen Herr [Jahwe] habe ich mich ihnen nicht zu erkennen gegeben.«[27]
Jahwes Ursprünge mögen in der Tat recht undurchsichtig sein, doch bis schätzungsweise zum 9. Jahrhundert v. Chr. war er fest etabliert als Oberhaupt der Pantheone zweier Königreiche auf dem Gebiet, das heute das moderne Israel und Palästina umfasst: Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem und nördlich davon Israel, das weitgehend von der Stadt Samaria aus regiert wurde, dessen eindrucksvolle Überreste im heutigen Westjordanland liegen. Von den beiden war das Königreich Israel das bei Weitem stärkere. Mit zehnmal so vielen Einwohnern wie Juda gründete seine florierende Wirtschaft auf den fruchtbaren Böden seines Hügellands und seiner üppigen Ebenen, die das Olivenöl, den Wein und den Weizen hervorbrachten, von denen Wirtschaft und Handel abhingen. Israel war in der südlichen Levante ein ziemliches Schwergewicht, während das trockenere und staubigere Juda meist nur wenig mehr war als sein kleinerer, schwächerer und ärmerer Nachbar.[28] Die beiden Königreiche waren nur zwei aus einer ganzen Reihe regionaler Staatswesen, darunter die Philister, die entlang der Küste des heutigen südlichen Israels und des Gazastreifens lebten, die Königreiche Ammon, Moab und Edom im heutigen Jordanien, die Phönizier, deren wichtigste Städte im Gebiet des heutigen Libanon und der südsyrischen Küste lagen, und die Armenier, die den Großteil des übrigen Syrien beherrschten. Bis zum 8. Jahrhundert v. Chr. waren diese Völker der riesigen Weite des Assyrischen Reiches einverleibt worden, das sich inzwischen von seiner mesopotamischen Heimat im heutigen Irak über die uns heute als Iran, Türkei, Syrien, Libanon, Israel, die Palästinensergebiete, Jordanien und Oberägypten bekannten Territorien erstreckte.
Die imperiale Unterwerfung der Königreiche Israel und Juda vermochte die diesen kleinen Gesellschaften in der südlichen Levante eigenen kulturellen Besonderheiten indes nicht zu verdrängen. In beiden Ländern – die nicht nur eine häufig umstrittene Grenze verband, sondern auch eine Sprache (Hebräisch), Verträge und Handelsabkommen, ähnliche gesellschaftliche und religiöse Praktiken sowie Mythen über gemeinsame Vorfahren und Götter – wurde Jahwe als »nationale« beziehungsweise Staatsgottheit und als Schutzgott des jeweiligen Königshauses gefeiert. Neben ihm wurde allerdings noch eine Reihe anderer Gottheiten verehrt, die in der polytheistischen Lenkung des Kosmos gewiss auch ihre Rolle spielten und deren bedeutendste Jahwes Ehefrau war, die Göttin Aschera. Die biblischen Autoren konnten nicht umhin preiszugeben, dass sie neben Jahwe in seinen Tempeln in Jerusalem und Samaria verehrt wurde. Und auch Inschriften aus dem 8. Jahrhundert v. Chr. zeugen von Gläubigen, die um den Segen von »Jahwe und Aschera« nachsuchten. Die Göttin war eine lokale Neuauflage einer der ältesten Gottheiten in der Levante, die von zahlreichen Kulturen in der gesamten Region über Jahrtausende hinweg innig geliebt worden war. Tatsächlich verrät schon ihr Name etwas über ihr früheres Leben: »Aschera« ist die hebräische Fassung von »Athirat«, des Namens der Mutter der Götter in Ugarit – und Els Gemahlin. Es sieht ganz so aus, als hätte Jahwe, als er seinen mythologischen Vater ablöste, dessen Frau gleich mit übernommen. Während sich die häuslichen Arrangements dieses biblischen Ödipus für eine Gottheit des Altertums und ihre Anhänger vollkommen unkompliziert dargestellt haben dürften, erwiesen sie sich für spätere biblische Autoren als untragbar. Sie zettelten daher eine so entschiedene Diffamierungskampagne gegen die Göttin an, dass sie am Ende für alle Zeit aus dem Himmel ausgeschlossen wurde.
Historisch gesehen spiegelt der Sturz der Göttin weitgehend den Niedergang des traditionellen, staatlich geförderten Polytheismus wider – ein Niedergang, der ausgelöst wurde von der assyrischen Eroberung des Königreichs Israel um 722 v. Chr. und der Zerstörung Judas durch die Babylonier im Jahr 587 v. Chr. Als Schutzgottheit und göttlicher Krieger für seine Völker hatte Jahwe allem Anschein nach versagt. Das löste in der Folge in bestimmten Priester- und Autorenkreisen, einige davon im Exil, eine tiefgreifende theologische und kulturelle Umorientierung aus. Sie begannen allmählich damit, die in der hebräischen Bibel reflektierten zentralen Überlieferungen zu prägen, und schufen am Ende ein neues Bild von ihrem Gott – dem Gott, aus dem dann der Gott der Bibel wurde. Seine Königreiche mochten zwar zerstört sein, doch Jahwe selbst war nicht besiegt, so machten sie geltend. Vielmehr habe er den Sturz der Staaten Israel und Juda selbst arrangiert als Strafe für das religiöse Fehlverhalten seiner Anhänger, die Verehrung anderer Götter. Jahwe wurde ab jetzt als Gott gezeichnet, der keine anderen Götter neben sich duldete, und die Jahwe-Verehrung wurde zunehmend monotheistisch.
Bibelleser sind womöglich verblüfft über diesen kurzen historischen Abriss von Jahwes frühem Werdegang. Schließlich bestehen die redaktionellen Stimmen, die schon in frühester Zeit die Weichen für die biblische Darstellung der Vergangenheit stellten, auf ihrer alternativen Version, in der behauptet wird, dass Gott von Anfang an ein unveränderlicher Einzelgänger war, ohne himmlische Kollegen, ein universales Wesen mit der alleinigen Verfügungsgewalt über den Kosmos, seinen Verlauf und seine Geschöpfe. Aber diese Geschichte ist das Produkt eines späteren theologischen Weltbilds – und sein Narrativ der Religionsgeschichte ist unzuverlässig. Die Texte, aus denen sich die Bibel zusammensetzt, waren nie als kohärente Darlegung der Vergangenheit gedacht, und sie stimmen weder in den zentralen Merkmalen noch in den geringfügigeren Details der religiösen Landschaft, die sie präsentieren, überein. So, wie ein Atlas nur eine konstruierte Version der Welt bieten kann, zusammengestellt aus einer Auswahl von politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Präferenzen (den wechselnden Namen und Grenzen von Nationen, stillgelegten Steinbrüchen und Bahnlinien) und Momentaufnahmen (den veränderlichen Konturen von Küstenlinien, Polkappen, Wäldern und Wüsten), besteht auch die Bibel aus einer breit gefächerten Sammlung von Material, das im Lauf der Zeit unter dem Einfluss konkurrierender Ideologien hervorgebracht und bearbeitet wurde.
Indem wir Gottes Körper kartografieren, statt der Bibel selbst, können wir die Verwandlung dieser uralten levantinischen Gottheit in den Gott, der uns heute vertrauter ist, besser nachvollziehen. Trotz aller theologischen Veränderungen, die sich mit dem alten Judentum und frühen Christentum ergaben, ist ein Aspekt dieser Gottheit unverändert geblieben: seine Körperlichkeit. Weil er einen Körper hat, hat er in all den Jahrhunderten der Entstehungsgeschichte der Bibel als kraftvoller gesellschaftlicher Vermittler im Leben seiner Anhänger fortbestanden. Indem wir den Körper dieser uralten Gottheit erkunden, wie seine Anhänger ihn sich vorstellten, finden wir Zugang zu ihrer Welt. Wir können den wahren Gott der Bibel kennenlernen.
Teil I
Füße und Beine
2 Geerdet
Gerade einmal 65 Kilometer nordwestlich von Aleppo liegen in Nordsyrien hoch über einem Tal die Überreste eines Himmelstores: ein antiker Tempel, der Schnittpunkt zwischen himmlischer und irdischer Sphäre. Die Kolossalstatue eines Löwen, der seine Zähne und Klauen zeigt, bewacht den Zugang. Von schwarzen Basaltmauern umgeben und mit hellen Steinplatten gepflastert, ist der Tempel der Wohnsitz einer seit Langem verlorenen Gottheit, die die Syro-Hethiter, enge kulturelle Verwandte der alten Israeliten und Judäer, anbeteten. Dieser im 8. Jahrhundert v. Chr. teilweise zerstörte und 2018 noch einmal bei einem türkischen Luftangriff verwüstete Tempel in ’Ain Dara ist das archäologische Beispiel, das dem Gotteshaus, das einst zur selben Zeit in Jerusalem stand, wohl am Nächsten kommt. Sein Aufbau und seine Ikonografie passen so genau auf die biblische Beschreibung des salomonischen Tempels, als ob ihnen derselbe göttliche Entwurf zugrunde gelegen hätte.
Als ich den Tempel im Jahr 2010 besuchte, kurz bevor der Krieg in Syrien begann, sprenkelten wilde Sommerblumen das Gras rund um den Tempel und warfen ihre Schatten auf die Füße der Wächterfiguren und Löwen, die die Fundamente seiner in sich zusammengebrochenen Mauern säumten. Ich zog meine Schuhe aus und ging barfuß die warmen, niedrigen Stufen zum Eingang des äußeren Tempelhofes hinauf. Und dann sah ich sie. Zwei riesige Fußabdrücke, jeder etwa einen Meter lang, in die Kalksteinschwelle hineingemeißelt; ordentlich nebeneinandergestellt zeigten sie in den Tempel hinein. Die Zehen und Ballen waren weich eingetieft, sanft gerundet, als ob sie fest in feuchten Sand gedrückt worden wären. Ich trat in diese gewaltigen und doch so zarten Abdrücke. Sie ließen meine eigenen Füße winzig erscheinen. Ich stand in den nackten Fußspuren eines Gottes. Vor mir sah ich, wie groß sein Schritt in den Tempel hinein gewesen war: Der linke Fuß hatte ein paar Meter weiter im Inneren des Tempels wieder einen Abdruck hinterlassen, diesmal im Eingang zum Vorraum; und etwa noch einmal zehn Meter weiter vorn war der rechte Fußabdruck zu sehen, in der Cella – dem Allerheiligsten, in dem der Gott wohnte [Abb. 58].[29] Er war zu Hause angekommen, und ich war hier, um das zu bezeugen.
Ich stand in der beeindruckenden Residenz einer Gottheit, deren genaue Identität schon vor langer Zeit in Vergessenheit geraten war. Doch obwohl sie allmählich aus dem Blickfeld der Menschen verschwunden war, wurde ihre körperliche Anwesenheit eindeutig durch jene riesigen Fußabdrücke belegt, die nur in eine Richtung führten: hinein. Spuren heraus gab es nicht; kein Anzeichen dafür, dass die Gottheit den Tempel verlassen hätte. Vielmehr signalisierten die Fußabdrücke ihre dauerhafte Gegenwart im Tempel. Die Wahrnehmung stofflicher Präsenz bildet den Kern antiker Vorstellungen über die Götter. Man nahm sie als real wahr, was mit der Vorstellung verknüpft war, dass jedes Ding oder Wesen in einer konkreten Form gegenwärtig und verortet sein muss, wenn es bestehen – und fortbestehen – soll. Es muss mit und in der physischen Welt verbunden sein. Die Fußabdrücke in ’Ain Dara vermittelten genau dieses Bewusstsein der Verortung. Sie markierten den konkreten Platz der Gottheit in der Welt der Menschen. An diesem Punkt, an dem sich himmlische und irdische Gefilde trafen, war der Gott manifest und für alle, die ihn anbeteten, zugänglich. Er nahm Kontakt mit ihnen auf.
Dass ein Fußabdruck es vermag, komplexe Vorstellungen über die göttliche Gegenwart in der Welt der Menschen zu vermitteln, sagt ebenso viel darüber aus, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, wie darüber, was es bedeutet, ein Gott zu sein. Wenn wir Fußabdrücke sehen, erkennen wir sie als materielle Spuren des Daseins; sie sind ein eingefrorener Moment der Bewegung oder Bewegungslosigkeit; das Erinnerungsmal einer Realität – wie flüchtig auch immer –, mit dessen Hilfe wir uns selbst in der Welt und mit den Menschen um uns herum einrichten. Fußabdrücke fangen etwas vom Außergewöhnlichen und vom Vertrauten am menschlichen Leben ein, vom Geplanten und vom Zufälligen, vom Beständigen und vom Veränderlichen. Die Fußstapfen, die ein Kleinkind begeistert im Sand oder Schnee hinterlässt. Die Schuhabdrücke, mit denen sich Berühmtheiten in den Zementflächen auf dem Hollywood Boulevard verewigen. Schlammspuren, die von der Hintertür über die Küchenfliesen führen. Die Fußabdrücke einer Gruppe des Australopithecus afarensis, eines unserer frühesten aufrecht gehenden Hominidenvorfahren, wie sie vor dreieinhalb Millionen Jahren im heutigen Laetoli in Nordtansania in Vulkanasche erstarrten.[30] Der berühmte Stiefelabdruck des Apollo-11-Astronauten Buzz Aldrin im Staub der Mondoberfläche. Ein Fußabdruck ist nicht einfach eine Spur oder ein Symbol des Fußes. Er ist eine Materie gewordene Erinnerung daran, dass der zugehörige Mensch die Fläche betreten hat, auf der der Abdruck erscheint, und er beschwört die Anwesenheit des ganzen Körpers – der gesamten Person – herauf.[31] Unsere Füße sind nicht einfach die anatomischen Sockel, auf denen wir stehen, oder die Bewegungswerkzeuge, mit denen wir laufen, sondern die Grundfesten unserer Anwesenheit in der Welt.





























