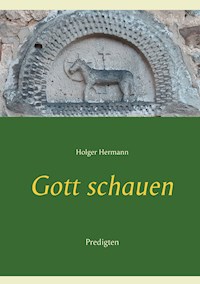
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Diese 43 Predigten und Andachten aus über 16 Jahren Tätigkeit in Espenau kreisen um die Sehnsucht, Gott in seiner Schönheit, seiner Treue, seinem Nahekommen und Mitgehen erfahren zu können. Sie halten fest an der Hoffnung, im Vertrauen auf Jesus, den auferstandenen Gekreuzigten, durch die dunklen Seiten des Lebens, wie Naturkatastrophen, Not und Krankheit, aber auch die Verborgenheit Gottes, hindurch letztlich und trotz allem den treuen und barmherzigen Gott erfahren zu können. Im Gebet und in der Teilhabe an den Sakramenten hineingenommen zu werden in die himmlische Liturgie oder den kosmischen Tanz vor dem Thron Gottes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Für Helga, Otto und Ella
Inhalt
Vorrede
Espenauer Predigten Mai 2004 bis Februar 2020
Füreinander beten, miteinander arbeiten
(1. Timotheus 2,1-6a)
Ich habe für dich gebeten...
(Lukas 22,32)
Ich bin der Herr, dein Arzt
(4. Mose 21,4-9)
Mutige Frauen
(2. Mose 1,15-22)
Folge mir nach!
(Lukas 9,57-62)
Bevor der Hahn kräht
(Markus 14,29-31.67.69-70)
Lord of the Dance
(2. Samuel 6,21)
„Beiß nicht gleich in jeden Apfel“
(1. Mose 3)
Von der Macht der Worte
(Jesaja 62,6-12)
Betet!
(2. Thessalonicher 3,1-5)
Sei mutig und stark!
(Josua 1,1-2.5b-9)
Herbei, o ihr Gläub’gen
(EG 45)
Unser Vater im Himmel
(Matthäus 6,5-15)
Wer ist mein Nächster?
(Lukas 16,19-31)
The Seven Stars
(Offenbarung 12,1-2a.5a)
Solches tut zu meinem Gedächtnis
(1. Korinther 11,23-26)
Wunder gibt es immer wieder
(Matthäus 9,18-26)
Neues Leben
(Psalm 103,1-5)
Gott loben, das ist unser Amt
(Psalm 148)
Der Herr hat seinen Engeln befohlen
(Psalm 91,1-2.11-12.14-16)
Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an
(Offenbarung 3,20)
Fürchte dich nicht!
(Offenbarung 1,9-18)
Espenauer Predigten März bis Oktober 2020 (Corona)
Draußen vor dem Tor
(Hebräer 13,12-14)
Verrückte Zeiten
(Markus 14,3-9)
Beziehungskrisen
(Johannes 19,16-30)
Hoffnung? - Hoffnung!
(Markus 16,1-8)
Hebt eure Augen in die Höhe und seht!
(Jesaja 40,26-31)
Frucht bringen
(Johannes 15,1-8)
Singt!
(2. Chronik 5,12-14)
Friede sei mit euch!
(Johannes 20,19-23)
Hier bin ich! Sende mich!
(Jesaja 6,1-8)
Das Leben siegt
(1. Mose 4,1-7.9b.25-26)
Zuversichtlich glauben
(Psalm 16)
Brot für die Welt
(Markus 8,1-9)
Andachten aus dem Espenauer Gemeindebrief 2011 bis 2020
Löwenhonig
(Richter 13-16)
Menschenopfer?
(Richter 11)
Beschneidung des Herzens
(Lukas 2,21)
Gipfelerlebnisse
(Matthäus 4,8; 5,1; 15,29; 17,1; 28,16)
Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten?
(Lukas 24,5-6)
Einige aber zweifelten
(Matthäus 28,17)
Lobpreis vor dem Thron Gottes
(Offenbarung 7,9-12)
Du hast einen weiten Weg vor dir
(1. Könige 19,7)
Anstelle eines Nachworts: Gott schauen
(1. Mose 28,15a)
Anmerkungen
Vorrede
Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie werden Gott schauen. (Matthäus 5,8) Warum mein Konfirmator mir diese Seligpreisung als Konfirmationsspruch mitgab1? Verheißung und Aufgabe ist er mir geworden. Letztlich aber geht es wohl nur so, dass wir wieder werden wie die Kinder, um eine derartige Erfahrung machen zu dürfen.
Gott schauen, oder wenigstens die schönen Gottesdienste des HERRN schauen können (Psalm 27,4):
Ich wünsche mir,
- dass Gottesdienste in ihrer Vielfalt ein Stück weit etwas vom himmlischen Gottesdienst widerspiegeln und in ihnen ein wenig vom Glanz des Reiches Gottes aufscheinen möge2;
- dass in der Feier des Abendmahls durch die Teilhabe der vielen an dem einen Leib Christi dieser Leib Gestalt gewinnt in der konkreten Ortsgemeinde3;
- dass das - gerade auch aber nicht nur liturgische - Gebet als der vornehmste Ort, an dem die Rechtfertigung des Sünders geschieht4, verstanden und geübt wird;
- dass mittels Lesungen und Predigt die Schönheit und der Reichtum des Wortes Gottes wahrgenommen und durch eigene Lektüre noch tiefer ausgeschöpft wird.
Gott schauen - seit über 16 Jahren ist das Lamm Gottes, das seit fast 900 Jahren das Tympanon an einem Portal der Hohenkirchener Kirche ziert, der erste Anblick auf dem Weg zum Gottesdienst.
Ich danke vor allem meiner Frau, die an vielen Wochenenden mit meiner mindestens geistigen Abwesenheit leben musste, für ihre Geduld und ihre immer wieder kritische Kommentierung meiner Gedanken.
Ihr zuerst und dann meinem Patenkind5 und dem jüngst geborenen und „virtuell“ immer schon anwesenden ersten Enkelkind sei die Sammlung gewidmet.
Die Predigttexte bis 2018 folgen überwiegend der Lutherübersetzung in der revidierten Fassung von 1984, seitdem vermehrt der zum Reformationsjubiläum 2017 erschienenen Fassung. Hin und wieder habe ich auf andere Übersetzungen, wie BasisBibel, Hoffnung für Alle oder Einheitsübersetzung zurückgegriffen.
In den Predigten angeführte Zitate habe ich versucht nachträglich zu verifizieren.6 Leider ist mir das bei älteren Ansprachen nicht mehr durchgängig gelungen.
In der Hoffnung, dass, was mir aufgeleuchtet ist, auch anderen zum Licht auf ihrem Weg zu Gott werde, wünsche ich eine gesegnete Lektüre.
Holger Hermann, im Oktober 2020
Espenauer Predigten Mai 2004 bis Februar 2020
Füreinander beten, miteinander arbeiten7
1 So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen,
2 für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit.
3 Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserm Heiland,
4 welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
5 Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus,
6 der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung.
(1. Timotheus 2,1-6a)
Aufgeregt bin ich, weil ich heute ganz offiziell und von Amts wegen in Hohenkirchen auf der Kanzel stehen darf, als ihr Pfarrer der Kirchengemeinde hier in Hohenkirchen.
Aber was bedeutet eingeführt zu werden?
Es heißt, hineingestellt zu werden in eine Gemeinde, eine Gemeinschaft von Menschen, die mit ihren unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten berufen sind zur Nachfolge Jesu Christi, die beauftragt sind zur Arbeit am und für das Reich Gottes.
Jede und jeder von uns bringt in diesen Dienst ihre / seine persönliche Lebens- und Glaubensgeschichte ein.
Sie und ich leben in und mit je eigenen kirchlichen Traditionen, haben Erfahrungen mit Pfarrern bzw. Gemeinden gemacht, haben Fähigkeiten und Fertigkeiten, die uns einander näher bringen, aber auch Marotten, die uns möglicherweise manchmal das Leben schwer machen werden.
Ich möchte ihnen deshalb an dieser Stelle noch einmal danken für das Vertrauen, dass sie mir entgegengebracht haben, für die Freundlichkeit und Herzlichkeit, mit der sie uns in Espenau, besonders hier in Hohenkirchen, im Pfarrhaus willkommen geheißen haben. Das hat uns, mir den Start und die ersten Schritte leichter gemacht.
Wir sind als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Reich Gottes aneinander gewiesen und zwar nicht zuletzt in gegenseitiger Fürbitte und im gemeinsamen Gebet. Denn keiner kann für sich allein Christ sein und keine kann allein die Aufgabe des Gemeindeaufbaus schultern. Wir brauchen einander und vor allem brauchen wir Gottes Beistand, seinen schöpferischen Geist und die Kraft, die besonders in den Schwachen mächtig sein will.
„So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung."
Bleibt mit Gott und in IHM miteinander im Gespräch. Seid untereinander offen, sagt einander, was zu sagen ist, aber hört auch aufeinander. Und bleibt immer offen für das, was die Welt bewegt. Diese liebevoll kritische Offenheit der Christinnen und Christen - in der Welt, untereinander und vor Gott - ist Voraussetzung dafür, dass Menschen sich dem Anspruch Gottes auf ihr Leben öffnen.
Denn Gott hat die ganze Welt geschaffen, er ist als Schöpfer Vater aller Menschen und will deshalb auch, „dass allen Menschen geholfen werde“. Das Heil, um das es im Christentum, in der Kirche geht, ist nicht nur für den innerkirchlichen Gebrauch bestimmt, sondern es gilt allen Menschen und ist allen Menschen zu bezeugen, ob sie es hören wollen oder nicht.
Kirche ist, als Teil der Welt, interessiert und engagiert im Gemeinwesen und für das Gemeinwohl. Ich freue mich, dass Vertreter von Vereinen und öffentlichen Einrichtungen hier sind, freue mich konkret auf die erste Zusammenarbeit beim Festgottesdienst zum Schützenfest am Pfingstsonntag.
Das Gebet „für alle Menschen“, das im Heilswillen Gottes wurzelt, „der will, dass allen Menschen geholfen werde“, konkretisiert sich für den Verfasser des 1. Timotheusbriefes im Gebet für die, die in leitender und verantwortlicher Position in Staat und Gesellschaft, auch in Espenau, sind. Diese Aussage ist nicht Ausdruck einer obrigkeitshörigen Haltung der Christen, sie ist vielmehr die Umsetzung einer Einsicht, die wir durch die ökumenische Bewegung in den letzten Jahrzehnten wieder gewonnen haben:
Das Heil Gottes betrifft nicht nur den inneren, sondern den ganzen, den leibhaftigen Menschen. Das Heil ist eingebettet in ökonomische, gesellschaftliche und politische Strukturen. Und damit „Heil“ umgesetzt werden kann, damit wir dem Willen Gottes gemäß leben und handeln können - das meint: „fromm sein“ - damit die von Gott geschenkte Würde des Menschen bewahrt und gefördert werden kann - das meint „Leben in Ehrbarkeit" - muss das Umfeld stimmen.
Sich dafür zu engagieren, dass das Lebensumfeld in Ordnung ist bzw. kommt, Lebenslügen, persönliche oder gesellschaftliche, aufzudecken, der Wahrheit zum Durchbruch zu verhelfen, die frei macht für ein selbstverantwortetes Leben vor Gott, das alles ist keine Einmischung in Dinge, die Christinnen und Christen nichts angehen, sondern gehört nach meiner Überzeugung zum Grundauftrag der Kirche, der Gemeinde.
Und wir brauchen einander, denn dass wir Christen bzw. kirchliche Mitarbeiter*innen im besonderen, mich immer miteingeschlossen, die besseren Menschen oder Staatsbürger sind, wäre eine Lebenslüge. Nur weil Menschen Christen sind, sind sie eben keine besseren Menschen, keine Elite, sondern immer noch Teil einer gefallenen Welt, Teil einer Welt, die nicht so ist, wie Gott sie gewollt hat. Christen gehören zu dieser Welt, für die sie beten sollen und an deren Verbesserung sie beteiligt sein sollen.
Es ist erstaunlich, wieviel unserem Gebet zugetraut wird. Gebete sind ja Ausdruck der Hoffnung, mit Gottes Hilfe doch etwas bewegen zu können. „Beten heißt: Sich aus der Angst der Welt aufmachen und zum Vater gehen", hat Friedrich von Bodelschwingh gesagt. Beten heißt, die Welt wahrnehmen, wie sie ist, sich keine Illusionen machen über die Gesellschaft, die Menschen, über mich selbst.
Und dann mit allem zu Gott gehen, mit meiner Erlösungsbedürftigkeit genauso wie mit der der Anderen. Dann kann ich in Frieden Gott bitten, dass er uns alle erlöse, uns Wege zum Frieden, zur Liebe und zur Gerechtigkeit schenke. Und dann darf ich, mit dem Wissen um die Vorläufigkeit meines wie jedes Tuns, mich ans Werk machen, um diese Welt ein Stück weit zu ändern und darin auf Gott vertrauen, dass in und durch seine Gemeinde, den Leib Christi, das Not-wendige geschieht. Martin Luther hat es so ausdrückt: ,,Man muss beten, als ob alles Arbeiten nichts nützt, und arbeiten, als ob alles Beten nichts nützt. "
In diesem Sinne lassen sie uns, ab heute ganz offiziell, gemeinsam anfangen, jede und jeder mit ihrer bzw. seiner Gabe, jede und jeder so, wie sie bzw. er es am besten kann, ohne jedoch das andere gering zu schätzen. Lassen sie uns gemeinsam am Reich Gottes und für das Heil und die Wohlfahrt aller Menschen, angefangen hier in Espenau, beten und arbeiten.
Ich habe für dich gebeten...8
Das alte Jahr ist mit Bildern einer Katastrophe9, mit Nachrichten über fast unvorstellbares menschliches Leid, gefolgt von einer Welle der Hilfsbereitschaft, ausgeklungen.
Obwohl - ich werde den Verdacht nicht los, dass das Interesse der sogenannten Weltöffentlichkeit nicht halb so groß wäre, wenn nicht so viele Europäer von dem Tsunami betroffen wären.
Aber darum soll es jetzt nicht gehen.
Viel interessanter ist die Frage, was derartige Ereignisse, was Naturkatastrophen - und da ist dieser Tsunami im Indischen Ozean, was die Zahl der Opfer anbetrifft, noch nicht einmal die größte - mit unserem Glauben machen. Oder berührt uns das gar nicht, weil es eine Naturgewalt ist, ein Schicksalsschlag, gegen den man zum einen nichts machen kann und der zum zweiten als solcher nichts mit Gott zu tun hat? Oder betrifft es meinen Glauben erst, wenn jemand getroffen wurde, den ich bzw. wir kennen?
Wenn wir jedoch in Wahrheit an „Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde“ glauben, dann hat auch so ein Ereigniss, dann hat das Leid jedes betroffenen Menschen etwas mit Gott und dem Glauben zu tun, weil es keine andere gleichwertige Macht - sei es die Natur oder das Schicksal oder das Böse - neben Gott gibt.
Angesichts dieses grundsätzlichen Problems, das eine Anfechtung des Glaubens bedeutet, höre ich die Losung für das neue Jahr 2005 als sehr tröstliches und Mut machendes Wort:
„Jesus Christus spricht: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.“ (Lukas 22,32)
Ich höre: Jesus Christus selbst betet für meinen Glauben. Jesus betet, dass mein Gottvertrauen, das in Christus gründet, nicht aufhöre; dass die Verbindung mit Jesus so fest und beständig ist, dass ich in und mit ihm am Vertrauen auf Gott, den Vater und Schöpfer, festhalten kann. Ich höre, dass es auch und vielleicht gerade beim Glauben nicht allein und nicht einmal zuerst auf mich und meine Kraft oder Stärke ankommt, sondern dass es andere oder doch mindestens einen anderen gibt, der für mich und meinen Glauben betet. Die Eltern und Großeltern unter uns möchte ich ermutigen: Beten sie für den Glauben ihrer Kinder und Enkel - und sagen sie es ihnen auch einmal. Ich bin überzeugt, dass diese Gebete nicht sinnlos sind, sondern hier und da Früchte bringen werden. Wie sie an sich sehen können, denn ich denke, auch für sie wurde, von wem auch immer, gebetet. Dieser Text zeigt mir, dass ich nicht alleine glaube oder glauben muss, sondern dass mein Glaube eingebettet ist in den Glauben einer Gemeinschaft und von ihr durch Gebete mitgetragen wird durch Zeiten der Anfechtung und Krisen hindurch.
Das führt zur Ausgangsfrage zurück: Was machen derartige Ereignisse, wie wir sie jetzt wieder erleben mussten, mit unserem, mit meinem Glauben? Wodurch wird der Glaube der Jünger so sehr erschüttert werden, dass Jesus ihnen ausdrücklich zusagt, für ihren Glauben zu beten?
Die Losung für das Jahr 2005 steht bei Lukas im großen Zusammenhang der Passionsgeschichte Jesu. Nach dem letzten Abendmahl redet Jesus noch einmal mit seinen Jüngern, bevor sie zum Garten Gethsemane aufbrechen, wo Jesus dann verhaftet werden wird. Jesus ahnt, dass seine Verhaftung und vor allem sein bevorstehender Tod das Vertrauen seiner Freunde in ihn und auch in Gott zutiefst erschüttern werden und er versucht ihnen so etwas wie Leuchtbojen oder Rettungsringe des Trostes und der Hoffnung zu geben, damit sie die kommende Zeit bestehen können.
„Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.“ (Lukas 22,31+32a)
Der Satan, Ankläger der Menschen vor Gott, insbesondere der Gerechten, will die Jünger wie Weizen sieben, will prüfen, entweder ob ihr Glaube wie Spreu verweht wird, sobald sie in Anfechtungen geraten, oder ob im Sieb nicht doch etwas zurückbleibt, was der Satan gegen die Jünger verwenden kann. So oder so werden die Jünger nicht vor dem Sieben des Satans, wie auch immer das dann aussehen wird, bewahrt.
Jesus betet im sogenannten hohenpriesterlichen Gebet, im Johannesevangelium Kapitel 17 (Vers 15): „Ich bitte nicht: Nimm sie aus der Welt!, sondern: Bewahre sie vor dem Bösen!“ Lukas formuliert so: „Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.“ Gott lässt zu, dass wir, dass unser Glaube geprüft wird - eine Erfahrung, die selbst Jesus machen musste.
Es war ein Ausdruck der Glaubenshoffnung und des Glaubenstrostes, dass im späten Mittelalter, als die Pest, der die Menschen hilflos ausgeliefert waren, Europa mehrfach heimsuchte, die Darstellungen des leidenden und sterbenden Christus zunahmen und immer realistischer ausgestaltet wurden und insbesondere in den Hospitälern der Zeit sich entsprechende Darstellungen fanden und finden.
Diese Bilder predigten den dort liegenden Menschen: Gottes Sohn selber war nicht vom Leid, von der Versuchung und der Anfechtung seines Glaubens ausgenommen, aber er hat ihn bewährt. Gott hat Jesus bewahrt und gerettet - und wenn ihr euer Vertrauen auf Christus nicht fahren lasst, wird er euch retten - auch durch das Leid und durch den Tod hindurch.
„Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.“
Trotzdem bleibt die offene Frage: Was hat Gott damit zu tun? Warum lässt Gott es zu, dass Menschen Leid widerfährt? Warum soll der Satan meinen Glauben prüfen dürfen?
Im Hintergrund des lukanischen Jesuswortes steht die Gestalt des Hiob10. Bereits vor dem Verlust seiner Gesundheit hatte Hiob alles andere verloren: zuerst seinen gesamten Viehbesitz mitsamt den Knechten durch räuberische Nomaden und Naturgewalt und schließlich auf einen Schlag alle Kinder durch einen Wirbelsturm. Ursache aller Katastrophen war jedoch nicht ein blindes Schicksal oder eine Schuld Hiobs bzw. seiner Kinder. Ursache war eine Art Wette zwischen Gott und Satan. Doch trotz allem: zunächst einmal bewährt sich Hiobs Glaube.
Erst als drei Freunde kommen und sieben Tage lang mit Hiob schweigen und trauern11, bricht es aus Hiob heraus - und diese Worte gehören zum Erschütterndsten, was die Bibel überliefert.
„Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin, und die Nacht, da man sprach.' Ein Knabe kam zur Welt,' ... Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam?... Warum gibt Gott das Licht dem Mühseligen und das Leben den betrübten Herzen - die auf den Tod warten, und er kommt nicht, und nach ihm suchen mehr als nach Schätzen, die sich sehr freuten und fröhlich wären, wenn sie ein Grab bekämen?“ (Hiob 3,3+11+20-22)
Hiob klagt Gott an, streitet mit ihm und seine Freunde versuchen Gott zu verteidigen, Gottes Tun zu rechtfertigen12. Doch am Ende13 erhält Hiob von Gott Recht gegenüber seinen Freunden. Hiob anerkennt die ihm von Gott demonstrierte Schöpfermacht, er akzeptiert Gottes Gottsein und des Menschen Geschöpflichkeit. Gott aber rechtfertigt Hiobs Widerspruch und Anklage, in der er jedoch Gott die Ehre gibt, während die Freunde mit ihren Rechtfertigungsversuchen Gottes Gottheit begrenzen und beschneiden, IHM also letztlich nicht die Ehre zubilligen, die IHM zusteht.
Auch Jesus rechtfertigt nicht Gottes Tun, er ringt mit Gott um das, was auf ihn zukommt, aber er hält bis in den Widerspruch und die Anklage des „Mein Gott, mein Gott, warum hast die mich verlassen!“ (Psalm 22,2; Markus 15,34 par.) an seinem Gottvertrauen fest - und wird von Gott gerechtfertigt, auferweckt. Im Nachhinein enthüllt sich, zunächst für die Jünger, dann für alle, die der Predigt vom Kreuz vertrauen, der Sinn jener eigentlich sinnlosen menschlichen Katastrophe.
Vielleicht gibt es ja jetzt schon darin einen Sinn, dass viele Menschen sich von der Not berühren lassen und zu Nächsten werden, dass wir und die Menschen dort diese große Hilfsbereitschaft und Solidarisierungswelle erleben, dass auf einmal viele erfahren und verstehen: Wir sind nicht allein und was dort passiert, geht auch uns hier im reichen Norden etwas an. Wir leben in einer Welt - und was ursprünglich einmal im Blick auf die christliche Ökumene gesagt wurde, dass, wenn ein Glied am Leib Christi leidet, alle Glieder mitleiden, das durchaus auch darüber hinaus gilt.
Doch wie auch immer: Wir erhalten keine allgemeingültigen Erklärungen. Aber wir sind durch die Jahreslosung eingeladen auch im Widerspruch am Vertrauen auf den Gott Jesu Christi festzuhalten, für unsere Nächsten zu beten und ihnen Trost und Hoffnung zu schenken.
Denn „Jesus Christus spricht: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre.“
Ich bin der Herr, dein Arzt14
4 Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege
5 und redete wider Gott und wider Mose: Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise.
6 Da sandte der HERR feurige Schlangen unter das Volk; die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben.
7 Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den HERRN und wider dich geredet haben. Bitte den HERRN, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk.
8 Da sprach der HERR zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben.
9 Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben.
(4. Mose 21,4-9)
Ein merkwürdiger Text, was vor allem die Rolle der Schlange bzw. der Schlangen betrifft. Zwei Traditionen fließen in diesem Motiv zusammen und werden mit Hilfe der Erzählung in den biblischen Gottesglauben integriert.
Zum einen: Können sie sich, könnt ihr euch etwas unter einer „feurigen Schlange“ vorstellen?
Wer nur ein bisschen in der Welt der Sagen und Legenden zu Hause ist, beginnend bei der Legende des heiligen Georg bis hin zu Tolkiens „Kleinem Hobbit", dem dürfte die Antwort nicht so schwer fallen:
„Feurige, geflügelte Schlangen", so die Bedeutung des hebräischen Wortes, sind nach unserem alten Sprachgebrauch „Lindwürmer“ bzw. „Drachen“, jene Tod und Verderben verbreitenden und Furcht einflößenden Wesen einer unvordenklichen Urzeit, die seit etwa zehn, fünfzehn Jahren und den ,,Jurassic-Parc"-Filmen unter anderem Namen überall präsent sind.
In diesen Wesen, wie auch immer sie genannt werden, verdichtet sich die Erfahrung des Chaos, die Erfahrung von Natur, die menschlicher Herrschaft entzogenen ist, die, wenn sie über den Menschen kommt, kein Entrinnen ermöglicht. Gott, das will diese Erzählung verdeutlichen, hat auch solche Ereignisse, solche Wesen in seiner Hand. Es ist kein undefinierbares Schicksal, sondern Gottes Zorn, der in dem erzählten Beispiel diese Plage, diese Unheilsmächte freilässt. Es ist sein Zorn, vor dem es kein Entrinnen gibt.
Ich muss ihnen gestehen, dass ich mit so einem Gott irnmer noch meine Probleme habe. Und es muss heute gefragt werden, ob so harte Strafen nach dem Motto des Hebräerbriefes „wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn" (vgl. Hebräer 12,6+7) ein angemessenes Mittel der Erziehung sind. Hier bleibt als offene Frage diese als Strafe interpretierte Plage, die unverständliche und harte Hand Gottes, stehen. Das ist nicht und das wird auch nicht der „liebe“ Gott. Und trotzdem ist es Gott, unser Gott, der von uns eben auch so erlebt werden kann bzw. wird: hart, strafend, verborgen.
Aber, und auch das mag uns teilweise unverständlich vorkommen, das Volk wendet sich nicht von Gott ab, sondern wendet sich mit der Bitte um Hilfe und Vergebung gerade an diesen seinen Gott. Hier wird, wie es Jesus in noch einmal ganz anderer Situation am Kreuz praktizierte und wie es Martin Luther immer wieder anmahnte, an Gott gegen Gott festgehalten. Der Zorn Gottes ist nicht sein letztes Wort, wir sollen und dürfen uns an Gottes Barmherzigkeit und Verheißung klammern und sie ihm vorhalten. Zwar bleiben die Schlangenbisse - und der vorgetragene Wunsch des Volkes wird nicht erfüllt - aber es wird von Gott die Möglichkeit der Heilung und damit des Lebens eingeräumt.
Und damit komme ich zur zweiten angesprochenen Traditionslinie, die sich in dieser Erzählung findet. Mose machte daraufhin nach Anweisung Gottes eine „eherne Schlange" und richtete diese an einem Stab auf. Einmal abgesehen davon, dass die eherne Schlange wohl ein Abbild der „feurigen Schlangen" war, - kommt ihnen / euch dieses Zeichen einer an einem Stab befestigten, um einen Stab gewundenen Schlange nicht bekannt vor?
Ich meine den sogenannten Äskulapstab, das Standeszeichen der Ärzte, das sich von dem schlangengestaltigen griechischen Gott der Heilkunde Asklepios / Aesculapius ableitet. Die Tempel dieses Gottes waren in der Antike gleichzeitig auch Heilstätten und es war dieser Gott des Heilens, der dem Heiland aus Nazareth mit am längsten Widerstand leistete, ca. 600 Jahre lang.
Vergleichbare erdverbundene schlangengestaltige Gottheiten des Heilens gab es bei fast allen Völkern im Mittelmeerraum. In unserer biblischen Geschichte werden diese göttlichen Wesen radikal entmachtet.
Gott allein gewährt Heilung bzw. die Gabe des Heilens. „Ich bin der Herr, dein Arzt" (2. Mose 15,26) sagt Gott zu seinem Volk unmittelbar nach der Flucht aus Ägypten.
Die eherne Schlange war nicht Gott; sie war nur ein von Gott, der allein Hilfe gewähren kann, gegebenes Zeichen. Nicht auf das Leid, auf die Plage starren, sondern im Leid, in der Plage auf das blicken bzw. auf den blicken, der allein Hilfe und Heilung geben kann, dazu will diese Erzählung aufrufen.
In diesem Sinne greift dann auch Jesus diese Szene auf. In Johannes 3 sagt er: „Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben." (Johannes 3,14+15) Gemeint ist das Kreuz, das für uns das Zeichen ist, auf das wir in unserer Not und Schuld, in unserem Leid blicken dürfen und sollen um Heil bzw. Heilung für unser Leben zu erhalten.
Mir hat zu diesem Verständnis eine Deutung des Isenheimer Altars geholfen: Im Zentrum des Mittelbildes ist Christus dargestellt, der, durch Hautgeschwüre entstellt, mit Striemen am Leib, in verrenkter und verkrampfter Haltung am Kreuz hängt. Dieser Altar war ursprünglich in einem Hospital angebracht, in dem Kranke, Todkranke durch Mönche gepflegt wurden. Sie konnten ständig zu diesem Jesus aufblicken, der ihre Krankheit trug. Und das war nun nicht mehr nur ein Zeichen, sondern Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus, der dort hing und der so für alle, die zu ihm aufblickten und ihm vertrauten, zum Heiland, zum Arzt der Seelen in ihrer damals unheilbaren Krankheit wurde.
Die eherne Schlange ging verloren, sie wurde von König Hiskija zerstört und aus dem Tempel entfernt. Aber wir brauchen sie, Gott sei Dank, auch nicht mehr; weil wir Christus haben, seine Erhöhung ans Kreuz. Durch das nicht abgestellte Leiden des Kreuzes hindurch wurde er in der Auferstehung erhöht zum Herrn über Himmel und Erde.
Das Leiden wird nicht einfach beseitigt, das mag uns unverständlich erscheinen angesichts heutiger Leidensdimensionen; aber im Leiden ist Gott selber an der Seite seiner Menschen und hilft; wenn wir nur wegblicken und aufblicken zu dem, der am Kreuz hing.
Mutige Frauen16
15 Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua:
16 Wenn ihr den hebräischen Frauen helft und bei der Geburt seht, dass es ein Sohn ist, so tötet ihn, ist‘s aber eine Tochter; so lasst sie leben.
17 Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben.
18 Da rief der König von Ägypten die Hebamrnen und sprach zu ihnen: Warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasst?
19 Die Hebammen antworteten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind kräftige Frauen. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren.
20 Darum tat Gott den Hebammen Gutes. Und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark.
21 Und weil die Hebammen Gott fürchteten, segnete er ihre Häuser.
22 Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach: Alle Söhne, die geboren werden, werft in den Nil, aber alle Töchter lasst leben.
(2. Mose 1,15-22)
Frauen, mutige Frauen, spielen in der Bibel oft eine herausragende Rolle. In der Vorgeschichte zu Weihnachten, wie sie der Evangelist Lukas erzählt, sind es Elisabeth und Maria, hochbetagt die eine, blutjung die andere, die von Gott für eine besondere Aufgabe ausgesucht wurden. Beide sollen sie und werden sie ein Kind bekommen, das etwas besonderes sein wird - mit denen Gott seiner Geschichte mit den Menschen, seiner Heils- und Befreiungsgeschichte eine neue, entscheidende Wendung geben will.
Nicht mehr nur gegen die Herrscher und Möchtegern-Götter dieser Welt soll es mit Elisabeths und Mariens gehen, sondern gegen den letzten Feind, den Tod selbst. Gott wird Mensch, damit der Tod, damit sein absoluter Griff nach dem Leben der Menschen, sich an Gott selbst zu Tode läuft.
Am Anfang einer anderen Heilsgeschichte, der Befreiungsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel, stehen ebenfalls mutige, gottesfürchtige Frauen:
15 Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra hieß und die andere Pua.





























