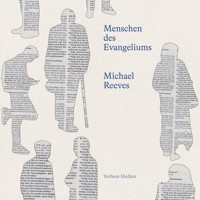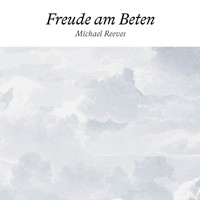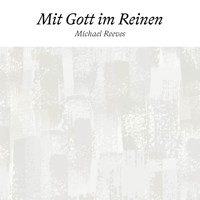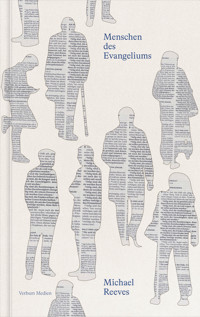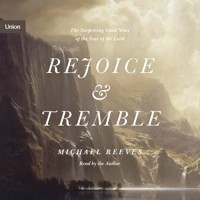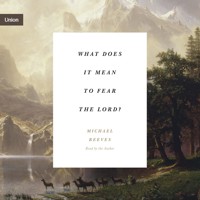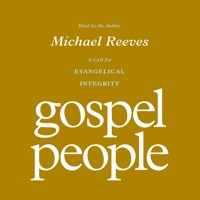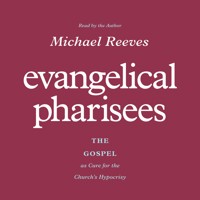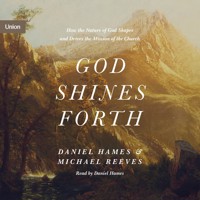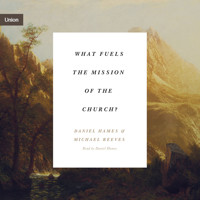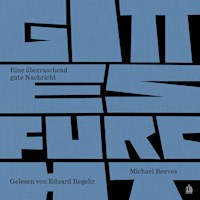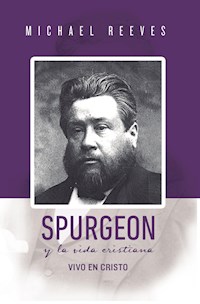Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verbum Medien gGmbH
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Angst ist wahrscheinlich die stärkste menschliche Emotion aber auch eine, die uns vor ein Rätsel stellt. Ist Angst in der Bibel nun etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Und was bedeutet es, den Herrn zu fürchten?Michael Reeves lichtet die Wolken der Verwirrung und zeigt, dass Gottesfurcht nichts Negatives ist, sondern ein freudiges Staunen über den herrlichen Gott, unseren Schöpfer und Erlöser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gottesfurcht
Eine überraschend gute Nachricht
Michael Reeves
Für meine lieben Freunde Rob und John
In einer vollkommenen Freundschaft ist eine liebevolle Wertschätzung oft so groß und so tief gegründet, dass jedes Glied des Kreises insgeheim beschämt vor den andern dasteht. Manchmal fragt sich der Einzelne, was er da unter all diesen hervorragenden Leuten zu suchen habe. Er hat ganz unverdientes Glück, sich in solcher Gesellschaft zu befinden, besonders wenn die ganze Gruppe beieinander ist und jeder im andern das Beste, Klügste oder Witzigste zum Klingen bringt. Das sind goldene Zeiten: wenn unser vier oder fünf nach einem anstrengenden Tagesmarsch den Gasthof erreicht haben, wenn wir, Pantoffeln an den Füßen, das Glas in Reichweite, die Beine dem Kaminfeuer entgegenstrecken, wenn sich uns Welten öffnen im Gespräch – und keiner erhebt Ansprüche, keiner ist für die andern verantwortlich, alle sind wir frei und gleichgestellt, als seien wir uns vor einer Stunde zum ersten Mal begegnet, während uns gleichzeitig eine Zuneigung umfängt, die in Jahren gereift ist. Das Leben – das natürliche Leben – hält keine bessere Gabe bereit. Wer hätte sie verdient?
C. S. Lewis, Was man Liebe nennt
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Vorwort zur Buchreihe
1Fürchte dich nicht!
2Sündige Furcht
3Rechte Furcht
4Überwältigt vom Schöpfer
5Überwältigt vom Vater
6Wie man in der Furcht des Herrn wächst
7Die Herrlichkeit der Gemeinde
8Ewige Ekstase
Endnoten
Bibelstellenindex
Vorwort zur Buchreihe
Unsere inneren Überzeugungen und Werte formen unser Leben und unseren Dienst. Union – das Gemeinschaftswerk von Union School of Theology, Union Publishing, Union Research und Union Mission (www.theolo.gy) – will Männer und Frauen dabei unterstützen, sich an Gott zu erfreuen, in Christus zu wachsen, der Gemeinde zu dienen und die Welt zu segnen. Die Union-Buchreihe ist ein Versuch, diese Werte auszudrücken und weiterzugeben.
Es sind Werte, die sich von der Schönheit und Gnade Gottes ableiten. Der lebendige Gott ist so herrlich und freundlich, dass er nicht erkannt werden kann, ohne auch angebetet zu werden. Diejenigen, die ihn wirklich kennen, werden ihn lieben. Ohne diese von Herzen kommende Freude an Gott sind wir nichts als oberflächliche Heuchler. Die Anbetung Gottes nährt den Wunsch, in der Christusähnlichkeit zu wachsen. Sie bewirkt auch eine Liebe zu Christi kostbarer Braut, der Gemeinde, und das Anliegen, ihr demütig zu dienen – statt von ihr bedient zu werden. Schließlich bringt uns die Liebe zu Gott auch dazu, seine Ziele zu verfolgen – besonders das Ziel, dass seine lebenspendende Herrlichkeit die Erde erfüllt.
Es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass diese Bücher ein Segen für dich und deine Gemeinde sind. Sie sollen dabei unterstützen, eine tiefere Freude an Gott zu entwickeln, die in freudige Integrität, Demut, Christusähnlichkeit, Liebe zur Gemeinde und eine Leidenschaft, alle Nationen zu Jüngern zu machen, mündet.
Michael Reeves
Herausgeber der Reihe
1 Fürchte dich nicht!
Buh! Dies ist eines der ersten Wörter, an denen wir Spaß haben. Als Kinder liebten wir es, aus einem Versteck hervorzuspringen und unsere Freunde mit einem lauten Buhruf zu erschrecken. Gleichzeitig hatten wir jedoch auch Angst vor der Dunkelheit und den Ungeheuern unter unserem Bett. Wir waren sowohl fasziniert als auch abgestoßen von unseren Ängsten. Und es ändert sich nicht viel, wenn wir älter werden: Erwachsene lieben Gruselfilme und Nervenkitzel, die uns mit unseren schlimmsten Ängsten konfrontieren. Wir zerbrechen uns jedoch auch den Kopf über all die schrecklichen Dinge, die uns zustoßen könnten: wie wir unser Leben, unsere Gesundheit oder geliebte Menschen verlieren oder wie wir versagen oder abgelehnt werden. Angst ist wahrscheinlich die stärkste menschliche Emotion – aber auch eine, die uns verwirrt.
Fürchten oder nicht fürchten?
Auch in der Bibel scheint die Thematik ähnlich verwirrend zu sein: Ist Furcht etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Soll man sich der Furcht hingeben oder vor ihr weglaufen? Die Heilige Schrift bezeichnet Furcht häufig eindeutig als etwas Schlechtes, vor dem uns Christus retten will. Der Apostel Johannes schreibt: »Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe; wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe« (1 Joh 4, 18). Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, prophezeite, dass die Erlösung durch Jesus bedeuten würde,
»dass wir, erlöst aus der Hand der Feinde, ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen.« (Lk 1, 74–75)
Der Autor des Hebräerbriefs sieht dies genauso und sagt, dass Christus genau dazu gekommen ist, um »die zu erlösen, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten« (Hebr 2, 15). Tatsächlich lautet die häufigste Anweisung in der Bibel: »Fürchte dich nicht!«
Und doch werden wir in der Heiligen Schrift immer wieder aufgefordert, uns zu fürchten. Vielleicht noch merkwürdiger ist, dass wir aufgerufen werden, Gott zu fürchten. Der Vers, an den man dabei sofort denkt, ist Sprüche 9, 10:
»Der Weisheit Anfang ist die Furcht des HERRN, und den Heiligen erkennen, das ist Verstand.«
Dieser Bibelvers ist zwar der bekannteste, aber bei Weitem nicht der einzige. Am Anfang des Buches der Sprüche heißt es:
»Die Furcht des HERRN ist der Anfang der Erkenntnis. Die Toren verachten Weisheit und Zucht.« (Spr 1, 7)
David betet:
»Weise mir, HERR, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit; erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte.« (Ps 86, 11)
Jesaja sagt: »Die Furcht des HERRN wird Zions Schatz sein« (Jes 33, 6). Hiobs Treue wird zusammengefasst, indem er beschrieben wird als »fromm, rechtschaffen und gottesfürchtig« (Hiob 1, 8). Dies ist aber keine rein alttestamentliche Aussage, die vom Neuen Testament überwunden worden wäre, denn im Magnificat sagt Maria:
»Und [Gottes] Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten.« (Lk 1, 50)
Jesus beschreibt den ungerechten Richter als einen, »der Gott nicht fürchtete«. Und Paulus sagt: »Weil wir nun solche Verheißungen haben, ihr Lieben, so lasst uns von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes uns reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes« (2 Kor 7, 1); und weiter: »Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren; dient nicht allein vor ihren Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn« (Kol 3, 22). Offensichtlich stimmt das Neue Testament mit dem Prediger im Buch Kohelet überein, der sagt: »Lasst uns am Ende die Summe von allem hören: Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das gilt für alle Menschen« (Pred 12, 13).
In der Tat ist die Gottesfurcht ein so bedeutungsvolles Thema in der Schrift, dass Professor John Murray schrieb: »Gottesfurcht ist das Herz der wahren Frömmigkeit.«1 John Owen, ein Puritaner aus dem 17. Jahrhundert, äußerte sich ähnlich: Gemäß der Schrift bedeutet »die Furcht des Herrn unsere ganze Gottesanbetung, moralisch und institutionell, und aller Gehorsam, den wir ihm schuldig sind.«2 Martin Luther lehrte in seinem Kleinen Katechismus, die Erfüllung des Gesetzes besteht darin, dass wir »Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen.«3 Er erklärte darin die Zehn Gebote und schrieb, das rechte Verständnis jedes einzelnen Gebotes bedeutet, zu wissen, »dass wir Gott fürchten und lieben sollen.«
All das kann uns ziemlich verwirren. Einerseits wird uns gesagt, dass Christus uns von der Furcht befreit; andererseits heißt es, dass wir uns fürchten sollen – auch vor Gott. Das kann uns entmutigen und den Wunsch aufkommen lassen, »Gottesfurcht« möge in der Heiligen Schrift keine so zentrale Bedeutung haben. Wir haben schon genug Ängste. Wir brauchen wirklich nicht noch mehr. Sich vor Gott zu fürchten, fühlt sich so negativ an, dass es mit dem Gott der Liebe und Gnade, dem wir im Evangelium begegnen, anscheinend nicht in Einklang zu bringen ist. Warum sollte ein Gott, der es wert ist, geliebt zu werden, gefürchtet werden wollen?
Es wird jedoch alles noch schlimmer durch den Eindruck, dass Furcht und Liebe zwei unterschiedliche Sprachen sind, die von zwei verschiedenen christlichen Lagern bevorzugt werden – vielleicht sogar von zwei verschiedenen Theologien. Das eine Lager spricht von Liebe und Gnade und niemals von Gottesfurcht. Das andere Lager scheint darüber empört zu sein und betont, wie sehr wir uns vor Gott fürchten sollten. Die Furcht vor Gott ist dabei wie kaltes Wasser, das die Liebe, die ein Christ für Gott empfindet, ertränkt. Das kann den Eindruck vermitteln, die Furcht Gottes sei so etwas wie das trostlose theologische Pendant zum Essen von langweiligem Gemüse. Damit stopfen sich die theologischen Gesundheitsapostel voll, während alle anderen eine viel köstlichere Mahlzeit genießen.
Mein Ziel ist es, diese entmutigende Verunsicherung zu durchbrechen. Ich möchte, dass du dich an dem seltsamen Paradoxon erfreust, dass das Evangelium uns einerseits von Furcht befreit und andererseits Furcht in uns bewirkt. Es befreit uns von unseren lähmenden Ängsten und beschenkt uns stattdessen mit einer köstlichen, glücklichen und wunderbaren Furcht. Ich möchte den oft abschreckenden Begriff »Gottesfurcht« entwirren, um anhand der Bibel zu zeigen, dass dieser keineswegs bedeutet, dass Christen Angst vor Gott haben sollen.
In der Tat hält die Schrift viele gewaltige Überraschungen für uns bereit, wenn sie die Gottesfurcht beschreibt, die der Anfang der Weisheit ist. Sie entspricht nicht dem, was wir erwarten würden. So wird uns etwa in Jesaja 11, 1–3 eine herrliche Beschreibung des geisterfüllten Messias gegeben:
»Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des HERRN, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des HERRN. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des HERRN.«
Diese letzten beiden Aussagen sollten uns zur Frage bringen, was genau diese Furcht des Herrn ist. Hier sehen wir, dass der Messias auf keinen Fall auf sie verzichten wollte. Sogar er – in seiner sündlosen Heiligkeit und Vollkommenheit – besitzt die Furcht des Herrn und widerstrebt ihr nicht. Es ist nicht so, dass er Gott liebt und Freude an Gott hat, aber Gott leider auch fürchten muss, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ganz im Gegenteil: Der Geist, der auf ihm ruht, ist der Geist der Furcht des Herrn und seine Freude ist in der Furcht des Herrn. Das zwingt uns zu der Frage: Was ist diese Furcht, die Christi ganze Freude ist? Sie kann keine negative, düstere Pflicht sein.
Die heutige Kultur der Angst
Bevor wir uns der guten Nachricht zuwenden, die Gottes Wort über unsere Ängste und die Furcht Gottes verkündet, sollten wir uns zunächst einmal ansehen, wie ängstlich unsere Kultur geworden ist. Wenn wir erkennen, in welchem Zustand sich unsere Gesellschaft befindet, können wir besser verstehen, warum wir ein Problem mit der Angst haben – und weshalb die Gottesfurcht die beste Medizin für diese Angst ist.
Heutzutage – so scheint es – spricht jeder von einer Kultur der Angst. Von Twitter bis zum Fernsehen machen wir uns Sorgen über den globalen Terrorismus, extreme Wetterbedingungen, Pandemien und politische Unruhen. In politischen Kampagnen und Wahlkämpfen setzen Politiker regelmäßig Angstrhetorik ein, weil sie wissen, dass Angst das Abstimmungsverhalten beeinflusst. In unserer digitalisierten Welt werden wir durch die Geschwindigkeit, mit der sich Informationen und Nachrichten verbreiten, mit mehr Gründen zur Sorge überflutet als je zuvor. Ängste, über die wir früher nie gesprochen hätten, durchqueren die Welt in Sekundenschnelle und werden global gebündelt.
Unser privater Alltag ist gefüllt mit weiteren Angstquellen – eine davon ist unsere Ernährung: Wer auf der Speisekarte die Vollfettvariante wählt, steuert auf einen Herzinfarkt zu. Dabei werden wir regelmäßig mit der neuesten Entdeckung konfrontiert, dass die kalorienarme Alternative eigentlich krebserregend oder anderweitig schädlich ist. So beginnt die leise Angst schon beim Frühstück. Oder denken wir an die Paranoia, die immer mehr Eltern heute entwickeln. Die berechtigte, aber meist übertriebene Angst vor dem Kidnapper, der im Internet oder vor jeder Schule lauert, hat dazu beigetragen, dass »Helikopter-Eltern« ständig über ihren Kindern schweben und sie zu ihrem Schutz umzäunen. So ist es nicht verwunderlich, dass neuerdings von Universitäten erwartet wird, bisher gänzlich unbekannte »sichere Räume« zum Schutz der Studenten einzurichten. Kinder sind so behütet aufgewachsen, dass sie kaum noch mit gegenteiligen Standpunkten oder Kritik umgehen können. Dies ist nur ein Anzeichen dafür, dass sie als empfindlicher und verletzlicher gelten als Studenten noch vor einer Generation.
Es wäre jedoch falsch, mit dem Finger nur auf die jüngere Generation zu zeigen. Als gesamte Gesellschaft werden wir zunehmend ängstlicher und unsicherer. Jeder, der im Management tätig ist, weiß um die schwindelerregende Ausbreitung bürokratischer Vorschriften rund um Gesundheit und Sicherheit. Dennoch fühlen wir uns dadurch nicht sicherer und überprüfen unsere Schlösser nur noch genauer. Die Sicherheit, nach der wir uns sehnen, entzieht sich uns und wir fühlen uns verletzlich – wie Opfer, die der Willkür von allem und jedem ausgeliefert sind.
Dabei ist das Ganze völlig paradox, denn wir leben sicherer als je zuvor. Von Sicherheitsgurten und Airbags in unseren Autos bis hin zur Entfernung von Bleifarbe und Asbest aus unseren Häusern ist unsere Sicherheit besser gewährleistet, als es sich unsere Vorfahren je hätten vorstellen können. Wir haben Antibiotika, um uns vor Infektionen zu schützen, die in anderen Jahrhunderten nur allzu leicht tödlich gewesen wären. Doch anstatt uns darüber zu freuen, machen wir uns Sorgen, dass wir immun werden und so auf eine post-antibiotische Gesundheitsapokalypse zusteuern könnten. Obwohl wir wohlhabender sind und mehr Sicherheit haben als fast jede andere Gesellschaft in der Geschichte, ist Sicherheit der Heilige Gral unserer Kultur geworden. Und wie der Heilige Gral ist auch Sicherheit etwas, das wir nie ganz erreichen können. Geschützt wie nie zuvor, sind wir nervös und panisch wie nie zuvor.
Wie kann das sein? Wenn wir als Gesellschaft doch so gut gepolstert und abgefedert sind, warum beherrscht uns dann heute die Kultur der Angst? Professor Frank Furedi schreibt: »Warum die Amerikaner mehr Angst haben, obgleich sie viel weniger zu befürchten haben als in früheren Zeiten, ist eine Frage, die viele Wissenschaftler vor ein Rätsel stellt. Ein Argument, das zur Erklärung dieses ›Paradoxons einer sicheren Gesellschaft‹ herangezogen wird, ist, dass der Wohlstand die Menschen dazu ermutigt, risiko- und verlustscheuer zu werden.«4
Da könnte etwas dran sein. Wir sind sicherlich frei, mehr zu wollen, haben die Möglichkeit, mehr zu besitzen, und fühlen uns oft berechtigt, mehr zu genießen. Und je mehr wir etwas wollen, desto mehr fürchten wir dessen Verlust. Wenn unsere Kultur hedonistisch, unsere Religion therapeutisch und unser Lebensziel persönliches Wohlbefinden ist, wird die Angst uns permanent Kopfzerbrechen bereiten. Furedi ist allerdings der Meinung, dass das »Paradoxon einer sicheren Gesellschaft« tatsächlich tiefere Wurzeln hat. Er behauptet, dass die moralische Verwirrung in der Gesellschaft zu einer Unfähigkeit geführt hat, mit der Angst umzugehen, zu einem Anstieg der Angst und damit zu einer wachsenden Zahl von Schutzzäunen, die um uns herum errichtet werden.
Furedis Argument ist besonders interessant, wenn man bedenkt, dass er ein glühender Humanist und kein Christ ist. Es ist aufschlussreich und sicher richtig von ihm, nach den tiefen Wurzeln unserer Kultur der Angst zu suchen. Ich behaupte jedoch, dass er nicht tief genug gegraben hat. Furedi argumentiert, dass die moralische Verwirrung unsere Gesellschaft ängstlich gemacht habe. Die moralische Verwirrung selbst ist jedoch nur die Folge eines früheren Verlustes: dem Verlust der Gottesfurcht. Es ist Gott, der die Logik und die Matrix der Moral liefert: Wenn er nicht mehr gefürchtet wird, folgt daraus moralische Verwirrung. Diese ist aber nicht die Wurzel unserer Angst. Vielmehr sind beide – unsere heutige moralische Verwirrung und unser allgemeiner Zustand erhöhter Angst – die Folge eines kulturellen Verlustes von Gott als dem eigentlichen Objekt menschlicher Furcht.5 Diese Furcht vor Gott war (wie ich zu zeigen hoffe) eine glückliche und gesunde Furcht, die unsere anderen Ängste formte und kontrollierte und so unsere Angst im Zaum hielt.
Da die Gesellschaft Gott als das eigentliche Objekt gesunder Furcht verloren hat, wird unsere Kultur zwangsläufig immer neurotischer, immer ängstlicher vor dem Unbekannten – ja, immer ängstlicher vor allem und jedem. Ohne die Fürsorge eines gütigen und väterlichen Gottes bewegen wir uns angesichts der veränderten Moral und Realität wie auf unsicherem Treibsand. Weil wir Gott aus unserer Kultur verdrängt haben, nahmen andere Sorgen – von der eigenen Gesundheit bis zur Gesundheit des Planeten – in unseren Köpfen eine göttliche Vorrangstellung ein. Gute Dinge sind zu grausamen und erbarmungslosen Götzen geworden – und so fühlen wir uns hilfsbedürftig und zerbrechlich. Die Gesellschaft hat ihren sicheren Anker verloren und wird dafür mit freischwebenden Ängsten überflutet. Denn während Furcht eine Reaktion auf etwas Bestimmtes ist, ist Angst eher ein unspezifischer Zustand, der in der Luft liegt. Angst kann sich daher mit allem Möglichen verbinden und sich augenblicklich und mühelos wandeln: In der einen Minute machen wir uns Sorgen über Messerkriminalität, in der nächsten über den Klimawandel.
Das schreckliche Erbe des Atheismus
Die Behauptung, dass der Verlust der Gottesfurcht die Hauptursache dafür ist, dass unsere Kultur von Angst beherrscht wird, ist ein echter Schlag für den Atheismus, denn dieser versprach genau das Gegenteil. Der Atheismus behauptete, wenn man die Menschen vom Glauben an Gott befreit, dann werden sie auch ihre Angst los. So argumentierte Bertrand Russell 1927 in seiner berühmten Erklärung Warum ich kein Christ bin:
»Die Religion stützt sich vor allem und hauptsächlich auf die Angst. Teils ist es die Angst vor dem Unbekannten und teils, wie ich schon sagte, der Wunsch zu fühlen, dass man eine Art großen Bruder hat, der einem in allen Schwierigkeiten und Kämpfen beisteht. Angst ist die Grundlage des Ganzen – Angst vor dem Geheimnisvollen, Angst vor Niederlagen, Angst vor dem Tod. Die Angst ist die Mutter der Grausamkeit, und es ist deshalb kein Wunder, dass Grausamkeit und Religion Hand in Hand gehen, weil beide aus der Angst entspringen. Wir beginnen nun langsam, die Welt zu verstehen und sie zu meistern, mit Hilfe einer Wissenschaft, die sich gewaltsam Schritt für Schritt ihren Weg gegen die christliche Religion, gegen die Kirchen und im Widerspruch zu den überlieferten Geboten erkämpft hat. Die Wissenschaft kann uns helfen, die feige Furcht zu überwinden, in der die Menschheit seit so vielen Generationen lebt. Die Wissenschaft, und ich glaube auch unser eigenes Herz, kann uns lehren, nicht mehr nach einer eingebildeten Hilfe zu suchen und Verbündete im Himmel zu ersinnen, sondern vielmehr hier unten unsere eigenen Anstrengungen darauf zu richten, die Welt zu einem Ort zu machen, der es wert ist, darin zu leben, und nicht zu dem, was die Kirchen in all den Jahrhunderten daraus gemacht haben.«6
Während Russell auf tragische Weise missversteht, was es für den Christen bedeutet, Gott zu fürchten, fällt es einem schwer, nicht darüber zu lachen, wie falsch seine Prophezeiung gewesen ist. Fast ein Jahrhundert nachdem er diese Worte gesagt hat, kann kaum jemand leugnen, dass das Ablegen der Gottesfurcht unsere Gesellschaft nicht glücklicher und weniger ängstlich gemacht hat. Ganz im Gegenteil – dies anerkennt auch der streng atheistische Professor Frank Furedi, der als internationaler Experte für unsere moderne Kultur der Angst bezeichnet werden könnte.
Natürlich war es nicht nur Bertrand Russell, der behauptete, dass uns mehr Selbstständigkeit und weniger Gottesfurcht helfen würden. Die ganze Prämisse der Aufklärung war, dass der Fortschritt unseres Wissens unsere Probleme und abergläubischen Ängste vertreiben würde. Dieses Vertrauen in die menschliche Vernunft finden wir auf dem Titelbild von Christian Wolffs herrlich ambitioniertem Buch aus dem Jahr 1720 Vernünftige Gedanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt: Den Liebhabern der Wahrheit mitgeteilt auf klassische Weise dargestellt.
Der Stich zeigt die glückliche Sonne des Wissens, wie sie die düstere alte Welt des Glaubens erhellt und die Schatten und die Dunkelheit der Angst und des Aberglaubens vertreibt. Ein schöner Gedanke für das 18. Jahrhundert – aber auch hier ist genau das Gegenteil eingetreten. Während wir heute alle unsere Smartphones und GPS-Geräte lieben, müssen wir dennoch anerkennen, dass der Fortschritt des Wissens nicht der reine Segen ist. Es ist nur allzu offensichtlich, dass neue Technologien Konsequenzen haben, die wir nicht vorhersehen können. Als du zum Beispiel dein erstes Smartphone gekauft hast, ahntest du nicht, welchen Einfluss es auf dein Sozialverhalten oder deine Schlafgewohnheiten haben würde. Als du zum ersten Mal soziale Medien benutzt hast, sahst du zwar einige potenzielle Vorteile, hattest aber keine Vorstellung davon, wie es deine Angst nähren würde, etwas zu verpassen. Mehr Wissen bedeutet nicht unbedingt weniger Angst, sondern häufig mehr.
Die vielleicht größte Ironie ist jedoch, dass die freischwebende Angst, die unsere »aufgeklärte« und gottlose Gesellschaft erfüllt, in Wirklichkeit nichts anderes ist als derselbe primitive Aberglaube, von dem wir dachten, dass das Wissen ihn ausrotten würde. Im Jahr 1866 hielt Charles Kingsley an der Royal Institution in London einen Vortrag mit dem Titel Aberglaube.7 In diesem Vortrag definierte er Aberglaube als jene Angst vor dem Unbekannten, die nicht von der Vernunft geleitet wird. Genau das sehen wir heute in unserer Gesellschaft. Es ist für uns nicht offensichtlich, dass unsere Ängste tatsächlich abergläubischer Natur sind, denn laut Kingsley versuchen wir immer, unseren Aberglauben vernünftig aussehen zu lassen. Als Beweis nannte Kingsley beispielsweise das Lehrbuch für Hexerei aus dem 15. Jahrhundert, den Hexenhammer Malleus Maleficarum. Dieser versuchte, aus der Hexensuche eine Wissenschaft zu machen und schürte den angsterfüllten abergläubischen Drang, Hexen aufzuspüren, indem er diesem eine scheinbar wissenschaftliche Grundlage gab. Gemäß dem Malleus Maleficarum konnte man nicht in Frage stellen, dass es Hexen unter uns gab, denn diese Sorge galt als vernünftig und wissenschaftlich nachweisbar. Sie war jedoch der reine Aberglaube, wie Kingsley darlegte. Obwohl das Wissen beträchtlich anwuchs, blieb solch unhinterfragter und Angst einflößender Aberglaube zu seiner Zeit bestehen. Der bloße Fortschritt in Wissen und Technologie beseitigt die Angst nicht.
Was macht unsere Kultur nun mit all ihrer Angst? Angesichts ihres säkularen Selbstverständnisses wird sich unsere Gesellschaft nicht Gott zuwenden. Die einzig mögliche Lösung muss also sein, dass wir sie selbst in den Griff bekommen. So versucht die westliche Gesellschaft seit der Aufklärung, die Angst mit medizinischen Mitteln zu therapieren. Die Angst ist zu einer schwer fassbaren Krankheit geworden, die medikamentös behandelt werden muss. (Ich will hier nicht andeuten, dass die Einnahme von Medikamenten gegen Angst falsch ist, sondern, dass sie nur eine – manchmal wichtige – Linderungsmaßnahme und keine endgültige Lösung ist.)8 Doch dieser Versuch, Angst so zu eliminieren, wie man eine Krankheit ausrotten würde, hat das Wohlbefinden (also die völlige Abwesenheit von Angst) zu einer gesundheitlichen – ja sogar zu einer moralischen – Komponente gemacht. Wo Unbehagen einst als ganz normal und für bestimmte Situationen durchaus angemessen galt, wird es nun als etwas grundsätzlich Ungesundes angesehen. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Universitätsstudent sagen kann: »Ihre Ansichten sind mir unangenehm«, und dies als legitimes Argument dafür angesehen wird, die Diskussion abzubrechen. Immerhin ist es nicht akzeptabel, jemandem Unbehagen zu bereiten.
Es bedeutet, dass in einer Kultur, die von Furcht und Angst überflutet wird, Angst zunehmend als etwas völlig Negatives angesehen wird. Die Christen sind von dieser Mainstream-Meinung auch mitgerissen worden und haben die negative Einschätzung der Gesellschaft über alle Angst übernommen. Kein Wunder also, dass wir uns scheuen, über die Gottesfurcht zu sprechen, obwohl sie in der Heiligen Schrift und im christlichen Denken historisch gesehen eine herausragende Rolle spielt. Das ist völlig verständlich, aber es ist tragisch: Der Verlust der Gottesfurcht hat unser modernes Zeitalter der Angst eingeleitet. Doch dieselbe Gottesfurcht ist das wahre Gegenmittel gegen unsere Ängstlichkeit.
Ein Wort, das besser redet
Im Gegensatz zu heute gelang es den Christen früherer Generationen, die sich die Gottesfurcht zu eigen machten, mit einer beneidenswerten Kombination aus Zärtlichkeit, Optimismus und Ausgewogenheit über Angst zu sprechen. Ein Beispiel ist John Flavel, einer der letzten Puritaner. In seinem klassischen Werk Der Sieg über die sündhafte Furcht zeigt er eine berührende Sensibilität für die seelischen Qualen, die unsere Ängste verursachen können:
»Unter allen sichtbaren Kreaturen Gottes ist der Mensch allein geneigt und fähig, sein eigener Peiniger zu sein. Und unter allen Geißeln, mit denen er seine Seele und seinen Körper quält, ist keine so grausam und unerträglich, wie seine eigene Furcht. Je schlimmer die Zeiten zu werden drohen, desto mehr braucht die Seele Beistand und Ermutigung, um sie für harte Kämpfe zu stärken und zu ermutigen; aber bei den schlimmsten Aussichten fügt die Angst dem menschlichen Geist die tiefsten und gefährlichsten Wunden zu und zerschneidet die Nerven seiner Widerstandskraft und seiner Belastbarkeit.«9
Doch anstatt sich von dieser Aussicht in eine Abwärtsspirale der Angst ziehen zu lassen, wie unsere Kultur es tut, verbreitet Flavel mit klaren und frohmachenden Worten Zuversicht und findet eine Lösung. Die Wurzel unserer meisten Ängste, behauptet er, ist unser Unglaube:
»Wenn die Leute an die Wurzel ihrer Furcht gehen würden, würden sie den Unglauben finden. ›Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen?‹ (Mt 8, 26). Je schwächer der Glaube, umso größer die Furcht; Unglaube erzeugt Furcht und Furcht verstärkt den Unglauben. … Alle Geschicklichkeit in der Welt kann uns nicht von der Krankheit der Furcht heilen. Zuerst muss uns Gott von unserem Unglauben heilen. Christus wendete die richtige Methode an, um seine Jünger von ihrer Furcht zu befreien, als er sie für ihren Unglauben tadelte.«10
Angst gedeiht am besten auf dem Boden des Unglaubens, aber sie verwelkt, wenn sie mit dem Glauben in Kontakt kommt. Der Glaube wiederum wird durch die Gottesfurcht befruchtet, wie Flavel im weiteren Verlauf seiner Abhandlung zeigt.
Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften
Flavel erkannte, was wir heute nur schwer begreifen können: dass nicht alle Ängste gleich und auch nicht alle Ängste schlecht, ungesund oder unangenehm sind. Er sagte, dass wir zwischen verschiedenen Arten von Furcht unterscheiden müssen – zwischen falscher und richtiger Furcht.11 Das werden wir im Folgenden tun, wenn wir uns ansehen, wie die Schrift einige ganz unterschiedliche Arten von Furcht beschreibt – negative und positive. Das wird uns helfen, uns darüber zu freuen, dass die in der Bibel beschriebene Gottesfurcht nicht deshalb abgetan werden kann, weil sie so klingt wie die Ängste, die uns quälen. Dann können wir schätzen lernen, dass es sich um eine Furcht handelt, die Christus und seinem Volk Freude bereitet. Es ist die einzig positive, wunderbare Furcht, die mit unseren Ängsten fertig wird.
2 Sündige Furcht
Wir alle kennen Angst. Wenn du Angst hast, reagiert dein Körper: Du spürst die Adrenalinausschüttung, dein Herz rast, deine Atmung beschleunigt sich, deine Muskeln spannen sich an und dein Gehirn ist in Hyperalarmbereitschaft. Manchmal kann das richtig Spaß machen: Denke an den Nervenkitzel in der Achterbahn oder bei einem entscheidenden Fußballspiel. Manchmal packt uns die Panik so sehr, dass wir nicht mehr denken können, sondern nur noch zittern und schwitzen.
Hinter diesen körperlichen Phänomenen verbergen sich ganz gewöhnliche Gedanken. Wir haben Angst, wenn wir etwas begegnen, das wir nicht kontrollieren können. Wir fürchten uns, wenn wir damit rechnen müssen, etwas Schlimmes zu erleben oder etwas zu verlieren, das wir lieben. Wir fürchten uns sogar, wenn wir die Erwartung haben, etwas Wunderbares zu bekommen, das uns zu schön erscheint, um wahr zu sein. Der niederländische Theologe Wilhelmus à Brakel ging der Sache auf den Grund und stellte fest: »Angst entspringt der Liebe«.12 Das heißt, wir fürchten uns, weil wir lieben: Wir lieben uns selbst und fürchten daher, dass uns etwas Schlimmes zustößt; wir lieben unsere Familien, unsere Freunde, unsere Dinge und fürchten daher, sie zu verlieren.
Aber wir fürchten nicht nur, zu verlieren, was wir lieben; seltsamerweise fürchten wir auch das Geliebte selbst