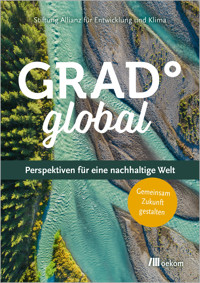
Grad° Global E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: oekom verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Wie gelingt globale Gerechtigkeit in Einklang mit umfassendem Klimaschutz? Dieses Buch liefert Antworten, Impulse und inspirierende Geschichten aus einer starken Gemeinschaft von Unternehmen, Organisationen und Menschen, die Verantwortung übernehmen. Es nimmt Sie mit zu Projekten im Globalen Süden, stellt innovative Wege freiwilligen Engagements vor und vermittelt konkrete Einblicke in eine Transformation, die längst begonnen hat. Stimmen aus Ruanda und Kambodscha sowie aus Wirtschaft, Bildung und Sport zeigen, wie nachhaltige Entwicklung und globaler Klimaschutz Hand in Hand gehen können. Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima bringt Unternehmen, Institutionen und Menschen in einer engagierten Multi-Akteurs-Gemeinschaft zusammen. Ein Buch für alle, die die globalen Zusammenhänge verstehen und aktiv zu einer gerechten, klimafreundlichen Zukunft beitragen wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2025 oekom verlag, München
oekom – Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH
Goethestraße 28, 80336 München
+49 89 544184 – 200
Inhalt: Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima (Hrsg.)
Redaktion: Vera Bünte, Valeska Gelfert, Dr. Olivia Henke und Clara Trebes
Layout und Satz: Studio Kunst GmbH
Korrektur: Maike Specht
Umschlaggestaltung: Laura Denke, oekom verlag
Umschlagabbildung: © iStock: nazar_ab
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-98726-606-5
https://doi.org/10.14512/9783987264986
Stiftung Allianz fürEntwicklung und Klima
GRAD°
global
Perspektiven für einenachhaltige Welt
Inhaltsverzeichnis
1. Business
Scope 3 – die große Bedeutung indirekter Emissionen für die Klimabilanz
Warum die freiwillige Unterstützung von Klimaschutzprojekten für Unternehmen sinnvoll ist
Immer auf dem aktuellen Stand – mit der Academy
Die Erde im Blick
Klimafinanzierung – Eine sinnvolle Ergänzung der unternehmerischen Klimastrategie
Contribution Claim-Modell: Ein neuer Ansatz für unternehmerischen Klimaschutz
Ausgezeichnet emissionsarm: Wie Sovereign Speed und Interface den Wandel in Logistik und Lieferkette gestalten
Zertifizierung und Nachhaltigkeitskommunikation: Zwischen Bilanz und Balance
2. Menschen
»Unsere Aktivitäten sprechen lauter als unsere Worte«
Die andere Erdhalbkugel im Wohnzimmer
Trikots, Tore, Transformation – Wie nachhaltig kann Fußball sein?
Sprung ins Morgen
3. Wissen
Unsere Erde ist schön! Gemeinsam bilden wir eine lebenswerte Welt
COP30 in Belém: Schulterschluss mit dem Globalen Süden
Was ist eigentlich Biodiversität?
4. Klimagerecht
Entwicklung für eine klimagerechte Welt: Eine gemeinsame Verantwortung
»Ohne Artenvielfalt kann kein einziger Mensch auf diesem Planeten leben«
Ganzheitliche Klimaschutzstrategien: Ein integrativer Ansatz für Nachhaltigkeit und Klimaschutz
Perspektiven schaffen im Globalen Süden
Klimaschutzprojekte in Kambodscha: Lösungen für Unternehmen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung
5. Die Stiftung
Über die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima
Foto: Die Hoffotografen
»Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.«
Dieses Zitat von Franz Kafka spiegelt den Ansatz der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima wider, die mit ihrem Angebot Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen bei den ersten Schritten in ihrem Engagement für nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz unterstützt. Zudem fördert sie auf breiter Basis das Bewusstsein, Entwicklungswirkungen und Klimaschutz im Globalen Süden zu koppeln. Dazu zeigt sie Wege auf und begleitet Engagierte dabei, diese zu gehen. Und globale Verantwortung zu übernehmen.
Die Stiftung integriert dabei engagierte Unternehmen und Organisationen in die von ihr getragene Multi-Akteurs-Gemeinschaft, um der Bedeutung des Engagements national und international Geltung zu verschaffen. Das entspricht ihrem Motto »Eine Welt, ein Klima«.
Mit diesem Ziel im Blick machen wir in diesem Buch Unternehmen sichtbar, die den Weg der Transformation beschreiten. Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist und Botschafter der Stiftung, erklärt wichtige Zusammenhänge zwischen Klima und Artenschutz. Wie man unternehmensintern Wissen und Meinungsbildung rund um den freiwilligen Kohlenstoffmarkt (VCM) fördern kann, zeigen wir im Porträt unserer Academy. Anhand zwölf guter Gründe wird erläutert, warum die freiwillige Unterstützung von Klimaschutzprojekten für Unternehmen sinnvoll ist. Mit dem Contribution Claim-Modell zeigen wir hierzu auch einen neuen Ansatz für Unternehmen auf.
Für dieses Buch haben wir mit Menschen gesprochen, die uns ihr Wirken im und für den Globalen Süden näherbringen: Christine Muhongerwa spricht über die Lebenswirklichkeit in Ruanda, wir besuchen Klimaschutzprojekte in Kambodscha, und Moderatorin Anja Backhaus berichtet, wie sie in über 40 Folgen des Podcasts Gradº Global mit Akteur:innen im Gespräch ist, die diesen Planeten im Ganzen betrachten. Sie lesen, wie Sportler:innen, beispielsweise unsere Botschafterin, die Stabhochspringerin Jacqueline Otchere, oder Menschen aus der Welt des Fußballs, gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Sie erfahren, wie Bildung spielerisch und wirksam zur Transformation beitragen kann und warum in der Nachhaltigkeitskommunikation Leise das neue Laut ist. Außerdem werfen wir einen Blick auf Historie und Ziele der Weltklimakonferenz (COP). Und wir zeigen die Vorteile einer ganzheitlichen Klimaschutzstrategie auf, mit der gleich mehrere Wirkungen erzielt werden. Zudem legen wir dar, warum wir gerade jetzt die Chance haben, eine gerechtere und nachhaltigere Welt zu schaffen.
Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre.
Dr. Olivia Henke und Peter Renner
Vorständin und Vorstandsvorsitzender
Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima
Business
Scope 3 – die große Bedeutung indirekter Emissionen für die Klimabilanz
Artikel: Karolina Landowski
Bilder: ClimateChoice, iStock
Scope 3-Emissionen sind die nicht ganz leicht fassbaren Giganten der Klimabilanz: Sie entstehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette eines Unternehmens – von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und Logistik bis zur Nutzung und Entsorgung verkaufter Produkte. Oft entziehen sie sich der direkten Kontrolle eines Unternehmens, da sie nicht in seinem unmittelbaren Einflussbereich liegen. Dennoch machen sie in vielen Branchen bis zu 90 Prozent der gesamten Emissionen aus. Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima unterstützt Unternehmen dabei, in allen Scopes Transparenz zu schaffen und so ihre Klimaziele zu erreichen.
Scope 3-Emissionen sind das komplexeste Element der betrieblichen Treibhausbilanz und gleichzeitig ihr größter Hebel. Sie umfassen 15 Kategorien, die entlang der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette eines Unternehmens entstehen – darunter eingekaufte Rohstoffe, Güter und Dienstleistungen, Transport, Abfall, Nutzung und Entsorgung verkaufter Produkte sowie Investitionen –, und bilden damit das gesamte indirekte Emissionsspektrum eines Betriebs ab. Scope 3-Emissionen liegen so per Definition außerhalb der direkten Unternehmensgrenzen, allerdings nicht außerhalb der Verantwortung eines Unternehmens. Wer Klimaziele erreichen und regulatorische Anforderungen wie die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) oder Science Based Targets Initiative (SBTi) erfüllen will, kommt an Scope 3 nicht vorbei. »Die Auseinandersetzung mit Scope 3 beginnt meist mit einem Aha-Moment – der Erkenntnis, dass der größte Teil der Emissionen nicht im Unternehmen selbst, sondern bei Lieferant:innen, Partner:innen und Nutzer:innen entsteht«, erklärt Lara Obst, Mitgründerin von ClimateChoice, einem Berliner ClimateTech-Start-up, das digitale Lösungen zur Dekarbonisierung komplexer Lieferketten entwickelt.
Indirekte Emissionen: Ein Schlüssel für robuste Klimastrategien
Doch wie gelingt es, diese indirekten Emissionen systematisch zu erfassen, zu bewerten und zu reduzieren? Gerade weil sie außerhalb des eigenen Betriebs anfallen, sind sie schwer zu quantifizieren. Lieferketten sind global, komplex und datenintensiv – und genau darin liegen die Herausforderungen. Die Erfassung dieser Emissionen ist mit erheblichem Aufwand verbunden: Mangelnde Datenverfügbarkeit, fehlende Standardisierung und ein hoher Ressourceneinsatz bremsen viele Unternehmen aus. Vor allem im Mittelstand fehlt es häufig an Kapazitäten, und die Datenbasis ist fragmentiert. »Besonders im Mittelstand sind viele Prozesse noch analog und Verantwortlichkeiten unklar«, sagt Lara Obst. Um einen fundierten Einstieg zu schaffen, empfiehlt sich eine umfassende Wesentlichkeitsanalyse. Hierbei werden Scope 3-Kategorien, z. B. Transport oder eingekaufte Materialien, nach Kriterien wie Signifikanz, Einflussmöglichkeit, Risikopotenzial, externen Transparenzanforderungen und dem Bezug zum Kerngeschäft bewertet. So entsteht eine Prioritätenliste der wesentlichen Emissionsquellen.
Ein gutes Praxisbeispiel ist Rotpunkt Küchen, ein international tätiger Hersteller von Küchenmöbeln mit Sitz in Ostwestfalen. Gemeinsam mit der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima und auf Basis des Greenhouse Gas Protocol identifizierte das Unternehmen relevante Scope 3-Kategorien. »Wir haben systematisch analysiert, wo unsere wesentlichen Emissionen entstehen – und welche davon wir beeinflussen können«, sagt Hendrik Fischer, Nachhaltigkeitsmanager bei Rotpunkt. Daraus ergaben sich konkrete Maßnahmen: die Elektrifizierung des Fuhrparks, ein unternehmensweites Abfallmanagement, Job-Bike-Programme, der vermehrte Einsatz von Rezyklaten sowie die Verwendung von Spanplatten mit hohem Recyclingholzanteil.
Lara Obst, Mitgründerin von ClimateChoice, liefert digitale Lösungen für komplexe Klimadaten.
»Besonders im Mittelstand sind viele Prozesse noch analog und Verantwortlichkeiten unklar.«
Die Lieferkette als Emissionstreiberin – und als Klimachance
In der Praxis startet die Emissionserfassung oft mit Emissionsfaktoren aus öffentlich zugänglichen Datenbanken. Doch für valide Aussagen sind Primärdaten nötig, und deren Erhebung ist aufwendig. Datenlücken bleiben ein zentrales Thema. »Die Datenverfügbarkeit ist und bleibt eine große Herausforderung«, sagt Hendrik Fischer. »Wir stehen im ständigen Austausch mit unseren Lieferant:innen, um belastbare Werte zu erhalten.« Denn Daten sind nur so gut, wie sie nutzbar sind. Wenn man erst einmal anfängt, sich mit den Klimadaten aus der Lieferkette zu befassen, merkt man, wie viele Fragen offenbleiben. Welcher Lieferbetrieb kann Emissionen reporten, hat aber auch Klimaziele gesetzt und eventuell Maßnahmen zur Emissionsreduktion umgesetzt, und wenn ja, welche? »Viele Unternehmen erfassen mit Excel – aber spätestens bei der zweiten oder dritten Erhebungsrunde zeigt sich, dass das nicht skalierbar ist«, erklärt Lara Obst.
Die Lösung sind digitale Tools. Systeme wie die Climate Intelligence Platform von ClimateChoice ermöglichen es, Daten von Lieferant:innen strukturiert zu erfassen, KI-gestützt auszuwerten und systematisch zu vergleichen. Sie bieten zudem standardisierte Klimareifegrad-Scores, um strategische Entscheidungen datenbasiert zu untermauern. Um den Prozess langfristig zu stärken, wurde 2023 die Scope 3-Action Group ins Leben gerufen – ein branchenübergreifendes Netzwerk, das Unternehmen hilft, ihre Dekarbonisierungsstrategien praxisnah zu entwickeln.
Kooperationen spielen bei Scope 3 eine zentrale Rolle. Ohne enge Zusammenarbeit mit Lieferantinnen, Technologiepartner:innen oder Partnerinnen wie der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima ist nachhaltige Wirkung kaum möglich. Neben dem Siegel SDGold bietet die Stiftung ein umfassendes Unterstützungsprogramm, etwa in Form von praxisnahen Workshops wie »Treibhausgas-Bilanzierung entlang der Lieferkette«. Diese richten sich insbesondere an kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) und behandeln konkrete Fragen: Wie beginne ich eine Wesentlichkeitsanalyse? Welche Datenquellen sind belastbar? Wie lassen sich sogenannte Science Based Targets, also wissenschaftsbasierte Ziele, integrieren? Zusätzlich stellt die Stiftung eine Toolbox mit Leitfäden, Checklisten für die Kommunikation mit Lieferantinnen und externen Datenquellen zur Verfügung – ein wertvoller Einstieg für Unternehmen jeder Größe.
Scope 3 als Schlüssel zur ganzheitlichen Klimabilanz
Rotpunkt Küchen zeigt eindrucksvoll, wie aus einem theoretischen Konstrukt ein strategisches Steuerungsinstrument werden kann. »Die Datenerhebung und -analyse betrifft heute alle internen Bereiche – von Einkauf, Produktion und Logistik bis hin zu IT und Entwicklung«, so Fischer. Der ganzheitliche Ansatz zahlt sich aus: Emissionen werden sichtbar und damit beeinflussbar. »Auch wenn Scope 3 komplex ist: Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Schritt für Schritt.« Emissionen lassen sich nur dann wirksam senken, wenn man sie kennt und bereit ist, auch an den indirekten Stellschrauben zu drehen. Unternehmen sollten Zuständigkeiten klar definieren und alle relevanten Abteilungen einbeziehen. »Sinnvoll ist es, sich dem Thema zu nähern, selbst wenn noch nicht alle Daten vorliegen. Dies ist ein kontinuierlicher Prozess, der im Unternehmen etabliert werden muss. Zudem kann man mit Hilfe der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima kontinuierlich Wissen zu dem Thema aufbauen«, sagt Hendrik Fischer. Besonders effektiv sei es, betont Lara Obst, mit den größten Emittenten zu beginnen. Denn frei nach dem Pareto-Prinzip: »20 Prozent der Lieferant:innen verursachen oft 80 Prozent der Emissionen. Wer hier ansetzt, kann mit vergleichsweise wenig Aufwand eine große Wirkung erzielen.«
Scope 3 ist eine Herausforderung, aber auch eine enorme Chance. Für Unternehmen, die bereit sind, Verantwortung über die eigenen Werkstore hinaus zu übernehmen, bieten sich neue Perspektiven: Transparenz, Effizienz, Innovation und nicht zuletzt eine glaubwürdige und robuste Klimastrategie. Wer sich der Herausforderung stellt, positioniert sich nicht nur regulatorisch sicher, sondern auch zukunftsorientiert im Wettbewerb.
Unterwegs in Richtung Klimaziel: Rotpunkts E-Transporter liefern Küchenmöbel emissionsarm aus.
Hendrik Fischer treibt bei Rotpunkt Küchen die Klimatransformation voran.
»20 Prozent der Lieferant:innen verursachen oft 80 Prozent der Emissionen. Wer hier ansetzt, kann mit vergleichsweise wenig Aufwand eine große Wirkung erzielen.«
Warum die freiwillige Unterstützung von Klimaschutzprojekten für Unternehmen sinnvoll ist
Artikel: Karolina Landowski
Bilder: Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima
Um unseren Planeten zu retten, müssen wir die CO2-Emissionen drastisch und sofort senken. Zur Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens ist ein starkes Engagement der Unternehmen im Klimaschutz unerlässlich. Je länger wir warten, desto mehr kostet uns der Klimawandel. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Folgen des Klimawandels Deutschland bis 2050 zwischen 280 und 900 Milliarden Euro kosten werden. Je früher wir handeln, desto geringer die Kosten – auch für Mensch und Umwelt. Hier sind zwölf überzeugende Gründe, warum Unternehmen in weltweite Klimaschutzprojekte investieren und freiwillig CO2 ausgleichen sollten:
1. Wertvoller Beitrag zur globalen Klimaschutzagenda
2. Schnelle und große Wirkung
3. Verbesserung der Unternehmensreputation
4. Stärkung der Mitarbeitendenmotivation
5. Vorbereitung auf zukünftige Regulierungen
6. Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten
7. Stärkung der Lieferkette
8. Steigerung der Kundenloyalität
9. Beitrag zur lokalen Entwicklung
10. Förderung von Innovation und Effizienz
11. Erfüllung von ESG-Kriterien
12. Verbessertes Risikomanagement
1Wertvoller Beitrag zur globalen Klimaschutzagenda
Indem Unternehmen Klimaschutzprojekte finanziell unterstützen, leisten sie einen direkten Beitrag zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen und zum Schutz wertvoller Ökosysteme. Dies hilft, die globale Erwärmung einzudämmen und die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu minimieren. Ihr Engagement trägt dazu bei, eine lebenswerte Zukunft für kommende Generationen zu sichern, und demonstriert Ihre Verantwortung als zukunftsorientierte Person, die an Lösungen für die größten Herausforderungen unserer Zeit mitarbeitet.
2Schnelle und große Wirkung
Freiwillige CO2-Kompensation ist nach der Vermeidung und Reduktion von Emissionen kurzfristig umsetzbar. Als Unternehmer:in können Sie direkt wirksam werden, indem Sie Klimaschutz außerhalb Ihrer Wertschöpfungskette unterstützen. Im Vergleich zu vielen kleinen direkten Klimaschutzmaßnahmen von Unternehmen und Privatpersonen im Alltag können durch den freiwilligen Ausgleich Tonnen an Emissionen anstelle von Kilogramm vermieden werden und sind daher von großer ökologischer Relevanz.
3Verbesserung der Unternehmensreputation
Die Finanzierung von Klimaschutzprojekten und die freiwillige CO2-Kompensation signalisieren Verantwortungsbewusstsein und stärken Ihr Image als nachhaltiges Unternehmen. Kund:innen, Investor:innen und Partner:innen nehmen dies positiv wahr, was zu einer verbesserten Markenwahrnehmung und Kundenbindung führt. Durch proaktives Handeln im Klimaschutz positionieren Sie sich als Vorreiter:in in Ihrer Branche und gewinnen das Vertrauen umweltbewusster Stakeholder. Dies kann langfristig zu Wettbewerbsvorteilen und einer Steigerung des Unternehmenswerts führen.
4Stärkung der
Mitarbeitendenmotivation





























