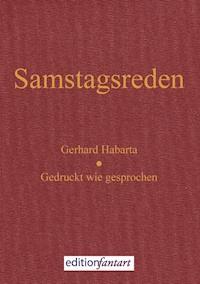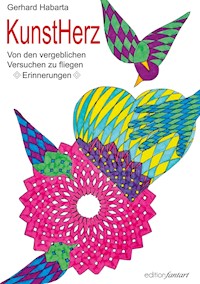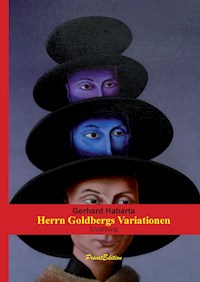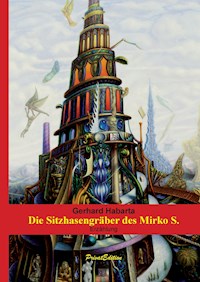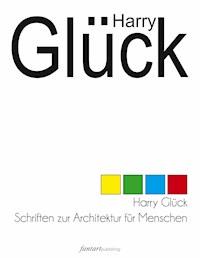Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Grafik ist immer eine Vervielfältigung. Auch wenn es nur ein Exemplar davon gibt, so könnten mehrere davon gemacht werden oder könnte es gegeben haben. Es dauerte nur unterschiedlich lange Zeit sie herzustellen. Von den mühsam in Holzplatten geschnittenen, auf Papier abgeriebenen und handkolorierten Einblattdrucken des 15. Jahrhunderts bis zu unseren in Sekundenschnelle hergestellten Farb-Kopien auf dem Bürodrucker. Vorher waren Bilder auf Kirchen, Klöster und Adelshäuser beschränkt. Die aufwändige Buchmalerei konnte nur ebenso aufwändig durch eifrige Kopisten vervielfältigt werden. Die rasche Verbreitung des Buchdrucks ab 1450 ersetzte die handgemalten Kopien durch gedruckte Bilder. Das kostbare Pergament wurde durch das einfacher herzustellende, billigere Papier verdrängt. Buchdruck und Papier und der Entdeckergeist der Renaissancekünstler, die neue graphische Bildtechniken fanden, schufen eine neue Bilderwelt für eine breitere Schicht. Aller graphischen Kunst ist eines gemeinsam: Sie will mehrere idente Stücke eines Bildes schaffen: ob als Heiligenbild, wissenschaftliche Illustration, aktuelles politisches Statement, Landschaftsdarstellung, Banknote, Briefmarke oder einfach nur ein Bild für viele. Ob als Holzschnitt, Kupferstich, Radierung, Stahlstich, Lithographie, Offset, Siebdruck oder Digitaldruck.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
E
INLEITUNG
: D
IE
K
UNST
D
ER
V
ERVIELFÄLTIGUNG
Z
EITTAFEL
: A
LLES HAT SEINE
Z
EIT
1 - H
OCHDRUCK
Der Holzschnitt
/
Der japanische Holzschnitt
/
Geschichte & Geschichten zum Holzschnitt
2 - T
IEFDRUCK
Der Kupferstich
/
Die Schabkunst
/
Der Stahlstich
/
Die Radierung
/
Kaltnadelradierung
/
Ätzradierung
/
Heliogravüre
/
Geschichte & Geschichten zum Tiefdruck
3 - F
LACHDRUCK
Lithographie
/
Das Plakat
/
Lichtdruck
/
Offsetdruck
Geschichte & Geschichten zur Lithographie
4 - S
IEBDRUCK
Siebdruck
/
Geschichte & Geschichten zum Siebdruck
5 - D
IGITALDRUCK
& G
ICLÉE
Giclée der Standard
/
Geschichte & Geschichten zur digitalen Grafik
6 - U
NIKATE
D
RUCKFORMEN
Monotypie
/
Collage
/
Mail-Art
7 - V
ERLEGER
, H
ÄNDLER
, M
ISSIONARE
Alles mit Originalen
/
Der Wandel vom Buch zur Grafik
/
Kunsthandel ist Grafikhandel
/
Die Missionare
/
Die papierenen 68er
8 - D
IE
L
EGENDE VOM
O
RIGINAL
Künstliche Verknappung
/
Original-Fälschung
/
Geschichte & Geschichten vom Urheberrecht
9 - F
OTOGRAFIE
Rohmaterial für Künstler
/
Der Verlust der Aura
/
Der Gewinn des Kunsthandels
10 - D
IE
V
ERVIELFÄLTIGUNG
Bewahrerin des Einmaligen
/
Grafik ist Politik
/
Geld ist Grafik
/
Der schöne Schein
/
Sünden Geld
/
Die Welt ist klein und hat Zähne
/
Geschichte & Geschichten der Vervielfältigung
11 - D
EFINITION
I
NDEX
Einleitung:
Grafik - Die Kunst der Vervielfältigung
Grafik ist immer eine Vervielfältigung. Auch wenn es nur ein Exemplar davon gibt, so könnten mehrere davon gemacht werden oder könnte es gegeben haben.
Es dauerte nur unterschiedlich lange Zeit sie herzustellen. Von den mühsam in Holzplatten geschnittenen, auf Papier abgeriebenen und handkolorierten Einblattdrucken des 15. Jahrhunderts bis zu unseren in Sekundenschnelle hergestellten Farb-Kopien auf dem Bürodrucker.
Vorher waren Bilder auf Kirchen, Klöster und Adelshäuser beschränkt. Die aufwändige Buchmalerei konnte nur ebenso aufwändig durch eifrige Kopisten vervielfältigt werden. Die rasche Verbreitung des Buchdrucks ab 1450 ersetzte die handgemalten Kopien durch gedruckte Bilder. Das kostbare Pergament wurde durch das einfacher herzustellende, billigere Papier verdrängt. Buchdruck und Papier und der Entdeckergeist der Renaissancekünstler, die neue graphische Bildtechniken fanden, schufen eine neue Bilderwelt für eine breitere Schicht.
Aller graphischen Kunst ist eines gemeinsam: Sie will mehrere idente Stücke eines Bildes schaffen: ob als Heiligenbild, wissenschaftliche Illustration, aktuelles politisches Statement, Landschaftsdarstellung, Banknote, Briefmarke oder einfach nur ein Bild für viele. Ob als Holzschnitt, Kupferstich, Radierung, Stahlstich, Lithographie, Offset, Siebdruck oder Digitaldruck.
Abb.: Scriptorum in einem Kloster des Mittelalters
Alles hat seine Zeit
DAS 3. JAHRHUNDERT – DIE STEINABREIBUNG
Abb.: Terrakotta-Armee in Qin Shihuandi, Chin 210 v.Ch.
Es war eine Zeit der ‚Streitenden Reiche‘, als sieben Staaten um die Vorherrschaft in China kämpften. Ab dem 4. Jh wurden Buddhisten verfolgt. Tempel wurden aufgelöst, Statuen zerstört und Schriften verbrannt. Wegen der soziale Wirren und Kriege meißelten und gravierten Mönche buddhistische Texte und Zeichen in den Fels, um die heiligen Schriften des Buddhismus zu bewahren. Diese Schriften wurden später auf Papier abgedruckt und Gläubigen mitgegeben.
Steinabreibungen: die ersten Druckgraphiken.
Aus China kommt auch um 960 die Erfindung von Papiergeld. Es war leichter zu transportieren als Säcke mit Kupfer- und Eisenmünzen.
DIE STEINABREIBUNG WURDE ZUR VERVIELFÄLTIGENDEN KUNST DER MÖNCHE UND DER WIRTSCHAFT
Abb.: Shaolin, „3 Religionen Bild“ Steinabreibung, 1000-Buddha-Halle, Ming Dynastie
DAS FRÜHE MITTELALTER - DER HOLZSCHNITT
Abb.: Psalterkarte von London, um 1260, London, British Library
Das Frühmittelalter 4. bis 11. Jahrhundert war das feudale Mittelalter, das Zeitalter der Mönchsorden und Ritter. Es war die Zeit der Glaubensverbreitung, der Glaubenskriege und der Besiedlung der Welt.
Das Heiligenbild, die Heiligen Schriften und die Landkarten wurden durch vervielfältigenden Druck verbreitet, meist Holzschnitte.
DER HOLZSCHNITT WURDE ZUR VERVIELFÄLTIGENDEN KUNST DER MISSIONARE UND EROBERER
Abb.: Jost Amman, Holzschneider, Holzschnitt 1568
DAS MITTELALTER - DER KUPFERSTICH
Die Zeit des Mittelalters (Hochmittelalter 11. - 13. Jh., Spätmittelalter 13. -15.Jh) war der Beginn des Bürgertums der Städte und der Geldwirtschaft. Die ersten Universitäten, in Bologna, Paris und Wien verbreiteten die antiken Lehren und den Künstlern eröffneten sich neue Technologien. Die ersten Papiermühlen entstanden und Papier ersetzte das Pergament
Die Waffenschmiede archivierten ihre in die Rüstungen gravierten Entwürfe, indem sie Farbe auf angefeuchtetem Papier aus den Vertiefungen zogen. Aus diesen Gravuren entstand der Kupferstich.
DER KUPFERSTICH WURDE ZUR VERVIELFÄLTIGENDEN KUNST DER WISSENSCHAFT UND KUNST
Albrecht Dürer „Melencolia“, Kupferstich, 1514
RENAISSANCE & BAROCK - DIE RADIERUNG
Abb.: Martin Luther 95 Thesen, 1517, Melchior Lotter d.J. 1522
Die Renaissance (14.-17. Jh.) und das Barock (16.-18. Jh.) waren Zeiten des Umbruchs. Martin Luther schrieb 1517 seine 95 Thesen und wurde zum Auslöser der Reformation in ganz Europa. Bauernaufstände erreichten einen Höhepunkt. Kopernikus begründete ein neues Weltbild. Papst Gregor XIII. reformierte den Kalender und in der Renaissance entwickelten sich Kunst und Wissenschaften. Die Alchemisten erfanden Säuren, außer Essig waren kaum andere bekannt, die Schwefelsäure wurde erst 1597 genauer beschrieben. Die Chemie der Säuren ersetzte die manuelle Kraft des Kupferstichs und es entstanden die vielfältigen Möglichkeiten der Radierung.
DIE RADIERUNG WURDE ZUR VERVIELFÄLTIGENDEN KUNST DER AUFKLÄRUNG
Abb.: Francisco Goya Caprichos, „Nohubo remedio – Es gibt keine Hilfe“ Radierung mit Aquatinta, 1799
REVOLUTION UND INFORMATION - DIE LITHOGRAPHIE
Abb.: Edouard Manet (1832-1883), “Guerre civile“ Lithographie 1871
Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 war eines der wichtigsten und folgenreichsten Ereignisse der europäischen Geschichte in der der Gegensatz zwischen Besitzenden und Besitzlosen mit der Abschaffung des feudalistischen Staates kulminierte. In dieser revolutionären Zeit der Aufklärung und der Verkündigung der Menschenrechte wurde ein Druckverfahren erfunden, schneller und einfacher als die bisherigen Drucktechniken. Alois Senefelder erfand um 1796 die Lithographie, den Steindruck, auf der Basis der Abstoßung von Gegensätzen, von Fett und Wasser. Der Holzschnitt wurde erneuert und industriell für den Illustrationsdruck nutzbar gemacht
DIE LITHOGRAPHIE WURDE ZUR VERVIELFÄLTIGENDEN KUNST DER ZEITUNGEN UND PLAKATE
Abb.: Honore Daumier „Das da haben sie mir abgelehnt!...diese Ignoranten“ Lithographie ‚Le Charivari, 1859
DAS 20. JAHRHUNDERT -SERIGRAPHIE
Abb.: Filmplakat ‚Metropolis
Es ist das Jahrhundert der Industrie, der Weltkriege, der Werbung, der bedruckten Sportkappen und T-Shirts.
Ab 1908 wurden Fähnchen und Sportkappen mit Schablonen auf Seidengaze bedruckt. 1918 wurde ein Patent für das „Selectasine-Verfahren“ erteilt und die Lizenzen dafür weltweit verkauft. Bedruckt wurden Schilder, Plakate, Textilien und während des Krieges Waffenbeschriftungen und Propagandaplakate für die US-Armee. Künstler entdeckten den Siebdruck ab dem Ende der 1930er Jahre.
DER SIEBDRUCK WURDE ZUR VERVIELFÄLTIGENDEN KUNST DER KONKRETEN, DER OP- ART UND DER POP ART
Abb.: Rakelsiebdruck (Foto ebay)
DIE 1960ER JAHRE - OFFSETGRAFIK
Abb.: Plakate der Revolution in China
Es waren die Jahre des Vietnamkriegs und der Friedensbewegung, des Raumflugs, der Berliner Mauer und der Kulturrevolution. Die Jahre in denen die Kennedys, Martin Luther King und Che Guevara ermordet wurden. Die Studentenbewegungen formierten sich zur APO, der Außerparlamentarischen Opposition. Es war die Zeit von Woodstock, Happenings, Flowerpower, und der sexuelle Revolution.
Der zeitgleich mit dem Siebdruck zum Beginn des Jahrhunderts entstandene Offsetdruck, eine Weiterentwicklung der Lithographie zum indirekten Druck, wurde zum billigen, leicht erreichbaren Ausdrucksmittel.
DIE OFFSET-LITHOGRAPHIE WURDE ZUR VERVIELFÄLTIGENDEN KUNST DER MANIFESTE UND POLITISCHEN GRAFIK
Abb.: Offsetraster
DAS 21. JAHRHUNDERT - GICLÉE UND DIGITALDRUCK
Abb.: QR Code
Der Wechsel zum 21. Jahrhundert ist die Zeit mit der schnellsten Entwicklung neuer Technologien. Geräte die nicht mehr durch Schalter- und Hebeldruck gesteuert werden, sondern berührungsempfindlich sind. In der Drucktechnik gibt es keinen geschnitzten Druckstock mehr, keine mit Säuren bearbeitete Metallplatte, keine mit Fettkreide bezeichneten schweren Steine, keine auf Siebe geklebten Schablonen und auch keinen Druck schwerer Pressen. Es gibt nur mehr die Datenmengen im Computer. Es gibt keinen besseren ersten Abzug, nur noch gleichwertig gute. So, wie der Künstler es will.
DAS GICLÉE WURDE ZUR VERVIELFÄLTIGENDEN KUNST DER GRENZENLOSEN MÖGLICHKEITEN.
Abb.: Ernst Fuchs „Die goldene Nase“ Giclée auf Leinwand, handsigniert, nummeriert 2012; © Courtesy Galerie F
Abb.: Albrecht Dürer, Holzschnitt 1497-98 ‚Johannes in den Wolken‘Schutzpatron der Papiermacher
1. HOCHDRUCK
HOCHDRUCK
Beim Hochdruck wird die Darstellung
Erhaben ausgeführt.
Nichtdruckende Teile werden weggeschnitten,
sind vertieft.
Zum Hochdruck gehören:
HOLZSCHNITT
HOLZSTICH
TONSTICH
LINOLSCHNITT
MATERIALDRUCKE
STEINABEIBUNGEN
Beim Hochdruck ist ein leichtes Relief spürbar,
bei dem die gedruckten Stellen vertieft wirken.
Der Holzschnitt
Die älteste von Künstlern eingesetzte Drucktechnik ist der Holzschnitt. Eine Hochdrucktechnik, bei der die Farbe von erhabenen Stellen des Druckstocks auf das Papier abgezogen wird. Seine praktische Verwendung erfolgte ab dem 13. Jh zuerst bei Heiligenbildern, Spielkarten und politischen Flugblättern.
Wird sonst überall grundsätzlich in der Grafik die Darstellung aufgetragen, so wird beim Holzschnitt alles um die Darstellung weggeschnitten und erst durch dieses wegschneiden, wird die Darstellung geschaffen. Das ist wie bei der Skulptur aus Holz oder Stein. Vom Grundmaterial wird so viel abgeschnitten, abgeschlagen, abgefeilt bis die Darstellung erhaben stehen bleibt.
Seine große Verbreitung fand der Holzschnitt durch die entstehende Papierfabrikation in Europa. Ab der Mitte des 13. Jh. wird in Italien Papier zum allgemeinen Gebrauch hergestellt, 1282 entsteht die erste Papiermühle in Spanien, 1389 in Nürnberg und dann in unmittelbarer Folge in ganz Europa.
Die ersten Holzschnitte die gedruckt wurden, zeigen Heilige. Der Schutzpatron der Papiermacher ist übrigens der Evangelist Johannes, zu dem Albrecht Dürer ein prächtiges Blatt schnitt.
Die meisten frühen Holzschnitte zeigen Heilige und Nothelfer. Die Gläubigen sollten sich nicht nur ein Bild im Kopf machen, sondern es als wundertätiges Bild nach Hause mitnehmen können. Oft auch als Belohnung für eine Spende.
Abb.: Heilige Dorothea, Holzschnitt 1420
Diese frühen Holzschnitte (Schwarzlinienschnitt) waren linear, also es wurde mehr vom Holz weggeschnitten und nur dünne Linien blieben. Das ist nicht dem Material entsprechend, sondern entwickelte sich aus den Linienzeichnungen der Gotik. Erst im 20. Jh. entstand im Expressionismus der dem Holz adäquate Flächenholzschnitt.
Die Herstellung der Bilder erfolgte arbeitsteilig. Ein Vorgang der die Regel blieb in der vervielfältigenden Kunst, aber durch den Künstlerkult des Kunsthandels mehr und mehr verschwiegen wurde.
DER REISSER überträgt die Zeichnung des Künstlers auf die Holzplatte.
DER FORMSCHNEIDER schneidet die Zeichnung in das Holz.
DER BUCHDRUCKER zieht die Druckstöcke auf Papier ab.
DER BRIEFMALER koloriert die schwarzweißen Drucke
Die Drucke wurden mit der Hand abgezogen, wobei die erhabenen Stellen der Druckplatte schwarz eingefärbt wurden und das aufgelegte Papier von der Rückseite aufgerieben wurde. Erst später, mit der Entwicklung des Buchdrucks, wurden Druckpressen verwendet.
Die Kolorierung erfolgte durch die Berufsgruppe der Briefmaler.
Abb.: Aus Jost Amman „Ständebuch - Eygentliche Beschreibung aller Stände auff Erden, hoher und nidriger, geistlicher und weltlicher, aller Künsten, Handwercken und Händeln“ Holzschnitte, 1568. Verse von Hans Sachs
Blockbuch – Buchschmuck
Den mittelalterlichen Einblattdrucken der Heiligenbilder und der Folge von Holzschnitten in Blockbüchern mit Biblischen Geschichten und Glaubensbekenntnissen und Kalenderblättern, folgte mit dem Ende des Mittelalters das illustrierte Buch. Hier waren Holzschnitte Buchschmuck und Illustrationen der durch den neuen Buchdruck möglichen Texte.
Abb.: Kalender des Johannes von Gmunden, 1470
Die mittelalterliche Literatur, Märchen, Epen, Historien, geistliche Belehrungen und triviale religiöse Erbauungsliteratur wurden damit zu Bildgeschichten und wurden so Volksschichten zugänglich, die nicht lesen konnten.
Die „LEGENDA AUREA“ des Jacobus de Voragine mit den reißerischen Heiligengeschichten war das, was man heute als Bestseller bezeichnen würde. Über 900 Abschriften davon haben sich erhalten. Von der Mitte des 15. bis zum 16.Jahrhundert aber wurde es nicht mehr abgeschrieben, sondern mit Holzschnitten fein versehen. Es war das meistgedruckte Buch Europas überhaupt. Kein Buch neben der Bibel wurde so oft gedruckt. Die Attribute der Heiligen in diesen Holzschnitten sind noch heute gültige Symbole.
Abb.: Jacobus de Voragine ‚Legenda Aurea‘ Günther Zainer, Augsburg 1472, mit Holzschnitten des Formschneiders Johann Bämler.
Abb.: Druckstock und Abzug des Holzschnitts „Martyrium des hl. Sebastian“, Süddeutschland 1470–1475 (British Museum)
Abb.: Albrecht Dürer „Die vier apokalyptischen Reiter”, Holzschnitt 1497?
Künstlerholzschnitt der Renaissance
Mit Albrecht Dürer (1471 – 1528) und Lucas Cranach (1472 – 1553) begann das Zeitalter der Renaissance auch im Holzschnitt. „In der ersten Zeit dieser intensiven Tätigkeit für den Holzschnitt ist Dürer noch Spätgotiker… Der Stil um 1510 ist aber ein ganz anderer.“ schreibt der ehemalige Stuttgarter Museumsdirektor H. Th. Musper. Unter Dürer entwickelte sich die Technik soweit, dass die Feinheit einer Federzeichnung erreicht wurde. Welche Bilder Dürer eigenhändig in Holz geschnitten hat und welche von Formschneidern, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen.
Es gab zur Zeit Dürers massenhaft Druckgrafik vor allem in den stark besuchten Wallfahrtsorten, aber Dürer gab dem Medium Druckgrafik einen ganz neuen Stellenwert, einen Rang, den es vorher nicht gehabt hatte, als Sammlerstück. Er erkannte sehr früh die Möglichkeiten dieser neuen Medien und machte sich zunächst stärker mit der Druckgraphik als mit der Malerei einen Namen. Dürer wandte sich gezielt an einen neuen Sammlerkreis gebildeter Interessenten mit höherem Einkommen.
Und er schuf Werke in einem größeren Format als bisher üblich. Nur begrenzt durch das Format der lieferbaren Papierbogen.
Ein neuer phantastischer Realismus wird von Dürer in großformatigen Blättern geschnitten. Bestes Beispiel für diesen Wandel sind die Blätter zur Apokalypse. In der Endzeiterwartung der Zeit vor 1.500 wird die Apokalypse des Johannes aus der Bibel besonders aufmerksam studiert. Dürer macht sie sichtbar, wie kein Künstler vor ihm. Ausdrucksstarke Bilder, bereichert durch eine Vielfalt von Schraffuren und kraftvolle energiegeladene Linien. Beispielhaft für eine neue Zeit in der Kultur und Kunst.
Ein wichtiger Renaissancekünstler und vielleicht wichtigster Mitarbeiter in Dürers Atelier war Hans Baldung genannt Grien (1484? – 1545). Er brachte in die Grafik etwas ein, was vor ihm nicht in dieser Form gezeigt wurde: Die Schönheit und Erotik des nackten Menschen. In zahlreichen Variationen schuf er Zeichnungen und Holzschnitte voll kraftvoller Sinnlichkeit Die nackte, sinnliche Frau wird dargestellt auf dem Umweg über die biblische Eva oder antike Göttinnen, aber vor allem als Hexen voll sexueller Weiblichkeit.
Die Druckgrafik bekommt immer mehr Bedeutung, da sie Religion, Politik, Wissenschaft und Phantasie zu der Ausbreitung verhilft, die das neue Zeitalter bestimmen.
Lucas Cranach d.Ä. (1472 – 1553) war einer der bedeutendsten Maler und Grafiker der Renaissance.
Als er als Geselle auf Wanderschaft ging, kam er 1501 nach Wien und bekam erste Kontakte zu führenden Humanisten. Seit seinem Wiener Aufenthalt signierte Cranach seine Bilder mit Lucas Cranach („Lucas aus Kronach“).
Er war eng befreundet mit den Reformatoren Luther und Philipp Melanchthon und entwickelte sich zum charakteristischen Künstler der deutschen Reformation. Er wirkte durch seine Grafiken zu reformatorischen Schriften in der politisch-geistigen Auseinandersetzung dieser Zeit.
Abb.: Lucas Cranach. ‚Papstesel‘, Holzschnitt der Cranach Werkstatt, nach Wenzel von Olmütz 1496
Abb.: Ehrenpforte Maximilian I, Holzschnitt-Montage bestehend aus 210 einzelnen Drucken
Holzschnitt: Die politische Kunst
Der Holzschnitt war lange Zeit das geeignete Medium zur Verbreitung politischer Absichten. Im Widerstand gegen die Herrschenden wie in der Reformation, aber auch zur Verbreitung der eigenen Bedeutung.
Das größte Werk dazu war die ‚EHRENPFORTE MAXIMILIANS I‘. Der Habsburger, genannt ‚der letzte Ritter‘, Maximilian I (1459 -1519) Herzog von Burgund, ab 1486 römisch-deutscher König, ab 1493 Erzherzog von Österreich und ab 1508 Kaiser des Heiligen Römischen Reiches nutzte sie als Propagandamittel um sich mit Hilfe der Kunst in ein besseres Licht zu rücken. Die Holzschnitte dienten als Inszenierung der Kaiser- und Reichsidee. Die Berater des Kaisers schlugen als ausführenden Künstler Albrecht Dürer vor. In den Säulen der Ehrenpforte ist der Stammbaum der kaiserlichen Familie verewigt. Von dem Werk, das erst sieben Jahre nach dem Tod des Kaisers gedruckt wurde, wurden schätzungsweise etwa 500 Exemplare vervielfältigt und zum Beispiel an andere Fürsten verschickt.
Die geniale politische Marketingidee war eine Ehrenpforte, nach dem Vorbild der antiken Triumphbogen der Cäsaren. Jedoch nicht an einem Platz gemauert, sondern in vielen Exemplaren auf Papier gedruckt und an die wichtigsten Plätze der bekannten Welt verschickt. Geplant war ein Riesenholzschnitt von 3,50 Meter Höhe, der aus 210 einzelnen Druckstöcken zusammengedruckt werden sollte.
Die Entwürfe von Dürer und einigen anderen Künstlern wurden vom Nürnberger Formschneider Hieronymus Andrae ausgeführt.
Das gigantische Holzschnittwerk der Ehrenpforte vollendete Maximilians Idee, mithilfe der neuen Druckkunst seine Kaiserwürde zu inszenieren. Mit seinen beiden autobiographischen Büchern, dem WEISSKUNIG mit 251 Holzschnitt-Illustrationen und dem THEUERDANK mit 101 Holzschnitten, für die er Drucker und Künstler ersten Ranges verpflichtet hatte, zeigte er sich als maßgeblicher Nutzer dieser neuen Vervielfältigenden Kunst.
Abb.: Hendrick Goltzius (1558 – 1617) „Hercules tötet Cacus‘“ Clair-Obscur-Holzschnitt, ca. 1588
Der Wunsch nach Farbe
Die farbige Gestaltung von Holzschnitten war ganz einfach: man nimmt Pinsel und Farbe und malt die gedruckten Konturen aus, man kolorierte die fertigen Blätter.
Sonst aber ist der Druck von Farbholzschnitten sehr schwierig. Man benötigt für jede Farbe eine eigene Platte, die müssen perfekt ineinander passen und dürfen sich auch beim Druck nicht verschieben. Aber das ist äußerst schwierig, da das feuchte saugfähige Papier beim Trocknen schrumpft. Cranach versuchte es für seinen Fürsten mit Gold- und Silberdrucken. Albrecht Altdorfer schuf 1519/20 mit der „Schönen Maria von Regensburg“ einen farbigen Holzschnitt von sechs Blöcken.
Der Aufwand stand bei den frühen Drucken in keinem Verhältnis zum Erfolg und außerdem verlangten die Holzschnitte Dürers in ihrer schwarzen malerischen Kraft nicht wirklich die Farbe.
Anders in Italien. Im Jahre 1516 verlangt Ugo da Carpi von der Signoria von Venedig ein Privileg, also Patent, für seine Entdeckung des „modo nuovo di stampare chiaro et scuro, cosa nuova et mai piu fatta“ Man könnte es als die Geburtsurkunde des Helldunkelschnitts, des CHIAROSCURO-Drucks oder auch CLAIR-OBscuR-Holzschnitts bezeichnen.
Es war kein eigentlicher Farbdruck in unserem Sinn sondern hatte die Wirkung der Farbzeichnungen mit weiß aufgesetzten Lichtern. Der wahre Meister war der Niederländer Hendrick Goltzius (1558 – 1916). Es war ein schwarzweiß Druck mit einer farbigen Tonplatte und freigelassene Stellen, durch die das Weiß des Papiers sichtbar war. Es war letztlich ein Linienholzschnitt verbunden mit einem Flächenholzschnitt wie er dann in der Moderne gepflegt wird.
Erste Beispiele des Druckverfahrens, bei dem die schwarze Linienplatte durch eine oder mehrere farbige Tonplatten ergänzt wird, stammen von Lucas Cranach und Hans Burgkmair, der mit dem Formschneider Jost de Negker zusammenarbeitete. Künstler aus dem Dürer-Kreis, Hans Baldung Grien, Hans Sebald Beham, sowie Meister wie Albrecht Altdorfer griffen das neue Verfahren auf, mit dem sich einzigartige Farbwirkungen in der Druckgraphik erzielen ließen.
Stechen nicht schneiden
Sehr bald wurde der Holzschnitt vom feineren Kupferstich abgelöst.
Im Barock wurde der Holzschnitt als zu bäuerlich primitiv für die feine Gesellschaft angesehen. Und die Formschneider wie Christoffel Jegher (1596 - 1652) aus Antwerpen, der Werke von Peter Paul Rubens (1577 – 1640 ) vervielfältigte, imitierten im Holzschnitt sogar den Kupferstich für die Vervielfältigung seiner Bilder.
Abb.: Christoffel Jegher Holzschnitt nach P.P. Rubens ‚Der Liebesgarten‘. 1631
Im 18.Jh kam es zu Erneuerung des Holzschnitts. Der vom Kupferstich nahezu verdrängte Holzschnitt wurde mit der Entwicklung des Holzstichs zu einem wirtschaftlichen interessanten Produktionsverfahren, das im 19. Jahrhundert am häufigsten verwendet wurde.
Er wurde jetzt weniger als Künstlergrafik verwendet, sondern als Buchillustration. Die Illustrationen waren kleiner als die Kunstblätter und mussten auch größere Auflagen aushalten.
Da entwickelte der englische Holzschneider Thomas Bewick (1753 – 1828) den Holzstich und den auch zur industriellen Methode der Grafikproduktion. Bewick war ein Naturalist und Schöpfer naturwissenschaftlicher Darstellungen. Berühmt seine Naturdarstellungen von Tieren, besonders von Vögeln.
Abb.: Thomas Bewick „Comon Snipe’ (Schnepfe)”, wood engraving 1797
Er erfand den Holzstich, bei dem statt den bisher üblichen weichen Holzbrettern, hartes Hirnholz verwendet wurde. Er verarbeitete für seine Holzschnitt-Technik das besonders harte Holz des Buchsbaums, das nicht im Langschnitt, sondern quer zur Faser geschnitten wurde. und damit besonders druckbelastbar war. Als Werkzeug diente ein neues Werkzeug den Holzschneider: der Stichel, mit dem das Holz in einem arbeitsaufwendigen Prozess graviert wurde, mehr gestochen als geschnitten - daher Holzstich.
Bewicks Ziel war nicht nur die perfekte Darstellung, sondern auch ein dem Kupferstich wirtschaftlich überlegenes Druckverfahren zu erfinden.
Abb.: Hirnholzscheiben
Abb Tonstichel mit V-förmiger Schneide. Holzstich um 1876
Der Hochdruck des Holzstichs, der auf Druckmaschinen in den Satz eingebettet gleichzeitig gedruckt werden konnte, wurde von der Industrie in der Folge perfektioniert und massiv eingesetzt. Die illustrierte Zeitschrift für den Massenverkauf war nur durch den Holzstich rentabel.
Die für die Wiedergabe von Graustufen im Massendruck erforderliche Rastertechnik wurde erst 1880 erfunden und so wurden Fotografien in Holzstiche übertragen. Das harte Hirnholz gestattete unmittelbare Druckauflagen von 100.000 Stück und mehr.
Der Holzstich erlaubte durch die feinen, eng geführten Linien auch Tonflächen, aus für das Auge kaum sichtbaren sich kreuzenden Linien. Ein Vorläufer der Druckraster bei Klischees.
Abb.: Xylograf mit seinen Werkzeugen bei der Arbeit. Holzstich 1876
Die Zeit der Xylographen
Der massive Einsatz von Holzschnitten in Zeitungen, Magazinen und Büchern hatte einen bedeutenden Einfluss auf die Kultur im 19. Jh.
Für viele Menschen bedeutete der Holzstich in Zeitungen, die erste Information über das Leben außerhalb seines eigenen Lebensbereiches. Reiseberichte in Magazinen und Büchern vermittelten erste Kontakte mit fremden Völkern, Ländern und Kulturen. Die Holzstichillustrationen in den neu entstandenen „Conversations-Lexikon“ und „Real-Encyklopädien“ von Brockhaus und Meyer für die „gebildeten Stände“ zeigten eine wahre Bilderflut über alle Bereiche des Wissens, der Kunst und der technischen Errungenschaften der Zeit.
Abb.: Die illustrierte Familienzeitschrift ‚Die Gartenlaube‘ 1875
Auch wenn die Holzschnitt-Illustrationen oft nach Fotografien gestochen wurden, zeigen sie immer die subjektive Sichtweise seines Stechers. Jeder Punkt, jeder Strich wurde bewusst graviert, unwichtig erscheinende Einzelheiten wurden fortgelassen. Obwohl der Holzschnitt im 19. Jahrhundert der alltäglichen Berichterstattung und der Dokumentation diente, waren sie immer ein Produkt der Sichtweise der Menschen jener Zeit. Auch die Reportage-Dokumentarbilder wurden zur künstlerisch gestalteten dramatischen Bildgeschichte.
Wegweiser war die 1843 erschienene Leipziger Illustrierte, eigentlich ‚ILLUSTRIERTE ZEITUNG‘. Sie war eine Lizenzausgabe der 1842 in England gegründeten ‚THE ILLUSTRATED LONDON NEWS‘ und nach dem Vorbild der Pariser ‚L’ILLUSTRATION‘ die erste illustrierte Zeitschrift in Deutschland. Zum ersten Mal waren Bilder in die Textseite integriert. „Die Technik der Holzstich-Illustrationen für damalige Verhältnisse zur Perfektion zu entwickeln, war für den Verleger J. J. Weber im Jahre 1843 der eigentliche Anreiz zur Gründung einer illustrierten Zeitschrift. Im Laufe der folgenden Jahre gliederte er ein xylographisches Atelier an, das 1849 bis 1857 von Robert Kretschmer“ geleitet wurde. (Wikipedia)
Abb: Titelblatt ‚Brehms Thierleben‘ Holzstich 1883
Dieser Robert Kretschmer (1818 – 1872) war ein wichtiger Mann für die Verbreitung des Holzstichs. Nach der Etablierung des Holzstichateliers begleitete er 1862 Herzog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha nach Ägypten und illustrierte dessen Reisewerk (1861). Sein Hauptwerk aber sind die großenteils nach dem Leben entworfenen Zeichnungen zu Alfred Brehms ‚ILLUSTRIERTEM THIERLEBEN‘.
Bei Holzstichen handelt es sich immer Originalgrafiken. Die Blätter wurden direkt vom Druckstock abgezogen, den der Stecher von eigener Hand geschaffen hatte.
Abb.: Illustrierte Zeitung Leipzig, Der Brand des Hamburger Schraubendampfschiffes ‚Austria‘. Holzstich 1858
Abb.: Holzstich-Atelier der Leipziger Illustrierten
Abb. Gustav Doré Holzstich zu „ London: A Pilgrimage“1872
Die Kunst des Holzstichs
Ein Gigant – vom Umfang des Werkes her – dessen Bedeutung durch den Holzstich begründet wurde, war der französische Maler und Grafiker Gustav Doré (1832 – 1883).
Mehrere tausend Werke sicherten seinen Ruf als Illustrator. Mit neun Jahren begann er mit Illustration zu Dantes ‚GÖTTLICHE KOMÖDIE‘ ‚ für die er Jahre später 136 Holzstiche schuf. Mit dreizehn Jahren kam er nach Paris und war 1847 mit 15 Jahren als Illustrator beim ‚JOURNAL POUR RIRE‘ tätig. Er illustrierte 90 Werke der Weltliteratur – allein zu Cervantes ‚DON QUICHOTTE‘ entwarf er 370 Bilder und zur Bibel 254- und alle graviert in Zusammenarbeit mit kongenialen Xylographen die jeden Stich signierten.
Aber Doré beschäftigte sich nicht nur mit der großen Literatur. Er machte auch eine Bildreportage. 1872 erschien das Buch ‚LONDON: A PILGRIMAGE‘mit 180 Holstichen. Es war kommerziell erfolgreich, wurde jedoch scharf kritisiert, da Doré die Armenviertel und das Proletariat in seinem ganzen Elend zeigte.
Abb.: Ludwig Richter Holzstich zu Musäus Märchen 1842
Im deutschsprachigen Raum schufen die Zeichner in der Zeit der Romantik Illustrationen zu weit verbreiteten Hausbüchern und Bibelausgaben. Es waren Zeichnungen zur Umsetzung in den ‚Tonstich‘.
In Deutschland war es Schnorr von Carolsfeld (1794 – 1872), der erst im hohen Alter von fast 70 Jahren den Holzstich entdeckte, dafür aber mit seinen Bibelillustrationen den Geschmack des protestantischen Publikums stark beeinflusste. Von 1851 bis 1860 schuf er 240 Holzstiche als Bilder zur Bibel. Neben Doré gilt er als der wichtigste Bibelillustrator des 19. Jahrhundert.
Abb.: Schnorr von Carolsfeld ‚Bibel in Bildern‘
Ludwig Richter (1803 – 1884) wurde bekannt durch seine Illustrationen, obwohl er ein bedeutender Landschaftsmaler seiner Zeit war. Das Verzeichnis des graphischen Werkes verzeichnet 2660 Holzschnitte von Ludwig Richter. Berühmt sind seine Zeichnungen zu den Musäus ‚VOLKSMÄHRCHEN DER DEUTSCHEN‘ (1842) das als eines der schönsten illustrierten Bücher des 19. Jh. gilt. Er illustrierte Liedersammlungen und Mappenwerke wie das ‚KINDERLEBEN‘ 1852. Insgesamt arbeitete er für über 150 Bücher.
Alfred Rethel (1816 – 1859) war ein bedeutender Historienmaler der u.a. den Krönungssaal im Aachener Rathaus mit Bildern zum Leben Karls des Großen gestaltete. Sein am meisten verbreitetes Werk sind die Holzschnitte zu ‚AUCH EIN TODTENTANZ‘ aus dem Jahre 1848.
Abb.: Adolf Menzel ‚FRIEDRICH DER GROSSE‘ Holzstich mit Anmerkungen des Künstlers an den Xylographen (nach H.Th.Musper Der Holzschnitt)
Adolf Menzel (1815-1905) wurde berühmt durch seine Holzstiche zum Leben Friedrichs des Großen. 1880 wurde seine Berufsbezeichnung offiziell angegebenen als ‚Dr., Geschichts-Maler, Prof. u. Senator d. Kgl. Academie der Künste, Kanzler des Ordens pour le mérite; Ehrenbürger von Breslau“.
Neben den historisierenden Bildern, war er aber ein wichtiger Maler des Realismus.
Menzels Karriere ist eng verbunden mit dem Aufstieg Berlins zur Hauptstadt des Deutschen Reiches, dem Zentrum von Politik, Finanzwelt und Industrie. Der Respekt des Kaisers für sein Werk brachte ihm auch zahlungskräftige Käufer. Häufig hat er die zahlreichen Baustellen Berlins gezeichnet und er machte das Berliner Bürgertum zum Thema seiner Arbeiten.
Er war aber mit der nüchternen Routine des Handwerks der Xylographen unzufrieden, die ihm für seine lebendigen Bilder, zu erstarrt erschienen.
Abb.: Wilhelm Busch zu ‚Max und Moritz‘ 1865
Zu den Erfolgreichsten Holzstichen gehören die humoristischen Blätter des 19. Jh. Die Bildgeschichten zeigen Bild und Text als Einheit wie einst die Flugblätter. Holzstiche in der für die damaligen Verhältnisse unglaublich hohen Auflagen von nahezu einer halben Million Exemplare sind die Bildgeschichten des Wilhelm Busch (1832 – 1908). Dem heutigen Betrachter von ‚Max und Moritz‘ (1865) ist es gar nicht bewusst, dass die Bildchen in den Holzschnitt übertragene Federzeichnungen sind. Nicht immer war die Umsetzung durch den Holzstecher jedoch adäquat zur Vorzeichnung und Wilhelm Busch ließ einzelne Platten überarbeiten oder neu stechen. Erst ab der Mitte der 1870er Jahre mit den Geschichten von ‚Herr und Frau Knopp‘ wurden die Zeichnungen als Zinkografien gedruckt. Die Originale wurden fotografiert und auf eine lichtempfindliche Zinkplatte übertragen.
Die xylographischen Verfahren wurden zum Ende des 19.Jh. durch die Fotographie und die Autotypien, auch Netzätzung genannten Klischees, bedeutungslos. 1880 entwickelte Georg Meisenbach (1941 – 1912) in München ein fotografisches und chemisches Reproduktionsverfahren zur Herstellung von Klischees als Druckform für den Buchdruck. Der Holzstich blieb dann auf wenige spezielle exklusive bibliophile Publikationen und die Exlibris-Kunst nur noch Künstlern vorbehalten.
Das letzte umfangreiche monumentale Meisterwerk in der Kunst des Holzstichs, und da in meisterlichen Farbdrucken, ist die 1963 veröffentlichte ‚DIVINA COMMEDIA‘ des Dante Alighieri mit 100 farbigen Holzgravuren von Salvador Dalí.
Tatsächlich entstand dieses Meisterwerk der vervielfältigenden Kunst in der aussterbenden Technik des Holzstichs durch einen Zufall. Es sollten eigentlich Lithographien nach den Gouachen des Künstlers werden, aber die Wiedergabe war dem Künstler zu unpräzise. Das Werk wurde dann von den letzten Spezialisten eines Ateliers für künstlerische Holzgravur und Buchgestaltung in Frankreich ausgeführt. Für das umfangreiche Werk mit farbigen Holzstichen waren 3.500 handgravierte Druckstöcke notwendig.
Die besondere Leistung der Xylographen war die Trennung der einzelnen Farben so, dass sie feinste Farbübergänge im Druck ergaben.
Mittlerweile wurde aber nicht mehr Buchsbaumholz mit der doch schwer kontrollierbaren Holzmaserung verwendet, sondern man gravierte Platten aus neutralem Hartplastik, die letztlich auf Holzplatten für den Druck montiert wurden und so als Holzstiche gelten konnten.
Abb.: Dalí „Göttliche Komödie- Der gefallene Engel“ Blatt 1, Fegefeuer, Holzstich, 1960
Abb. Buchillustration von Werner Klemke
Unabhängig vom Niedergang der großen Ateliers in denen Reportagen und Kunstwerke gleichermaßen vervielfältigt wurden, bestand und besteht der Holzstich immer noch in Meisterleistungen von eigenhändig schaffenden Holzschneidern, den in Frankreich präzise genannten peintre-graveur.
Zu den bedeutendsten Vertretern gehören Karl Rössing (1897-1987), Werner Klemke (1917-1994), Buchkünstler und Hochschullehrer an der Kunsthochschule in Berlin, oder Otto Rohse (1925-), Graphiker und Buchkünstler in Hamburg.
Abb.: Karl Rössing ‚Mein Vorurteil gegen diese Zeit‘ Holzstichfolge 1927-1931 © Sammlung Karl Rössing
Holzschneider mit dem Taschenmesser
DerWeg zum modernen Holzschnitt führte über Asien.
Anlässlich der Pariser Weltausstellung 1867, beeindruckten japanische Farbholzschnitte die Künstler. Was sich u.a. in der Grafik des Jugendstils in Deutschland, dem Secessionismus in Wien, der Art Nouveau in Frankreich, dem Modern Style in England und dem Japonismus ganz allgemein zeigte.
Aber die tatsächlich neue Holzschnittkunst entstand nach Paul Gauguins Südseeholzschnitten im Expressionismus. Es war der Versuch einer Erneuerung und Überwindung des dekadenten Ideals der Verfeinerung. Man schnitt ins Holz wie man Holz hackt. Man ließ die Maserung des Materials mitspielen, bevorzugte die Fläche anstatt der Nachbildung der Federzeichnung oder des Kupferstichs. Es war der Flächenholzschnitt der die Kunst des Expressionismus und danach prägte.
Der Norweger Edvard Munch (1863 – 1944) war einer, der direkt ins Holz schnitt. Eine Vorzeichnung oder ein Entwurf hätte einem Xylographen da nichts geholfen. Er schnitt nach Gefühl und Holzstruktur ausdrucksstark - expressiv - seine Druckplatten selbst. Er setzte die Holzmaserung ebenso ein, wie er die Spuren der Bearbeitung als Mittel nutzte. Er färbte die Holzstöcke unterschiedlich ein und ‚malte‘ mit der Wirkung des Materials. Manchmal zersägte er sie auch. Er war der erste, der den Farbholzschnitt neu aufleben ließ und in jeder Form variierte.
Er war der große Anreger der deutschen Expressionisten.
Die Französischen Künstler waren dem Holzschnitt weitgehend ausgewichen, mit einigen Ausnahmen der Buchillustration wie von Aristide Maillol (1861 – 1944) oder André Derain (1880 – 1954).
Aber die Deutschen, denen behagte die unmittelbare, kraftvolle und simple Art. Die wichtigsten der Expressionisten wie Erich Heckel (1883 – 1970) und Karl Schmidt-Rotluff (1884 – 1976) gründeten 1905 die Künstlervereinigung ‚BRÜCKE’ der sich bald Ernst Ludwig Kirchner (1880 – 1938), Emil Nolde (1867 – 1956), Max Pechstein und Otto Müller (1874 – 1930) anschlossen.
Erich Heckel schuf 1073 registrierte Holzschnitte und war damit einer der schöpferischsten expressionistischen Grafiker.
Abb.: Munch ‚Der Kuss IV‘ Holzschnitt, 1902
Franz Marc (1880 – 1916) und Wassily Kandinsky, (1866 – 1944) Meister der Gruppe ‚Blauer Reiter‘ waren als Holzschneider tätig. Kandinsky entwickelte in dieser Technik seine Abstraktionen
Abb.: Franz Marc ‚Der Tiger‘ Holzschnitt 1912
Ernst Barlach (1870 – 1938) der Berliner Bildhauer und Dichter schuf ein ebenso reiches graphisches Werk, das im Holzschnitt eine „zwischen Wirklichkeit und mythisch-grotesker Realität“ angesiedelte Eigenständigkeit hatte., Der Belgier Frans