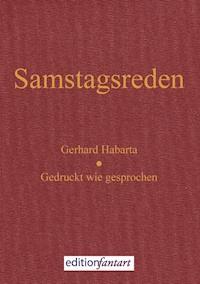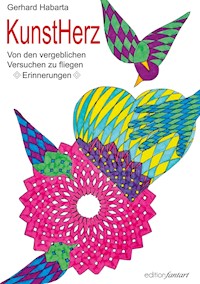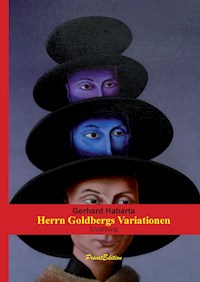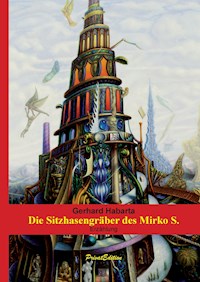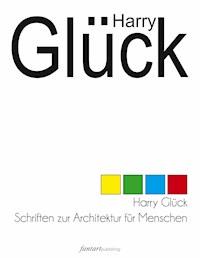
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Multifunktionalität von Wohnbauten sollte noch weitergehend erweitert werden: Freizeit und Wohnen - kommunikative Freizeit Verbindung mit bandstiftenden Situationen, Möglichkeiten zum Körpererlebnis und Naturerlebnis müssen gegeben sein. Dazu gehört auch das Rauschen der Bäume und der Anblick des Sternenhimmels. Aber die Architekturszene glaubt eher an den Zauber der jeweils aktuellen Prospekte der Glasindustrie. Harry Glück
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 733
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto: Hertha Hurnaus
HARRY GLÜCK (1925 – 2016)
SCHRIFTEN & REDEN
HERAUSGEGEBEN
IM AUFTRAG SEINER FRAU
TRIXI BECKER – GLÜCK
VON
GERHARD HABARTA
ANMERKUNG DES HERAUSGEBERS
Dipl.-lng. und Dr. techn. Harry Glück publizierte seine Thesen und Theorien, seine Baugesinnung, seine praktischen Erfahrungen und Erkenntnisse über mehr als 40 Jahre. Und er baute seine Architektur für Menschen mehr als 50 Jahre.
18.000 Wohnungen beweisen, dass seine Architektur-Philosophie Realität ist.
Die immer wieder erfasste Meinung und Stellungnahme der Bewohner zur Wohnzufriedenheit, beweisen deren Richtigkeit, die ein Jurymitglied bei der Ablehnung einer Auszeichnung für den Architekten so formulierte: „Diese Wohnbauten seien nichts anderes als die Erfüllung dessen, was sich die Leute wünschten - und das sei doch keineswegs Architektur.“
Glück erklärt in seinen Texten, was Architektur für Menschen ist, anderes als Beschmückung und augenfälliger Firlefanz. Und ohne zu ermüden, wiederholte er das Mantra seiner Baugesinnung. In der Zusammenfassung seiner Texte mag das auffällig sein, aber die Wiederholung seiner Grundsätze war und ist notwendig, weil sie, so einfach er sie auch formuliert, immer noch nicht von Architekten und Politiker, Bauherrn und Planern verstanden und nachvollzogen wird.
Ganz bewusst wurde die Schreibweise und Orthographie der Originalmanuskripte belassen, die über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten verfasst wurden.
Diese Texte in ihrer Klarheit, die in seiner Dissertation zur Gebrauchsanweisung für den Nachvollzug vereinigt sind, müssen künftigen, unvoreingenommenen mit der Wohnbau-Architektur Befassten, zur Verfügung stehen.
Prof. Gerhard Habarta
Herausgeber
INHALT
W
IR BRAUCHEN EINE GRÜNE
S
TADT
Humanethnologische Grundlagen
Abstandsgrün und Alleebäume sind kein Biotop
Das Recht auf eine grüne Stadt Kurzfassung
Das Recht auf eine grüne Stadt
K
ONZEPT EINER GRÜNEN
S
TADT
Wohnen in der verkehrsfreien Biotop-Stadt
Kriterien einer grünen Stadt
Die grüne Stadt: Realistische Vision
Die Sehnsucht nach einer „grünen Stadt“
Z
U
S
TADTPLANUNG UND
A
RCHITEKTUR
Städtebau und Gesellschaft
Architektur als Ausdruck gesellschaftlicher Kultur
Anmerkungen zur Stadtplanung und Architektur
Städtebau und Gesellschaft
Was haben Wirtschaftlichkeit, Wissenschaft und
Technologie mit Architektur zu tun?
Urbane Wohnformen in der Stadt der Zukunft
Das Haus der Zukunft: Interview
A
RCHITEKTUR MUSS DEM
M
ENSCHEN DIENEN
Anmerkungen zu Stadtplanung und Architektur
Der Fluch des Hippodamus oder Wir brauchen eine grüne Stadt
Der Mensch das Maß aller Dinge
Die großen Städte müssen kleiner werden - und grüner
Konzept Rede für Antwerpen
Frankfurt Vortrag 2.2.2016
Diskussion Neuer Gemeinde Bau
Vollwertiges Wohnen und vollwertige Stadterneuerung
Grüne Städte ~ Die Aufgabe
Studie durchgrünte Stadt
Interview Dr. Reinhard Seiss mit HG
Denkbare Zusammenhänge zwischen Stadtplanung und Kriminalität
Was kostet eine grüne Stadt
E
VOLUTION UND ARBEITS
TEILIGE
Z
IVILISATION
Die Evolution und wir
Evolution und Städtebau
Evolution und Kunst
D
IE
D
ISSERTATION
Dissertation
R
EAKTIONEN
Die verlorene Wette: Profil 1976
Das Gesiba-Debakel und die Folgen: Profil, Peter
M. Lingens Architektur muss dem Menschen dienen ~ Alterlaa und die Stadt als Heimat
B
IOGRAPHIE
Glücklich wohnen - Interview 80
Harry Glück wird 90: Zauberformel zum Glück - Interview
Nachruf
Nachruf 2
1. WIR BRAUCHEN EINE GRÜNE STADT
Humanethologische Grundlagen
1.
Nur in grünen fruchtbaren Landstrichen war menschliches Leben in unserer Frühzeit möglich.
Die Entstehung und die Frühgeschichte des Menschen vollzog sich - wie heute durch genügend Funde belegt ist - in der Savanne Afrikas. Dieser Lebensraum ist durch Baumgruppen charakterisiert, zwischen denen sich Grasflächen mit Büschen befinden. An Pflanzen und Tieren ist dieses Gebiet reich.
Es gibt eine Reihe von Indizien dafür, dass sich in den über zwei Millionen Jahren, da unsere Vorfahren dort als Jäger und Sammler lebten, eine im Erbgut fixierte Präferenz für Gegenden mit solchen Eigenschaften bildete.
Soweit sich der heutige Mensch auch von seinen Tiervorfahren wegentwickelt hat, im Ansprechen auf Schlüsselreize zeigt sich doch immer noch die deutliche Verwandtschaft. Darauf jedenfalls führen wir zurück, dass man in Großstadtwohnungen so häufig auf Pflanzendekor stößt. Ranken, Blätter und Blumen zieren sowohl Tapeten wie auch Vorhänge und Teppiche, Lampenschirme, Geschirr und Möbel – und das keineswegs bloß in unserer Kultur, sondern ebenso auch in Japan, China oder auf Bali. Hier zeigt sich eine Appetenz, ein uns endogen erzeugtes Bedürfnis.
Wo immer der Mensch sich in Wohnungen zurückzieht, schafft er sich dort eine Ersatznatur – schafft sich also selbst ,,Attrappen“, die ihm ähnlich positive Empfindungen vermitteln wie der echte Schlüsselreiz. Hier kommt ein tiefempfundener Drang, den man nur eben als ökologische Prägung deuten kann, zum Ausdruck. Die Phytophilie des Menschen zeigt eine angeborene Präferenz für einen bestimmten Landschaftstyp an - sie ist gleichsam ein Wegweiser zu dem für uns zweckmäßigen Biotop. (Irenäus Eibl-Eibesfeldt und Hans Hass)
Naturkontakt und Naturnähe in der Form der Villa, des Einfamilienhauses in einem Gartenvorort, des innerstädtischen Penthouse mit Dachgarten – oder aber des regelmäßigen Jagdausflugs, des Zweitwohnsitzes auf dem Lande, einer ausgebauten Mühle oder eines Bauernhofes als Wochenendsitz im Grünen. Oder auch die Mitgliedschaft im Golfklub, mit Schwimmbad und Tennisplätzen. Dazu kommt ein sich allwöchentlich wiederholendes Phänomen mit oft genug mörderischen Folgen: die ,,Blechlawine“, die sich zu jedem Wochenende ins sogenannte ‚Grüne’ ergießt. Weder der Stau des Rückflutverkehrs noch die Unfallstatistiken in den Montagszeitungen können die Menschen davon abhalten, ihre Wohnstätten zu fliehen. (Harry Glück)
Die großen Hotelketten wie Hilton oder Inter-Continental, die ihren schnellreisenden Gästen für die kurze Aufenthaltsdauer Wohngefühl vermitteln wollen, beachten die biologischen Konditionen ganz genau. Sie siedeln sich grundsätzlich neben innerstädtischen Parkanlagen an.
2.
Zugang zum Wasser - Der Mensch der Frühzeit konnte Wasser nicht transportieren. Er musste in der Nähe des Wassers leben. Am Wasser, das regelmäßig aufgesucht wird, schwindet das Misstrauen gegen den Fremden – denn auch dieses ist uns angeboren – durch schrittweises Kennenlernen. So wird das Wasser zur ,,bandstiftenden Situation“.
Unsere Vorfahren hielten sich vor allem an Plätze, wo es fließendes Gewässer gab. Wanderten sie in andere Gebiete weiter, dann zeigte ihnen Pflanzenwuchs, Tierreichtum und Wasser die für sie günstigsten Lebensräume an.
Doch der Mensch musste in der Nähe des Wassers leben, denn nur dort gab es Vegetation – Wasser wurde erst spät, vor etwa 6.000 - 8.000 Jahren transportierbar.
Wo immer es sich der Mensch leisten konnte, siedelte er sich in der Nähe von trinkbaren Gewässern an. Das Rauschen des Flusses, das Rieseln des Baches und der Quelle sind für uns empfindungsmäßig „positiv getönt“. In der Umgebung von Schlössern und den Parks von Wohlhabenden – also im Rahmen von Luxusstrukturen von Menschen, welche sich die Befriedigung ihrer instinktiven Bedürfnisse leisten konnten – finden wir so gut wie immer künstlich angelegte Teiche und ,,Wasserspiele‘, die Aug und Ohr erfreuen. (Freisitzer und Glück 1979)
Im Dorf wurden der Brunnen und der Bach, wo die Wäsche gewaschen wird, zum Treffpunkt der Frauen. All dies weist darauf hin, dass bei Wohnanlagen Teiche, Springbrunnen und ähnliches – selbst in bescheidenem Ausmaß – zur „heimeligen Atmosphäre“ der Umwelt beitragen und deshalb als annehmlichkeitsfördernd empfunden werden. (lrenäus Eibl-Eibesfeldt und Hans Hass).
Haben die Reichen und die Mächtigen ans Wasser gebaut, künstliche Teiche, Springbrunnen und Wasserspiele in ihren Gärten angelegt, so ist das Dach der ideale Platz für ein Schwimmbecken. 8x25m große Becken erwiesen sich als für 200 und mehr Familien ausreichend. Luxus? Ist es wirklich ein Luxus, dem Menschen täglich Zugang zum Wasser zu ermöglichen, zum Schwimmen als Ausgleich eines bewegungsarmen Berufes? Erkrankungen, der Gelenke, der Bandscheiben und des Stützapparats, Schwäche und Verkrampfung vor allem der Rückenmuskulatur sind typische Leiden des Großstädters. Regelmäßiges Schwimmen ist die erste Empfehlung aus ärztlicher Sicht. Zudem kann Schwimmen bis ins hohe Alter ausgeübt werden. Und vergessen wir nicht die psychische Bedeutung des Eintauchens in ein Element, das dem Menschen vom ersten Schlag seines Herzens anvertraut ist und ihm die mit der Geburt verlorene Schwerelosigkeit wiederzugeben vermag.
Der Mensch ist als Erbe seiner Ahnen ein soziales Wesen. Die Gemeinschaft war einst eine existenzielle Notwendigkeit. Dieses Erbe wirkt in uns als ein seelisches Bedürfnis nach Geselligkeit, nach Nicht-Vereinsamung, Der Einzelgänger ist ein Außenseiter. Ebenso angeboren wie das Bedürfnis nach Geselligkeit ist dem Menschen das Misstrauen gegen den Fremden. Dieses Misstrauen ist offenbar die Vorsicht unserer tierischen und menschlichen Ahnen, Damit Geselligkeit, Kommunikation, Kontakt unter den Menschen entstehen, muss das Misstrauen abgebaut werden, durch schrittweises Kennenlernen, durch ,Beschnuppern‘.
Das Schwimmbad auf dem Dach, das, wie die Soziologen feststellten, von mindestens 80 Prozent regelmäßig und vom Rest gelegentlich, insgesamt also von 98 bis 100 Prozent aufgesucht wird, ist eine „bandstiftende Situation“. Gegenseitiges Kennenlernen kann nicht ausbleiben. (Harry Glück)
Untersuchungen über die Rentabilität von Schwimmbädern in Großhotels haben ergeben, dass das Hotel mit Schwimmbad auch bei geringfügig höherem Zimmerpreis dem ohne Bad vorgezogen wird. Auch dann, wenn nur etwa 50% der Hotelgäste das Schwimmbad tatsächlich nutzen können.
3.
Aussicht - In der Nähe des Wassers gab es jagdbares Wild, aber auch Raubtiere, und manchmal verwandelte sich das Wasser in einen reißenden Strom. Daher suchte der Mensch erhöhte Punkte, von denen aus er seine Umwelt beobachten konnte.
Das Bedürfnis nach freiem Ausblick zeigt sich bei Naturvölkern, wenn vor dem Hauseingang Büsche und Bäume entfernt werden. Wo die Gefahr einer Überraschung durch große Raubtiere oder feindliche Mitmenschen besteht, wird das gesamte Vorfeld von Sträuchern und Bäumen befreit. Und wo das Gelände und das Klima es erlauben, werden die Siedlungen auf Bergrücken, Felsen oder Hängen angelegt. Dass auch diese Tendenz noch heute in unserem Wohnverhalten nachweisbar ist, zeigt sich deutlich darin, dass Hanggrundstücke besonders geschätzt sind und höher bezahlt werden. Sie steigern unsere ,,Wohnqualität“ – ebenso wie Türme und Dachterrassen, die uns die ,,Aussicht“ auf ein weiteres Umfeld gestatten. Ganz sicher spielt auch eine Rolle, dass jeder Ausblick am Geschehen im Umfeld teilnehmen lässt und damit unsere Neugier befriedigt, unsere Phantasie anregt. Aber die uns angeborene Sicherheitsmotivation hat hier bestimmt ebenfalls einen entscheidenden Einfluss.
Dazu kam im Laufe der menschlichen Geschichte noch als weiterer Feind der Mitmensch hinzu – ein weit gefährlicherer Gegner als das Raubtier. Beides führte in stammesgeschichtlicher Anpassung zu einem uns angeborenen Bedürfnis nach Sicherheit, das sich unter anderem im instinktiven Streben nach Deckung und nach freiem Ausblick äußert. (Irenäus Eibl-Eibesfeldt und Hans Hass)
Wohnen mit Aussicht das Penthouse, der ausgebaute Dachboden, die Terrassenwohnung, die Villa in Aussichtslage, zumindest ein attraktives Gegenüber.
Es besteht kein Zweifel, dass ein sehr großer Teil Menschen hoch wohnen möchte. Die Vergabe der Wohnungen eines neuen Hauses geht – praktisch ohne Ausnahme – von oben nach unten vor sich.
Es hat sich als nötig erwiesen, die unteren Geschosse möglichst mit besonderen Vorteilen auszustatten. Unsere frühen Ahnen suchten, soweit sie in Höhlen lebten, diese in – sicherer – Höhe: sicher vor menschlichen und tierischen Feinden, mit Aussicht, um solche rechtzeitig zu erkennen, und geschützt vor Überschwemmungen. (Harry Glück)
Die Betriebsrestaurants für leitende Angestellte von US-Konzernen befinden sich fast immer im obersten Stockwerk mit Aussicht auf die Skyline. Und das Büro mit Fenstern in zwei Richtungen ist ein Prestigesymbol für leitende Manager.
4.
Revieridentifikation - denn ohne ein vertrautes und dadurch sicheres Territorium konnte die Gruppe nicht Überleben
Territorialität ist ein Grundzug der Primaten. Beim Menschen sind die Reviere hierarchisch strukturiert.
Es gibt klar umgrenzte Privatbezirke des einzelnen, sodann Familienreviere und Gruppenterritorien.
Jeder dieser Bereiche hat mehr oder minder klar definierte Grenzen, die von den Angehörigen der Gruppe deutlich empfunden werden.
Familien bilden bei allen Völkern natürliche Einheiten innerhalb der größeren Gemeinschaft. Die Buschleute errichten für die Zeit, da sie nicht umherziehen, Familienhütten, in denen die Ehepartner mit ihren kleinen Kindern leben. Die Hütten unverheirateter erwachsener Kinder, der Großeltern und anderer naher Verwandter liegen in der unmittelbaren Nachbarschaft, jedoch werden die Eingänge so angeordnet, dass man von einer Hütte in die andere sieht. Bei den Waika-lndianern lebt die Dorfgemeinschaft in einem nach außen hin geschlossenen Rundbau, der einen Platz umschließt. Unter dem ringsum verlaufenden, nach innen vorstehenden Pultdach lebt die Gemeinschaft um den freien Platz, irgendwelche Wände gibt es hier nicht, Jeder kann den anderen sehen. Aber auch hier hat jede Familie ihren eigenen Abschnitt, ihr deutlich abgegrenztes Territorium in dem ausgeruht, gekocht und gegessen wird, in dem man Freunde willkommen heißt. Wir kennen keine Ausnahme von der familiären Grundstruktur. Selbst der Kibbuz konnte sie nicht gänzlich überwinden [Spiro 1917]
Der Wunsch nach einem eigenen Raum, nach einer eigenen Ecke, in die man sich zurückziehen kann, ist im Verhalten aller Naturvölker und ebenso bei uns deutlich ausgeprägt. Schon solche kleinen Privatbezirke werden vehement angestrebt und auch verteidigt. In der Massengesellschaft haben soziologische Erhebungen gezeigt, dass die Anfälligkeit für Jugendkriminalität nicht nur durch schlechte Familienverhältnisse, sondern auch durch Nichtbesitz eines eignen Zimmers, einer eigenen Privatspähe deutlich erhöht wird. [Uwe Meier 1983]. (Irenäus Eibl-Eibesfeld und Hans Hass)
Der Mensch benötigte einprägsame Merkmale in der Landschaft zur Orientierung, um vor der Dunkelheit von der Jagd, vom Sammeln in den Schutz der Horde zurückzufinden. Er benötigte ein Revier, denn er war in seiner Frühzeit weder als Sammler, Jäger, Viehzüchter oder Ackerbau sehr leistungsfähig. War sein Revier zu klein oder wurde es ihm streitig gemacht, drohte ihm der Hunger. (Harry Glück)
5.
Nur in der Gruppe konnte der Mensch der Frühzeit überleben, - daher verlangte es uns nach sozialen Kontakten, bedürfen wir der Geselligkeit – wir strafen mit Einzelhaft.
Der Mensch ist keineswegs beliebig formbar. Seine Reaktionen fügen sich deshalb nur beschränkt in die Konzepte rationeller Organisation. Um sein Wohlbefinden zu sichern – und damit das Wohlbefinden der Gemeinschaft –, kommt es nicht nur auf Hygiene, Sicherheit und Bildung an. Nicht minder wichtig – wenn nicht noch wichtiger – sind Maßnahmen und Strukturbildungen, die den angeborenen sozialen Bedürfnissen entgegenkommen. Und zu diesen gehören vorrangig die Bandbildung zum Mitmenschen, also Einrichtungen, die kommunikative Anreize bieten, sowie eine kreative Freizeitgestaltung, welche die persönliche Entwicklung fördert. Der Mensch will jedoch nicht nur als Individuum und Familie etwas darstellen, er hat auch das deutliche Bedürfnis, einer größeren Gruppe anzugehören, die etwas darstellt. Diese größere Gruppe war ursprünglich der Sippenverband, später das Dorf, die Gemeinde.
Sitte und Brauchtum vereinigen Menschen zu größeren Gemeinschaften. Feste und Zeremonien sind gleichsam Kitt, der Individuen und Familien enger miteinander verbindet. Musik, Tanz, gemeinsames Essen, Trinken und Beten sind Mittel der Stimmungsübertragung, durch welche die uns angeborene Fremdenangst überwunden und Misstrauen abgebaut wird. Durch Verschiedenheit in der Kleidung und sprachliche Dialekte profilieren sich einzelne Gruppen. Bei den Buschleuten kann man verschiedene „Völker“ am Zuschnitt der Frauenschürzchen und an der Form der Pfeilspitzen erkennen.
In der anonymen Massengesellschaft geht davon viel verloren. Hier vermischen sich die verschiedensten Strömungen und Wertungen. Wirtschaftliche und politische Interessen werden zum formenden Faktor. Die überall zu erkennende Tendenz zur Klub und Vereinsbildung zeigt das deutlich. Die Größe der Lokalgruppen oder Dorfgemeinschaften wechselt bei Naturvölkern zwischen 10 und 40 Familien. In warmen, klimatisch günstigen Zonen spielen sich die täglichen Aktivitäten und damit auch die sozialen Kontakte vor allem vor den Hütten ab, die meist um einen freien Platz angeordnet sind. Hier werden auch Feste abgehalten, sakrale Rituale zelebriert, Gäste empfangen und bewirtet. So wird dieser Platz zu einem Forum der Begegnung.
In den Bergen Neuguineas, wo Regenfälle, Hitze oder Insekten den Aufenthalt im Freien behindern, finden wir neben den Familienhäusern auch Gemeinschaftshäuser. (lrenäus Eibl-Eibesfeldt und Hans Hass)
Wir erkennen, dass die Bedürfnisse nach Revier und Identifikation – die auch immer als Bedürfnisse nach Besitz und Sicherheit angesehen werden müssen – in engem Zusammenhang mit dem Verlangen nach Geselligkeit und sozialen Kontakten stehen. „Bekanntenkreis“ und „gute Nachbarn“ sind genauso wichtig für die Wahl eines Wohnortes wie sachliche Notwendigkeiten, also die Schule für die Kinder oder die Verkehrssituation. Das ist ganz natürlich: Unsere Vorfahren konnten nur in der Gruppe überleben. Wenn wir uns bewusst machen, welchen Schwierigkeiten sich auch heute noch ein „Außenseiter“ aussetzt, wird klar, dass auch in unserer Frühzeit nur das sozialer Anpassung fähige Individuum in einer solchen Gruppe Aufnahme fand – finden konnte. Diese Fähigkeit zu sozialem Verhalten ist in uns auch als Bedürfnis lebendig, so wie alle Fähigkeiten gleich physikalischen Kräften nach zwei Seiten wirken als Fähigkeiten und als Bedürfnisse. Daraus erklärt sich der starke Zusammenhalt sozialer Gruppen oder bei wachsender Population, sozialer Schichten. Dieser Zusammenhalt erreicht nach Konrad Lorenz die Intensität des Zusammenhalts ethnischer Gruppen – was die sozialen Gruppen ursprünglich und dem Wesen nach waren.
Das Bedürfnis nach Geselligkeit, verbunden mit den Bedürfnissen nach Revierzugehörigkeit und Identifikation, bedarf zu seiner Befriedigung der Bekanntheit, zumindest aber der Vertrautheit mit charakteristischen Verhaltensweisen persönlich nicht bekannter Gruppenmitglieder. Denn es gibt einen Antagonisten: das Misstrauen gegen den Fremden. Bekanntheit, Vertrautheit, Geselligkeit und Identifikation entstehen erst nach dem Abbau des Misstrauens. Daraus entsteht erst der Wirkungsmechanismus von Vereinen, Logen, Bruderschaften: Dem Genossen wird ein Vertrauensvorschuss gewährt. Es gibt noch anderes, welches das angeborene menschliche Bedürfnis nach Geselligkeit deutlich zeigt: Begriffe wie Vereinsamung, Einzelgänger, Einsiedler sind negativ besetzt. Einzelhaft ist eine Strafverschärfung. Der Eremit genoss ehrfürchtige Bewunderung, weil er freiwillig ertrug, was allen anderen unerträglich erschien, nämlich allein zu sein. (Harry Glück)
6.
Spiel und Kreativität - im Spiel lernen und erfinden wir. Tiere spielen, sind „neugierig“ nur in der Jugendphase – der Mensch bis zum Greisenalter. Manche Menschen dürfen in ihrem Beruf „spielen“ – für die meisten Menschen gibt es diese Möglichkeit in unseren arbeitsteiligen Produktionsweisen aber nicht. Es müssen daher spielerische und kreative Aktivitäten möglich sein in der Wohnumwelt.
Eine Buschmannfrau braucht nur zwei bis drei Stunden am Tage zu sammeln, um die für die Familie benötigte Nahrung aufzubringen, und die Männer brauchen nicht täglich auf Jagd zu ziehen. Man sieht die Dorfbewohner viele Stunden am Tag in kleinen Gruppen bei ihren Hütten oder unter dem Schattenbaum sitzen: Man ergeht sich in kleinen handwerklichen Verrichtungen, näht einen Lederbeutel, schäftet Pfeilspitzen und plaudert dabei. Oder man diskutiert, lässt das Rauchrohr kreisen und spielt mit den Kindern. Auch Musikinstrumente haben die Buschleute entwickelt – den Spielbogen und den Dongo. Ganz erstaunlich ist die Vielzahl der hier ausgeübten Spiele (Sbrzesny, 1976). Langeweile kann man bei diesen ursprünglichen Völkern nirgends beobachten. Sie wissen stets mit ihrer Freizeit etwas anzufangen, sind Meister im Erzählen und in der Pflege freundlichen Umgangs. Jung und Alt erfreuen sich an mannigfachen Regel-, Bewegungs- und Tanzspielen. Muße ist demnach sicherlich nicht erst eine Erfindung der Neuzeit. Sie stand am Anfang der Entwicklung und ging wohl erst sekundär mit dem Aufkommen effizienter Wirtschaftsformen verloren. Die bäuerliche Gesellschaft der Vergangenheit hatte noch zwischen Anbau und Ernte sowie im Winter Zeiten der Muße und wusste diese ebenfalls sinnvoll zu gestalten. Ein Instrument zu spielen, zu singen und Feste zu feiern, war keineswegs nur Sache von Experten. Sehr viele beherrschten künstlerische Fertigkeiten, man fand sich zu Spielen und erzählte sich Geschichten. Man kann sagen, dass angeborene ‚Bedürfnisse‘ die Zielrichtung vieler unserer Handlungen sehr deutlich beeinflussen.
Auch der Mensch kann Triebe, denen er nicht entsprechen kann, über ‚Ersatzhandlungen‘ abreagieren, etwa aggressive Gestimmtheit durch Sport – oder indem wir uns in Aufgaben verbeißen, Probleme attackieren, Hindernisse überwinden. Wir wissen aus der Verhaltungsforschung, der Psychoanalyse und der einfachen Beobachtung des täglichen Lebens, dass solche Appetenzen, wenn sich kein geeigneter Auslösereiz findet, der eine zielgerichtete Befriedigung zulässt, überspringen. Das reicht von der Sublimierung des Erotischen ins Schöpferische bis zu zerstörerischen Abläufen, wenn aus unbefriedigtem Bewegungstrieb und Identifikationsbedürfnis Aggression wird als nationaler oder Gruppenchauvinismus, oder wenn persönliche Frustration, weil in einem monotonen Broterwerb das Neugierverhalten unterdrückt, dem Bewegungstrieb kein Spielraum gegeben wird, in Aggression gegen das nächste erreichbare schwächere Individuum oder in Vandalismus umschlägt. Diese Abläufe lassen sich bei Tieren ebenso wie beim Menschen beobachten. (Irenäus Eibl-Eibesfeldt und Hans Hass)
Die vielleicht wichtigste Voraussetzung für den Erfolg des Menschen als Art ist unser „Neugierverhalten“. Dieses „Neugierverhalten“ treibt uns lebenslänglich. Tiere spielen und lernen – mit wenigen Ausnahmen, wie dem Hund, unserem Gefährten seit Jahrtausenden – nur bis zur Geschlechtsreifs dann sind Tiere fertig. Automaten ihrer Instinkte.
Möglichkeit zu Spiel und Bewegung, im gesicherten und identifizierbaren Revier, vielleicht auch mit der Gelegenheit zu Erlebnissen – unsere Vorfahren lebten ja ziemlich aufregend. Die Fähigkeit, all diese Abenteuer zu bestehen, muss wohl in uns noch als „Erlebnishunger“ lebendig sein. Diesen Hunger befriedigten, als die Zeiten ruhiger wurden, die Geschichtenerzähler und fahrenden Sänger – und der Erfolg des Fernsehens hat sicher die gleiche Ursache, soweit es nicht für allzu viele auch der Ersatz für die verlorengegangene Geselligkeit sein muss. Der Individualverkehr hat die Straße als Lebensraum als Spiel und Aufenthaltsmöglichkeit für die weniger mobilen Teile der Bevölkerung, die Kinder und die Alten, zerstört. Weder im öffentlichen noch im privaten Bereich – in den Höfen – finden sich ausreichend Grünraum und Freizeiteinrichtungen. Was für Kinder und Alte unerreichbar ist, finden Halbwüchsige und Erwachsene mit Hilfe von Motorrad und Auto außerhalb – in der Regel erst am Stadtrand. (Harry Glück)
„Die Sportpflege muss jedem Stadtbewohner zugänglich sein. Der Sport muss zu Füßen des Hauses selbst vor sich gehen: man kommt heim, wirft Mütze, Hut Jacke ab, geht hinunter und spielt. Man spielt, um zu atmen, um sich Muskeln zu schaffen und sie geschmeidig zu machen, Männer, Frauen, Kinder, alle. Eine Trambahn nehmen, einen Autobus, eine Untergrundbahn und mit einem Köfferchen in der Hand kilometerweit fahren? Nein, unter solchen Bedingungen ist kein Sport möglich.“ (Le Corbusier, 1925)
Anmerkung: Der Text entstand 1987 für die Ausstellung ‘Wohnen in Wien’ der Europalia in Antwerpen und danach auf Wunsch der Landesregierung von NRW in Düsseldorf. Das Katalogbuch erschien in Deutsch, Flämisch und Französisch.
Abstandsgrün und Alleebäume sind kein Biotop
oder
Wir holen die Natur in die Stadt zurück
In den letzten 3,4 Jahrtausenden hat sich die Art Mensch zum größten Teil in Städten zusammengefunden, wo eine arbeitsteilige Gesellschaftsform eine Entwicklung der Technologien ermöglicht haben, die in den Jahrmillionen der Entwicklung des Lebens auf der Erde noch nicht existierten. In diesen Jahrmillionen der Evolution lebte der Mensch und seine Vorfahren ausschließlich in Anpassung an die vorhandene Natur, was nicht nur Gräser und Bäume bedeutet, sondern auch alle Fähigkeiten und Lebensformen, die dieser Umwelt angepasst sind.
In diesen letzten Jahrtausenden entwickelte der Mensch Technologien und die Gabe der Vermittlung von Wissen, was dazu geführt hat, dass wir viele Phänomene der Evolution und ihrer zufälligen Entwicklung bloß durch Mutationen, sondern auch durch willkürliche geplante Eingriffe veränderten, und der Mensch Städte schuf, deren immer noch wachsende Dimensionen möglicher Weise mit den „natürlichen“ Vorgängen der Evolution nicht mehr übereinstimmen. Wohin dies führt, wissen wir nicht, ebenso, wie wir die erstmalig in der Geschichte des Lebens auftretende Bereitschaft zur Aggression innerhalb der Art, offenbar nicht zu beherrschen in der Lage sind. Die durch das Wirken der Evolution entstandenen psychischen Bedingnisse in uns sind aber weiterhin wirksam. Wir haben die immer größer werdende Städte gebaut und bewohnt, doch alle diejenigen, die sich durch Besitz oder Macht Privilegien geschafft haben, schaffen für sich „Biotope“, also Umweltbedingungen, die dem von der Evolution in uns entwickelten Bedingnissen entsprechen. Diejenigen, die Großzahl die sich diese Privilegien nicht verschaffen konnten, nützen jede ihnen gewährte Freizeit, oder Urlaubszeit, dazu, sich in Situationen zu begeben, die dem Erbe der Evolution entsprechen.
Dies bedeutet, dass wir die von der Stadt vertriebene Natur zurückholen müssen, und zwar in einer Weise, die die verlorenen Bedingnisse und Fähigkeiten zumindest substituiert.
Diese Fähigkeit zur Substitution ist allerdings begrenzt: Ein Indiz hierfür könnte sein, dass der „französische“ Garten wohl die Befriedigung der Herrschaft über die Natur vermittelt, nicht jedoch die Anmutung des „englischen“ Parks, der nach allem was wir wissen, in Annäherung jener Landschaft entspricht, in der der frühe Mensch sich das erste mal aufrichtete.
In die Praxis des Städtebaus übersetzt bedeutet dies, dass die Grünräume, die wir schaffen, nach Möglichkeit so gestaltet werden müssen, dass sie an diese Landschaft unserer Frühzeit erinnert. Bei allen ökonomischen Rücksichten können, wenn wir den psychischen Appell der Natur erlangen wollen, Mindestdimensionen– die sicherlich auch von Klima und sonstigen Bedingungen abhängig sind – „grün“ werden.
Es ist möglich diese notwendigen Dimensionen auch inner-städtisch, auf frei werdenden Parzellen oder verlassenen Industrie-Grundstücken, – in unterschiedlicher Annäherung – zu erreichen.
Es liegt in der Hand der Stadtplaner, zumeist also auch der Behörden, von Vorhinein unwirtschaftlich zu erschließende Kleinteiligkeit zu vermeiden und gleichzeitig ein mit Bäumen bepflanztes, begrüntes und parkartiges Umfeld zu schaffen. Dieses Konzept hat sich von 200 Wohnungen aufwärts, bis zu 3.500 Wohnungen als problemlos und von den Bewohnern akzeptiertes Konzept erwiesen. Es schafft zwar nicht die von vielen propagierte Auto-Freiheit, aber – in großem Maßstab – Verkehrs-Freiheit. Man sollte dabei nicht vergessen, dass die individuelle Mobilität eine Jahrhunderte alte Einschränkung des Lebens der Minderprivilegierten der Gesellschaft beseitigt, da das Verlassen des bäuerlichen Gehöfts von der Gnade des Grundbesitzers abhängig war.
Wesentlich für die Durchgrünung der Stadt ist, die Grünräume zusammenhängend zu gestalten. Dies erleichtert auch die Dimensionen zu finden, die für ein „Biotop“ nötig sind. Ziel für eine unseren in den Jahrmillionen der Evolution entstandenen psychischen Bedingnisse entsprechenden Stadt muss sein, die Stadt insgesamt in ein Biotop, das heißt ein sich selbst genügender Lebensraum zu schaffen. Es gibt erfolgreiche Beispiele, die nachweisen, dass auch unter den aus ökonomischen, logistischen, soziologischen Gründen erforderliche Kompaktheit zu erreichen – Kompaktheit der Bauten, ebenso wie der Grünräume. Gleichzeitig müssen die in den letzten Jahrzehnten drastisch gestiegenen Anforderungen an die Wohn- und Lebensqualität, die umfassend gesehen werden müssen, von den Planenden, das sind die Politiker, die Kaufleute, die technologischen Konsulenten ernstgenommen und erfüllt werden. Es genügt nicht, sich mit der Verkäuflichkeit von Wohnungen die dieses Ziel nicht erreichen – häufig gar nicht erreichen wollen – zu begnügen, bloß weil im Augenblick ein Verkäufer-Markt da ist, der die Menschen zwingt auch das Minderwertige, den skizzierten Zielen aber keineswegs entsprechende zu akzeptieren. Wohnbau und Stadtplanung sind Disziplinen, an die aus ökonomischen, aber auch humanen Grün-den Nachhaltigkeit gefordert werden muss.
Das Recht auf eine grüne Stadt
Kurzfassung 2011
Städtebau und Wohnbau sind – und waren zu allen Zeiten – Ausdruck und Funktion der gesellschaftlichen Situation.
In den für uns überschaubaren Jahrtausenden hierarchischer Gesellschaftsordnungen war Wohnen als nicht nur von der existenziellen Notwendigkeit bestimmte, sondern selbstgestaltete Lebensumwelt nur einer Minderheit durch Besitz und/oder Macht Privilegierter möglich.
Das Wohnen dieser Privilegierten war in allen Epochen und allen Kulturkreisen durch übereinstimmende Kriterien gekennzeichnet. Eines der wichtigsten war – und ist – die unmittelbare Einbettung in Natur oder in eine naturnah gestaltete Form der Umwelt.
Andere Kriterien waren – und sind – die Nähe zu Wasser, freie und weite Aussicht, Zonen individueller Privatheit und differenzierter Grade der Öffentlichkeit, Optionen, die Körpererlebnis und gesundheitsdienliche Aktivitäten, soziale Kontakte, Geselligkeit und Spiel ermöglichen, sowie ein Mindestmaß an kreativer Mitgestaltung des individuellen Wohnbereichs.
Die Aufklärung am Ende des 18. Jahrhunderts stellte erstmals die bis dahin unbestrittenen hierarchischen Gesellschaftsformen in Frage. Dies führte im 19. Jahrhundert zunächst zur Teilnahme des Besitz- und Bildungsbürgertum an der Macht, im 20. Jahrhundert entwickelte sich – in der westlichen Welt – die Demokratie. Diese hat breiteren Schichten nicht nur einen bis dahin ungekannten wirtschaftlichen Aufstieg gebracht, sondern auch zum Verlangen legitimiert, für sich Wohnformen zu beanspruchen, die bislang nur den durch Besitz und/oder Macht Privilegierten erreichbar waren. Zumindest jedoch Wohnformen, deren Kriterien den Lebensweisen dieser – früher und immer noch – Privilegierten entsprechen, wohl in verkleinertem Maßstab, doch vollständig.
Die Legitimität dieses Verlangens, das erstmalig im Gemeindebau des Roten Wien umzusetzen versucht wurde, leitet sich nicht nur aus dem heute von allen politischen Parteien reklamierten Anspruch auf soziale Gerechtigkeit her, sondern aus der Übereinstimmung dieser Kriterien mit den auch von der täglichen Beobachtung menschlicher Lebensweisen bestätigten Erkenntnissen der Verhaltensforschung: Es geht um die Befriedigung endogen wirkender Bedürfnisse, deren Programm sich in Jahrmillionen der Evolution formuliert hat. Das zeigt nicht zuletzt die Übereinstimmung, ja nahezu Identität, in allen Kulturen und Epochen, der Wohnsituationen jener durch Besitz und/oder Macht Privilegierter, die ihre Lebensweisen ohne oder mit nur geringen Einschränkungen gestalten konnten.
Die heute in den europäischen Großstädten für die große Zahl der Menschen erreichbaren Wohnsituationen entsprechen diesen Kriterien nur mangelhaft, auch wenn sie sanitär, im Komfort, im Flächenangebot gegenüber dem 19. Jahrhundert einen Fortschritt darstellen. Immer noch fehlt dem größten Teil dieser Wohnungen der psychische Appell der Natur, Aussicht und Wasser, soziale und spielerische Optionen, kreativer Freiraum, usw..
Das Faktum bestätigt sich in den Phänomenen der Stadtflucht in der Freizeit und der Suburbanisation, der überproportionalen Zunahme der Bevölkerung im Umland. Die mehr als nur bedenklichen ökologischen, logistischen, ökonomischen und soziologischen Konsequenzen sind evident.
Eine weitere Bestätigung dieser Zusammenhänge kann darin gesehen werden, daß in den seit mehr als zwei Jahrzehnten wiederholt von offiziellen österreichischen Stellen durchgeführten Wohnwertanalysen Bauten, deren Optionen den genannten Anforderungen zumindest in Annäherung entsprechen, von ihren Bewohnern signifikant besser beurteilt werden als alle zum Vergleich herangezogenen sonstigen Bauten, die vor allem wegen der ihnen zugeschriebenen architektonischen Qualität ausgewählt wurden.
Die Frage stellt sich, ob diese Entwicklung unausweichlich oder beeinflußbar ist.
Aus den Vorgangsweisen fast aller Stadtplanungsämter – nicht nur in Wien – und den von der Architekturprominenz vertretenen Thesen scheint man sich mit dieser Entwicklung abgefunden zu haben. Vor allem werden Städtebau und Wohnbau fast ausschließlich als formalarchitektonische Probleme, und nicht als gesellschaftspolitische Phänomene gesehen.
Auch der zumeist als flächensparend angepriesene Verdichtete Flachbau, oder das Siedeln auf Kleinparzellen, verbessern die Situation nur geringfügig. Es sind Alternativen, die ebenfalls städtisches Umland in Anspruch nehmen, und zumeist fast die gleichen Konsequenzen wie die Suburbanisation außerhalb der Stadtgrenzen verursachen.
Eine mehr als nur marginale Änderung der Entwicklung kann nur von
Wohnformen
erwartet werden,
die innerstädtisch jene Qualitäten und Kriterien aufweisen, die die Menschen vom Leben im „Haus im Grünen“ erwarten
– und die die schon mehrfach zitierten Privilegierten immer schon, wenn auch in größerem Maßstab, für sich beansprucht und umgesetzt haben.
Es stellt sich somit die entscheidende Frage, ob in der Stadt solche „grünen Wohnformen“, die mit dem Einfamilienhaus zu konkurrenzieren vermögen und vor allem die Kriterien und Optionen der Lebensweisen und Wohnformen jener Privilegierten aufweisen, für alle überhaupt möglich sind, ob die durchgrünte Stadt nicht einen Widerspruch in sich darstellt.
Diese Frage wurde durch eine Reihe von Anlagen, von 200 bis 3.200 Wohneinheiten, vom Verdichteten Flachbau über 4, 6, 8 bis zu 23 Geschossen, beantwortet. Ihre ökonomische Machbarkeit ist daher erwiesen, sie sind abgerechnet, ihre Betriebskosten stehen seit Jahren fest. Ihre Akzeptanz bei den Bewohnern – und ihre Einschätzung als Alternative zum Wohnen „im Grünen“ - ist ebenso aus ihrem Markterfolg wie aus den erwähnten sozialwissenschaftlichen Erhebungen erwiesen. Das Konzept dieser Wohnanlagen läßt sich als das einer „Grünen Stadt“ bezeichnen. Ihre Kriterien sind die folgenden:
Reduktion des Individualverkehrs durch dessen Beschränkung auf ein möglichst großräumiges Netz von Verkehrs- und Geschäftsstraßen, und Führung der individuellen Zufahrten in ein unterirdisches, und zwar unter den Bauten verlaufendes kommunizierendes Garagensystem. Dadurch wird die – bereits in Gang befindliche – Entwicklung beschleunigt, bestimmte Straßenzüge in bandförmige Geschäfts-, Büro- und Gewerbezentren zu verwandeln.
Soweit durch Verlegung des ruhenden und Zufahrtsverkehrs unter Niveau möglich, kann Straßenraum in begrünte Fußgängerzonen rückgebaut werden. Einsatzfahrzeuge können befestigte Fußwege benutzen. Auch für Radfahrer sind diese verkehrsberuhigten Zonen sicherer und attraktiver.
Dadurch entstehen große zusammenhängende begrünte Fußgängerbereiche, ohne Einschränkung der individuellen Zufahrten, mit geringstmöglicher Versiegelung des Bodens, und einem Anteil von ¼ bis
1
/3 von Wohnungen mit eigenen Gärten – in dicht bebauten Quartieren der Stadt.
Dieses Konzept reduziert gleichzeitig den Aufwand öffentlicher technischer Infrastruktur – von Straßen, deren Einbauten, Beleuchtung usw., sowohl ihrer Errichtung als auch ihres Unterhalts, von Ver- und Entsorgungsleitungen. Es ermöglicht gleichzeitig die Einbettung der Wohnbauten in verkehrsfreie Grünräume – innerstädtisch und trotz überdurchschnittlicher Dichte.
Es erhöht den Anteil unversiegelten Bodens in der Stadt. Es schafft biotopisch und kleinklimatisch wirksame Grünräume.
Voraussetzung sind zusammenhängende kompakte Baukörperstrukturen. Nur solche ermöglichen die urbanistisch und ökonomisch erforderlichen Dichten und gleichzeitig parkartig bepflanzbare Grünräume.
Sie – und nur sie – sind auch die Voraussetzung für jene Wirtschaftlichkeit – und Ökologie – in Errichtung und Betrieb, die erlaubt, diese Bauten mit Dachgärten und Schwimmbädern, mit gemeinschaftlich nutzbaren Räumen für Spiel und Geselligkeit auszustatten. Sie – und nur sie – schaffen auch die hiefür erforderlichen planlichen und geometrischen Voraussetzungen.
Aus dieser Wirtschaftlichkeit resultiert weiters die Möglichkeit, im Rahmen der Kostenlimits des Wohnbaus für die große Zahl jede Wohnung mit einem bewohnbar geräumigen, bepflanzbaren Freiraum, Terrasse oder Loggia, auszustatten, die als wichtige Zwischenzonen die Privatheit der Wohnung mit dem halböffentlichen Grünraum verbinden, über den die Wohnanlage in den öffentlichen Raum übergeht. Sie bieten auch das erforderliche Mindestmaß an kreativer Mitgestaltung des Wohnumfelds und intensivieren den „psychischen Appell der Natur“. Es entsteht dadurch – in ihrer Summe – ein Ausgleich an begrüntem menschlichen Erholungsraum für den durch den Bau beanspruchten Grund und Boden.
Durch all dies und durch die erfahrungsgemäß erwiesene intensive Nutzung dieser Gemeinschaftseinrichtungen entsteht – und entstand, wie aus der Erfahrung ausreichend belegt – eine in der Großstadt selten erreichte Identifikation und das Gefühl, nicht in beziehungsloser Anonymität, sondern in „einer kleinen Gemeinde“ zu leben. Die vorliegenden Wohnwertanalysen sagen u.a. aus, daß in den seit Jahren bestehenden Bauten nach diesem Konzept die Präferenz des Einfamilienhauses als Wohnideal zurückgeht und mehr Freizeit im engeren Wohnbereich verbracht wird. Beides hat städtebaulich und soziologisch wünschenswerte und mit anderen Konzepten bisher nicht erreichte Wirkungen.
Das Konzept der Grünen Stadt wird trotz seiner unbestreitbaren und auch kaum mehr bestrittenen Erfolge und Vorteile von der Architekturszene abgelehnt, da es den aus dem 19. Jahrhundert übernommenen Vorstellungen der Selbstverwirklichung von Originalgenies und der Architektur als vor allen formal künstlerischen Disziplin nicht zu entsprechen scheint. Diese Auffassung wurde letztendlich von der Politik übernommen, da die Multifunktionalität dieser Bauten und ihre scheinbar „luxuriösen“ Optionen trotz – oder wegen – des mehrtausendfachen Nachweises der Realisierbarkeit als Kritik an der Phantasielosigkeit der Wohnbaupolitik – was für ganz Europa gilt – angesehen wurde. So hat sich die Wohnbaupolitik, begleitet von der etablierten Architekturszene, in die scheinbare Progressivität und das semantische Alibi arrangierter Wettbewerbe zurückgezogen, zwar manche Kriterien des Konzepts der „Grünen Stadt“ als Schlagworte übernommen, ohne sie aber tatsächlich umzusetzen.
Das Recht auf eine grüne Stadt
Vorwort
Ich habe nicht die Absicht der Diskussion über die ästhetischen Aspekte der Architektur eine weitere Meinung hinzuzufügen, sondern darzulegen, dass, zumindest was Wohn- und Städtebau betrifft, die für das Leben und Wachsen der Städte entscheidenden gesellschaftspolitischen, logistischen und ökologischen Phänomene nicht die ihrer Bedeutung entsprechende Beachtung finden. Dieses Versäumnis könnte im Zusammenhang mit den neoliberalistischen Tendenzen unserer Zeit gesehen werden, die ja im vielem den Geist des 19. Jahrhunderts wiederbeleben, und damit auch zu Stadtmodellen der Vergangenheit zurückkehren. Dies hat zu einer Raum und Mittel verschwendenden Ausdehnung und Ausdünnung der Städte geführt, was sich in der fortschreitenden Suburbanisation, dem allmorgendlichen und allabendlichen Verkehrsstau niederschlägt und in hektischer Freizeitflucht aus den Städten. Mir sind, jedenfalls was größere Städte betrifft, keine Ausnahmen bekannt.
Dies führt zu einem ungeheuren Verlust an Lebenszeit für jeden Einzelnen, neben einem ebenso ungeheuren materiellen Aufwand und ebenso beunruhigenden ökologischen Schäden. Die sogenannten Verantwortlichen scheinen sich damit abgefunden zu haben. Ich höre seit 30 Jahren, dass eine Wanderung zurück in die Stadt im Gange sei. Genauso lange jedoch sagen die Statistiken das Gegenteil
Ich kann im Folgenden keine Theorie zur völligen Umkehr dieser Situation darlegen, aber ein Konzept, das zumindest eine Reduktion dieser Probleme zu bewirken vermag. Ich bin in der Lage dazu Beispiele anzuführen, die dieses Konzept erläutern, die seit Jahren bestehen, bewohnt und abgerechnet sind, und die die Wirksamkeit des Konzepts erweisen.
Das folgende soll nicht als Monographie verstanden werden. Aber die Beispiele die ich heranziehen kann sind ausschließlich Bauten die unter zumindest maßgeblicher Beteiligung meines Büros entstanden sind, da sich meines Wissens niemand mit den Problemen in derjenigen Komplexheit befasst hat die zur Beurteilung der Situation erforderlich ist, und sich nicht nur theoretisch mit diesen Problemen befasst hat, sondern auch Gelegenheit hatte oder sich diese verschafft hat um nachprüfbar und nachvollziehbar erweisen zu können, wie und warum eine solche Beeinflussung möglich erscheint.
Wie alles begann
In den Jahrzehnten vor und nach dem Jahr 1800, das die Geschichtsschreibung als den Beginn des Industriezeitalters bezeichnet, setzten jene philosophischen, wissenschaftlichen und technologischen Entwicklungen ein, die, zumindest in Europa, zum Wachstum und der Entstehung der großen Städte führten.
Nach den aktuellen Prognosen der großen Weltorganisationen wird dies, und zwar auch in den Ländern der sogenannten 2. und 3. Welt, bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts dazu führen, daß mehr als 80 % der Erdbevölkerung in Städten oder stadtartigen Agglomerationen leben wird.
1765 erfand der Ingenieur Watt die Dampfmaschine, 1798 der Arzt Jenner die Pockenimpfung, 1840 der Chemiker Liebig den Kunstdünger, der den Ertrag der Landwirtschaft vervielfachte, was die Theorien des Ökonomen Malthus, der 1798 vorausgesagt hatte, die Nah-rungsmittelproduktion würde mit der Vermehrung der Weltbevölkerung nicht Schritt halten können, widerlegte. Es war, von Pasteur bis Koch und Ehrlich, das Heldenzeitalter der Entdeckungen und Erfindungen. 1847 erkannte Semmelweiß die Ursache des Kindbettfiebers und 1866 baute Siemens den ersten Elektromotor. Die Ideale der Aufklärung, auf dem Wiener Kongreß nur scheinbar zu Grabe getragen, führten zu jenem Paradigmenwechsel, der die hierarchischen Gesellschaftssysteme der vorangegangenen Jahrtausende beendete. Das 19. Jahrhundert brachte die Emanzipation des Bürgertums, im 20. entstand die demokratische Massengesellschaft.
Gleichzeitig ist unsere Kultur und Zivilisation, und zwar nicht nur die europäische, endgültig zur Stadtkultur und Stadtzivilisation geworden. Sie basiert auf arbeitsteiligen Prozessen, deren Verästelung so vielfältig geworden ist, daß nur das engste Nebeneinander einer sehr großen Zahl unterschiedlich befähigter und ausgebildeter Individuen in der Lage ist, dieses Zusammenwirken ohne unerträgliche Zeit- und Reibungsverluste zu ermöglichen. Dies gilt für Produktionsvorgänge ebenso wie für Lehre und Forschung, für Kunst und Rechtsprechung, für Politik, für die Sorge um Kranke, Alte und Benachteiligte. Auch die denkbare Weiterentwicklung der Telekommunikation wird das nicht grundsätzlich verändern.
Diese Stadtkultur kennzeichnet ein Gesellschaftssystem, das in einem in der Geschichte noch nie dagewesenen Ausmaß Gleichheit vor dem Gesetz, Chancengleichheit und Verringerung der Unterschiede zwischen Oben und Unten verwirklicht hat – und zwar in einem Zeitraum von wenigen Generationen. Es ist nicht die Beste aller möglichen Welten, wahrscheinlich noch nicht einmal eine gute Welt, aber, zumindest im Westen, die Beste aller bisherigen.
Da die Stadt bis auf Weiteres den menschlichen Lebensraum darstellt und darstellen wird, sollte dieser unseren Lebensbedürfnissen, den Lebensbedürfnissen einer erstmals in der Geschichte durchgehend demokratischen Gesellschaft, so gut wie möglich entsprechen. Ist das so?
Ohne Zweifel haben die – auch in der demokratischen Massengesellschaft – durch Besitz, Bildung und Macht Privilegierten in den Städten adäquate Biotope gefunden, räumlich befriedigendes Wohnen an „guten“ – ein Begriff, der noch zu definieren sein wird – Standorten, sie üben Berufe aus, die gestaltendes Wirken zulassen oder erfordern, und genießen ebenso rekreative wie stimulierende Freizeit. Der großen Zahl der Angehörigen der demokratischen Massengesellschaft, den Menschen mit beschränkten Einkommen und Möglichkeiten, steht dies immer noch in weit geringerem Ausmaß zur Verfügung. In so geringem, daß es, dafür gibt es deutliche Indizien, offenbar unseren aus der Evolution her stammenden Bedürfnissen nicht genügt.
Diese Indizien sind zunächst einmal die Suburbanisation, jedenfalls deren zunehmendes Ausmaß, also die Stadtflucht ins Umland. Weiters die nahezu lemminghafte Freizeitflucht aus den Städten ins sogenannte Grüne, und die Bedeutung, die vor allem für Dienstnehmer, also die Bezieher im Durchschnitt niedriger und mittlerer Einkommen, der Urlaub gewonnen hat. Dieser ist vielfach zum Mittelpunkt des Jahres geworden, ebenso wie das Auto über ein Transportvehikel hinaus zum mobilen Zweitwohnsitz geworden ist, der die Flucht aus der für die menschlichen Bedürfnisse offenbar nicht ausreichenden Stadtwelt ermöglicht. Nun sind die Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen aber jene kompakte Majorität, deren große Zahl den entscheidenden Einfluß auf Leben und Wachstum der Städte ausübt. Diesen Einfluß verstärkt die in den letzten 100 Jahren dieser großen Zahl zugewachsene wirtschaftliche und politische Bedeutung, aus der noch nie dagewesene Anforderungen an die Logistik der Städte und die Nutzung der Bodenreserven entstanden sind. Mir ist keine Stadt bekannt, der es gelungen wäre, diese Prozesse, die tief in die ökonomischen, ökologischen und soziologischen Zusammenhänge eingreifen, erfolgreich einer vorausschauenden Gestaltung zu unterwerfen.
Es mag tatsächlich für einen auf jeweils nur wenige Jahre gewählten Politiker nicht verführerisch sein, Maßnahmen in Gang zu setzen, die erst in längeren Zeiträumen wirksam werden – obwohl es ein sehr nachhaltiges Gegenbeispiel gibt, den sogenannten Gemeindebau des sogenannten Roten Wien, auf den einzugehen sein wird. Aber Tatsache ist, daß, von diesem Beispiel abgesehen, auch noch keine Stadtplanung versucht hat, das Verhalten der Menschen auf deren ursprüngliche Bedürfnisse zurückzuführen – auf die Bedürfnisse von Lebewesen mit einer in Millionen Jahren der Evolution entstandenen Disposition für ein bestimmtes Biotop. Der Nachweis, daß diese Disposition allen Menschen gemeinsam ist, ungeachtet einer unendlichen Zahl von Variationen – wenn auch bei näherem Augenschein, nur mikroskopischen Unterschieden – und abgesehen höchstens von einer statistisch nicht relevanten Anzahl von Ausnahmen, ist von der Verhaltensforschung bereits vor Jahrzehnten geführt worden. Davon abgesehen müßte das Faktum jedem bewußt sein, der unvoreingenommen und ohne Überheblichkeit sich selbst und seine Umgebung beobachtet. Eigenartigerweise ist unser Selbstverständnis von der idealistischen Philosophie des 19. Jahrhunderts so sehr geprägt, daß wir uns für autarke, monadische Individuen halten – und nicht als Angehörige einer Spezies, die zwar unendlich vielfältig, aber trotzdem nahezu gleichartig ist – nämlich Menschen.
Unsere Herkunft bestimmt unser Sein
Menschen, das heißt Nachkommen jener Lebewesen, die vor einigen der schon erwähnten Jahrmillionen ihre Gefährten der Evolution in den Tiefen der Wälder zurückließen und selbst aufbrachen, sich eine neue Umwelt zu suchen: die Savanne, die Baumsteppe, eine grüne, fruchtbare Wiesenlandschaft mit Baumgruppen und Büschen, mit Bächen und Teichen, sanft hügelig – jene Landschaft, die die frommen Maler des Mittelalters als das Paradies darstellten. Wir bilden diese Landschaft auch in unseren Gärten ab, in unterschiedlichen Stufen der Abstraktion, vom illusionistischen englischen Park bis zum minimalistischen japanischen Garten. Selbst der für manche eine Vergewaltigung der Natur darstellende sogenannte französische Garten ist ein Arrangement der gleichen Elemente. In unseren Wohnungen, unseren künstlichen Höhlen, hängen wir Blumenstilleben und Bilder von Landschaften an die Wände, versehen wir Tapeten und Vorhänge mit floraler und vegetabiler Dekoration, in Büros und Amtsstuben wachsen kleine Wälder von Topfpflanzen. Wir stehen bewundernd und schaudernd vor der Großartigkeit der Wüste, der Unendlichkeit der Meere, der Majestät der Gebirge – aber trotzdem und obwohl wir gelernt haben, uns mit Hilfe unserer künstlichen Organe, unserer Kleidung, Häuser, Werkzeuge, Waffen und Transportmittel in den unterschiedlichsten Umwelten am Leben zu erhalten, am „schönsten“, wie eine Heimkehr, erscheint uns jene schon beschriebene fruchtbare, blühende, grüne Landschaft aus Wiesen, Bäumen und Büschen, ruhigem und fließendem Wasser, für die uns die Evolution seit unseren Anfängen an angepaßt hat. Jede andere Landschaft als diejenige, für die wir konditioniert sind, empfinden wir vielleicht als Herausforderung, jedenfalls aber als mühe- und gefahrvoll. Ein Wald, der noch den Charakter des Urwaldes an sich trägt, birgt auch Elemente des Unheimlichen. Es ist daher wohl kein Zufall, daß die europäische Kulturlandschaft, durch Rodung der dichten Wälder, die unseren Kontinent bedeckten, in den vergangenen ein-, zwei- und dreitausend Jahren entstanden, letztendlich jener Landschaft entspricht, in der der Mensch in den Millionen Jahren seiner Frühzeit lebte. Eine Umwelt, die diese Komponenten als „Auslösereize“ für unsere „Appetenzen“ bereithält, empfinden wir als „guten“ Standort zum Wohnen und Leben.
Rückkehr?
Die Frage liegt nahe, ob es überhaupt vorstellbar sein kann, daß die Milliarden Menschen, die heute die Erde bevölkern, ihre Städte verlassen um zurück in jene Landschaft ihrer Frühzeit, wo immer sich diese befinden mag, zu ziehen. Immerhin wissen wir, daß diese paradiesische, fruchtbare und blühende Landschaft auch kein sich selbst unablässig und unerschöpflich erneuerndes Schlaraffenland zu sein vermag.
So absurd die Frage scheint, ist sie nicht. Die Flucht aus den Städten findet nämlich statt – nahezu total in der Freizeit, und in immer mehr zunehmenden Ausmaß durch Übersiedeln in die Vorstädte und in das städtische Umland. Das Ausmaß, das diese Suburbanisation im letzten Jahrzehnt angenommen hat, ist dramatisch – auch in ihren ökonomischen, ökologischen, logistischen und soziologischen Konsequenzen. Daß diese, Ökonomie und Ökologie zunächst außer Acht gelassen, allein von unserem traditionellen Stadtverständnis aus problematisch sind, ist offenkundig. Und man kann wohl davon ausgehen, daß wir mit großer Übereinstimmung überzeugt sind, daß diese europäische Stadtkultur einen wesentlichen Bestandteil unserer Zivilisation darstellt.
Andererseits lebt, wenn auch unter ganz wesentlich anderen Voraussetzungen und Randbedingungen der größte Teil, nämlich mehr als 90 % der Stadtbevölkerung der USA und Kanadas, in Suburbia. Die Hauptvoraussetzung dieses „Amerikanischen Wegs“ ist der immer noch praktisch unerschöpfliche Reichtum an Land dieses Kontinents. Es spielt im Umfeld der Städte der USA tatsächlich kaum eine Rolle, ob die Grenze zu landwirtschaftlich genutzten oder auch brachliegenden Flächen ein paar Meilen weiter nach außen verschoben werden. Dies scheint der nach wie vor unerschöpflich scheinende materielle Reichtum Nordamerikas zu erlauben, der ermöglicht, immer größere Flächen mit Straßen und technischer Infrastruktur zu erschließen, sobald Bedarf gegeben scheint.
Dazu kommt die aus der Geschichte Amerikas erklärbare höhere Mobilität vor allem der mittleren Schichten der Bevölkerung, wofür die Gleichmäßigkeit des technologischen und kommerziellen Versorgungsstandards über das Land hinweg eine wesentliche Voraussetzung darstellt.
Die riesigen Wohngebiete rund um die amerikanischen Städte, jeweils mehrere tausend eher eng aneinander grenzende Einfamilienhäuser, liegen zwischen radialen Erschließungsstraßen, die in der Regel bandförmig von Leichtindustrie, Gewerbe und Handelsbetrieben gesäumt werden. Dieses sicher nicht ideologisch geplante sondern aus pragmatischer Logik entstandene Prinzip bietet sowohl Arbeitsplätze und Dienstleistungen im Nahbereich als auch Immissionsschutz für die dahinter liegenden Wohngebiete. In deren Zentrum finden sich dann Einkaufsmärkte mit für europäische Verhältnisse erstaunlich vielfältigem Angebot, Kirchen und Schulen, Tennis- und Golfklubs. Diese Zentren, in den gesamten USA ziemlich ähnlich, sichern Versorgung ebenso wie Kommunikation, die sich in den Schul- und Kirchengemeinden, und den Klubs mit ihren hohen Mitgliederzahlen nahezu zwangsläufig entwickelt – natürlich nicht in der Qualität großstädtischer Urbanität, dafür jedoch in gewissermaßen dörflicher Überschaubarkeit. Es scheint, daß diese Wohn- und Lebensform einen Gutteil unserer evolutionären Triebstrukturen zumindest substitutiv zu befriedigen vermag.
Das Problem der für unsere Begriffe großen Entfernungen und daher langen Anfahrtswege, die in der Regel nur mit Hilfe des Individualverkehrsmittels bewältigt werden können, werden, vielleicht auch aus Gründen der Tradition eines weiträumigen Landes, hingenommen, wobei die Bequemlichkeit der Fahrzeuge und des Straßennetzes eine ebensolche Erleichterung bedeuten mag wie die generell kürzere Arbeitszeit, die in vielen Betrieben auf nur mehr vier jeweils aufeinander folgende Arbeitstage beschränkt ist.
Natürlich werden auch die Nordamerikaner einmal an die Grenzen ihrer Ressourcen stoßen – an der Ostküste und in Südkalifornien ist dieser Zustand bereits eingetreten oder zeichnet sich ab. Es bedarf auch keiner Beweisführung, daß das Prinzip ökologisch und energetisch verschwenderisch ist, und daher eines Tages der Korrektur bedürfen wird. Ebenso sollte es aber ohne Beweisführung erkennbar sein, daß dafür in Europa, jedenfalls im industriell hochentwickelten Mitteleuropa, alle Voraussetzungen für einen derart extensiven Umgang mit Land und Energie fehlen. Dabei muß man gar nicht in Betracht ziehen, daß, selbst wenn wir wollten und bereit wären uns über die Zerstörung der stadtnahen Natur hinwegzusetzen, und wir in der Lage wären, das ohnedies bereits ruinös kostspielige und trotzdem unbefriedigende Verkehrs- und Straßennetz weiter zu verdichten, allein die Eigentumsverhältnisse und die zwischen Städten und Ländern existierenden Kompetenzprobleme, vor allem aber die viel zu geringen ökonomischen Dimensionen, großräumige „amerikanische“ Entwicklungen kaum zulassen würden – ganz zu schweigen von der Degradierung der gewachsenen Innenstädte zu „Down-Towns“.
Aber selbst davon abgesehen erhebt sich die Frage, ob denn die – zig Millionen Einfamilienhäuser Nordamerikas und die sich immer weiter ins Land fressenden Stadtrandsiedlungen Europas überhaupt dem Ideal jener ursprünglichen Heimat der Menschen entsprechen. Natürlich nicht – oder nur als Fiktion und mit Hilfe unserer Fähigkeit zu abstraktem und substitutivem Denken. Die weitere Frage muß daher lauten: gibt es Alternativen, die unserer evolutionären Konditionierung gleich gut oder noch besser entsprechen, die ökologisch bedachtsamer und mit unseren Ressourcen an Land und Natur sparsamer umgehen – ja vielleicht sogar eine Umwelt schaffen, die Natürliches oder der Natur Näheres wieder an die Stelle von Artefakten setzt.
Weiteres über unsere Herkunft
Wir haben im Lauf unserer Menschwerdung nicht nur ein immer größeres und leistungsfähigeres Gehirn erworben, sondern es sind auch andere Veränderungen, die uns von allen Tieren unterscheiden, eingetreten. Die Verhaltensforschung nennt diese Vorgänge Domestikation. Diese bewirkt, unter anderem, eine Abnahme der Intensität bestimmter angeborener Instinkte, sowie ein Phänomen, das als „persistierende Neotenie“ bezeichnet wird.
Daß „Instinktsicherheit“ als positive Fähigkeit gilt, ist ein verräterisches Indiz unserer Herkunft. Tatsächlich ist aber der sich abschwächende Instinkt nur ein scheinbarer Verlust. In fast allen Tieren wirken die Instinkte so strikt, daß auf bestimmte Ereignisse der Außenwelt, die sogenannten Auslösereize, völlig automatisch, nahezu zwanghaft reagiert wird – und zwar in unveränderlich vorprogrammierter Weise. Dies hat, in der Natur, den Vorteil, rasch und ohne Nachdenken handeln zu können, und zwar in einem in Jahrmillionen erprobten und gemäß der Statistik des Überlebenskampfes in der überwältigenden Zahl der Fälle als richtig erwiesenen Ablauf. Diese Instinktstärke und Sicherheit hat aber auch einen Nachteil: sie hindert, Alternativen wahrzunehmen und zu suchen, die für Überleben und Entwicklung vorteilhafter sein könnten. Nun mögen diese Alternativen für die meisten Raubtiere keine besondere Rolle spielen. Für den Großteil der Fluchttiere wäre solches aber durchaus vorstellbar. Der Mensch war in seiner Frühzeit zweifellos in erster Linie auf die Flucht angewiesen oder auf Verstecke – es hat ziemlich lange gedauert, bis er sich selbst zum Raubtier entwickelt hat. Und auch dies konnte er erst, als er für sein bescheidenes Gebiß, seine nicht vorhandenen Krallen, seine geringe Körperstärke, Ersatz in Form künstlicher Organe entwickelt hatte, also über Werkzeuge und Waffen verfügte. Es war aber erst die Befreiung von automatenhaft vorprogrammierten Handlungsabläufen, die jene innovativen geistigen Leistungen ermöglicht hat, die die Grundlage des Aufstiegs der Spezies Mensch waren. Allein die Aneignung des Feuers, das in allen Wildtieren Angst erweckt, wäre anders nicht möglich gewesen.
Hiezu existiert ein signifikantes Beispiel: der Wolf, Ur- und Wildform des Hundes, diesem bis heute so nahe verwandt, daß Paarung möglich ist, muß, in einigen Exemplaren, vor 10.000 oder mehr Jahren, eine Mutation erfahren haben, die es ermöglichte, daß diese sich dem Feuer hütenden Menschen anschlossen. Mag sein, daß es Jungtiere waren. Denn in der Jungendphase ihres Lebens zeigen viele höhere Säugetiere, insbesondere diejenigen, die wir im weitesten Sinn als Raubtiere bezeichnen, eine bestimmte sehr bedeutsame Abweichung zu den vorprogrammierten Handlungsabläufen, die ihr erwachsenes Leben bestimmen: sie spielen.
Auch hier ist der Vergleich Wolf – Hund aufschlußreich: zieht man einen jungen Wolf und einen jungen Hund nebeneinander auf, so machen sich, bis zur Pubertät, keine Unterschiede des Verhaltens bemerkbar. Im Spiel üben sie jene Verhaltensmuster ein, deren Programm sie von der Evolution erhalten haben. Der Unterschied tritt erst mit der Geschlechtsreife zutage: der Wolf ist fertig, er hört auf zu spielen, für den Rest seiner Tage gehorcht er seinen vorprogrammierten Verhaltensmustern, die ihn zwingen, auf bestimmte Auslösereize auf ebenso bestimmte Weise zu reagieren. Er lernt nur mehr durch Erfahrung, die auf ihn zukommt, die er aber nicht mehr sucht. Der Hund dagegen spielt lebenslänglich, jedenfalls bis zum Eintritt seines Greisenalters, das, beim Hund wie beim Menschen, häufig mit dem Ende jener geistigen Fähigkeit einhergeht, die uns nicht nur spielen, sondern auch erfinden, entdecken, neue Wege suchen und gehen ermöglicht.
Die Ewige Jugend
Die „persistierende Neotenie“, das Andauern des der Jugendphase eigenen spielerischen Verhaltens, ermöglicht uns die lebenslängliche Nutzung und Weiterentwicklung der Grundkomponente des Spiels, nämlich der Fähigkeit zur Abstraktion. Der Stock, der Ball, das Wollknäuel, jedes bewegte tote Objekt wird zur Beute. Der Krieg findet nicht auf dem Schlachtfeld statt, sondern auf dem Spielfeld. Abstraktes Denken ist die Voraussetzung jeder höheren geistigen Leistung. Innovation erfordert das Voraus-Denken kausaler Ketten, um aus der gezielten Veränderung technischer, organisatorischer, physikalischer Bedingungen neue, bislang unbekannte Phänomene zu bewirken.
Kein erwachsener Wolf wird einem Ball nachlaufen, die meisten Hunde sehr wohl. Die Domestikation hat den Hund der Intensität vieler seiner Instinkte beraubt – ihm dafür aber ein Repertoire an Alternativen eröffnet, die sein Überleben als Art noch sichern werden, wenn es den Wolf schon lange nur mehr als Schaustück oder in Reservaten geben wird.
Die lebenslängliche Jugendlichkeit des Hundes bewirkt ebenso einen Appell an unseren Brutpflegeinstinkt, wie seine Spielbereitschaft ihn zum – dem Menschen – nützlichen Weg- und Jagdgefährten befähigt.
Die Domestikation hat im Menschen in gleicher Weise und noch weit darüber hinausgehend gewirkt. Die persistierende Neotenie, die uns von allen Wildtieren unterscheidet, hat uns ermöglicht, die Welt zu erobern. Sie hat uns gleichzeitig befähigt, zumindest einen Teil unserer auf Zerstörung gerichteten Instinkte durch Handlungskonzepte zu ersetzen, die wir als Moral und Ethik bezeichnen - und die zweifellos unserer Erhaltung als Art dienen. So ist die Domestikation die Voraussetzung der Fähigkeit und des Bedürfnisses, diese unsere Welt zu verändern, zum Besseren, wie wir meinen, im Großen und im Kleinen, und die Grenzen unserer Möglichkeiten zu erforschen.
Aber dieser Drang stößt, jedenfalls in unserer arbeitsteiligen Zivilisation, auf Grenzen: und zwar für jenen großen, größten Teil aller Menschen, die ihren Unterhalt in einem Routineberuf, sei es in einer Werkstätte, einer Fabrik, oder an einem Schreibtisch, nachzugehen gezwungen sind, in dem eigenes, innovatives, explorierendes Handeln nicht nur unerwünscht, sondern sogar verboten oder ausgeschlossen ist. Man sollte die Konsequenzen des daraus entstehenden psychischen Staus nicht unterschätzen. Es handelt sich um jene Kraft, die Amundsen auf den Nordpol trieb und Hannibal die Alpen überqueren ließ, die die Kathedralen, die großen Brücken und Eisenbahnen schuf und dem Menschen Flügel. Aber auch die Werke der Kunst, durch die der Mensch darzustellen sucht, was sein Verstand nicht zu erreichen vermag, unser Drang, zu erkennen, was hinter dem Schleier der Maja auf uns wartet, wird aus dieser Kraft gespeist. Sicher, es sind nur einzelne Individuen, in denen diese Kraft kulminiert. Doch es ist ein kollektives Erbe der Spezies.
Der Ernst des Lebens, den Erwachsene gelegentlich Jugendlichen androhen, bedeutet ja nichts anderes, als daß diese demnächst ihrem schweifenden Spiel- und Explorationstrieb würden entsagen müssen – handelte es sich dabei nicht um einen sehr starken, angeborenen Trieb, dann wäre der Zwang, ihn unterdrücken zu müssen, wohl keine Strafe.
Dieser permanente, „persistierende“ Wunsch“, die Welt zu verbessern, ist ebenso die Triebfeder aller Revolutionen und gesellschaftlichen Umwälzungen, wie auch das Grundmuster dessen, was wir politisches Bewußtsein des Einzelnen nennen. Und hier berührt sich unsere Abstraktions- und Innovationsfähigkeit, unser Drang nach Exploration und Fortschritt mit einem weiteren Erbgut der Evolution.
Das soziale Verhalten
Das Wesen, das aus den tiefen Wäldern heraus in die grüne, sonnige, fruchtbare Baumsteppe trat, aus Gründen, die wir nicht kennen, verzichtete damit auch auf den Schutz, den diese Wälder ihren ihnen angepaßten Bewohnern boten. Es war daher eine Bedingung des Überlebens – und diese Bedingung hat sich bis heute nicht geändert – daß nur Gruppen dieser Wesen sich behaupten und überleben konnten. Trotz zahlreicher Funde in der jüngsten Vergangenheit wissen wir sehr wenig über die Lebensweise unserer frühen Vorfahren, die immerhin mehrere Millionen Jahre auf der Erde lebten, sich vermehrten und ausbreiteten – über riesige Strecken hinweg, und über für uns nahezu unvorstellbare Zeiträume hinaus. Erst mit jener vergleichsweise kurz zurückliegenden Epoche, die wir Steinzeit nennen, können wir Vorstellungen verknüpfen. Diese werden immer konkreter, seitdem wir von Menschen wissen, die vor einigen wenigen Jahrtausenden im Nahen Osten, für unsere Kenntnisse nahezu aus dem Nichts, Gemeinwesen schufen, die über Schrift, hierarchische Staatsordnungen, Kulte, Architektur, bildnerische und literarische Künste verfügten: vom technologischen Abstand abgesehen, also fast alles, was moderne Kulturen und Zivilisationen kennzeichnet. Jede dieser Zivilisationen entstand aus dem organisierten Zusammenwirken großer Zahlen von Menschen – was kaum möglich gewesen wäre, wenn die Fähigkeit und Bereitschaft dazu, zum Miteinander, nicht von Anfang an vorhanden gewesen wäre.
Nun ist der Staat letztlich nichts anderes als die vergrößerte Horde, die ursprünglichste Form menschlicher Gemeinschaft. Schon diese setzt Normen des Verhaltens, fordert Teilnahme aller an den zum gemeinsamen Überleben notwendigen Leistungen und bietet dafür Schutz. Solche sozialen Normen, das Selbstverständnis gemeinsamen Handelns, und dafür der Schutz aller für das einzelne Individuum kennen wir auch bei Rudeltieren. Man kann daher davon ausgehen, daß diese soziale Konditionierung, das Schutzsuchen und Agieren in der Gemeinschaft ein sehr altes Erbgut darstellt, älter als die Menschwerdung selbst.
Auch die Stärke dieses Bedürfnisses zum sozialen Eingebundensein in eine überschaubare, vertraute Gemeinschaft sollte nicht unterschätzt werden. Wir strafen mit Einzelhaft. Durch Jahrhunderte war Verbannung die schwerste Sanktion nach dem Tod. Einzelgänger, Eigenbrötler, Vereinsamung sind auch heute negativ besetzte Begriffe.
Was wir noch geerbt haben und die Macht der Triebe
Außer diesen drei dominierenden Erbgütern der Evolution: dem Bedürfnis nach dem psychischen Appell der Natur und des Landschaftsbildes unserer Frühzeit, der Fähigkeit, nahezu der Lust an abstrakten planerischen Denkvorgängen, dem Antrieb zur Weltverbesserung und Welteroberung, und dem Verlangen nach dem Schutz und der Geborgenheit der Gruppe, kennt, fühlt und erlebt jeder von uns noch viele Verhaltensmuster, Vorlieben und Antriebe, die allesamt Erbstücke der Evolution sind: die Empfindung, die offenes Feuer und warmes Licht hervorrufen, unsere Affinität zu klarem, fließenden, trinkbaren – oder so erscheinenden – Wasser, die Befriedigung und Sicherheit, die freie und weite Aussicht verleiht, die Freude am gemeinsamen Essen und das Bedürfnis, die Mahlzeit mit vertrauten Menschen zu teilen, die Einladung zum Essen als Geste der Freundschaft, Blumen als Gastgeschenke, aber auch das Bedürfnis, unsere Physis auszuleben und Herausforderungen zu bestehen. Dazu kommt die große Zahl von Ritualen der Mimik und der Körpersprache, deren wir uns kaum bewußt sind, die wir mit vielen höheren Tieren teilen, sodaß – neben anderen Beweisen – kein Zweifel daran bestehen kann, daß es sich um angeborene Programme, Ergebnisse der Evolution, handelt.
All dies, vieles davon bereits von Darwin vermutet, ist heute gesicherte Erkenntnis der Verhaltensforschung, es sind anthropologische Konstanten.
Die Humanwissenschaften, insbesondere die Humanbiologie, lehren uns aber noch einiges anderes: fast all diese Kräfte und Triebe sind angeboren, nicht angelernt, abgeschaut oder eingeübt, sondern, jedenfalls in ihrer Hauptrichtung und Intensität, von Anfang an vorhanden, sodaß sich Ihre Auswirkungen in allen Kulturen und Zivilisationen zeigen, in nur von den Randbedingungen und dem Stand der Technologie differenzierten Variationen. Sie zeigen sich besonders deutlich in den Formen des Wohnens und der Lebensführung – jedenfalls soweit es sich um das Wohnen und die Lebensführung jeweils jener Individuen handelt, die durch Besitz und oder Macht in der Lage sind oder waren, ihre Wünsche und Vorstellungen in ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft ohne Einschränkungen und Kompromisse umzusetzen und auszuleben.
Die große Zahl der Menschen hatte im Lauf der Jahrtausende, deren Geschichte uns bekannt ist, genug damit zu tun, zu überleben und ihre physische Existenz zu erhalten – das Wie hing mehr vom Schicksal als vom Wirken des Einzelnen ab.
Es war erst die gesellschaftliche und politische Emanzipation der großen Zahl, die gesellschaftliche Entwicklung der letzten hundert Jahre, die zumindest in der westlichen Welt auch die große Zahl der Menschen in die Lage versetzte, sich ihrer aus der Evolution stammenden Antriebe bewußt zu werden und Ansprüche auf deren Erfüllung anzumelden.
In der Nichtzurkenntnisnahme dieser Emanzipation der großen Zahl, dem revolutionärsten Ereignis der letzten Jahrhunderte und vielleicht unserer gesamten bisherigen Geschichte, bedeutsamer noch als die technologische Entwicklung, wenn auch mit dieser nicht zufällig nahezu synchron, liegt die entscheidende Ursache für die Probleme, um nicht zu sagen, das Versagen eines Wohn- und Städtebaus, der hartnäckig an den Vorstellungen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts festhielt, der letzten Epoche vor dem endgültigen Übergang der hierarchischen Herrschaftssysteme zur Massendemokratie.