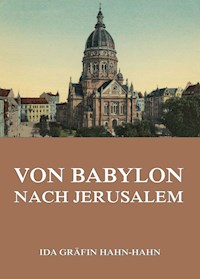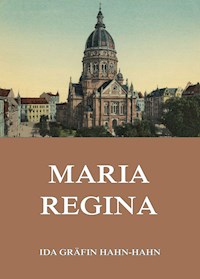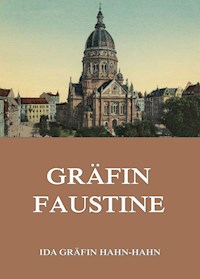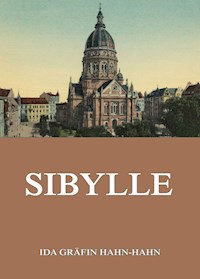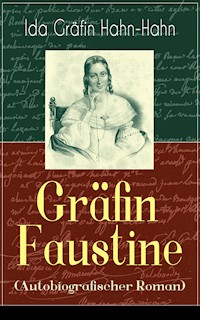
0,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Gräfin Faustine (Autobiografischer Roman)" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Ida Hahn-Hahn, eigentlich Ida Marie Louise Sophie Friederike Gustave Gräfin von Hahn (1805-1880) war eine deutsche Schriftstellerin, Lyrikerin und Klostergründerin. Sie entstammt dem uradeligen Geschlecht der Hahn. Sie selbst benutzte mit Vorliebe den Doppelnamen "Gräfin Hahn-Hahn". Ida Gräfin Hahn-Hahn galt als eine der meistgelesenen Autorinnen ihrer Zeit. Aus dem Buch: "Damals sagte ich zu meinem Gefährten: "Frauen wie Faustine sind die Racheengel unseres Geschlechts, die die Vorsehung zuweilen, aber selten auf die Erde schickt und denen die Allerbesten unter Euch verfallen; denn nur die Allerbesten unter Euch sind zu dem bereit, wozu die meisten Frauen bereit sind: ein Herz für ein Herz, ein Leben für ein Leben, eine ganze Existenz für eine ganze Existenz zu geben, und sie wähnen, diesen Tausch bei solchen Frauen zu finden, deren glutvolle Unersättlichkeit eine Bürgschaft unerschöpflichen Gefühls zu geben scheint. Ein so strahlendes Wesen, meinen sie, müsse ein verklärtes sein. Aber mitnichten! Eine solche feingeistige Vampirnatur verbrennt und verbraucht, zuerst den Andern, dann sich selbst. Nehmt Euch vor den Faustinen in acht! Es ist nicht mit ihnen auf gleichem Fuß zu leben. Es ist immer die Geschichte vom Gott und der Semele. Nein, nicht von Gott, vom Dämon.""
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Gräfin Faustine (Autobiografischer Roman)
Inhaltsverzeichnis
Der Dichter
Sieht ihm nicht die enge Grenze, Die das Alltagssein umflicht! Bietet ihm die kahlen Kränze Eurer mäßigen Freuden nicht!
Reicht ihm auch nicht Eure Becher, Scherben, halbgefüllt und matt, Ihm, dem lustberauschten Zecher, Der die Götterschale hat!
Eure Krücken, unverhohlen, Bieten ihm nicht Stützen dar, Der an Schultern und an Sohlen Trägt ein luftig Flügelpaar.
Was weiß er von Euren Schranken, Die dem Mittelmaß Ihr zieht, Da mit Seele und Gedanken Er durch alle Himmel flieht!
Was weiß er von Eurem Glücke, Das Ihr mühsam Euch erbaut, Da mit einem einzigen Blicke Er der Götter Wonne schaut!
Was weiß er von Eurem müden Streben nach dem Rausch der Welt, Da die Frucht der Hesperiden In die offene Hand ihm fällt!
Was weiß er von Tag und Stunde, Die Ihr zu berechnen pflegt, Da sein Herz in der Sekunde Voll wie für Äonen schlägt!
Was weiß er von jener Schwere, Die Beruf und Stand vermißt, Da in seiner freien Sphäre Alles Licht und Flamme ist!
Möge flüchtig er verschweben
An Bystram
Seit fünf Monaten schmachte ich im zwiefachen Kerker der Blindheit und der Krankheit; seit fünf Monaten hast Du, unermüdlich über mich wachend, mich gepflegt und getröstet, mir Mut und Beruhigung zugesprochen, mir die Träne aus dem Auge und den Angstschweiß von der Stirn getrocknet, mir Dein Auge und Deine Hand geliehen. Daß ich nicht ganz in Verzweiflung, Stumpfsinn, Apathie untergegangen bin, danke ich Dir. Darum soll dies Buch, das freilich schon vor einem halben Jahre bis auf die letzte Durchsicht fertig war, dessen Herausgabe aber doch einen aufglimmenden Funken geistiger Regsamkeit in mir verkündet, – darum soll es Deinen Namen wie ein Diadem an der Stirn tragen. Vielleicht ist er das Beste an dem ganzen Buche.
Tharandt, 14. August 1840.
Späteres Vorwort
Ich hasse es, in einem Vorwort das nachfolgende Buch zu erläutern. Es schien mir immer unendlich überflüssig. Leider habe ich bei meiner unglücklichen Faustine die für mich sehr demütigende Erfahrung gemacht, daß es mir nicht gelungen ist, in dem Buche leichtverständlich das auszudrücken, was ich habe ausdrücken wollen, und daß eine Erläuterung daher an ihrem Platz sein dürfte. Es versteht sich von selbst, daß ich dies nicht in Bezug auf journalistische Kritik sage. Für die Rezensenten unsrer Tage würde ich mir wohl nie diese Mühe geben. Nein! Es geschieht für die Menschen, die sich für meine Faustine genug interessiert haben, um über sie nachzudenken, und die doch nicht den Gesichtspunkt haben auffinden können, von dem aus ich das Buch geschrieben, – was natürlich meine Schuld ist! Denn hätten sie ihn gefunden, so würden sie mir wohl keine Vorwürfe darüber gemacht haben, daß Faustine eben das tut, was sie tut.
Ich war im Frühling 1837 in Prag und brachte einen Morgen ganz einsam auf dem Wisserad zu, wo das Schloß der Königin Libussa gestanden haben soll, wo man noch jetzt ihr Badezimmer zeigt und die bekannte Anekdote dabei erzählt, worauf Klemens in einem Gespräch mit Faustine Bezug nimmt. Der Vergleich zwischen Sonst und Jetzt, die Verschiedenheit der Form, in der sich die Gleichartigkeit des Wesens wiederfinden läßt, fesselt mich so unglaublich in den Geschichten der Menschheit, daß ich mich in Gedanken darüber vertiefte: Wie würde sich eine Königin Libussa unsrer Tage benehmen? – Und daraus ist drei Jahr später Faustine entstanden. Sie trägt die Kronen der Schönheit, des Genies, der Anmut; sie ist Königin an Macht über die Herzen; sie will Befriedigung, dauernde, ewige, unerschöpfliche; sie will sie um jeden Preis und gibt Menschen und Verhältnisse auf, die sie ihr nicht mehr gewähren. Wohin sie blickt, bezaubert sie und macht sie elend; was sie tut, bereitet Seligkeit und Schmerz. Nie gewöhnt, sich selbst Schranken zu setzen, kommt sie früh bei der letzten an; und trauriger, als sie andere hat untergehen lassen, geht sie selbst unter in banger Einsamkeit, losgerissen, abgeschieden, und verschwindet mit ihrem Glanz und ihrer Glut hinter den finstern kalten Klostermauern. Sie verzehrt in ihren Flammen erst andere und dann sich selbst. Der Kern ihres Wesens ist ein feingeistiger Egoismus, der alles ausschließt, was Opfer und Entsagung ist, und der sich im Streben nach der mißverstandenen Entwicklung und Befriedigung ausgebildet. Denn nicht das, was der Mensch äußerlich erlangt, befriedigt ihn, sondern das, was er in seinem Innern sammelt.
Jemand hat meine Idee vollkommen begriffen und mit zwei Worten wiedergegeben: »Faustine, diese sublime Egoistin!« Ich kenne den nicht, der dies gesagt hat, aber es ist gar erquickend, sich so verstanden, zu wissen, um so mehr, wenn man durch die seltsamsten Vorwürfe halb befremdet, halb entmutigt ist. Hier soll Faustine dem Andlau nicht treulos sein. Dort vergibt man ihr den Andlau, aber nicht den Mario. Da vergibt man ihr sämtliche Männer, aber nicht, daß sie das Kind verläßt. Es wäre ja unzweifelhaft unendlich viel besser, wenn sie all das Unrecht nicht beginge, und man möchte ein ganz hübsches Buch darüber schreiben können, nur eben keine Faustine. Und wenn ich mich heute wieder hinsetzte und mich fragte: Wie benimmt sich eine prächtig begabte, reich organisierte Natur, die nichts sucht, will und verlangt als ihre eigene Befriedigung ohne Rücksicht auf Andre, so müßte ich zum zweitenmal schreiben meine Faustine.
Berlin, 5. Oktober 1844.
Ida Gräfin Hahn-Hahn
Faustine
I
In Norddeutschland gibt es wohl wenig lieblichere Punkte als die Brühlsche Terrasse in Dresden zur Frühlingszeit. An einem Junitage, frisch, grün und strahlend wie ein Smaragd, saßen mehrere junge Männer vor dem Baldinischen Pavillon, rauchten Zigarren, nahmen Gefrorenes oder Kaffee, musterten die Vorübergehenden und schwatzten eine Musterkarte von Unsinn durcheinander, wozu, wie sich von selbst versteht, Pferde, Theater und Frauen den Stoff lieferten.
Es war drei Uhr nachmittags und daher keine elegante Frau auf der Terrasse zu sehen. Sie speisten oder wollten speisen und fürchteten die Hitze, die Sonne, obgleich sich kühler, grüner, wehender Schatten über die Terrasse legte. Desto mehr mußte es auffallen, daß eine augenscheinlich dem höheren Stande angehörende Frau allein auf einer Bank saß, den Rücken dem Pavillon zugewandt, ungestört vom Geschwätz der Männer und vom unruhigen jauchzenden Treiben der Kinder, die mit und ohne Wärterinnen die Terrasse gleich Ameisen überdeckten. Aber es fiel keinem auf. Sie mußte also eine Erscheinung sein, die jedermann kannte und um die sich niemand kümmerte. Sie zeichnete emsig. Ein Bedienter stand wie eine Bildsäule seitwärts hinter ihr und hielt einen Sonnenschirm so, daß weder ein blendender Lichtstrahl noch ein zitternder Schatten des Laubes Auge, Hand und Papier der Gebieterin treffen konnte. Ihr großes dunkles Auge flog mit einem schnellen scharfen Aufschlag hin und her zwischen Gegend und Zeichnung, und die feine Hand, ohne Scheu vor der Luft, der größern Festigkeit wegen des Handschuhs entledigt, folgte gewandt dem Blick. Sie war ganz in ihre Arbeit vertieft.
»Lady Geraldin ist heute nach Teplitz gefahren. Das ist meine letzte Neuigkeit,« sagte ein junger Mann aus jener Gruppe.
»Ist gar keine Neuigkeit!« rief ein anderer. »Es war längst bestimmt.«
»Aber auf morgen.«
»Nein, auf heute!«
»Wahrhaftig, auf morgen!«
»Kurz und gut, sie ist fort,« sagte ein dritter, »und bald wird Dresden ganz ausgestorben sein. Man muß sich auch davonmachen. Es ist unerträglich, nichts als gemeine unbekannte Gesichter zu sehen.«
»Ich liebe gerade die fremden Gesichter, die wie Wandervögel jetzt hindurch und in die Bäder ziehen.«
»Ah, fremde Gesichter! Das ist etwas ganz anderes! Die liebe ich auch, und die kennt man sehr schnell. Ich meinte die unbekannten, unbedeutenden Persönlichkeiten, den Bodensatz der Gesellschaft, Namen, die man sich hundertmal wiederholen läßt, ohne imstande zu sein, sie zu behalten, Gestalten, die Anspruch darauf machen, gegrüßt zu werden, weil man sie in irgendeinem Salon flüchtig gesehen hat. Und von solchen wimmelt Dresden plötzlich, wie die Nacht von Gespenstern.«
»Ich bedaure jeden, der gezwungen ist den Sommer hier zuzubringen.«
»Und gestern Abend ist Graf Mengen angekommen. Der Gesandte hat nur darauf gewartet, um seine Badereise anzutreten. So bleibt er denn solo soletti! Freilich, reiten kann man überall, und auch allein ist's amüsant.«
»Beneidenswert! Und wo werden Sie hingehen?«
»Unbestimmt noch! Hie und da aufs Land, zu Freunden. Später nach Teplitz. Wenn Fürst Clary Wettrennen veranstalten wollte, wie sie doch jetzt in jedem zivilisierten Lande Europas und ziemlich an jedem Ort Mode sind, wo sich Leute der Welt zusammenfinden, so würde der dortige Aufenthalt bedeutend gewinnen. Das Gelände wäre vortrefflich. Die Wiener würden auch ihre Pferde schicken. Unbegreiflich, daß der Clary den Vorteil nicht einsieht.«
»Kennen Sie den Graf Mengen?« wurde gefragt.
»Ich sah ihn heut früh bei Feldern, seinem Universitätsfreunde, aber nur einen Augenblick. Wir wurden einander genannt. Dann ging er zu seinem Gesandten.«
»Wie sieht er aus? Hat er gute Manieren?«
»Ich denke, er muß pompös zu Pferd sitzen.«
»Aber, lieber Kentaur,« rief einer, »im Zimmer, im Salon kann man nicht zu Pferd sitzen und muß sich doch gut machen.«
Der Kentaur, der nichts Schmeichelhafteres kannte als diesen Beinamen, sagte:
»Wer gut reitet, macht sich überall und immer gut, hat Gewandtheit, Kraft, Haltung, Ungezwungenheit, – kurz alles, was ein Kavalier bedarf.«
»Auch Verstand?«
»Auch Verstand! Die Pferde sind kluge, schlaue, pfiffige, tückische Bestien, haben viel Ähnlichkeit mit den Weibern, müssen gehorchen lernen, auf den Wink, auf die geringste Bewegung. Es gehört viel Verstand dazu, ein tiefes Studium und ernste Beharrlichkeit, ihnen Gehorsam einzuimpfen.«
»Den Weibern oder den Pferden?«
»Beiden! Der Umgang mit diesen ist gleichsam die Vorschule zum Verkehr mit jenen.«
»Ich gratuliere Deiner künftigen Gemahlin, lieber Kentaur!«
»Hat noch Zeit! Bin noch nicht firm genug,« war die Antwort.
»Da kommt Feldern mit einem Fremden, wahrscheinlich Graf Mengen,« unterbrach jemand das Gespräch.
»Richtig, er ist's!« rief der Kentaur. »Ich wette, er ist ein großartiger Reiter!«
Neben dem kleinen, blonden, schmächtigen, zierlichen Feldern, der Hände hatte, weiß und zart wie ein Frauenzimmer, und ein Gesicht freundlich lachend wie ein vierzehnjähriges Mädchen, ging ein großer Mann, schlank und dunkel wie eine Tanne, von Scheitel zur Sohle ernst und fest wie aus Erz gegossen; aber die ganze Erscheinung wunderbar gelichtet, erleuchtet fast, durch seine Augen, die Lichtstreifen auf den Gegenstand zu werfen schienen, den sie anblickten; im übrigen aber vornehm gleichgültig, zerstreut selbstbewußt in Haltung und Wesen, kalt übersehend, spöttisch abwehrend in Wort und Ausdruck für die Masse, jedoch dem einzelnen nie Huldigung oder Bewunderung versagend, – so trat Graf Mario Mengen auf.
Feldern machte ihn mit all den jungen Männern bekannt. Einige empfingen ihn neugierig zudringlich; andere taten gleichgültig gegen den Fremden, den Uneingeweihten in das Geschwätz und die Liebhabereien ihres engen kleinen Kreises. Mario ließ alle schwatzen, gähnen, rauchen, setzte sich mit untergeschlagenen Armen, und blickte in die lachende Gegend hinein.
»Da zeichnet ja die Gräfin Faustine!« sagte Feldern plötzlich.
»Aber wo ist denn Andlau?« fragte einer. »Fast eine Stunde ist sie allein hier. Mich wundert, daß er das zugibt.«
»Daß er es erträgt!« rief ein andrer.
»Nun, nun,« sagte der immer begütigende Feldern, »sie sind ja beide nicht aneindergeschmiedet.«
»Glauben Sie nicht, Feldern, daß sie heimlich verheiratet sind?«
»Nein, denn sie könnten es ja wohl öffentlich sein, wenn sie wollten.«
»Wer kann's wissen! Das Ding hat gewiß seinen Haken.«
»O ganz gewiß!« rief ein dritter. »Zum Beispiel den eigenwilligen Kopf der Gräfin Faustine selbst, die, um etwas ganz Besonderes zu haben, in der Stille bestimmt tausend Martern ertrüge, – natürlich ohne sich selbst oder andern zu gestehen, daß es in der Tat Martern sind.«
»Es ist wahr. Sie hat ihre eigenen und eigentümlichen Allüren,« sagte Feldern.
»Ein Beispiel hat mich ungeheuer erstaunt,« entgegnete der andere. »Sie hat den ganzen Winter hindurch in allen großen Gesellschaften ein und dasselbe Kleid getragen.«
»In allen Gesellschaften! Sie geht doch wenig in die Welt.«
»Kann sein, aber wenn sie ging, so trug sie ihr himmelblaues Atlaskleid. Zuerst war das ganz gut; aber es ist doch wunderlich, öfter als drei bis viermal genau im nämlichen Anzuge zu erscheinen. In Italien herrscht die Sitte, daß Mütter ihre Kinder unter den besondern Schutz der Madonna stellen und sie deshalb in deren Farbe, hellblau, kleiden – ein Jahr, eine Reihe von Jahren, immer, je nachdem sie es gelobt haben. Ich fragte die Gräfin Faustine, ob sie ein solches Gelübde getan. Nein, sagte sie, aber das der Bequemlichkeit. – Ist dies natürlich bei einer Frau? Ich frage!«
Indem erhob sich Faustine, gab dem Bedienten das Zeichenbuch und nahm den Sonnenschirm. Dann stand sie ungefähr eine Minute lang am Geländer der Terrasse. Sie trug ein ganz schlichtes weißes Perkalkleid, den Hals umschließend, auf die Füße herabfallend. Kein buntes Band, keine Schleife, kein Schal störte den harmonischen Eindruck ihrer ebenmäßigen Gestalt. Ein tiefer weißer Tafthut verbarg ihr Haar, fast ihr Gesicht. Sie wandte sich langsam. Es sah aus, als bildeten die grünen Bäume ein Laubdach für andere, einen Tempel für sie. Sie ging mit dem Anstand einer Königin an den Herren vorüber, die sie freundlich grüßte, als sie Bekannte unter ihnen wahrnahm.
»Wer war die Dame?« fragte Graf Mengen lebhaft.
»Eben die Gräfin Faustine, von der wir sprachen.«
»Eine Fremde?«
»Ja; doch seit einigen Jahren hier wohnhaft.«
»Verheiratet?«
»Gewesen.« – »Vielleicht.« – »Man weiß nicht.« – »Witwe.« – »Unverheiratet!« – erscholl es von allen Seiten.
Mengen warf den Kopf herum: »Die Herren sind guter Laune.«
»Auf Ehre! Reine Wahrheit, was wir sagen!«
»Das Wahrste und Einfachste,« sprach Feldern, »ist indessen doch, wenn man sagt, daß Gräfin Faustine Obernau Witwe ist.«
»Kennst Du sie?« fragte Mengen.
»Recht gut.«
»Ist sie liebenswürdig? Kann ich sie auch kennen lernen? Nimm nicht übel, daß ich die törichtste aller Reden, eine fragende mache! Dem Fremden muß man das verzeihen.«
»Über diese Frau,« nahm ein anderer das Wort, »könnte man noch ein paar hundert Fragen tun, wenn es der Mühe lohnte, und jeder würde eine andere Antwort geben, weil ein Feld von allerlei Möglichkeiten bei solchem Verhältnis aufgetan ist. Aber eben weil ein solches Verhältnis stattfindet, kann man ja alle Fragen von Hause aus sparen.«
»Wann werden Sie dem Könige vorgestellt, Graf Mengen?« fragte einer.
»Ich denke, Sonntag, wenn er von Pillnitz herein kommt.«
»Ist der Wiener Hof von großem Rückhalt für die Gesellschaft?«
»Von gar keinem! Mit einer Cour hat die Gesellschaft, mit ein paar Kammerbällen hat der Hof seine Pflicht abgetan.«
»War das diesjährige Pferderennen glänzend, und wessen Pferd siegte?« fragte der Kentaur.
»Ich meine, es war ein Lichtensteinsches.«
»Das wissen Sie nicht einmal gewiß! Ich hoffe, Graf Mengen, daß Sie ein Liebhaber der Pferde sind.«
»O ja,« sagte Mengen gelangweilt, »nur nicht der Gespräche über sie. Sobald ich meine Pferde hier habe, will ich die Gegend weidlich durchstreifen.«
»Graf Mengen!« rief der Kentaur mit überquellendem Herzen. »Gleich vom ersten Augenblick an habe ich das in Ihnen vorausgesetzt. Ich habe eine schreckliche Freude, daß mich mein erster Blick in diesem Punkte nie trügt.«
Er packte seine Hand und schüttelte sie. Die Übrigen lachten und neckten den Kentauren mit seinem untrüglichen Urteil. Kein Demosthenes wäre imstande gewesen, dem Gespräch über Pferde eine andere Wendung zu geben.
Mengen stand auf.
»Die Tischzeit meines Ministers,« erklärte er grüßend, und ging.
»Nun, Feldern,« riefen alle durcheinander, »heraus damit! Erzählt, erzählt! Von seinen Verhältnissen, seinen Umständen, seiner Laufbahn!«
»Mein Gott,« sagte Feldern, »davon gibt es nichts Besonderes zu erzählen! Er macht die diplomatische Karriere wie jeder andere und wie er auch seine Studien machte – auf ganz gewöhnlichen Wegen, ohne besondere hohe Gönner. Und ob er Vermögen hat, weiß ich nicht. In Göttingen hatte er bald vollauf Geld und bald nichts; aber immer war er, als befehle er über Goldminen und verachte sie nur. Einmal kam ein Prinz dahin und brachte die Mode der kostbaren und eleganten Stöcke mit. Wir schafften uns alle dergleichen an. Mengens Geldbestände mochten gering sein; er hatte keinen. Da sagte er einmal bei Tisch. »Bah! Wer mag denn den Tambourmajor spielen und einen Stock mit blankem Knopf tragen!« – Es kam uns vor, als habe er uns dadurch zu Tambourmajors ernannt. Die prächtigen Stöcke verschwanden.«
»Solch ein riesiges Übergewicht kann auf der Universität jeder Raufbold haben.«
»Das war er nicht. Er schlug sich, wenn er mußte und dann tüchtig; aber nie suchte er Händel.«
»Wir wollen doch sehen, ob der Gesandtschaftssekretär das Übergewicht des Studenten hier wird geltend machen wollen und können.«
»Er scheint Lust dazu zu haben.«
»Ich glaube nicht,« sagte Feldern. »Er hat Lust aus der untergeordneten in eine unabhängige Stellung zu kommen, freie Hand zu haben. Seinen alten Minister wird er wohl etwas tyrannisieren; allein die Fanfaronaden der Burschenzeit liegen zu weit ab, um sie in die gegenwärtigen Zustände zu verflechten.«
»Wenn er sich in die Höhe bringen will, muß er eine Ministerstochter heiraten. Anders geht's heutzutage nicht.«
»Oder nicht heiraten! Das hilft bisweilen auch.«
»Rücksichten regieren die Welt,« meinte Feldern bedachtsam.
»Aber sie genieren teufelmäßig!« rief ein anderer.
»Ich habe das nie finden können,« entgegnete Feldern. »Rücksichten sind die Gleise, in denen der Wagen der Gesellschaft ruhig und sicher fährt, ohne mit andern zusammenzustoßen, zu zertrümmern und zertrümmert zu werden.«
»Aber es gibt breitspurige Wagen.«
»Nun, die halten halbe Spur und sind nach einer Seite wenigstens geschützt.«
Die Zigarren waren geraucht, die Tassen und Becher geleert, die Gespräche erschöpft. Jeder schlenderte seiner Wege; die Meisten zur Siesta.
II
In Faustinens Wohnung herrschte tiefe Stille. Sie lag an der Promenade; da gab es kein Wagengerassel, kein Pferdegestampf, kein Marktweibergeschrei, nichts, was an den Tumult und das Bedürfnis erinnert. Die Fenster des Salons – lange Glastüren, die auf den Balkon führten – waren geöffnet und die Jalousien herabgelassen, damit nur das scharfe Licht, nicht die Luft verbannt sei. Auf einer Ottomane saß der Baron Andlau und blätterte in einem Buch, ziemlich unaufmerksam, denn er wartete. Nichts auf der Welt ist störender als die Erwartung, sogar von den geringfügigen Dingen. Von dem Augenblick an, wo man wartet, ist man trotz aller Fähigkeiten, Kräfte und Sinne nichts als ein Schütze, der von der ganzen Erde nichts sieht und weiß außer dem schwarzen Punkt in der Scheibe.
Andlau wartete auf Faustine. »Warum kommt sie nicht?« sagte er zu sich selbst. »Sollte ihr irgend etwas zugestoßen sein? Warum bin ich nicht mit ihr gegangen? Mein Kopfweh wäre nicht ärger worden! Warum ließ ich sie überhaupt gehen in dieser heißen Tageszeit!«
Er nahm den Hut und wollte ihr entgegen; da hörte er ihren Schritt auf der Treppe. Er sprang auf und öffnete ihr die Tür. Es wurde ganz hell in dem verfinsterten Gemach, als sie eintrat.
Faustine warf ihren Hut auf den einen Tisch, ihr Zeichenbuch auf den andern, sich selbst auf ein Sofa und sagte:
»Lieber Anastas, das wird ein hübsches Bild werden! Aber müde bin ich, todmüde!«
»Warum strengst Du Dich so an? Muß das Bild denn notwendig eine so heiße Sonnenbeleuchtung haben?«
»Ganz notwendig!« entgegnete sie und stand auf. »Ich bin auch schon ausgeruht, und heut Abend mußt Du mit mir nach der Neustadt hinüber! Ich will mir recht einprägen, wie der Strom und die Kirchen im Mondlicht aussehen. Das wird ein Gegenstück dazu.«
»Hier ist ein Brief an Dich,« sagte Andlau und nahm ihn vom Schreibtisch. »Nach dem Wappen zu urteilen, von Deinem Schwager.«
»Richtig!« rief Faustine und las:
Geehrte Frau Schwägerin!
Ihrem erfreulichen Schreiben vom 24. hujus zu Folge, entnehmen wir aus demselben Ihre gütige Absicht, uns im Lauf des Monats Junius mit Ihrem schmeichelhaften Besuch zu erfreuen. Da mein jüngstgeborenes Söhnchen am 10. desselben Monats die Taufe empfangen soll, so vereinigen meine liebe Frau und ich unsre Bitte und Wunsch dahin, daß es Ihnen gefallen möge, eine Patenstelle bei selbigem Knäbchen zu übernehmen, und es am 10. Juni, mittags um 2 Uhr, in meiner Kirche zu Oberwalldorf über die Taufe zu halten. Ihre Mitgevattern werden sein: die Frau Baronin von Feldkirch, geborene Gräfin Hagen aus Mühlhof, und mein Bruder Klemens von Walldorf, welcher sich, nachdem er seine Studien zu Würzburg und Jena seit Ostern vollendet hat, bei mir aufhält, um die Landwirtschaft praktisch zu erlernen, was ein ganz ander und viel wichtiger Ding ist, als es theoretisch zu tun. Meine Kinder befinden sich sämtlich wohl und munter, was unter allen Umständen mit Dankbarkeit anzuerkennen ist, aber dann ganz besonders, wenn man sieben hat und auf dem Lande, fern von ärztlicher Hilfe, wohnt. Auch meine liebe Frau ist, gottlob, so wohl wie man es nur wünschen kann, denn die Wochenbetten sind ihr bereits zur Gewohnheit worden, wie Tag und Nacht. Sie trägt mir die herzlichsten Grüße für die liebe Schwester auf. Ich aber, verehrte Frau Schwägerin, unterzeichne mich als Ihren treuergebenen Schwager und Bruder und ganz gehorsamen Diener
Maximilian von Walldorf.
»Nun gut,« sagte Faustine, »auf ein paar Tage früher oder später kommt es Dir wohl nicht an. Laß uns übermorgen reisen! Bis Koburg zusammen; dann Du nach Kissingen, ich nach Oberwalldorf. Und in der ersten Hälfte des Juli hole ich Dich ab und fort nach Belgien!«
Andlau machte keine Einwendung. Er war mit allem zufrieden, was ihr genehm war, und da sie meistenteils auf nichts und niemanden in der Welt Rücksicht nahm als auf ihn allein, so muß man ihm diese Zufriedenheit als ein außerordentliches Verdienst anrechnen; denn die Masse der Menschen ist am verdrießlichsten, wenn man die größte Rücksicht auf sie nimmt.
Faustine sagte:
»Es ist nur eine Trennung von vier bis fünf Wochen, die uns bevorsteht; aber dennoch, Anastas, bin ich traurig, als wären es ebensoviel Jahre. Trennung ist Trennung! Auf die Länge der Zeit, auf die Weite des Raumes kommt es gar nicht dabei an. In drei Tagen, wo ich Dich nicht sehe, nicht höre, nichts von Dir weiß, kannst Du und kann ich ebensogut zugrunde gehen, als wenn wir auf immer getrennt wären. Ist denn das Wiedersehenwollen eine Bürgschaft des Wiedersehens?«
»Gewiß, Faustine! Meinst Du, daß etwas anderes uns trennen könne als unser Wille?«
»O ja!« erwiderte sie melancholisch.
»Ja,« rief er heftig. »Ja? Nun, wenn Du das glaubst, so sind wir schon getrennt.«
»Der Tod nimmt auf keinen menschlichen Willen Rücksicht. Er hat seinen eigenen Gang.«
»O der Tod, Faustine! Du wirst nicht sterben, und wenn ich sterbe . . . .«
»So sinke ich Dir nach! Du hast recht, Anastas, das ist kein Tod und keine Trennung.«
Sie hatte sich zu ihm auf die Ottomane gesetzt und legte nun ihr weiches frisches blühendes Haupt auf seine Schulter und ihre gefalteten Hände in seine Linke, während er sie mit dem rechten Arm umschlang. Er berührte leise mit den Lippen ihre Stirn und sah auf sie herab mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Zärtlichkeit, Andacht und Freude. Er hatte ein Gesicht mit scharf gezeichneten Zügen, mit Spuren von starker Leidenschaft, von ernsten Gedanken; aber wenn der Blick seines großen blauen Auges auf Faustine fiel, so verklärte sich dies strenge Auge und die schneeweiße Stirn, die es überwölbte, auf eine Weise, die keiner ahnte, der ihn nicht mit ihr gesehen; denn seine breiten dunkeln Augenbrauen und sein glänzend schwarzes seines Haar, das sich schlicht um seine Stirn legte, verbunden mit einem durchdringenden klaren Blick, gaben ihm einen Ausdruck von ungewöhnlicher Strenge. Nur Faustine hatte ihn aus innerer Freudigkeit lächeln gesehen; denn für sie war er alles, was sie bedurfte, und in jedem Augenblick, wo sie es bedurfte: Vater oder Freund, Lehrer oder Geliebter, lächelnd oder warnend, ermahnend oder scherzend, sorgend oder liebend, und wie an ihre sichtbare Vorsehung lehnte sie sich an ihn. Ihre fliegende Phantasie ward in Schranken gehalten durch seine Klarheit; ihre reizbare Beweglichkeit durch seine Ruhe. Bisweilen fühlte sie sich beängstigt durch das Übergewicht, das besonnene Charaktere immer über phantastische haben, und sagte scherzhaft:
»Wie jene Sklavinnen des Morgenlandes als Zeichen ihrer Knechtschaft nur eine kleine goldene Fessel an der Hand tragen, die wie ein Schmuck aussieht, so ist auch Deine Liebe wohl ein Schmuck, aber doch eine Fessel.«
»Die Du notwendig brauchst, um nicht in alle vier Winde zu verflattern,« entgegnete Andlau.
»Und dann verdiene ich es auch nicht besser,« sagte sie, »habe eine echte Sklavennatur und liebe da am meisten, wo ich am meisten tyrannisiert werde; und zwar so sehr, daß ich die Menschen gar nicht begreife, die genug und übergenug lieben und sich doch gar nicht um das Liebste kümmern, ihm sein Glück gönnen, ohne es teilen, seine Freude, ohne sie genießen, seine Wege, ohne sie verfolgen zu wollen. Aus lauter Liebe lassen sie das Liebste laufen. Was bleibt da der Gleichgültigkeit übrig? Ich halt' es mit der ausschließlichen Liebe!«
Da ihr Geist immer Nahrung und Anregung bei Andlau fand, und seine Seele für sie der Inbegriff aller Vollkommenheit war, so drückte seine Überlegenheit sie auch nur in den seltenen Fällen, wo ihr Wille sich durch den seinen beeinträchtigt glaubte. Aber wenn sie sich die Mühe nahm zu überlegen, so sagte sie immer:
»Du hast wirklich recht.«
Indessen kam es selten bei ihr zur Überlegung. Sie tat, wie und was Andlau wünschte, sobald seine Meinung die ihrige überwog. Außerdem handelte sie nach Laune, aus Leidenschaft, aus Eingebung. was immer eine mißliche Sache ist, und wenn die Natur auch die allerreinste. Faustine hatte eine solche; jedoch Grundsätze hatte sie nicht.
»Wenn ich die Grundsätze nur begreifen könnte,« sagte sie oft, »so wollte ich sie mir ja sehr gern zu eigen machen. Allein jeder hat seine ganz besonderen und ganz possierlichen. Der eine spricht: Ich stehe alle Morgen um sechs Uhr auf, – das ist mein Grundsatz. Der andere: Ich erziehe meine Kinder durch Prügel, – das ist mein Grundsatz. Der dritte: Ich lasse die Leute schwatzen, was sie mögen, bekümmere mich um nichts und tue, was ich will, – das ist mein Grundsatz. Mit letzterem bin ich gewiß ganz einverstanden; nur sehe ich nicht ein, weshalb eine so natürliche Denk- und Handlungsweise mit dem pomphaften Wort Grundsatz belegt werden soll.«
»Die Grundsätze sollen uns ja keineswegs eine unnatürliche, sondern eine edle, unserm Wesen entsprechende Richtung geben,« sagte Andlau, »und uns helfen, diese Richtung zu verfolgen, soviel es in menschlicher Kraft steht, wenn es uns auch schwer wird, eben weil wir sie als die erforderliche und notwendige zu unserer Entwicklung erkannt haben.«
»Sie machen mich starr und unbeugsam!« rief Faustine.
»Wo sie fehlen, gibt es Leichtsinn und Flatterhaftigkeit,« meinte Andlau lächelnd.
»Wenn ich mir nun auch vorgenommen habe, auf der Heeresstraße zu gehen, warum soll ich nicht aus dem dicken Staub oder von den harten Steinen auf die Wiese nebenbei, und so zu meinem Ziel spazieren? Ich komme ja angenehmer hin.«
»Aber Du kannst Dir im Tau nasse Füße und den Schnupfen holen. Oder ein breiter Graben sperrt Deinen Pfad und Du mußt umkehren. Oder ein Schmetterling lockt Dich seitab. Oder Du kommst eine Minute später an, und diese eine ist zu spät.«
»Ich hab' auch einen Grundsatz,« sprach Faustine ernsthaft.
»Und der wäre?«
»Nie mit Dir zu streiten, weil ich immer den kürzeren ziehe, was sehr demütigend ist.«
Doch auch dieser war nur ein flüchtiger Einfall. In ihrem Charakter waren viele Unregelmäßigkeiten und manche Schatten; doch der vorherrschende Zug ihres ganzen Wesens war eine Liebenswürdigkeit, die jene ausglich und diese überstrahlte. Worin ihre Liebenswürdigkeit bestand, konnte man nicht bestimmt sagen, vielleicht bloß darin, daß sie natürlich und ohne Ansprüche war, und von niemandem weder Lob, noch Beifall, noch Huldigung verlangte. Die tiefe Sorglosigkeit über den Erfolg ihrer Erscheinung oder ihres Gesprächs gab ihr eine solche Frische, daß um alltägliche Handlungen, um gewöhnliche Worte ein reizender Schmelz gehaucht war, wie er auf frischgepflückten Früchten liegt. Es ist ein Hauch, ein Duft, eben Nichts. Doch wenn die Früchte zwölf Stunden im Zimmer gestanden, so ist dies liebliche Nichts verschwunden, und dann, wenn man es vermißt, wird es erst erkannt. Trotz ernster Lebenserfahrung, die oft mutlos; trotz herben Kummers, der oft trübe macht; trotz der Verhältnisse, die sie beengten, war Faustine an Körper und Geist, an Sinn und Seele jung und frisch, als hätte sie nichts erfahren, nichts gelitten; und fremd in den Verhältnissen des Lebens, als bewohne sie den Regenbogen oder den Orion und komme nur zufällig bisweilen auf die Erde herab. Sie war ganz und ungeteilt Eins, nicht zerstückelt, nicht zersplittert. Das gab ihr Klarheit. Sie blickte weder rechts noch links auf Wege, wo andere gingen; sie wandelte unbekümmert auf dem ihren. Das gab ihr Sicherheit. Sie griff nicht hier und dort nach Haltung umher, nach Liebe und Freundschaft suchend. Sie war begnügt im tiefsten Wesen. Doch wenn man ihr entgegentrat und ihr die Hand bot, oder wenn sie erkannte, daß sie die Hand bieten durfte, so tat sie es gern, nahm und gab dem fremden wie dem eignen Bedürfnis und Wunsch. Aber wer nicht mit ihr Schritt hielt, wer ihr kein Stab war, woran sie sich heraufranken konnte ans Licht, kein Fels, woran sie emporklettern konnte zur Luft, den ließ sie los, gleichgültig, unbefangen, wie man eine welke Blume nicht wegwirft, aber fallen läßt. Menschen, Zustände, Welterscheinungen, eigene Fehltritte, alles war ihr Mittel, um sich daran fort- und auszubilden. Sie sagte oft:
»Helden, Künstler, große Herrscher, was tun sie anderes, als daß sie in ihrem Wirkungskreise, der freilich nicht kleiner als die Welt ist, sich selbst zur Vollkommenheit durchzuarbeiten suchen? Das ungemessene Streben, Dursten und Ringen nach Vollendung kennt jeder, aber nicht jeder kann zu seiner Bildung in die Zeit hineingreifen und sich einen Thron in ihr errichten, oder in den Stein hauen und sich ein Monument daraus bauen. Es ist eine große Erleichterung für den Menschen, ein Genie in irgendeiner Kunst, daß heißt in irgendeinem Zweige des geistigen Lebens zu sein; er hat, woran er sich üben kann. In seine Schöpfungen legt er den Überfluß des Daseins nieder und taucht frischgewaschen aus diesem Bade hervor, wie die großen Bergströme erst dann klares Wasser bekommen, wenn sie durch einen See geflossen sind. Wir Nicht-Genies müssen uns helfen, wie wir eben können, und ich bilde mir ein: Alles kann uns dienen, ohne daß wir deshalb geistige Blutsauger werden müssen.«
Aber unter dienen verstand sie eine Behilflichkeit zur Erlangung kleiner Absichten und Zwecke. Niemand besaß weniger Geschick als sie, die Menschen zu gewinnen und zu lenken für ihre Pläne; schon deshalb, weil sie schwerlich je einen andern Plan als den einer Reise oder einer Spazierfahrt gehabt. Die Menschen dienten ihr wie anatomische Präparate oder wie seltene Pflanzen, als Studien, nicht einer Wissenschaft oder einer Kunst, sondern des Lebens, das sie nach allen Richtungen, in allen Äußerungen verfolgen und verstehen wollte. »Ein Vogel singt, der andere fängt Mücken; jedes Ding hat seine Art,« sagte sie, und jede Art war ihr interessant; mitunter freilich nur auf zwei Minuten. »Ist das meine Schuld?« fragte sie unbefangen, wenn Andlau oder andere Freunde ihr vorwarfen, daß sie leicht der Dinge überdrüssig werde und heute gähne, wo sie gestern Beifall geklatscht. »Ich habe wirklich noch nie Überdruß an meinem Gott und meiner Liebe empfunden.«
Fast alle Frauen ohne Ausnahme hatten Faustine lieb, denn in keinem Stück wetteiferte sie mit ihnen. Sie gönnte ihnen ihre Triumphe, ihre schönen Kleider, ihre Anbeter, ihre Verdienste, und begnügte sich, das alles nicht zu haben. Zwar stellte sie die schönsten und glänzendsten Frauen in Schatten, doch so, daß beide Teile keine Ahnung davon hatten. Die schönen sagten: »Sie hat sehr viel Verstand, aber schön ist sie durchaus nicht.« Die klugen: »Verstand hat sie nicht viel, aber sie ist allerliebst.« Keine verglich sich mit ihr, so wie prächtige Gartenblumen sich vielleicht nicht mit einer Alpenpflanze vergleichen möchten. Ein Wilder sagte einst, als er das Gemälde eines Engels sah: »Er ist meines Geschlechts.« Zivilisierte Leute haben nicht mehr diesen erhabenen inneren Blick.
Männer interessierten sich im allgemeinen weniger für Faustine. Sie war zu unduldsam gegen fade Schmeicheleien, und – Gott sei es gesagt! – sie machen den Lichtpunkt in der Unterhaltung der Männer aus. Damit hatte sie gar keine Nachsicht; das heißt die Langeweile malte sich unwillkürlich, aber so deutlich auf ihr durchsichtiges Antlitz, daß mehr als Verwegenheit dazu gehört hätte, eine Unterhaltung fortzusetzen, die solche Wirkung hervorbrachte. Folglich hatte die Masse der Männer ihr nichts zu sagen, und nichts drückt einen Mann mehr, als sich einer Frau gegenüber unwichtig zu fühlen. Daher kommt es, daß das eigene Geschlecht ziemlich willig einer hervorragenden Frau geistige Bedeutung und Übergewicht verzeiht; das fremde hingegen nur dann, wenn sie von den Grazien zur Gefährtin geweiht ist.
Älteren Leuten gefiel sie besser als jungen; vermutlich deshalb, weil sie freundlicher gegen jene war, teils aus Achtung vor dem Alter, teils weil sie behauptete, man liefe bei ihnen keine Gefahr, nicht – sich zu verlieben, sondern in diesen Verdacht zu kommen, was sehr unbequem und störend sei. Ohne Vermögen, ohne Ansehen, ohne Verbindungen, ohne Intrigen, nur durch die Macht ihrer Persönlichkeit hatte sie es dahin gebracht, daß die Welt ihr Verhältnis zum Baron Andlau stillschweigend wie ein gesetzliches anerkannte und, um sich gleichsam für diese Nachsicht zu entschuldigen, eine heimliche Ehe voraussetzte.
Faustine und ihre Schwester Adele, als Kinder schon verwaist und ganz arm, wurden von einer Schwester ihres verstorbenen Vaters erzogen, das heißt diese bezahlte die Pension beider Mädchen für ihre Erziehung in einer großen Kostschule und bekümmerte sich nicht eher um sie, als bis sie erwachsen waren. Dann nahm sie die Geschwister in ihr Haus und hatte keinen sehnlicheren Wunsch, als sie sobald wie möglich zu verheiraten, nicht aus Mitleid für die hilflose Lage der Mädchen, sondern weil sie selbst noch sehr gern Huldigungen entgegennahm und ihrer vierzigjährigen Schönheit nicht mehr die Kraft zutraute, siegreich neben siebzehnjähriger zu bestehen. Zwei junge Männer, die öfters ihr Haus besuchten, schienen ihr so wünschenswerte Neffen, daß sie beschloß, sie müßten es werden. Und sie wurden es. Graf Obernau, ein wilder brutaler Soldat, dem nichts über sein Pferd, seinen Schoppen Wein und seine Pfeife ging, war der eine; Maximilian von Walldorf, Gutsbesitzer, derb und vierschrötig, ohne Manieren, aber brav und ehrlich, war der andere; dieser von geringem, jener von bedeutendem Vermögen, was aber ziemlich auf eins herauskam, da Walldorf ein sehr guter Wirt, »ein äußerst solider Mensch« war, – wie die Tante zu Adele sagte – und Obernau ein Tollkopf und Verschwender »den Du zum schönen und nützlichen Gebrauch seines Vermögens anleiten wirst«, – wie sie zu Faustine sprach.
Adele, emsig und tätig, von Kindheit auf mit hausmütterlichen Neigungen, froh der Kostschule entronnen zu sein, dachte sich keine lieblichere Zukunft, als ein eigenes Haus zu haben, und darin vom Morgen bis in die Nacht wirtschaftliche Geschäfte zu treiben.
Sechs Wochen nach ihrer Bekanntschaft waren und blieben Walldorf und Adele ein glückliches Paar, glücklich auf ihre Weise; denn jeder hat seine eigene. Und zu ihnen wollte Faustine jetzt.
Andlau sagte:
»Wie seltsam, daß Dein unzeremoniöser Schwager solche steife, förmliche Briefe schreibt, die doch gar nicht in seiner Natur liegen.«
»Er hat so wenig Form, daß er gleich gezwungen wird, sobald er artig sein will; und was diesen Brief betrifft, so mag er ihn wohl aus einem uralten Briefsteller aus der Bibliothek von Oberwalldorf abgeschrieben haben, denn das Briefschreiben und Bücherlesen ist seine Sache nicht. Nur die Bücher studiert er mit wahrer Wonne, die er selbst schreibt und von denen er schon eine recht hübsche Sammlung besitzt.«
»Also schreibt er seine landwirtschaftlichen Beobachtungen nieder?«