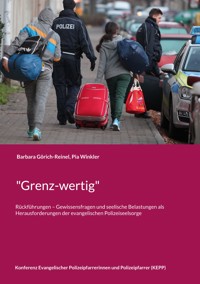
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Rückführungen bzw. Abschiebungen gehören immer wieder zu den besonders belastenden Tätigkeiten im Polizeiberuf. Die Arbeit mit Grenzgängern und Grenzgängerinnen führt in der Polizei selbst manchmal an Grenzen: zu unterschiedlichen Verantwortlichkeiten zwischen Kommunen, Ländern und Staaten, zwischen Staat und Kirche, zwischen Profession und Überzeugung. Eigene Werte und Wertvorstellungen werden dabei strapaziert. Im vorliegenden Band werden die seelischen und berufsethischen Fragestellungen und Konfliktfelder in diesem Bereich aus Sicht der Polizeiseelsorge dargestellt und diskutiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
1. Einführung: „Lagebild“ der Polizeiseelsorge vor Ort
1.1 Allgemeine Lage
1.2 Besondere Lage und der polizeiliche Auftrag
2. Grundlagen
2.1 Selbstverständnisse der KEPP in der seelsorglichen Begleitung
2.2 Traditionen von Asyl in Geschichte der Menschheit, Kirche und Recht
2.3 Rechtliche Einordung von Flucht und Asyl seit 1945
2.3.1 Internationale, europäische und nationale „Rechtstraditionen“ zum Asyl
2.3.2 Nationale einfachgesetzliche Regelungen im Kontext europäischer Einbindung
Exkurs: Schutzstatus
2.4 Selbstverständnis der KEPP in der berufsethischen Begleitung
2.4.1 Zum Verhältnis von Polizeiseelsorge und Berufsethik
2.4.2 Berufsethik lehren in kirchlicher Beauftragung
(a) Einübung in Pflichten gegenüber sich selbst auf unterschiedlichen Ebenen
(b) Verantwortlichkeit inmitten einer „Kette von Verantwortlichkeiten“
(c) Verantwortung im Angesicht des „Anderen“
2.5 Führungsethische Aspekte in seelsorglicher und berufsethischer Begleitung
3. Konkretionen
3.1 Verfahrensabläufe
3.2 Grundsätzliche Konfliktzonen
3.2.1 Individuelle moralische Bewertungen der Asylgesetzgebung von Polizeibediensteten
3.2.2 Nächste Konfliktzonen/-situationen an Schnittstellen von Entscheidenden und Vollziehenden
3.3 Priorisierung moralischer „Zu-Mutungen“ bei bestimmten Zielgruppen und die Folgen
3.3.1 Vorbemerkungen
3.3.2 Infragestellung einer grundsätzlich verpflichtenden Einsatzzuständigkeit
3.4 Infragestellung der Legitimität in der Wahl der eigenen polizeilichen Mittel
3.4.1 Infragestellung der Sinnhaftigkeit des eigenen Handelns beim konkreten Vorgehen
3.4.2 Infragestellung der Legitimität der Inkaufnahme einer Schädigung der menschlichen Grundbedürfnisse
3.4.3 Infragestellung der Legitimität in der Wahl der Mittel beim sog. polizeilichen Gegenüber
3.4.4 Infragestellung der Auswahl der „richtigen“ Adressatinnen und Adressaten
3.5 Priorisierung moralischer „Zu-Mutungen“ bei bestimmten Zielgruppen
3.5.1 Begegnung mit Tatverdächtigen, Straffälligen, mit Menschen nach verbüßter Haft sowie Gefährdern
3.5.2 Alleinlebende Frauen, Männer sowie Minderjährige und Heranwachsende und die ungeklärte Frage nach ihren Schicksalen im Heimatland
3.5.3 Segmentierung von Familien und unverheirateten Paaren
3.6 Sind wir die Guten? Anfragen an das eigene Handeln
3.7 Anfragen an die Legitimität polizeilichen Handelns durch medial hergestellte Öffentlichkeit
3.8 Konsequenzen für die in der Polizei tätigen Menschen
4. Orientierungen für ihres Amtes waltende Menschen in Staat und Kirchen
4.1 Optionen: Bleiben, fliehen oder sich abschotten?
4.2 „Damit klarkommen“ – (Über-)Leben in dunklen Welten und das Angebot der Polizeiseelsorge
5. Anfragen der Polizei an Polizeiseelsorgende als „Beauftragte von Kirche“ zur Durchführung von berufsethischen Veranstaltungen
5.1 Mitwirkung der Polizeiseelsorge bei der Vorbereitung von Beamtinnen und Beamten auf Abschiebungen
5.2 Eigene Standortbestimmung der Polizeiseelsorge
5.3 Haltungen der Kirchen zu Abschiebung
5.3.1 Abschiebungen von Kindern, Jugendlichen und bei jungen Volljährigen aus Kindergärten, Kindertageseinrichtungen (Kitas), Schulen, weiteren Einrichtungen der Bildung und der Jugendhilfe
5.3.2 Keine grundsätzliche Qualifizierung der Taufe von Geflüchteten als „asyltaktische Entscheidung“
5.3.3 Schutz vor Abschiebungen aus Krankenhäusern
5.3.4 Abschiebungen nach Afghanistan
5.3.5 Die Verbringung von Ausreisepflichtigen in Abschiebehafteinrichtungen
6. „Warum mischt sich Kirche in staatliches Handeln ein?“ Anfragen der Polizei an kirchliches Handeln – Annäherung durch kirchliche Entgegnungen
6.1 Pflichten und Zumutungen als Grenzmarkierungen
6.2 Spezialfall: Abschiebung aus dem Kirchenasyl
6.2.1 Die Position der Kirchen zum Kirchenasyl
6.2.2 Das Kirchenasyl in neuerer Zeit
6.2.3 Fallzahlen, Fakten und Wirkungen von Kirchenasyl
6.3 Theologische Herleitungen und Begründungen für das Kirchenasyl
6.4 Wirkung des öffentlichen Diskurses zwischen Kirchen und Staat
6.5 Juristische Bewertungen des Kirchenasyls
6.6 Bedeutung der Logiken von Staat und Kirche für Polizeiseelsorgende
7. Fazit und Ausblick
8. Zum Geleit – Gedicht für grenzenlose Zeiten (eschatologischer Ausblick)
Interview
Glossar
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Vorwort
„Grenz-wertig. Rückführungen – Gewissensfragen und seelische Belastungen als Herausforderungen der evangelischen Polizeiseelsorge“ ist eine Handreichung der für die Länderpolizeien zuständigen evangelischen Polizeiseelsorge. Sie dient dem eigenen Selbstverständnis der Polizeiseelsorgerinnen und -seelsorger, aber insbesondere auch der Orientierung für Polizistinnen und Polizisten, die – womöglich als Christinnen und Christen – im Rahmen von Rückführungen1 eingesetzt werden. Wir Autorinnen verwenden im Folgenden auch den im deutschen Recht im Gegenüber zum europäischen Recht benutzten Begriff „Abschiebung“2, der in seiner negativen Konnotation unseres Erachtens der bisherigen deutschen Ausländer- bzw. „Integrations“politik eher entspricht.
Christinnen und Christen sowie Kolleginnen und Kollegen im Pfarramt auf Ebene der Gemeinden, Kirchenkreise oder der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), die sich in vielfältiger Weise für Flüchtlinge und ihre Rettung engagieren, tun dies aufgrund ihres christlichen Menschenbildes, ihres theologisch-ekklesiologischen Selbstverständnisses wie etwa im Sinn eines migrantischen Gottesvolkes3. Sie akzentuieren ihr Engagement vor dem biblischen Hintergrund einer spezifischen Befreiungsgeschichte samt Ge- und insbesondere Verboten (z. B. „Den Fremdling sollst du nicht bedrücken, denn du warst selbst Fremdling in Ägyptenland …“, Ex. 22,20). Auf all diesen Ebenen begegnen diese Christinnen und Christen mitunter Polizeibeamtinnen und -beamten, die mit unterschiedlichen religiösen Orientierungen unterwegs und mit hoheitlichen Aufgaben betraut sind. Z. T. sind es Christinnen und Christen, die sich als Kirchenmitglieder, Gottesdienstbesucherinnen und –besucher, als in Presbyterium und/oder Synode engagierte Menschen einbringen. Sie alle, mit ihren religiösen oder areligiösen Glaubensüberzeugungen, haben sich beruflich im Rahmen eines Eides verpflichtet: „Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. (So wahr mir Gott helfe.)“4 Der Ausübung von Gerechtigkeit verpflichtet, sind sie eingebunden zwischen einer an ihrem Gewissen orientierten Pflichterfüllung und ihrer Bindung an Recht und Gesetz.
Die vor Ort im Rahmen von Rückführungen eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten wie ihre Vorgesetzten haben als Teil der staatlichen Exekutive unseres Erachtens einen Anspruch darauf, von ihrer Kirche in ihrem Tun wahrgenommen, ja in ihrem beruflichen Handeln begleitet zu werden. Das ergibt sich aus den biblischen Grundlagen über den Staat sowie aus den Evangelischen Bekenntnisschriften über die „gute Ordnung“ unserer staatlichen Gemeinschaft. Unter den Bedingungen einer noch sehr unerlösten Schöpfung sind die Polizeibeamtinnen und -beamten von uns allen beauftragt, stellvertretend für die Zivilgesellschaft zu handeln. Doch das gilt aus Sicht der Bekenntnisschriften nur so lange wie „der Obrigkeit Gebot ohne Sünde nicht befolgt werden kann“, wo dies nicht möglich sei, müsse „man Gott mehr gehorchen als den Menschen.“5
Im Umfeld dieses Handelns agiert die evangelische Polizeiseelsorge in den Bundesländern in ökumenischer Verbundenheit mit den katholischen Schwestern und Brüdern, im Austausch mit ihren Kolleginnen und Kollegen der Bundespolizei. Landes- wie Bundespolizei, womöglich in Begleitung der Polizeiseelsorge, haben im Extremfall den Auftrag, den zuvor ggf. mit kirchlicher Unterstützung Geretteten und den für ihr Bleiben sich engagierenden Christinnen und Christen – etwa im Rahmen eines Kirchenasyls – entgegenzutreten und die Geflüchteten wieder zurückzuführen in ein Land, das diese nicht ohne Grund verlassen haben.
Polizeiseelsorge versteht sich als „qualifiziertes Handeln an der Schnittstelle von Kirche und Staat“6. Insofern sollen in dem vorliegenden Beitrag vor dem Hintergrund spezifischer Kompetenzen der Polizeiseelsorge Antworten gefunden werden gegenüber beiden – gegenüber der Kirche (auch mit ihren sehr unterschiedlichen Funktionspfarrämtern wie dem Pfarramt für Ausländer- und Flüchtlingsarbeit und sehr unterschiedlichen Gruppierungen) und gegenüber dem Staat. So mag diese Handreichung eine Hilfe sein, miteinander im Gespräch zu bleiben, Logiken und Argumente für gutes Handeln und Begleitung auf beiden Seiten auszutauschen und den Diskurs voranzutreiben im Wissen um den eigenen Kompass, den es auszubilden und – sofern erforderlich – neu zu justieren gilt.
Diese Handreichung folgt dem Duktus des Symposiums der Konferenz Evangelischer Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer (im Folgenden KEPP7) „‚… unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden sorgen‘ (Barmen V)“8 im Jahre 2014. Die dort formulierten vier Thesen für polizeiliches Handeln haben nichts von ihrer Gültigkeit verloren:
Polizeiliche Gewaltanwendung
geschieht im gesellschaftlichen Auftrag,
in Form legaler und legitimer Gewaltanwendung (d. h., die Polizei ist sich der Ambivalenz staatlicher Gewalt als moralisches Gut und gleichzeitigem Übel bewusst und weiß um die Legitimations- und Rechtfertigungsbedürftigkeit ihres Agierens),
mit der möglichen/tatsächlichen Folge der Deformation von Leben bei allen Beteiligten sowie
der Aufgabe ihrer fortschreitenden Humanisierung.
D. h., sie hat für eine Perspektive der innerlichen und äußerlichen Begrenzung der Gewaltanwendung zu sorgen für alle einzelnen, aber auch für sich selbst als gewaltausübende Organisation, für den Staat und nicht zuletzt für uns als Gesellschaft.
Wie kann Polizeiseelsorge im Kontext von Rückführungen diese Perspektive fortschreitender Humanisierung aufseiten aller Beteiligter einbringen?
Ausgangspunkt dieser Veröffentlichung ist die Frühjahrstagung der KEPP „Grenz-Wertig“ in Ainring (Bayern) 2019 mit dem damaligen Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm (zugleich damaliger EKD-Ratsvorsitzender) und dem Innenminister Joachim Herrmann (zugleich MdL) sowie Expertinnen und Experten der Landes- und Bundespolizei und den Herausforderungen, die sich im Rückblick auf die Ereignisse in dieser Grenzregion im Sommer 2015 ergeben haben und bis heute nachwirken.
Wir haben damals gefragt: Welche Sichtweisen haben Polizeibeamtinnen und -beamte in Führungspositionen auf Grenzen und wie verändern Grenzen Menschen? Ihre Schilderungen haben uns als Autorinnen nicht mehr losgelassen. Wir haben uns gefragt: Welche Antworten haben, oder bescheidener formuliert, welche Hilfestellung – welcher Art auch immer – geben wir als Polizeiseelsorge in führungsethischer Perspektive und in der seelsorglichen Begleitung von Führungskräften? Über die Begleitung von Führungskräften hinaus legen wir nun unsere Recherche und Expertise vor mit Blick auch auf die Menschen der ausführenden Ebene. Wir verstehen unsere Ergebnisse als einen Beitrag zu Fragen der Legitimität von polizeilichem Handeln im Kontext staatlichen Rechts der Abschiebung9 und damit zusammenhängenden Herausforderungen für die Seelsorge.
Unser Dank gilt der KEPP für die Beauftragung und Unterstützung. Er gilt aber insbesondere allen Polizistinnen und Polizisten – seien sie explizit christlich geprägt oder religiös ungebunden, die uns unterstützt haben. Nicht unerwähnt lassen wollen wir hier die vielen Mitarbeitenden der Kommunen, insbesondere der Ausländerbehörden, ohne die es die Handreichung in dieser Form nicht gegeben hätte. Unser Dank gilt v. a. Werner Schiewek für Beratung und redaktionelle Unterstützung und Frau Lydia Elisabeth Katzenberger, deren Examensarbeit zum 1. Theologischen Examen der Ev. Kirche im Rheinland zum Thema „Kirchenasyl: Eine Praktisch-Theologische Analyse in Diskursethischer Perspektive“10 wir sehr wertvolle Impulse verdanken. Wir freuen uns insbesondere über das Interview eines erfahrenen Beamten im Anschluss an unsere Ausführungen (vgl. S. 147 ff.). Für die Genehmigung danken wir dem Landespolizeipräsidium im Hessischen Ministerium des Innern und für Sport.
Aufmerksamen Leserinnen und Lesern wird auffallen, dass die Textpassagen dieser Arbeit unterschiedliche Sprachstile aufweisen. Bewusst haben wir die Textpassagen als Autorinnen sprachlich nicht geglättet, sondern zu erhalten versucht. Dennoch wird die gesamte Handreichung von beiden Unterzeichnerinnen mitgetragen und verantwortet.
So hoffen wir, dass unsere Arbeit allen Interessierten einen guten Dienst erweisen wird, und sind gespannt auf nachfolgende Veröffentlichungen und Weiterentwicklungen des Themas.
Barbara Görich-Reinel & Pia Winkler11
Darmstadt und Bielefeld, April 2023
1 Vgl. Glossar „Rückführung“.
2 Vgl. Glossar „Abschiebung“.
3 Vgl. Kap. 2.5.
4 § 38 Landesbeamtengesetz NRW, vergleichbar mit LBG anderer Bundesländer, allerdings wird nicht in allen von ihnen die „Gerechtigkeit“ explizit genannt.
5 Confessio Augustana [1530], in: Evangelisches Gesangbuch Bekenntnisschriften, Gütersloh, Bielefeld, Neuenkirchen-Vluyn 1996, S. 1363-1376 [1370], hier Art. 16.
6 Kurt Grützner, Polizeiseelsorge und ihr Selbstverständnis, in: Grützner, Kurt/Gröger, Wolfgang/Kiehn, Claudia/Schiewek, Werner (Hg.), Handbuch Polizeiseelsorge, 2. Auflage, Göttingen/Bristol 2012, S. 39-49 [39].
7 Die Konferenz Evangelischer Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer (KEPP) ist ein kollegialer Zusammenschluss von 20 landeskirchlichen Diensten, die als Polizeiseelsorge neben der berufsethischen Orientierung zur „Sorge um die Seelen der Polizeibeamtinnen und –beamten“ im engeren Sinne beauftragt sind. Die Polizeiseelsorge, verantwortet von den einzelnen Landeskirchen, ist somit ein funktionaler Dienst der einzelnen Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und wird gemäß beruflichem Selbstverständnis herkömmlich verstanden und gelebt im Sinne zugewandter, aber zugleich kritischer Solidarität der Kirchen gegenüber der Polizei. Unseres Erachtens gilt die kritische Solidarität wechselseitig, denn nicht nur die Polizei sondern auch die Kirche und ihre Polizeiseelsorgerinnen und -seelsorger bedürfen des solidarisch-kritischen Blicks ihres jeweiligen Gegenübers, ohne ihre je spezifischen Aufgaben aus dem Blick zu verlieren.
8 Konferenz Evangelischer Polizeipfarrerinnen und Polizeipfarrer (KEPP), Thesen der Konferenz Evangelischer Polizeipfarrerinnen und Pfarrer (KEPP) „‚ … unter Androhung und Ausübung von Gewalt für Recht und Frieden sorgen‘ (Barmen V). Reformation – Politik – Polizei. Symposium des Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und EU in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Polizeiseelsorge in Deutschland. Berlin, 11. März 2014“, in: epd-Dokumentation Nr. 16, Frankfurt/M. 2014, S. 21-25.
9 Vgl. Glossar „Abschiebung“.
10 Lydia Elisabeth Katzenberger, Kirchenasyl: Eine Praktisch-Theologische Analyse in Diskursethischer Perspektive, in Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl e.V. 2021 unter: https://www.kirchenasyl.de/wp-content/uploads/2021/10/Katzenberger_Examensarbeit_BAG.pdf (letzter Aufruf am 26.10.2021).
11 Barbara Görich-Reinel ist Leitende Polizeipfarrerin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und Hochschuldozentin für Berufsethik an der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HöMS), Campus Mühlheim. Pia Winkler ist Landespolizeipfarrerin der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) und Dozentin für Berufsethik an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW (HSPV NRW), Abteilung Bielefeld.
1 Einführung: „Lagebild“ der Polizeiseelsorge vor Ort
Bei Übernahme eines Amtes innerhalb der Polizeiseelsorge im engeren Sinne oder im weiteren Verlauf des Dienstes im Bereich der Berufsethik ist es zunächst einmal hilfreich, die im eigenen Zuständigkeitsgebiet agierenden Beamtinnen und Beamten durch Begleitungen und Gespräche in ihrem spezifischen Handeln zu sehen und in aller Komplexität wahrzunehmen, bevor eine ethische Bewertung abgegeben („mit Herz und Verstand“), ein moralisches Urteil gefällt oder ggf. gar Optionen von Handlungsalternativen auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen in den Blick genommen werden.
Im Grunde wäre bei diesem Thema eine eigene „Landkarte“ zu erstellen, da sich mit Übernahme des kirchlichen Amtes zumindest eine sachliche und örtliche Zuständigkeit ergibt. Zu fragen wäre also: Welche Orte und Bediensteten der Polizei sind im vorliegenden Zusammenhang in den Blick zu nehmen – ob nun in originärer Zuständigkeit für Rückführungen oder bei ihrer Mitwirkung im Rahmen von Vollzugshilfe. Womöglich liegt im eigenen Zuständigkeitsgebiet sogar eine Abschiebehaftanstalt, in der mitunter auch Kräfte der Polizei zur Unterstützung eingesetzt werden, mindestens eingesetzt wurden (s. u.), oder im Rahmen des Wach- und Wechseldienstes tätig sind und eingesetzt werden, wenn Menschen dorthin zu transportieren bzw. von dort abzuholen sind.
Diese „Landkarte“ zu erstellen ist mit allem, was sich daran anknüpft, alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Über die Komplexität der Materie und bei aller grundsätzlichen Legitimität eines Staates auf Schutz und Sicherheit seiner Grenzen hinaus scheint es, als würde man mitunter wie in eine Art „Darknet“ eintauchen, mit allen möglichen (In-)Fragestellungen rechtlicher wie ethisch-moralischer Natur, die sich nicht nur für die eingesetzten Bediensteten der Polizei ergeben können, sondern ebenso auch für die sie im kirchlichen Auftrag begleitenden Menschen.
Der Titel „Grenz-wertig“ bezieht sich insofern auch auf die Frage an die eigene innere Belastungsgrenze und die durch solche Begleitungen entstehenden Zumutungen moralischer Zweideutigkeit.
1.1 Allgemeine Lage
Die Wahrnehmungen der Verfasserinnen beziehen sich auf einen Zeitraum von 2015 bis 2021. Hintergründe sind neben den rechtlichen Veränderungen zur Asylgesetzgebung seit 1993, dem sog. Dublin-Abkommen mit der Drittstaatenregelung12 und dem Migrationspaket 2019, eine stetig veränderte Gesetzeslage mit unterschiedlichen Regelungen in einzelnen Staaten und Bundesländern.
Der gesellschaftliche Diskurs in der Spannung zwischen dem allgemein zivilreligiös, christlich und/oder humanitär geforderten Schutz für Bedürftige im Sinne einer Haltung einladender Gastfreundschaft und dem legitimen Recht auf Wahrung der eigenen Landesgrenzen für eine Migrationsgesellschaft ist längst nicht beendet. Multikulturalität wird nicht durchgehend als Gewinn, sondern durch den zunehmenden Rassismus und allen weiteren Formen „Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“ mit der rigiden Forderung nach geschlossen Grenzen in Teilen der Gesellschaft als Bedrohung von Sicherheit und Ordnung wahrgenommen. Auch wenn die Lage derzeit eher nicht eskaliert, ist sie doch „teuer erkauft“ bzw. z. B. aktuell mit der Türkei immer wieder auszuhandeln. Ob ein solcher „Deal“ hält und unter welchen Bedingungen, ist alles andere als sicher, zumal die Klimaveränderungen neben den wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen bewirken, dass Wanderungsbewegungen eher zu- als abnehmen – mit allen Folgen für alle Beteiligten.
Die seit 2019/2020 grassierende Corona-Pandemie führte dazu, dass Abschiebungen vorübergehend ausgesetzt wurden, was weitere innenpolitische Debatten nach sich zog. Zudem haben sich manche bereits bestehenden internationalen Konflikte weiter verschärft, wie z. B. die Ereignisse in Afghanistan seit dem Abzug der US-amerikanischen Truppen im Spätsommer 2021 und der Herrschaft der Taliban gezeigt haben. Der Umgang mit abzuschiebenden Straftätern und Gefährdern ist zudem in die parteipolitische Diskussion und ihre Wahlprogramme gerückt. Korrespondierend dazu wurde die Sicherheitslage in der Bundesrepublik vorübergehend als akut gefährdet eingestuft.
Die lange Diskussion um ein Aussetzen der Abschiebungen aus innen- und außenpolitischen Gründen zeugt von der gesellschaftlichen Uneinigkeit über diese Art staatlichen Handelns.
Mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine seit Februar 2022 ist wieder eine große Anzahl an Geflüchteten, insbesondere Mütter mit ihren Kindern und ältere Menschen, auch in Deutschland angekommen. Die (il-)legitime Diskussion über kulturelle und religiöse Unterschiede ab 2015 geflüchteter Menschen im Vergleich zu aktuell Geflüchteten in der Bewertung der Aufnahmegesellschaft wurde von uns bewusst nicht aufgenommen. Dies wäre zu gegebener Zeit berufsethisch zu reflektieren und eine ganz eigene Veröffentlichung wert, sofern die Polizei (und damit die Polizeiseelsorge) in diese Prozesse in besonderer Weise involviert werden sollte.
In dieser Veröffentlichung geht es zunächst um eine Annäherung an ein Verständnis der Ereignisse der Jahre zuvor und um die Herausforderungen in der Begleitung durch die Polizeiseelsorge, um eigenes Handeln zu reflektieren oder/und Anregungen für zukünftige Herausforderungen zu entdekken.
1.2 Besondere Lage und der polizeiliche Auftrag
Um zu verstehen, was Polizeiseelsorgende bei Begleitungen von Beamtinnen und Beamten etwa des Wach- und Wechseldienstes (im Folgenden WWD), von Hundertschaften der Bereitschaftspolizei (im Folgenden BePo und nicht wie in manchem Landespolizeien BP aufgrund möglicher Verwechselung mit der Abkürzung der Bundespolizei) oder der Technischen Einsatzeinheiten (im Folgenden TEE) erleben, ggf. vereinzelt im Kontakt mit Spezialeinheiten, ist es zunächst hilfreich, sich über staatliche Zuständigkeiten und Abläufe bei Rückführungen im Allgemeinen und über spezifische Regelungen im eigenen Bundesland im Besonderen zu informieren – samt aller daraus resultierenden Folgen für die Verantwortlichkeit der dort eingesetzten Menschen.
Grundsätzlich gilt: Je nachdem, von wo aus in Deutschland und wohin jemand ausreisen soll, ergeben sich unterschiedliche Zuständigkeiten und Arten der Ausreisemodalitäten.13
Es gibt Bundesländer wie etwa Nordrhein-Westfalen (im Folgenden NRW), wo nicht die Polizei, sondern die Kommune originär für Rückführungen bzw. Abschiebungen ausreisepflichtiger Menschen zuständig ist.14 Die Polizei wird hier auf Anforderung mit der Bitte um Amtshilfe (sog. Amtshilfeersuchen) im Rahmen der Vollzugshilfe15 tätig, sofern Widerstand prognostiziert wird und daher Unterstützung durch polizeiliche Kräfte samt ihrer Befugnisse zur Ausübung unmittelbaren Zwangs erforderlich scheint. Die Ausländerbehörden selbst verfügen mitunter selbst nicht immer über das dafür erforderliche Personal, insbesondere wenn es sich um eine größere Gruppe von ausreisepflichtigen Menschen handelt und die Durchsetzung der Maßnahme alternativlos erscheint. Entsprechende Anträge der Ausländerbehörden sind bei den zuständigen Kreispolizeibehörden zu stellen und die prognostizierte Gefahr ist zu konkretisieren.
Über die Art und Weise der Zusammenarbeit gibt es in den einzelnen Bundesländern jedoch nicht nur verschiedene Vorstellungen und gegenseitige Erwartungen, sondern auch eine sehr unterschiedliche Praxis.
Während in NRW eher „zurückhaltend“ beim polizeilichen Einsatz von Personal agiert wird und auf das erforderliche Maß hingewiesen wird mit Hinweis auf originäre Zuständigkeit der Ausländerbehörden, agiert Hessen mit sehr viel mehr polizeilichem Einsatz. In NRW wird die Bereitschaftspolizei in diesen Lagen selten eingesetzt und nur bei größeren Menschenmengen und erwartetem Widerstand – etwa bei Abschiebungen aus Unterbringungseinrichtungen oder zur vorübergehenden personellen Verstärkung in der Vergangenheit in einer der größten Abschiebehaftanstalten Europas in Büren in NRW.16
Die Zentralen Ausländerbehörden (im Folgenden ZAB) sind zunächst zuständig für die Unterbringung und Versorgung von Asylsuchenden in den Erstaufnahmeeinrichtungen (im Folgenden EAE) des Landes. Die dort registrierten Personen werden erst zu einem späteren Zeitpunkt unter gewissen Voraussetzungen im Rahmen eines Zuweisungsverfahrens einer Kommune zugeordnet.
Nur für Asylsuchende, die einer Stadt zugewiesen werden, ist die Kommunale Ausländerbehörde zuständig. Neben den Flüchtlingen werden hier auch alle anderen Ausländerinnen und Ausländer betreut. In den EAEs werden sie medizinisch auf schwere Erkrankungen hin untersucht. Zudem werden grundlegende Daten zur Person für die Zentralen Ausländerbehörden erfasst. Weiterhin stellen die Geflüchteten aus der EAE heraus ihren Asylantrag beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.





























