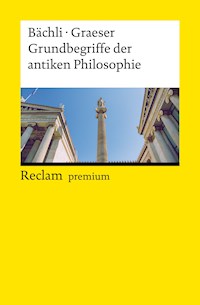
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
In diesem Nachschlagewerk erklären Andreas Bächli und Andreas Graeser die wesentlichen Begriffe der antiken Philosophie: In 48 Artikeln – von A wie ›Akademiker‹ und ›Atomismus‹ über ›Epikureismus‹, ›Idee‹, ›Kosmos‹, ›Seele‹, ›Stoa‹ und ›Wahrheit‹ bis hin zu Z wie ›Zeit‹ und ›Ziel‹ – stellen sie zum einen die bedeutenden Philosophenschulen der Antike vor, zum anderen erörtern sie anhand wichtiger Quellentexte zentrale philosophische Konzepte der Zeit. Eine besondere Rolle spielt dabei die jeweilige Bedeutung des Begriffes für die heutige philosophische Diskussion. E-Book mit Seitenzählung der gedruckten Ausgabe: Buch und E-Book können parallel benutzt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Andreas Bächli / Andreas Graeser
Grundbegriffe der antiken Philosophie
Ein Lexikon
Reclam
2021 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2021
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-961851-7
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014049-9
www.reclam.de
Inhalt
Vorwort
Lexikon
Akademie, Akademiker
Allgemeines
Atomismus
Bedeutung
Beweis
Definition
Dialektik
Eigenschaft(en)
Eleatik, Eleaten
Element
Epikureismus
Epoché
Erscheinung
Evidenz
Ewigkeit
Form
Geist
Glück
Gut
Handlung
Idee
Individuum
Kategorie
Kosmos
Kunst
Materie
Meinung
Nachahmung
Natur
Neuplatonismus
Peripatos
Platonismus
Pyrrhonismus
Qualität
Relativität
Schönheit
Seele
Sein
Skepsis
Stoa
Subjekt
Substanz
Tugend
Wahrheit
Wahrnehmung
Wissen(schaft)
Zeit
Ziel
Literaturhinweise
Zu den Autoren
[5]Vorwort
Die hier vorliegenden Erörterungen wesentlicher Grundbegriffe der antiken Philosophie verfolgen ein doppeltes Anliegen: Sie sollen wichtige philosophische Thematiken im Spiegel systematischer Interessen verfügbar machen; und sie sollen die Aufmerksamkeit z. T. auf andere Gesichtspunkte wie z. B. Evidenz, Bedeutung lenken helfen, die im Lichte der Gegenwartsdiskussion an Gewicht gewonnen haben. Beides legt eine gewisse Distanzierung zu anderen Lexika nahe, die im Zweifelsfall eher der traditionellen Kanonbildung folgen, Problematisierungen weitgehend vermeiden und weniger an den Bewegungen in der heutigen Diskussion teilnehmen. In diesem Sinne hoffen wir, eine Lücke schließen zu können. Dass dies wiederum nur punktuell geschehen kann, ist uns wohl bewusst.
Zwar haben wir sämtliche Belange gemeinsam diskutiert, unsere Beiträge sorgfältig aufeinander abgestimmt und die Einträge so betrachtet gemeinsam geschrieben. Doch wurde die Arbeit zum Hauptteil von Andreas Bächli geleistet, der seinerzeit ein entsprechendes Projekt durchführte, das vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt wurde.
A. B. und A. G.
[9]Lexikon
[11]Akademie, Akademiker
»Akademiker« hießen die Philosophen, die sich zur »Akademie«, der von PLATON begründeten Schule bekannten. Diese hatte ihren Namen von dem lokalen Heros Akademos erhalten und war die älteste Philosophenschule in Athen. Sie hatte bis in die Zeit der Spätantike Bestand und scheint erst 529 n. Chr. geschlossen worden zu sein. Dabei gilt die Bezeichnung »Akademiker« in erster Linie für jene Phase, die sich bis ins erste vorchristliche Jahrhundert verfolgen lässt. Die späteren Philosophen der Schule Platons verstanden sich selbst als Platoniker. Dieser Punkt ist insofern erheblich, als aus heutiger Sicht unklar scheint, ob die Akademiker anders als die Platoniker (s. Art. ›Platonismus‹) späterer Jahrhunderte in irgendeinem dogmatischen Sinne der Philosophie Platons anhingen; und diese Unklarheit wiederum hängt mit einer Frage zusammen, die schon gelegentlich in der Antike kontrovers diskutiert wurde, aber insbesondere im 20. Jahrhundert als kontrovers gilt. Dies ist die Frage, ob Platon überhaupt philosophische Thesen inhaltlicher Art vertrat und ob sich derartige Thesen in den Dialogen oder aber in Dokumenten über schulinterne Erörterungen ausmachen lassen. Hier zeichnet sich ein weites Spektrum möglicher Auffassungen ab. Die vielleicht am wenigsten problematische Meinung ist wohl die, dass Platon in der Tat eine Zwei-Welten-Theorie zur Diskussion stellte und in den schulinternen Diskussionen in Gestalt der Prinzipien-Spekulation weitere Dimensionen eröffnete, die in den Dialogen selber nur angedeutet werden.
Zu hellenistischer Zeit wurden bei der Beurteilung der Entwicklung der Platonischen Schule drei Epochen [12]unterschieden, die ›alte‹, die ›mittlere‹ und die ›neue Akademie‹. Die alte Akademie wird durch Platons Schüler und Nachfolger repräsentiert. Hier ragen SPEUSIPP, Platons Neffe und erster Nachfolger in der Schulleitung, und XENOKRATES heraus. Beide lassen sich nicht ohne weiteres als ›treue‹ Advokaten der Meinungen Platons charakterisieren. Zumindest Speusipp scheint sogar die Ideenlehre (s. Art. ›Idee‹) selbst als unhaltbar bzw. als verzichtbare Konstruktion angesehen zu haben. Die nächste Generation von Platon-Schülern scheint sich eher moralphilosophischen Fragen zugewandt und spekulative Probleme nicht berührt zu haben.
(1) Begründer der sogenannten mittleren Akademie, welche die skeptische Phase der Platonischen Akademie einleitete (s. Art. ›Skepsis‹), war ARKESILAOS VON PITANE (316–241 v. Chr.). Arkesilaos hat nichts geschrieben, scheint aber ein mitreißender Redner gewesen zu sein. Aufgrund der Berichte Ciceros (Lucullus) und des Sextus Empiricus (Gegen die Mathematiker VII 150–158) wird sein Standpunkt, den er gegenüber ZENON VON KITION (s. Art. ›Stoa‹), dem Begründer der Stoa, in der Frage des Kriteriums der Wahrheit vertreten hat, einigermaßen fassbar. Zenon hatte die ›erkenntnishafte Erscheinung‹, die er als Wahrheitskriterium ansah, offenbar zunächst so definiert: Eine solche Erscheinung sei eingeprägt und abgebildet von dem her, was ist, so wie es ist. Arkesilaos scheint nun Zenon zu einer Erweiterung der Definition veranlasst zu haben, die ausschließe, dass die betreffende Erscheinung falsch sei; die Definition in der später offenbar gebräuchlichen Form hatte dann einen Zusatz, der besagt, dass die Erscheinung so beschaffen sein müsse, dass sie [13]nicht von etwas herstammen könne, was nicht ist, bzw. dass sie wahr sein müsse, und zwar solcherart, dass sie nicht falsch sein könne. Arkesilaos bestritt dann, dass eine Erscheinung diese Definition erfülle, da eine wahre Erscheinung nicht von solcher Art sei, dass sie nicht falsch sein könne, woraus die These von der Unerkennbarkeit der Dinge resultierte. Unklar ist dabei, aus welchen Erwägungen Arkesilaos auf eine Erweiterung der Definition drängte oder warum Zenon sie in seinem Sinn erweiterte. Denn die Stoiker haben auch von Erscheinungen gesprochen, die unklar und indistinkt sind, wie sie z. B. Betrunkene haben können; solche Erscheinungen sind zwar wahr oder falsch, aber nicht erkenntnishaft, und Zenon war vermutlich der Meinung, seine ursprüngliche Definition bringe das Erfordernis der Klarheit und Distinktheit schon zum Ausdruck. Arkesilaos dagegen könnte von der Überlegung geleitet gewesen sein, dass Zenons ursprüngliche Formulierung nur als Definition einer wahren Erscheinung bestimmt genug sei, dass aber zur Bestimmung einer erkenntnishaften Erscheinung, welche die Wahrheit einer Erscheinung garantieren soll, noch der erwähnte Zusatz erforderlich sei. Und seiner Meinung nach gibt es eben keine derartige Garantie.
Arkesilaos ging es offenbar darum, unbegründete Wissensansprüche anderer – oder was er dafür hielt – als solche zu entlarven. Dazu würde passen, dass Arkesilaos in seinen Argumentationen von stoischen Voraussetzungen ausging, um dann ihre Unhaltbarkeit aufzuzeigen. So ging er z. B. von der stoischen Auffassung aus, dass der Weise niemals bloße Meinungen hat (s. Art. ›Meinung‹), und argumentierte, dass, da es keine erkenntnishaften, d. h. zustimmungsfähigen Erscheinungen gebe, der Weise, wenn er [14]seine Zustimmung gebe, eine bloße Meinung habe. Arkesilaos zog daraus die Konsequenz, dass der Weise gemäß stoischer Auffassung verpflichtet sei, sein Urteil stets zurückzuhalten (s. Art. ›Epoché‹). So gesehen stand Arkesilaos wohl in der Tradition der sokratischen Aporetik, und ein Gerücht besagt, dass er auf diese Weise die Leute nur auf ihre Eignung zur Aufnahme der Lehren Platons testen wollte.
Arkesilaos hat offenbar Begriffe der Stoiker auch als bloße Worthülsen verwendet. So zeigte er, wie auch derjenige, der in allen Dingen sein Urteil zurückhält, trotzdem handeln und das Ziel des Lebens, die Glückseligkeit (s. Art. ›Glück‹), erlangen könne, nämlich indem er sich an dem orientiere, was vernünftig (eúlogon) sei. Für ›Handeln‹ verwendete er dabei zwar den Begriff der ›tugendhaften Handlung‹ (katórthōma), aber die Definition einer Handlung (kathēkon), die zwar einer tugendhaften Handlung gleicht, aber nicht aus der tugendhaften Einstellung heraus vollzogen wird. Vielleicht lässt sich darin Arkesilaos’ Geringschätzung der hohen Ansprüche der stoischen Ethik erkennen.
(2) Angesehenster Vertreter der sogenannten neuen oder skeptischen Akademie, über dessen Philosophie wir nur indirekt informiert sind, war KARNEADES VON KYRENE (214–129 v. Chr.) (vgl. Cicero, Lucullus; Sextus Empiricus, Gegen die Mathematiker VII 159–189). Er hat selbst nichts geschrieben, hat sich aber als großer Redner einen Namen gemacht. Die wohl berühmteste Rede hielt er 155 v. Chr. in Rom als Mitglied einer Gesandtschaft griechischer Philosophen, die die Interessen der Stadt Oropos vertreten sollten. Berichten zufolge (vgl. Cicero, De re publica[15]III) hielt er an zwei aufeinanderfolgenden Tagen je eine Rede für und eine gegen die Gerechtigkeit und gab damit auch eine Probe der skeptischen Kunst des Argumentierens nach beiden Seiten. Nachdem er am ersten Tag die Gerechtigkeit gelobt habe, soll er am zweiten Tag die Theorien besonders von Platon und Aristoteles über die Gerechtigkeit widerlegt haben. Karneades scheint argumentiert zu haben, dass diese Verteidiger der Gerechtigkeit nicht wüssten, was Gerechtigkeit sei: Indem sie in ihr diejenige Tugend sahen, die jedem das zuteilt, was ihm gebührt, hätten sie Gerechtigkeit so aufgefasst, dass sie zwar auf den Nutzen anderer ausgerichtet, nicht aber auf den eigenen bedacht sei. Den schwachen Punkt ihrer Theorien scheint er darin gesehen zu haben, dass sie den realen Gegebenheiten nicht Rechnung trügen, offenbar in dem Sinne, dass die Berücksichtigung der Ansprüche anderer im Widerspruch zur Wahrung eigener Interessen stehe und demzufolge Gerechtigkeit unvereinbar sei mit der Klugheit, die gebiete, dem eigenen Interesse Rechnung zu tragen. Seine Attacke galt demnach nicht dem Gedanken der Gerechtigkeit als solchem, sondern bestimmten Argumenten dafür bzw. Theorien darüber.
Auch seine Behandlung anderer Fragenkreise scheint zu zeigen, dass Karneades um den Nachweis bemüht war, dass seine dogmatischen Gegner nicht über einen zureichenden Begriff ihres Gegenstandes verfügten. So argumentierte er z. B., dass man dem Göttlichen weder körperliche noch unkörperliche Existenz zuschreiben dürfe, ohne in einen Widerspruch zum Begriff des Göttlichen zu geraten; denn körperliche Existenz impliziere Vergänglichkeit, unkörperliche Existenz aber Leblosigkeit und Inaktivität, beides aber [16]widerspreche dem Begriff des Göttlichen als eines lebendigen, unvergänglichen Wesens (vgl. Cicero, De natura deorum III 29–37). Gewissermaßen aufklärerische Züge hat seine Kritik der stoischen Lehre der Vorsehung, die besagt, dass der Kosmos von der Gottheit zum Wohl des Menschen eingerichtet worden sei; so führte er insbesondere den Gedanken ad absurdum, dass Naturprodukte und auch Tiere einzig für die Zwecke der Menschen da seien (vgl. Cicero, De natura deorum III 65–93).
Die Frage, ob Karneades gegebenenfalls auch eigene Auffassungen ins Spiel brachte, ist schwer zu beantworten. In manchen Punkten erweckt das Überlieferte jedoch den Eindruck, dass Karneades in Sachfragen anderer Meinung war als die Stoiker. So scheint er z. B. den stoischen Gedanken der kosmischen ›Sympathie‹ (s. Art. ›Stoa‹), d. h. des gleichsam organischen Zusammenhalts aller Teile des Kosmos, nicht abgelehnt zu haben, führte ihn aber nicht auf die Wirksamkeit des göttlichen Pneuma-Stroms zurück, sondern auf ›natürliche‹ Kräfte (Cicero, De natura deorum III 28). Eine solche Auffassung steht möglicherweise auch im Hintergrund seiner Kritik des stoischen Determinismus (vgl. Cicero, De fato). Während CHRYSIPP (um 280 – 206 v. Chr.) die Lehre vertrat, dass alles, was geschieht, als Folge einer festgefügten Kette von Ursachen geschieht, scheint Karneades die Ansicht verfochten zu haben, dass alle Ereignisse entweder auf die Natur oder den Zufall zurückzuführen seien. Er scheint nicht bestritten zu haben, dass alles, was geschieht, aufgrund von Ursachen geschehe, aber er rechnete auch mit »zufälligen Ursachen«: Was ›zufällig‹ geschieht, könnte sich ebenso gut auch nicht ereignet haben, d. h., das Eintreten eines bestimmten Ereignisses ist [17]nicht »von Ewigkeit her« festgelegt. Wenn es aber kontingente Ereignisse gibt, dann ist auch das Fundament der Weissagekunst zerstört, an der die meisten Stoiker festhielten.
Auf dem Gebiet der Erkenntnislehre (vgl. Sextus Empiricus, Gegen die Mathematiker VII 159 ff.) bestritt Karneades, dass das erkennende Subjekt in der Lage sei, sich seiner Erkenntnisse zu vergewissern, da nichts schlechthin als Kriterium der Wahrheit angesehen werden dürfe. Ebenso wie Arkesilaos vor ihm versuchte er dies in erster Linie am Beispiel des stoischen Kriteriums, der »erkenntnishaften Erscheinung«, zu zeigen (vgl. Cicero, Lucullus). Nach stoischer Lehre ist eine Erscheinung dann erkenntnishaft, wenn sie von einem zugrundeliegenden Gegenstand und gemäß diesem eingeprägt ist, so dass sie nicht von einem Gegenstand herrühren könnte, der nicht zugrunde liegt. Karneades scheint die ersten beiden Bedingungen als erfüllbar betrachtet zu haben, nicht jedoch die dritte, nach der eine erkenntnishafte Erscheinung nicht von einem Gegenstand herrühren könne, der nicht zugrunde liege. Mit einer Reihe von Argumenten wollte er nachweisen, dass es keine wahre Erscheinung gebe, zu der sich nicht eine von ihr ununterscheidbare falsche finden lasse. So versuchte er z. B. zu belegen, dass, wenn Evidenz ein Merkmal einer erkenntnishaften Erscheinung ist, es zu jeder wahren, evidenten Erscheinung eine falsche Erscheinung gibt, die gleich evident ist, insofern sie eine Person, die die Erscheinung hat, genauso wie eine wahre zum Handeln veranlassen kann. In diesem Zusammenhang scheint er auch die Meinung vertreten zu haben, dass Evidenz die Wahrheit einer Erscheinung nicht verbürge (s. Art. ›Evidenz‹).
[18](3) Eine wichtige Neuorientierung wurde von PHILON VON LARISSA (um 159/158 – 85/80 v. Chr.) vollzogen, der seit 110/109 Nachfolger des Kleitomachos als Vorsteher der Platonischen Akademie war und 88 v. Chr. im 1. Mithridatischen Krieg nach Rom flüchtete. Seine namhaftesten Schüler waren ANTIOCHOS VON ASKALON und CICERO, dessen Auffassung von Philosophie er maßgeblich bestimmte. Da keine Schriften von ihm erhalten sind, muss man seine Position rekonstruieren, vor allem auf der Grundlage von Ciceros Lucullus.
Grundlegend für Ciceros Position ist der Begriff des Wahrscheinlichen bzw. Wahrheitsähnlichen (verisimile), dessen Verwendung einen wichtigen Unterschied zum Skeptizismus des Karneades signalisiert und den Einfluss Philons zu verraten scheint. Seinem eigenen Bekunden nach verfolgen Ciceros Untersuchungen den Zweck, mit Hilfe eines Argumentierens nach beiden Seiten hin zu etwas zu gelangen, das entweder wahr sei oder doch der Wahrheit möglichst nahe komme. Im Vergleich zu Karneades’ Position, der gemäß man allenfalls zu etwas gelangen kann, was subjektiv plausibel (probabile, griech. pithanós) ist, erscheint die Auffassung Philons bezüglich der Erreichbarkeit der Wahrheit als die gemäßigtere. Dies erweist sich auch darin, dass Philon nur das stoische Wahrheitskriterium, die erkenntnishafte Erscheinung, verwarf, während Karneades’ Kritik offenbar viel weiter ging. Philon soll sogar gelehrt haben, dass die Dinge nur hinsichtlich des stoischen Kriteriums unerfassbar seien, hinsichtlich ihrer eigenen Natur jedoch erfassbar (vgl. Sextus Empiricus, Grundzüge der pyrrhonischen Skepsis I 235). Damit könnte er gemeint haben, dass die Natur der Dinge selbst die [19]Anwendung eines so strikten Kriteriums weder verlange noch gestatte. Wenn das stoische Kriterium gar nicht erst zur Anwendung kommen kann, weil eine wahre Erscheinung, als Erscheinung, von einer falschen nicht unterscheidbar ist – so die allgemeine These der akademischen Skeptiker –, dann – so könnte Philon in Abgrenzung zu anderen akademischen Skeptikern überlegt haben – lässt sich auch die These von der Unerfassbarkeit der Dinge generell nicht verfechten. Evidenz und Übereinstimmung der Wahrnehmungen scheinen ihm als zureichende Kriterien für die Erkenntnis der Dinge gegolten zu haben, auch wenn sie nicht gesicherte Erkenntnis verbürgen. Für diese Auffassung wurde er von seinem Schüler Antiochos von Askalon, der an der Unverzichtbarkeit des stoischen Kriteriums festhielt, vehement kritisiert.
In die von Philon vertretene Variante der Skepsis fügt sich gut auch seine auf dem Gebiet der Ethik vertretene Auffassung von der Aufgabe der Philosophie als Therapie der Seele. Diese Aufgabe sah er in der Hinführung zur Philosophie und im Nachweis der Nützlichkeit der Tugend, und damit insbesondere im Entfernen falscher und im Einpflanzen richtiger Meinungen. Mit dieser Position dürfte er auch Ciceros eigene Einstellung zum Problem des Status der Meinung (s. Art. ›Meinung‹) beeinflusst haben: Cicero verstand sich selbst als »großen Meiner«.
[20]Allgemeines
Das lateinische Wort universale, ein auch in der heutigen Philosophie gebräuchlicher Terminus, bedeutet ›allgemein‹ oder ›das Allgemeine‹ und wird als Gegensatz zu Ausdrücken wie ›Besonderes‹, ›Einzelnes‹ oder ›Individuelles‹ verwendet. Als Universalien wurden im Mittelalter die sog. Prädikabilien bezeichnet, nämlich die fünf Arten von Prädikaten, die PORPHYRIOS in seiner Einführung in die Kategorienschrift des ARISTOTELES im Anschluss an das erste Buch von dessen Topik unterschieden hatte. Danach fällt alles, was von einem Einzelding aussagbar ist, unter eine der fünf Arten; wird z. B. von einem Menschen ausgesagt, dass er ein Lebewesen ist, wird die ›Gattung‹ angegeben, während »Mensch« die ›Art‹ angibt, »rational« die ›spezifische Differenz‹, »der Grammatik fähig« etwas dem Menschen Eigentümliches (›Proprium‹), »rationales Lebewesen« die ›Definition‹ und »weiß« eine zufällige Eigenschaft (›Akzidens‹). Die genannte Schrift des Porphyrios stellt wohl die erste systematische Behandlung der Universalien dar, während Aristoteles’ Ausführungen eher unsystematisch sind.
Im 7. Kapitel seiner Lehre über den Satz unterscheidet Aristoteles zwischen »Dingen im Allgemeinen« (tà kathólou) und »Dingen im Einzelnen« (tà kathʼ hékaston). Mensch ist ein Gegenstand »im Allgemeinen«, da »Mensch« von vielen Dingen aussagbar ist, d. h. von allen Menschen; Kallias hingegen ist ein Gegenstand »im Einzelnen«, denn »Kallias« ist als Eigenname nicht von mehreren Dingen aussagbar. Aristoteles’ Auffassung des Allgemeinen als das, was von mehreren Dingen aussagbar ist, eröffnete einen [21]neuen Zugang zum sogenannten Universalienproblem. Dabei geht es um folgende Fragen: 1. Was sind Universalien? 2. Existieren Universalien in der Wirklichkeit? 3. In welcher Beziehung stehen die Universalien zu den Einzeldingen? Die Diskussion des Universalienproblems beginnt bei PLATON. Im Dialog Parmenides wird folgende Problemstellung entwickelt: Wenn Universalien – Platon spricht von »Formen« bzw. »Ideen« – nicht existieren, wird Denken und Sprechen über die Welt verunmöglicht. Die Annahme der Existenz von Universalien ist aber so lange ungerechtfertigt, als sich keine kohärente Theorie formulieren lässt, die die Beziehung der Universalien zu den Einzeldingen erklärt. Danach lassen sich zwei Problembereiche unterscheiden: (a) Im Bereich der Epistemologie oder Erkenntnistheorie führt die Feststellung, dass wir in unserem Sprechen und Denken über die Welt allgemeine Termini (»Mensch«, »rot«, »Farbe«) und allgemeine Begriffe (Gattung, Art) verwenden, zu der Frage, ob die Annahme der Existenz von Universalien zur Erklärung unserer Erkenntnis der Welt notwendig sei. Platon bejahte diese Frage. (b) Im Bereich der Ontologie geht es um den Status der Universalien im Verhältnis zu den Einzeldingen. Im Parmenides kritisiert Platon seine eigene Auffassung, wonach die Einzeldinge an den Ideen »teilhaben« (s. Art. ›Idee‹). Das bekannteste Argument, das dann in Aristoteles’ Kritik der Ideenlehre Platons unter dem Titel Der dritte Mensch eine wichtige Rolle spielte, ist folgendes: Wenn die einzelnen Menschen an der Idee des Menschen – dem ›Menschen selbst‹ – teilhaben sollen und sich sowohl von den einzelnen Menschen als auch von der Idee des Menschen ›Mensch‹ prädizieren lässt, dann muss es einen [22]dritten Menschen geben, an dem sowohl die Idee als auch die einzelnen Menschen teilhaben. Diese Theorie führt also zu einem unendlichen Regress, was den Gedanken der Teilhabe destruiert.
Die erwähnte Unterscheidung des Aristoteles zwischen Universalem und Einzelnem wirft, für sich genommen, die mit der Annahme der wirklichen Existenz der Universalien verbundenen Probleme nicht auf, da sie für das Universale nur verlangt, von mehreren Dingen prädizierbar zu sein. Platons Ideenansatz hingegen wird mit diesen Problemen konfrontiert. Im 10. Buch des Staates (596a) heißt es: »Wir pflegen doch von all dem vielen Einzelnen, das wir mit demselben Namen bezeichnen, jeweils eine bestimmte Form (eîdos) anzusetzen.« Platons Position wird gewöhnlich insofern als ›realistisch‹ bezeichnet, als der Ansatz einer Form des Menschen oder des Schönen bedeutet, dass diese Universalien in der Wirklichkeit existieren; d. h.: Die Formen sind in vollkommener Weise, jenseits von Raum und Zeit, jeweils das, was ihre raum-zeitlichen Exemplifikationen in unvollkommener Weise sind. Die Formen selbst sind nicht sinnlich wahrnehmbar, während die wahrnehmbaren Dinge, die z. B. mit Bezug auf die Form des Schönen schön genannt werden, nicht ›eingestaltig‹ schön sind, da sie in einer Hinsicht schön, in anderer Hinsicht wiederum nicht schön sind. Gegen diese ontologische »Trennung« (chōrismós) der Universalien von den Einzeldingen ist Aristoteles’ Kritik an der platonischen Ideenlehre zur Hauptsache gerichtet (vgl. z. B. Metaphysik XIII 4, 1078b); sie bedeutet seiner Ansicht nach eine Verdoppelung der Welt, die für deren Erkenntnis keinen Erklärungswert habe.
[23]Für Platon stand die Transzendenz der Formen fest, Aristoteles dagegen behauptete ihre Immanenz; die Annahme einer Form z. B. des Menschen, die getrennt von den einzelnen Menschen existierte, erschien ihm nicht haltbar. Der Unterschied der platonischen von der aristotelischen Position wurde später terminologisch dahingehend fixiert, dass für Platon die Universalien den Dingen vorausliegen (universalia ante res), während sie für Aristoteles in den Dingen sind (universalia in rebus). Die Betrachtung des ›Trennungs‹-Problems allein im Lichte der Antithese Transzendenz – Immanenz verdeckt jedoch den Umstand, dass der »Chorismos« bei der Bildung des Universalien-Begriffs eine entscheidende Rolle spielte. Platon gibt im ersten Teil seines Dialogs Parmenides einige Hinweise zur Genese dieses Begriffs, indem er die Annahme von Formen in den Zusammenhang einer Auseinandersetzung mit dem Monismus des PARMENIDES VON ELEA stellt. Er lässt ZENON, den Schüler des Parmenides, die These vertreten, dass sich aus der Annahme, das Seiende sei nicht Eines, sondern Vieles, die absurde Konsequenz ergäbe, dass »das Ähnliche unähnlich und das Unähnliche ähnlich« wäre. Der Begriff der Ähnlichkeit im Zusammenhang von Zenons These ist aufschlussreich. Denn einerseits gibt er einen Hinweis auf das, worauf sich die Meinung, das Seiende sei Vieles, stützt, nämlich auf die erfahrbaren Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten der Dinge. Andererseits beruht Platons Annahme jeweils einer Form offenbar darauf, dass die wahrnehmbaren Dinge jeweils in Hinsicht auf eine bestimmte Eigenschaft einander ähnlich sind. Platon behauptet nun, dass Dinge aufgrund ihrer Teilhabe an der Form der Ähnlichkeit ähnlich sind und entsprechend [24]unähnlich durch Teilhabe an der Form der Unähnlichkeit. Es liegt also keine Absurdität in der Auffassung, dass die Dinge sowohl ähnlich als auch unähnlich sind. Die Form der Ähnlichkeit hingegen, die nicht wahrnehmbar, sondern nur im Nachdenken (logismós) erfassbar ist, kann nicht »unähnlich werden«, ebenso wenig wie die anderen Formen etwas anderes werden können als das, was sie sind. Vielmehr werden die Formen im Nachdenken als »getrennt« (chōrís) und »für sich bestehend« (kathʼ hautḗn) erkannt. Diese Erkenntnis ist das Resultat einer logischen Operation des Denkens, der »Trennung« bzw. »Teilung« (dihaíresis).
Daraus, dass die Formen im Nachdenken als voneinander getrennt und für sich bestehend erfasst werden, ergibt sich, dass sie auch von den an ihnen teilhabenden Dingen ›getrennt‹ erfassbar sind, denn die Dinge sind nie in vollkommener Weise das, was sie genannt werden, sondern nur jeweils in bestimmter Hinsicht z. B. schön, in anderer Hinsicht hässlich. Diese Trennung der Formen oder Ideen von den Dingen erachtete Platon im Parmenides als das wichtigste Problem seiner Ideenlehre. Denn damit stellt sich die Frage, ob die für sich bestehenden Formen für uns überhaupt erkennbar sind. Auf der anderen Seite hält Platon daran fest, dass Erkenntnis nur möglich ist, wenn es für sich bestehende Formen gibt (s. Art. ›Wissen(schaft)‹). Dieser Gedanke wurde von Aristoteles verworfen. Im Dialog Parmenides spiegelt sich wohl schon die beginnende Kontroverse: Der von Platon selbst problematisierte Begriff der ›Teilhabe‹ wurde später von Aristoteles als bloße Metapher beiseitegelegt. Während Platon den für sich bestehenden Formen substantielles Sein (ousía) zuerkannte, [25]den an ihnen teilhabenden Dingen jedoch nur ein Sein in abgeleitetem Sinne zugestand, sah Aristoteles das Verhältnis gerade umgekehrt (s. Art. ›Individuum‹, ›Kategorie‹, ›Substanz‹). Substanzen sind nach der Kategorienschrift die individuellen Dinge, das »Zugrundeliegende«, von dem etwas ausgesagt wird, das den Status des Allgemeinen hat, insofern es von mehreren Dingen aussagbar ist. Aristoteles bezeichnete in dieser Schrift Individuen, z. B. einzelne Menschen, als »erste Substanzen«, die Universalien, d. h. Art (›Mensch‹) und Gattung (›Lebewesen‹) als »zweite Substanzen«. Später entfernte er sich noch weiter von Platon, indem er den Universalien substantielles Sein gänzlich absprach. So heißt es in Metaphysik VII 13, 1038b: »Es scheint nämlich unmöglich zu sein, dass irgendetwas von dem, was allgemein ausgesagt wird, Substanz (ousía) ist. Erstens nämlich ist die Substanz jedes Einzelnen etwas, das ihm eigentümlich ist und nicht auch einem anderen zukommt, das Allgemeine (tò kathólou) aber ist gemeinsam […].« Die Universalien haben deswegen kein substantielles Sein, weil aus dieser Annahme folgen würde, dass z. B. alle Menschen ihrer Substanz nach identisch wären, d. h. ein einziger Mensch. Nach Aristoteles ging also Platons Antwort auf den Monismus des Parmenides (s. Art. ›Eleatik‹ (1)) nicht weit genug, sondern verschob nur das Problem; denn die Ideenlehre kann Vielheit nur auf der Ebene der Universalien, nicht aber auf der Ebene der Einzeldinge, erklären. Wenn die Einzeldinge nur in einem abgeleiteten Sinne Sein haben, wenn vielmehr die Formen jeweils das wirklich sind, was die Einzeldinge nur durch Teilhabe sind, dann können sie auch nicht wirklich als Instanzen des Universalen betrachtet werden. Doch wenn die Dinge der [26]sinnlich erfahrbaren Welt nicht wirklich das sind, was von ihnen ausgesagt wird, dann gibt es auch kein Wissen von ihnen. Daher ist für Aristoteles nicht die Existenz von Formen oder Ideen notwendige Bedingung unseres Wissens von der Welt, sondern die Anwendbarkeit allgemeiner Termini, d. h. die Existenz individueller Dinge, die nicht die allgemeinen Formen bloß »nachahmen«, sondern wirklich über die Eigenschaften verfügen bzw. das wirklich sind, was wir in unseren Aussagen über sie behaupten.
Obwohl man Aristoteles’ Auffassung der Universalien klar von Platons ›realistischer‹ Position abgrenzen muss, weil er den Universalien substantielles Sein abspricht, kann man seine allgemeine Position bezüglich der Universalien-Frage dennoch als Form des Realismus bezeichnen. Denn die Gegenthese zum Realismus, der Nominalismus, bestreitet nicht nur, dass die Universalien in der Wirklichkeit existieren, sondern dass sie überhaupt in irgendeiner Form zur Struktur der (denkunabhängigen) Wirklichkeit gehören. Aristoteles aber bestreitet nur, dass Universalien getrennt von den Dingen, d. h. als Substanzen, existieren. Er bestreitet nicht, dass Universalien zur Struktur der erfahrbaren Wirklichkeit gehören. Denn wenn das Allgemeine nicht irgendwie ›in‹ den Dingen wäre, wäre Wahrnehmung und damit Erfahrung gar nicht möglich; so ist zwar das Wahrgenommene ein Einzelnes, z. B. ein bestimmter Mensch, aber die Wahrnehmung richtet sich auf das Allgemeine, ›den Menschen‹ (Zweite Analytiken II 19). Das Allgemeine ist für Aristoteles ebenso wie für Platon etwas, das zwar nicht ›gesehen‹ wird, aber die Wahrnehmung bestimmt und im Denken erfassbar wird. Es ist das allen Dingen derselben Art oder Gattung Gemeinsame, das es [27]rechtfertigt, sie mit demselben Namen zu benennen. Diese realistische Auffassung der Universalien wurde durch die Erwägung in Frage gestellt, dass die Klassifizierung der Dinge nicht im Hinblick auf ihre ›natürlichen‹ Arten und Gattungen erfolge, sondern ein Beitrag unseres Denkens sei. Dieser Gedanke, der später bei John Locke eine Rolle spielte, steht auch hinter der vom skeptischen Philosophen SEXTUS EMPIRICUS aufgeworfenen Frage, ob die Eigenschaft des Menschseins wirklich eine den Menschen gemeinsame Eigenschaft sei (Grundzüge der pyrrhonischen Skepsis II 227). In unserem Jahrhundert hat L. Wittgenstein bestritten, dass es eine notwendige Bedingung für die Klassenzugehörigkeit eines Gegenstandes sei, dass er mit allen anderen Gegenständen derselben Klasse eine gemeinsame Eigenschaft habe.





























