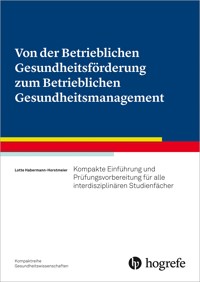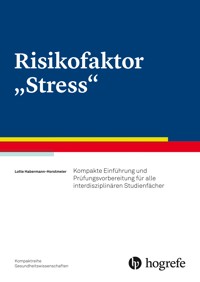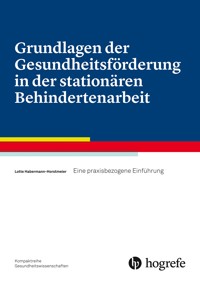
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Gesundheitsförderung und Prävention für Menschen in der stationären Behindertenarbeit. Wie gelingt die sinnvolle Einbindung von Gesundheitsförderung und Prävention in der stationären Behindertenarbeit?Wichtige Leitbegriffe und Prinzipien wie z.B. Inklusion, Equality of Opportunity, Soziale Gerechtigkeit, Partizipation oder Empowerment werden anhand von Fallbeispielen anschaulich erklärt. Mit Fragen und Antworten zum Inhalt kann das Erlernte anschließend leicht überprüft werden. Damit gelingt ein Einstieg in das Thema leicht und der Leser kann mit Hilfe dieser kompakten Übersicht: zwischen Grund- und Sekundärbedürfnissen behinderter Menschen differenzieren vorhandene Probleme in diesen Themenbereichen schnell erkennen, die epidemiologischen Zusammenhänge und Risikofaktoren richtig einschätzen, sinnvolle Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen der eigenen Behindertenarbeit selbst umsetzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Ähnliche
Kompaktreihe Gesundheitswissenschaften
Grundlagen der Gesundheitsförderung in der stationären Behindertenarbeit
Lotte Habermann-Horstmeier
Wissenschaftlicher Beirat Programmbereich Gesundheit:
Ansgar Gerhardus, Bremen; Klaus Hurrelmann, Berlin; Petra Kolip, Bielefeld; Milo Puhan, Zürich; Doris Schaeffer, Bielefeld
Lotte Habermann-Horstmeier
Kompaktreihe Gesundheitswissenschaften
Grundlagen der Gesundheitsförderung in der stationären Behindertenarbeit
Eine praxisbezogene Einführung
Korrespondenzadresse der Autorin:Dr. med. Lotte Habermann-Horstmeier, MPH
Leiterin des Villingen Institute of Public Health (VIPH)
der Steinbeis-Hochschule Berlin
Klosterring 5
D-78050 Villingen-Schwenningen
E-Mail: [email protected]
Internet: www.studium-public-health.de
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Kopien und Vervielfältigungen zu Lehr- und Unterrichtszwecken, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Gesundheit
Länggass-Strasse 76
3000 Bern 9
Schweiz
Tel: +41 31 300 45 00
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.hogrefe.ch
Lektorat: Susanne Ristea, Marie-Theres Nagel
Bearbeitung: Elisabeth Dominik, Allendorf
Herstellung: René Tschirren
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Druck und buchbinderische Verarbeitung: Finidr s.r.o., Český Těšín
Printed in Czech Republic
1. Auflage 2018
© 2018 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-95836-1)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-75836-7)
ISBN 978-3-456-85836-4
http://doi.org/10.1024/85836-000
Inhaltsverzeichnis
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden.
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Audiodateien.
Anmerkung
Sofern der Printausgabe eine CD-ROM beigefügt ist, sind die Materialien/Arbeitsblätter, die sich darauf befinden, bereits Bestandteil dieses E-Books.
Mein herzlicher Dank geht an die Bewohner und Mitarbeiter der zahlreichen Behinderteneinrichtungen, die ich bisher kennenlernen durfte. Sie haben die Arbeit an diesem Buch direkt und indirekt durch wertvolle Hinweise und Anregungen unterstützt.
Vorwort
Gesundheitsförderung ist in der Behindertenarbeit ein recht neues Thema. Zwar haben Menschen mit Behinderung nach der UN-Behindertenrechtskonvention – ebenso wie alle anderen Menschen – Anspruch auf eine adäquate Gesundheitsversorgung und damit implizit auch auf Maßnahmen der Gesundheitsförderung. Die hierfür zuständigen Wissenschaften Public Health bzw. Gesundheitswissenschaften sind jedoch gerade erst dabei, dieses Feld für sich zu entdecken. Aus der Praxis der Behindertenarbeit kommen jedoch schon seit einigen Jahren immer wieder Nachfragen nach praxisorientierten gesundheitsfördernden Einzelmaßnahmen, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen. Auch fehlt es bislang an einer wissenschaftlichen Grundlage der Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit.
Dieses Buch beschäftigt sich daher am Beispiel der stationären Behindertenarbeit v.a. mit folgenden Themen:
Was ist Gesundheitsförderung?Ist angesichts der angestrebten Inklusion von Menschen mit Behinderung eine spezielle Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit notwendig?Was sind die Prinzipien und Leitbegriffe der Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit?Wie kann eine gesundheitsfördernde Lebenswelt „Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung“ entstehen?Wie sehen gesundheitsfördernde Maßnahmen aus, die sich an den Grundbedürfnissen der Menschen mit Behinderung orientieren?Zu den Grundbedürfnissen der Menschen – und somit auch der Menschen mit Behinderung, die in einer Einrichtung leben – gehören insbesondere gesundes Essen und Trinken, ausreichend Bewegung, adäquate Körperpflege, gesunder Schlaf, eine gesundheitsfördernde Umgebung, eine adäquate Zeitgestaltung, der Schutz vor Wettereinflüssen und Infektionskrankheiten, der Schutz vor Gewalteinwirkungen und Unfällen sowie ein adäquater Umgang mit Sexualität. Auf der Basis von epidemiologischen Daten und Risikofaktoren, die zur Entstehung von Krankheiten bzw. Störungen in diesen Bereichen beitragen können, werden spezifische Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention erarbeitet. Diese Bausteine formen schließlich ein gesundheitsförderndes Setting „Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung“.
Der vorliegende Band „Grundlagen der Gesundheitsförderung in der stationären Behindertenarbeit“ ist der vierte Band einer Reihe, die sich unter dem Titel „Kompaktreihe Gesundheitswesen“ an ein breites Publikum im deutschsprachigen Raum wendet. Die wissenschaftlich fundierten, aktuellen, leicht verständlichen und gut illustrierten Texte bieten jeweils einen ersten Einstieg in ein abgegrenztes Gesundheitsthema. Praxisbezogene Fragen zum Ende jedes Kapitels erlauben es, die Textinhalte mit der eigenen Erfahrungswelt zu verknüpfen. Um diesen Transfervorgang zu unterstützen, finden sich am Ende des Buches ausführliche Lösungsvorschläge und ein umfangreiches Glossar sowie aktuelle Literatur- und Internetquellen. Als Adressaten kommen nicht nur Studierende im Bereich der Behindertenarbeit (Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Behindertenpädagogik, Soziale Arbeit etc.) infrage, sondern v.a. auch Interessierte, die bereits in Behinderteneinrichtungen oder im öffentlichen Bereich arbeiten, und sich mit den Grundlagen der Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit beschäftigen möchten.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Buch bei personenbezogenen Bezeichnungen die im Deutschen übliche, meist männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit jeweils Frauen und Männer gleichermaßen gemeint. Dies gilt insbesondere, da im Bereich der Gesundheitsberufe überwiegend Frauen tätig sind.
Villingen-Schwenningen, Oktober 2017Lotte Habermann-Horstmeier
Grundlagen und Fragen
2 Gesundheitliches Gesamtkonzept in einer Behinderteneinrichtung
Ziel der Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit ist es, eine gesundheitsfördernde Lebenswelt „Behinderteneinrichtung“ zu schaffen. Als Grundlage hierfür braucht es ein Gesamtkonzept, in dessen Rahmen dann die einzelnen Maßnahmen der Gesundheitsförderung und (Krankheits-)Prävention geplant und umgesetzt werden. Das Konzept sieht vor, die Bedingungen in der Einrichtung schrittweise so zu verbessern, dass sich dies positiv auf die Gesundheit der Bewohner und der dort beschäftigten Betreuungskräfte auswirkt. Auf dieser Basis soll es allen leichter fallen, sich gesundheitsbewusst zu verhalten.