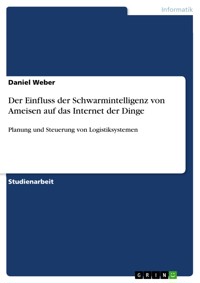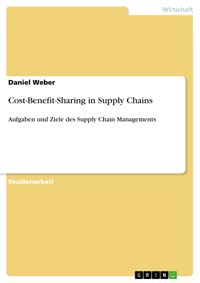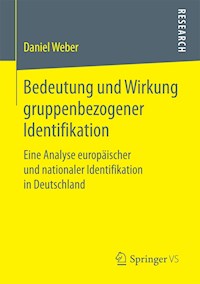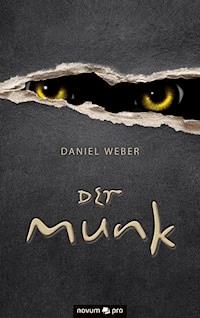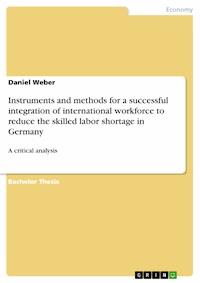4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der junge Schriftsteller Stefan Hanns erbt das Haus seines verstorbenen Großonkels in Phillipsdorf, dem verbotenen 24. Bezirk Wiens. Die düsteren Geschichten, die sich um diesen Ort ranken, sind für ihn natürlich nur Altweibergeschwätz. Der Ort sieht das aber anders. Stefan wird klar, dass die Geschichten der Wahrheit entsprechen. Nun gibt es kein Zurück mehr. Der Wahnsinn beginnt. Phillipsdorf - Bezirk des Wahnsinns (1. Roman) Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
IN DIESER REIHE BISHER ERSCHIENEN:
DIE ZWEIFELHAFTE ERBSCHAFT
PHILLIPSDORF - BEZIRK DES WAHNSINNS NO. 01
GRUSEL-THRILLER
BUCH 10
DANIEL WEBER
Als Taschenbuch gehört dieser Roman zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt.
Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2023 BLITZ-Verlag
Hurster Straße 2a, 51570 Windeck
Redaktion: Jörg Kaegelmann
Titelbild: Mario Heyer
Logo: Mario Heyer
Satz: Torsten Kohlwey
Alle Rechte vorbehalten.
ISBN: 9783757955502
3410v1
INHALT
Die zweifelhafte Erbschaft
Epilog
Anhang
Danksagung
Über den Autor
Anmerkungen
Für Thomas Fröhlich.
Weil Du es schon immer gewusst hast.
DIE ZWEIFELHAFTE ERBSCHAFT
Mein Name ist Stefan Hanns.
Ich glaube, ich bin verrückt.
* * *
Freitag, der 15. Mai 2015. An diesem Tag sollte ich mein Erbe antreten.
Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Entscheidung war.
Wir passierten das Ortsschild, und das Navi meines Smartphones gab den Geist auf.
Auch die Nachmittagssonne schien an Strahlkraft zu verlieren. Mit einem mulmigen Gefühl betrachtete ich die ersten Häuser der Stadt. Fahle, trostlose Fassaden.
„Mein Navi hat keine Verbindung mehr“, sagte ich und blickte zu Raphael, der fuhr.
„Ich bleibe dort bei der Polizeiwache stehen. Wir müssen die Wegbeschreibung deines Großonkels doch verwenden.“ Sein zweifelnder Blick mochte nichts heißen. Das war sein Alltagsausdruck: grüblerisch, fast bedrohlich. Er saß mit gekrümmtem Rücken am Steuer. Nur ein Zentimeter trennte seinen schwarzen Haarschopf von der Decke des Ford Kas.
Er verlangsamte und hielt neben der Polizeiwache.
„Na, die könnten mal renovieren“, sagte er schroff.
Ich beugte mich nach vorne.
Raphael hatte recht, das Gebäude war heruntergekommen. Der graue Verputz der Mauern war an vielen Stellen abgeblättert. Ein paar Fenster waren mit Brettern vernagelt. Im Hof standen zwei Polizeiwagen, beide dreckig; einem fehlte ein Reifen.
„Ein beruhigender Anblick.“ Ich verzog das Gesicht. Das Kribbeln in meinem Magen verstärkte sich.
Raphael zuckte die Achseln. „Die Häuser da drüben sehen auch nicht lebendiger aus. Was hast du erwartet?“ Er lachte. „Wir können umkehren. Du musst das nicht tun.“
„Ich bekomme das Haus nur, wenn ich auch hier lebe“, entgegnete ich und kramte aus der Sakkotasche den Brief meines Großonkels. „Was könnte mir Besseres passieren? Dieser Ort ist perfekt für mich.“
„Wie du meinst.“
„Hier, sieh her.“ Ich faltete die Briefseiten auf und suchte den skizzierten Plan. „Wir sind hier, in der Helmutgasse. Das Beste wird sein, wir fahren da runter zum Zagler-Platz und weiter in die Holzergasse ... Herrgott, sind das viele Straßen ...“ Ich griff mir an den Kopf. Der Weg zur Meyrinkgasse 3 war kompliziert, diese verwinkelten Wege auf der behelfsmäßigen Karte ließen den Ort wie einen Irrgarten erscheinen.
„Mhm. Denke ich auch.“ Raphael legte den Gang ein, während er auf den Plan schaute. „Na dann.“
Der Motor stotterte. Und starb ab.
„Was soll das jetzt?“ Raphael griff zum Zündschlüssel und versuchte zu starten. Wieder stotterte der Motor, aber er sprang nicht an.
„Ist der Tank leer?“, fragte ich.
„Sicher nicht. Ich hab ...“ Raphael stockte, als er auf die Tankanzeige schaute. Der Zeiger stand auf leer. „Das gibts nicht. Ich hab gestern vollgetankt.“ Er öffnete die Tür. „Das schaue ich mir an.“
Ich blieb sitzen, als er das Auto umrundete. Ich sah im Seitenspiegel, wie er den Asphalt nach Zeichen ausgelaufenen Benzins untersuchte. Er legte sich auf den Boden und sah unter den Wagen.
Als er aufstand, verschränkte er die Arme. In seinem Gesicht lag Unverständnis. Er starrte den Tankdeckel an, als könne er den Tank mit Geisteskraft wieder vollzaubern.
Ich stieg ebenfalls aus, um mir ein bisschen die Füße zu vertreten, stockte aber, bevor ich die Autotür zumachen konnte. Ich fühlte mich beobachtet von den blinden Fenstern ringsum. Keine Menschenseele außer uns auf der Straße.
Auf jedem Friedhof ist die Stimmung fröhlicher, zitierte ich in Gedanken.
„Keine Ahnung, was da los ist“, sagte Raphael und ließ die Hände auf seine Oberschenkel klatschen.
Verwirrt sah ich ihn an. Reiß dich zusammen, Stefan. Das bildest du dir ein. Die Geschichten von diesem Ort sind bloßes Altweibergewäsch! „Was sollen wir machen?“
„Ich probiere es noch mal.“ Raphael ging zur Fahrertür. „Wenn nicht, dann müssen wir zu Fuß gehen. Und eine Tankstelle suchen.“
Er setzte sich hinters Steuer und versuchte erneut, den Wagen zu starten.
Ich blieb stehen und blickte mich weiter um. Das Geräusch des immer wieder absterbenden Motors untermalte die trostlose Stimmung.
Ich dachte an die Schauermärchen, die mir meine Eltern von diesem Ort erzählt hatten, als ich klein gewesen war. Hier gehe es nicht mit rechten Dingen zu, hieß es, hier lauerten Geheimnisse, die besser gemieden würden.
Alles Blödsinn, hatte mir die Vernunft gesagt, als ich alt genug geworden war, um zu verstehen, dass es das Monster im Kleiderschrank nicht gibt. Aber als ich die Straße hinunterblickte, die ins Herz dieses Orts führte, war ich mir da nicht mehr sicher.
Ich hatte den Impuls, den Plan aufzugeben, schalt mich aber einen Narren. Eingeimpfter Aberglaube war nicht so einfach abzulegen. Natürlich erinnerte ich mich an die Geschichten ... und sie machten mir Angst. Außerdem zog ich von zu Hause aus. Das war Grund genug zur Nervosität. Ich hatte vor einigen Monaten einen Job als Telefonist in einem Callcenter angenommen, trotz eines abgeschlossenen Studiums, weil ich Geld brauchte, um mir meinen Traum zu finanzieren: die Schriftstellerei.
Alles, was mir fehlte, war ein Ort, an dem ich ungestört schreiben konnte.
Der Besuch dieses Notars war mir wie ein Fingerzeig des Schicksals erschienen. Ich hatte ein Haus geerbt, die größte Sicherheit, die sich ein Fünfundzwanzigjähriger wünschen kann. Noch dazu hier: An einem Ort, um den sich mehr düstere Legenden ranken als um irgendeinen anderen in Wien. Perfekt für meine unheimlichen Geschichten.
Es waren Schauermärchen. Sonst nichts. Zumindest redete ich mir das ein.
Das Krachen der zufallenden Fahrertür schreckte mich aus den Grübeleien.
„Vergiss es, der ist tot.“ Raphael schlug mit der flachen Hand aufs Dach des Kas. „Wir müssen gehen. Hoffentlich finden wir eine Tankstelle auf dem Weg ... Ich versteh das nicht.“
Wir gingen los.
Jetzt, da wir uns nicht mehr im Auto fortbewegten, drangen die Eindrücke aggressiver auf mich ein. Das Straßenpflaster war uneben, überall waren Einbuchtungen und Risse im Stein. Der Gehsteig sah genauso aus.
„Hier müssen wir links, oder?“ Raphael deutete mit dem Finger in die angegebene Richtung.
Ich schaute auf den Plan. „Ja. Da kommen wir direkt zum Zagler-Platz.“
Die Umgebung blieb trostlos: eine ausgebleichte Hausfassade nach der anderen, wucherndes Unkraut in den Vorgärten, blinde Fenster, menschenleere Straßen.
Vereinzelt standen Autos am Straßenrand oder in Vorhöfen. Ein alter Golf stach mir ins Auge, da sich der Rost bis knapp unter die Türfenster vorgearbeitet hatte.
„Ob der noch fährt?“, sagte ich, um die drückende Stille mit einem Gespräch aufzulockern.
„Glaub ich kaum“, antwortete Raphael.
Nach fünf Minuten waren wir beim Zagler-Platz angelangt und schlugen den Weg ins Ortszentrum ein, wie er auf dem skizzierten Plan verzeichnet war. Mir fiel gleich die Bibliothek auf, als wir den Platz überquerten. Dieses Gebäude ließ ebenso wie die Wohnhäuser der Umgebung an Pflege vermissen.
Ich wandte mich ab. Vor uns erstreckte sich die Holzergasse.
Aus den Augenwinkeln bemerkte ich eine Bewegung.
Ein blasses Gesicht mit stechenden Augen starrte durch eines der Fenster, war aber gleich wieder in der Dunkelheit des Raums verschwunden. Die grauen Gardinen bewegten sich sachte, als hätte sie jemand gestreift beim raschen Verlassen des Beobachtungspostens.
„Neugierige Leute“, brummte ich. Ich spürte das Pochen meines Herzens.
„Was meinst du?“
„Da hat uns grade irgendwer nachgeschaut. Aus einem Fenster.“
„Vorhin auch schon“, sagte Raphael. „Wahrscheinlich lauter alte Leute hier.“
Ich seufzte in Gedanken. Deine Ruhe will ich haben.
Um eine Straßenecke kam eine Gestalt. Eine Frau, altmodisch gekleidet in fahlblauem Rock und grauer Bluse, einen Weidenkorb in der Hand. Sie hielt inne, als sie zu uns aufblickte. Nach einer Sekunde wechselte sie auf die andere Straßenseite und ging langsam, fast vorsichtig weiter, die Augen auf uns gerichtet.
Als wir auf gleicher Höhe waren, trafen sich unsere Blicke. Ihrer war voll Misstrauen, argwöhnisch. Sie wandte das Gesicht nicht ab.
„Ich glaube nicht, dass die hier besonders freundlich gegenüber Fremden sind“, murmelte ich. Ich spürte die Augen hinter mir. Die Frau beobachtete uns.
„Wie gesagt, wir können umkehren.“ Raphael grinste süffisant. „Zumindest wenn wir wieder Sprit haben.“
„Halt den Mund.“
Wie er hier ruhig bleiben konnte, überstieg mein Begriffsvermögen. Raphael Kurzhaus war niemand, der Schauermärchen Glauben schenkte. Er war nicht abergläubisch, nicht übermäßig sensibel. Die Geschichten über diesen Ort, erzählt hinter vorgehaltener Hand und verschlossenen Türen, hatten für ihn keine Bedeutung. Das zeigte er deutlich.
Vielleicht war das der Grund, warum ich mit ihm und nicht mit meinen Eltern zum ersten Mal hierherfuhr. Ich brauchte einen kühlen Kopf neben mir; nicht die Leute, die beim Lesen des Briefes meines Großonkels kreidebleich geworden waren.
Endlich bogen wir in die Meyrinkgasse ein.
Raphael hatte zwar gesagt, wir könnten jederzeit umkehren, aber dieses Gefühl hatte ich nicht. Seit der Einfahrt in den Ort war mir das klar gewesen, als latente Gewissheit. Dieser Ort schien mich zu beanspruchen.
Es gab kein Zurück. Hier würde ich leben.
Wir kamen an einem versifften Kaffeehaus vorbei. Das Café Bernhard, wie es über dem Eingang hieß. Die blassrosa Fassade mochte einst purpurrot gewesen sein. Grind bedeckte die Fensterscheiben wie Nebel.
Gleich daneben stand der einzige Gemeindebau in diesem Ort. Der Bernhardshof. Ein Bogengang führte ins Innere. Viele der Fenster auf der rechten Seite waren mit Kartons verklebt, zwei ganze vertikale Reihen. Ich glaubte, einen leisen Windhauch von diesem Teil zu spüren.
Eine leer stehende Wohnstiege, vermutete ich.
Aus einem Fenster auf der linken Seite sah ich undeutlich das faltenzerfurchte Gesicht einer Frau. Sie blickte starr auf uns. In ihren Armen hielt sie ein Bündel, an dessen oberen Ende ich den leicht behaarten Schopf eines Kindes ausmachen konnte.
Das Bündel rührte sich nicht. Es hing schlaff in der Umarmung.
Als ich den Blick mit der Alten kreuzte, grinste sie mit lückenhaften Zahnreihen. Sie wandte sich ab und der Kopf des Kindes klappte nach hinten. Dann verschwand sie aus meinem Blickfeld.
Galle stieg in mir hoch.
Hatte ich das gerade wirklich gesehen? War das ein schlechter Scherz gewesen, den die Bewohner hier Fremden gerne spielten? War dieses Kind tot? Am besten war es, ich dachte nicht weiter darüber nach. Aber das schien mir unmöglich.
Wenn es hier Hexen gibt, habe ich die erste gefunden.
„Da vorne muss es sein“, verlautbarte Raphael, der offenbar nichts von der Erscheinung mitbekommen hatte. „Die Meyrinkgasse 3. Sieht gar nicht so schlimm aus.“
Ich verscheuchte die Gedanken an die Hexe und folgte Raphaels Blick.
Er hatte wieder einmal recht. Mein Großonkel dürfte sein Zuhause gut gepflegt haben. Das Haus war zweistöckig, hatte intakte Fenster und eine hellblaue Fassade, die nicht zu den düsteren Gebäuden ringsum passen wollte. Das Dach war mit roten Schindeln bedeckt.
Ein niedriger Holzzaun mit Steinpfeilern grenzte den Vorgarten ab, vom tiefer gelegenen Garagentor führte eine Rampe auf die Straße. Gras und Unkraut wucherten hinter dem Zaun, aber das erklärte sich mit der langen Abwesenheit richtiger Pflege.
Mir fiel der Briefkasten neben dem Vorgartentürchen auf. Er quoll über vor Zeitungen. Viele der Blätter lagen auf dem Boden verstreut, zerrissen, nass geworden und wieder getrocknet, voller Schmutz. Josef Zeilner stand auf dem Kasten.
Das war mein neues Zuhause.
In Phillipsdorf, dem inoffiziellen 24. Bezirk der Stadt Wien. Ein Ort, der zwar zur Stadtgemeinde gehört, den aber niemand haben will. Auch nicht die angrenzenden Gemeinden.
* * *
„Keine Tankstelle“, sagte Raphael und kramte seine Zigarettenpackung aus der Brusttasche des Hemds. Er lehnte am Zaun. „Wenn dieser Notar kommt – Engelbrecht, heißt er? – wenn er kommt, dann frage ich ihn gleich.“
Ich nickte abwesend und betrachtete das Haus. Es passte nicht an diesen Ort. Gepflegt und sauber, intakte Fenster. Es wirkte wie ein Fremdkörper.
Ich ließ meinen Blick ein wenig schweifen und stockte, als ich zum Nachbarhaus sah.
Zwei funkelnde Augen stierten mich aus dessen Mansardenfenster an. Sie gehörten einem gelblichen Gesicht, das sofort wieder mit den Schatten hinter der Fensterscheibe verschmolz.
Das kommt mir bekannt vor. Das Bild des toten Kindes kam mir in den Sinn. Ich hatte eine zu lebhafte Phantasie. Genau! Das musste der Grund sein.
Ich zwang mich, eine Grimasse zu schneiden. „Mein Großonkel hatte recht. Die Leute hier sind misstrauisch gegenüber Fremden.“
„Meinst du den Kerl, der da aus dem Fenster geschaut hat?“ Raphael nickte zu dem Mansardenfenster.
„Mhm.“ Ich sah auf die Uhr. Es war ein paar Minuten vor zwei. „Gut, dass wir früher losgefahren sind. Engelbrecht sollte gleich auftauchen. Danke noch mal, dass du mitgekommen bist.“
„Kein Problem.“ Raphael ließ die Zigarette auf den Boden fallen und trat sie aus.
Hinter ihm, aus der Richtung, aus der wir gekommen waren, sah ich eine schlaksige Gestalt um die Häuserecke kommen. Sie war dunkel gekleidet und trug eine Aktentasche in der Hand. An der wippenden Bewegung des Kopfes samt Hut erkannte ich den Notar, Simon Engelbrecht, der mir vor einer Woche persönlich den Brief meines Großonkels gebracht hatte. Er winkte uns zu.
Als er bei uns war, kam ich ihm die letzten Schritte entgegen. „Guten Tag, Herr Engelbrecht. Darf ich vorstellen, das ist Raphael Kurzhaus. Ein guter Freund von mir. Er war so nett, mich zu chauffieren. Ich selber habe kein Auto.“
„Sehr erfreut“, sagte Engelbrecht mit schilfiger Stimme. Er hielt sich aufrechter als das letzte Mal, da ich ihn gesehen hatte. Vielleicht lag es daran, dass er nicht mit Mutter konfrontiert war, die bei seinem Besuch in meinem Elternhaus in Bachbrunn dabei gewesen war.
„Herr Engelbrecht“, sagte Raphael. „Apropos Auto. Wir haben die letzten zwei Kilometer zu Fuß gehen müssen, weil mein Auto den Geist aufgegeben hat. Leerer Tank.“
„Oh, wirklich?“
Raphael nickte. „Wir haben keine Tankstelle beim Hergehen gesehen. Wo finde ich denn eine?“
„Ach, das ist einfach.“ Der Notar drehte sich auf dem Absatz um und deutete in die Richtung, aus der wir gekommen waren. „Sie gehen die Meyrinkgasse wieder zurück, hinauf auf den Walterweg – da kommen Sie an unserem hiesigen Antiquariat vorbei – und dann rechts in die Josefstraße. Von dort sehen Sie sie schon. Leicht zu finden.“
„Dankeschön.“ Raphael wandte sich mir zu. „Ich hol Benzin und das Auto. In einer halben Stunde bin ich zurück ... Wenn ich mich nicht verlaufe.“ Er lachte.
Unwohlsein breitete sich in mir aus. Ich wollte nicht alleine gelassen werden, zumindest nicht so schnell. Aber was konnte mir schon passieren? Es gab keinen Grund zur Nervosität. „Bis dann.“
Raphael nickte und ging los, die Hände in den Hosentaschen.
Engelbrecht sagte lächelnd: „Dann fangen wir an. Wie Sie sehen, Herr Hanns, hat das Haus hier eine wunderbare Lage. Zu Fuß sind es keine fünf Minuten zum August-Platz.“
„August-Platz?“, fragte ich.
„Sozusagen unser Hauptplatz. Dort finden Sie das Rathaus, das Stadtwirtshaus, den Greißler,1 die Trafik2 und eine Handvoll weiterer Geschäfte. Alles, was Sie brauchen. Wenn Sie wollen, können wir nachher gemeinsam hinspazieren und ich zeige Ihnen alles.“
„Das wird nicht nötig sein.“ Ich winkte ab. „Ich finde mich zurecht. Danke. Sagen Sie, wie kommt es, dass mich die Menschen hier so finster anschauen?“
Engelbrecht hantierte nervös mit der Aktentasche. „Nun ja, Herr Hanns, die Phillipsdorfer sind Fremde nicht gewöhnt. Es kommen selten Leute von außerhalb, Sie wissen ja ...“
Ich nickte langsam. Und du bist freundlich zu mir, weil mein Großonkel es dir aufgetragen hat, oder wie?, dachte ich, verkniff mir aber jeden Kommentar. Engelbrecht hatte vor einer Woche erwähnt, dass ihn mein Großonkel persönlich gebeten hatte, die Sache mit dem Erbe rasch über die Bühne zu bringen.
Ich habe keine Ahnung, was da im Hintergrund abgelaufen war. Josef Zeilner war seit zwei Monaten für tot erklärt, und Engelbrecht hatte es hingebogen, dass ich bereits jetzt mein Erbe antreten konnte, ohne bürokratische Hürden. Selbst als juristischer Laie war mir klar, dass hier irgendetwas faul sein musste. Waren mein Großonkel und dieser Notar befreundet gewesen? In dem Brief hatte nichts darüber gestanden.
„Nun“, sagte Engelbrecht und kramte einen Schlüssel aus der Hosentasche. „Dann würde ich sagen, wir gehen hinein und Sie schauen sich Ihr neues Zuhause an.“
Der Notar zeigte mir das Haus. Er blieb sachlich und unverbindlich, nichts in seinem Tonfall ließ darauf schließen, dass er irgendwelche persönlichen Verbindungen zu meinem Großonkel gepflegt hätte.
Küche und Essbereich waren ordentlich, das Wohnzimmer komfortabel. Es gab zwei Bibliotheken, eine im Erdgeschoss und eine kleinere im Obergeschoss, die meinem Großonkel augenscheinlich als Lese- und Arbeitszimmer gedient hatte, denn Schreibtisch und Ohrensessel standen darin. Elektronische Geräte, abgesehen von denen in der Küche, sah ich fast keine. Außer Radio, Plattenspieler und Festnetz-Telefon dürfte Josef Zeilner nicht gerade medienaffin gewesen sein.
Der Kunstgeschmack meines Großonkels war speziell, traf jedoch meinen eigenen morbiden Geschmack. Im Haus verteilt hingen Bilder von unbekannten, vielleicht regionalen Künstlern, die verstörende Motive zeigten. Ein Gemälde, das an der Wand über dem Esstisch angebracht war, erinnerte an den Schrei von Munch, nur dass die Schemen hinter der schreienden Figur deformiert und unmenschlich wirkten. Andere Bilder stellten das Grauen deutlicher dar. Hier eine Kreatur mit Fangzähnen und ledriger Haut, dort ein pechschwarzes dürres Monstrum mit zerfetzten Flügeln.
Im Keller befanden sich Vorratsraum, Werkstatt, Waschküche, Heizraum und ein Gesellschaftsraum mit Lederbänken, Kühlschrank und Holzboden. Rustikal gehalten, aber gemütlich. Hier ließ es sich sicher gut plaudern.
In der Garage, die durch eine Verbindungstür erreichbar war, fand sich ein alter VW Jetta, grün, Baujahr Steinzeit, der fahrtüchtig wirkte. Ich besaß jetzt ein Auto. Das würde ich auch brauchen, wenn ich meine Eltern in Bachbrunn besuchen wollte.
Als wir nach der Besichtigung des weitläufigen Gartens ins Haus zurückkamen, klopfte es an der Eingangstür. Raphaels Stimme drang durch das dicke Holz. „Stefan? Ich bin da.“
Ich öffnete sofort. „Hallo. Wir sind gerade fertig mit der Hausschau.“
„Perfekt. Der Wagen läuft wieder. Ich sag’s dir, die Leute hier sind echt seltsam. Der Typ an der Tankstelle wollte mich erst gar nicht bedienen.“
„Wie hast du ihn überzeugt?“
Er schnaubte nur zur Antwort.
Ich stellte mir vor, wie er sich vor einem ungehobelten Tankwart aufbaute und ihm die Meinung geigte. Raphael war ein liebenswerter und höflicher Mensch, bis man etwas tat, das ihm arg zuwiderlief. Er sah nicht aus wie ein Kerl, dem man nachts begegnen wollte. Das gereichte ihm oft zum Vorteil.
„Und? Wie ist das Haus?“, fragte er.
„Schön. Eigentlich mehr als schön. Du solltest die Bücher sehen!“ Ich schloss die Tür und führte ihn in den Essbereich, wo Engelbrecht stand und wartete.
„Fein.“ Raphael sah sich um. Er nickte zur Küche. „Auf der Arbeitsplatte kannst du dich ja austoben. Zeit, kochen zu lernen, nicht wahr?“
Ich kratzte mich im Nacken. „Scheint so. Glaubst du, hier in der Nähe gibts gute Pizzerias? Oder Kebab-Stände?“
„Meine Güte, Stefan. Ein bisschen Kochen wird dich nicht umbringen.“ Zu Engelbrecht sagte er: „Danke noch mal. Ich hab die Tankstelle schnell gefunden.“
„Das freut mich.“ Der Notar lächelte. „Wollen wir uns dem Geschäftlichen widmen? Ich habe die Dokumente vorbereitet. Sie brauchen nur noch zu unterschreiben, Herr Hanns.“
Ich tauschte einen Blick mit Raphael und presste die Lippen zusammen. Das graue Umfeld, die seltsamen Leute, die drückende Atmosphäre ... Wenn ich unterschrieb, wäre ich an dieses Haus und Phillipsdorf gebunden, mit allen seinen Nachteilen – und allen beträchtlichen Vorteilen.
Das Vermögen meines Großonkels belief sich auf knapp eine Million Euro. Keine Summe, mit der man sich auf die faule Haut legen konnte. Das meiste waren Sachwerte, wie das Haus, das aufgrund der Erbschaftsbedingungen meines Großonkels unveräußerlich war, zumindest vorerst. Ich müsste trotzdem haushalten. Aber ich hätte Sicherheiten. Und ein Polster.
Das sind alles nur Geschichten, sagte ich mir. Und die meisten Dinge, die ich bei der Anreise geglaubt habe zu sehen, waren nicht mehr als überbordende Phantasie. Weil ich die Geschichten, die man von Phillipsdorf erzählte, kannte. Weil ich ein zu lebhaftes Vorstellungsvermögen besaß.
Ich nickte entschlossen. „Ich nehme das Erbe an.“
Engelbrecht rieb sich die Hände.
Als ich meine Unterschriften machte, sagte er: „Ihr Großonkel würde beruhigt sein, wenn er wüsste, dass Sie sich dazu entschlossen haben. Als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe, war er besorgt, Sie würden sich nicht durchringen können ... Sie wissen schon, bei dem Ruf, den wir außerhalb genießen.“ Sein Bubengesicht zog sich zusammen, als hätte er in eine Zitrone gebissen.
Ich legte den Kugelschreiber zur Seite. „Sie haben meinen Großonkel näher gekannt?“
„Wir hatten des Öfteren miteinander zu tun.“
Eine kryptische Antwort.„Was hat mein Großonkel gearbeitet?“ Ich hatte bisher keinen Hinweis auf den Job Josef Zeilners gefunden.
Engelbrecht hob entschuldigend die Hände. „Da bin ich überfragt, Herr Hanns. Ich lernte ihn kennen, als er sich bereits zur Ruhe gesetzt hatte. Er hat selten über die Vergangenheit gesprochen. Und wenn, dann nur über die Zeit vor seinem Leben in Phillipsdorf.“
Josef Zeilner war vor fünfzig Jahren nach Phillipsdorf gezogen, so hatte er es in dem Brief erzählt. Er musste damals um die zwanzig gewesen sein. Aber wie er sein Leben verbracht hatte, darüber verlor er kein Wort in dem Schreiben.
„Meine Arbeit ist getan.“ Engelbrecht sammelte die Dokumente ein. „Sie bekommen noch offizielle Post von meiner Kanzlei ... Hier ist der Schlüssel zu ihrem neuen Zuhause. Willkommen in Phillipsdorf.“
Ich atmete erleichtert aus, während mir gleichzeitig ein eisiger Finger über die Wirbelsäule strich. Ich hoffe, ich tue das Richtige ...
* * *
„Glaubst du, dein Großonkel hat die alle gelesen?“, fragte Raphael, als wir in der Bibliothek im Erdgeschoss herumstöberten. Wir waren bei einem neuerlichen Rundgang hier hängen geblieben. Die Anzahl der Bücher war schier unfassbar. Die Regale waren zum Bersten gefüllt.
„Kann ich mir nicht vorstellen. So viel kann kein Mensch in siebzig Jahren lesen. Das müssen Tausende sein im ganzen Haus verteilt.“ Ich las ein paar Titel. „Mein Großonkel dürfte meinen Geschmack gehabt haben, zumindest zum Teil. Bram Stoker, Sheridan LeFanu, Poe ... Stephen King. Und sogar Andreas Gruber!“
„Hast du nicht gesagt, du hast keinen Platz mehr für deine Bücher daheim?“, fragte Raphael und grinste.
Ich schaute skeptisch ein Regal an. „Vielleicht, wenn man sie anders sortiert ...?“
Doch das war ein Ding der Unmöglichkeit. Die Regale waren voll. Basta. Bücher jüngeren Datums reihten sich hier an Antiquitäten mit körnigen Umschlägen und gelb gewordenem Papier.
„Hier stehen historische Werke“, sagte Raphael und fuhr mit dem Finger die Buchrücken ab. „Über die Hexenverfolgungen, den Hexenhammer. Dann etwas über Satanismus und Okkultismus ... Dein Großonkel war ja sehr speziell interessiert.“
„Und hier steht im harten Kontrast ein alter Zauberberg.“ Ich nahm den Roman Thomas Manns aus dem Regal und blätterte ihn durch. Der Rücken war verbogen. Die Seiten rochen alt, waren vergilbt. Mein Lieblingsroman.
Eine halbe Stunde später saßen wir im Wohnzimmer und tranken Kaffee. Ich hatte eine frische Packung in einem der Schränke gefunden. Die Ledercouch war verdammt bequem und machte nicht den Eindruck, abgesessen zu sein. Nur einer der Sessel hatte eine Mulde in der Mitte. Wahrscheinlich der Lieblingsplatz meines Großonkels.
„Ein seltsamer Vogel, dieser Engelbrecht.“ Raphael zündete sich eine Zigarette an. Wir hatten keinen Aschenbecher im Haus gefunden, also diente uns ein mit Wasser gefülltes Glas als Behelf.
Ich nickte. „Mhm.“ Ich holte die Zigarillos aus der Innentasche meines Sakkos.