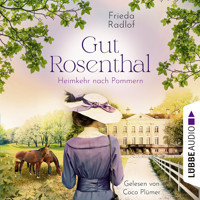9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Eine Gestüts-Familiensaga
- Sprache: Deutsch
Ein dunkles Geheimnis, ein altes Gestüt in Pommern und die Suche nach der wahren Liebe
Brasilien, 1909: Für die junge Cida scheint das Glück auf dem elterlichen Hof perfekt. Doch als ein Mann aus Europa auftaucht, wird ihre Welt auf den Kopf gestellt. Der Fremde behauptet, Cidas Schwester Helena sei noch am Leben. Besteht tatsächlich Hoffnung auf ein Wiedersehen der beiden Frauen?
Kurzerhand reist Cida in die alte Heimat nach Gut Rosenthal in Pommern, wo sich Helenas Spur damals verlor. Doch nicht alle auf dem Gestüt heißen sie willkommen - vor allem der Hausherr Friedrich von Neuenstedt verhält sich seltsam distanziert. Trotz aller Widerstände setzt Cida alles daran, das Geheimnis um ihre Schwester Helena zu lüften ...
Der zweite Band der fesselnden und emotionalen Familiensaga um das Gut Rosenthal in Pommern. Ein Lesegenuss für alle Fans von Modehaus Haynbach und Grandhotel Schwarzenberg.
Stimmen zu Band 1 der Saga: Gut Rosenthal - Das Gestüt in Pommern
»Dieser historische Roman war so spannend geschrieben, die Charaktere so unglaublich lebensecht und die Story einfach genial. Ich habe selten ein Buch gelesen, was mich so mitgerissen und gefesselt hat. Ich bin nur so durch die Seiten geflogen und konnte es kaum aus der Hand legen.« (Nadys-Buecherwelt, Lesejury)
»Ein wunderschöner spannender erster Teil der Saga, den ich, einmal mit dem Lesen angefangen, nicht mehr aus der Hand legen konnte. 5 Sterne und eine ganz klare Leseempfehlung.« (Shilo_, Lesejury)
»Insgesamt ein wirklich gelungener Auftakt in die Gestüts-Familiensaga! Für alle Fans von historischen Romanen ein Muss, aber auch New-Adult-Fans kommen auf ihre Kosten.« (Buchofant, Lesejury)
Die Gestüts-Saga umfasst die folgenden drei Bände:
Gut Rosenthal - Das Gestüt in Pommern
Gut Rosenthal - Heimkehr nach Pommern
Gut Rosenthal - Nebel über Pommern
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Epilog
Danksagung
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Hat es Dir gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Inhaltsbeginn
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an:be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Brasilien, 1909: Auf dem elterlichen Hof fühlt Cida sich wohl. Und als ihr Jugendliebe sie um ihre Hand bittet, scheint ihr Glück perfekt. Auf einmal taucht jedoch ein Fremder in Brasilien auf, der sich als Karl von Bütow vorstellt. Er behauptet, Lottes erste Tochter und damit Cidas Schwester sei noch am Leben. Aber Helena ist bereits vor Jahren in der Heimat verstorben – oder besteht etwa noch Hoffnung? Cida muss einfach herausfinden, ob ihre Schwester noch lebt.
Kurzerhand reist sie über den Ozean nach Pommern, wo Helena aufgewachsen ist. Doch nicht alle auf Gut Rosenthal heißen Cida auf dem Gestüt willkommen, und auch der Hausherr Friedrich von Neuenstedt verhält sich ihr gegenüber distanziert. Trotz aller Widerstände lässt Cida sich nicht von ihrer Mission abbringen und setzt alles daran, das Geheimnis um Helena zu lüften ...
Der zweite Band der emotionalen Familiensaga um das Gut Rosenthal in Pommern. Ein Lesegenuss für alle Fans von Modehaus Haynbach und Grandhotel Schwarzenberg.
Kapitel 1
Als Cida großjährig wurde, erzählten ihre Eltern ihr eine Geschichte. Es war keine schöne Geschichte. Nicht wie die, die ihre Mutter sich ständig für sie ausdachte, oder die Märchen, die Großvater Tayo ihr in der Sprache ihrer Vorfahren erzählte. Diese Geschichte fuhr wie eine kalte Windböe ins Haus und legte die winzig kleinen Risse frei, die schon immer dort gewesen waren. Das Flackern im Blick ihrer Mutter, manchmal, wenn sie Cida ansah und glaubte, sie würde es nicht bemerken. Die stummen Gespräche, die ihre Eltern über den Frühstückstisch hinweg führten, seit sie angefangen hatte, Fragen zu stellen, und das Wachstuch mit dem gelb-braunen Zopfmuster und dem Blutfleck, das ihre Mutter ganz unten in der Wäschetruhe aufbewahrte. All die kleinen Dinge, die sich jetzt zu einem Bild fügten, von dem ein Teil von ihr wünschte, sie hätte es nie gesehen.
Es war der Tag ihres Geburtstags, als Cida die Wahrheit einforderte. »Wenn du volljährig bist«, hatte ihr Vater, Johann Engel, stets gesagt, und jetzt war es so weit.
Es war schon spät am Abend, als Cida ihre eigene Feier im Hof verließ und ihren Vater an das Versprechen erinnerte, das er ihr gegeben hatte.
Bevor sie ins Haus ging, warf sie einen Blick auf den staubigen Hof, gesäumt von Pferdestall und Scheune und beschienen von bunten Lampions. Ihr Großvater saß im Schatten der großen Palme und rauchte, während Ayana um die Feiernden herumwuselte und selbst gemachtes Konfekt verteilte. Cida lächelte, als die alte Frau ihren Großvater sanft an der Schulter berührte und einige Worte mit ihm wechselte. Tayo hatte in seinem hohen Alter tatsächlich noch die große Liebe gefunden.
Yaris hockte neben Großvater auf einem Schemel, eine Trommel zwischen den Beinen, und gab einen schwungvollen Rhythmus vor. Er fing ihren Blick auf und blinzelte ihr zu. Du schaffst das, schien er ihr sagen zu wollen.
Sie nickte kaum merklich, bevor sie das trutzige Holzhaus betrat, in dem sie aufgewachsen war, um endlich eine Antwort zu bekommen – darauf, wer sie war und woher sie gekommen war.
Cida hatte immer gewusst, dass Lotte und Johann Engel nicht ihre richtigen Eltern waren. Weder hatte sie die knabenhafte Statur ihrer Mutter noch das weizenblonde Haar ihres Vaters. Ihre Haut hatte die Farbe von Milchkaffee, ihre Augen waren von einem warmen Braun, das manchmal, wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel stand, aussehen konnte wie Gold. Das jedenfalls sagte Yaris immer.
Als sie das Haus verließ, war es mitten in der Nacht. Draußen lag der Hof unter einem hell scheinenden Vollmond. Keine Wolke war am Nachthimmel zu sehen, und ein lauer Wind strich über das Gras und die Pferdekoppeln, die sich links und rechts der sandigen Zufahrt erstreckten, die zum Haus führte. Die Musik war verstummt, und alles, was die nächtliche Stille durchbrach, waren die Zikaden in den Bäumen.
Cida blickte über die Schulter zurück zum Haus. Im Schlafzimmer ihrer Eltern brannte noch Licht. Jetzt wusste sie alles. Alles über ihre beiden Mütter. Alles über ihren leiblichen Vater.
Tränen der Wut schossen ihr in die Augen. Nun verstand sie, warum sie so lange gewartet hatten. Sie wischte sich über das Gesicht. Sie war so wütend! Wie konnte sie die Toten ruhen lassen, jetzt, da sie wusste, dass das Ungeheuer, das sie gezeugt hatte, am Leben war? Und wie hätte sie sich nicht fragen können, wie viel sie von ihm hatte? Hatte sie seine Augen, sein Gesicht, hatte sie ihre Wut von ihm?
»Cida?«
Sie wirbelte herum. Sie hatte seine Schritte nicht gehört. Wieder wischte sie sich über die Augen. »Was machst du hier?«
Yaris schenkte ihr ein schiefes Lächeln. »Ich dachte, ich gratuliere dir noch einmal zum Geburtstag. Ist das ein schlechter Zeitpunkt?«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust. »Papa bringt dich um, wenn er herausfindet, dass du mir nachläufst.«
Er machte einen Schritt auf sie zu und berührte hauchzart ihre Wange. »Was ist passiert? Du hast geweint.«
»Habe ich überhaupt nicht«, murmelte sie.
Yaris war Stallbursche auf dem Gestüt, und er hatte das schönste Lächeln der Welt. Er war vierzehn gewesen, als er bei ihnen angefangen hatte, genauso alt wie Cida damals. Schon am ersten Tag hatte er ihr dieses Lächeln geschenkt. Wenn seine schwarzen Augen zu funkeln begannen, wenn sich die Grübchen in seinen Wangen vertieften, dann fühlte sie sich vollständiger als an jedem anderen Ort auf der Welt.
Am Anfang hatte Cida so getan, als würde sie ihn überhaupt nicht mögen. Jedes Mal, wenn er sie sah, hatte er so gelächelt. Als hätte er nur auf sie gewartet. Und irgendwie hatte sie gedacht, er würde sich über sie lustig machen. Sie hatte ihn immer böse angeguckt, aber statt sich davon abschrecken zu lassen, lächelte er sie beim nächsten Mal, wenn sie einander auf dem Hof oder bei den Ställen begegneten, wieder an. Offen, herzlich, als gäbe es nichts, was seine Welt trüben könnte.
Eines Tages hatte er sie gefragt, warum sie ihn nicht mochte. Ihr war die Hitze in die Wangen gestiegen – schließlich kritzelte sie seinen Namen heimlich in ihr Tagebuch!
»Weißt du«, hatte er gesagt, als sie nur verstockt geschwiegen hatte. »Ich weiß, du magst mich nicht. Das ist in Ordnung, wirklich. Ich wüsste nur gern, warum. Ich mag dich nämlich.« Er hatte linkisch mit den Schultern gezuckt, während Cidas Herz wild zu klopfen begonnen hatte. Als er Anstalten gemacht hatte, sich abzuwenden, hatte sie ihn am Handgelenk gefasst und ihn auf die Wange geküsst. Sie hatte den Stall mit glühenden Wangen verlassen, nicht ohne noch einmal über die Schultern zu blicken und sein glückliches Lächeln schüchtern zu erwidern.
So hatte das mit ihnen angefangen. Ein Jahr später hatte Yaris Cida ihren ersten richtigen Kuss gegeben. Es war Liebe auf den ersten Blick gewesen, das wusste sie heute. Und sie warteten nur auf die richtige Gelegenheit, es ihren Eltern zu sagen – schließlich war sie sicher, dass Yaris eines Tages um sie anhalten würde. Sie wusste, dass er fleißig sparte, um irgendwann ein Haus bauen und eine Familie ernähren zu können. Da sollten ihre Eltern nicht aus allen Wolken fallen.
Sie ließ zu, dass er sie an sich zog und die Arme um sie schlang. »Ich weiß, wer mein Vater ist«, flüsterte sie schließlich. Er umfasste sie eine Spur fester. »So schlimm?«
Sie nickte kaum merklich, presste das Gesicht an seine Brust. Er roch nach Erde und frischem Heu. Nach Pferd. Nach Zuhause.
»Und was willst du jetzt tun?«, fragte er, als sie sich ein wenig voneinander gelöst hatten.
Sie musste nicht über die Antwort nachdenken. »Ich will ihn sehen.«
»Soll ich mitkommen?«
Sie zögerte nur eine Sekunde. Dann nickte sie, bevor sie sich auf Zehenspitzen stellte, um ihn zu küssen. Wenn sie nur erst aufhörte, sich so unvollständig zu fühlen. Dann würde sie mit Yaris so glücklich sein, dass selbst der Mond am Himmel heller für sie leuchten würde.
Kapitel 2
Cida sagte niemandem, was sie vorhatte.
Als sie in der Nacht aus dem Haus schlich, schien nicht einmal der Mond am Himmel. Yaris erwartete sie schon. In Windeseile sattelte sie ihre Schimmelstute Luana. Ihre Eltern hatten sie ihr zu ihrem siebzehnten Geburtstag geschenkt, und Cida hatte sie Luana nach dem Mond genannt, weil sie ihn jede Nacht, wenn sie nicht einschlafen konnte, am Himmel betrachtete.
Als sie den Hof verließen, erklang ein leises Zischen.
Cida fuhr zusammen. Da stand Großvater Tayo auf einer der Pferdekoppeln, auf einen Stock gestützt, als hätte er schon längst gewusst, dass sie sich davonschleichen wollten. »Habt ihr den Verstand verloren?«, fragte er auf Yoruba.
»Wir sind bald zurück, Großvater«, antwortete Cida leise. Wenn sie schnell ritten, konnten sie in weniger als einem Tag wieder auf dem elterlichen Gestüt sein. Das Land war nicht mehr so unwegsam wie noch vor zwanzig Jahren. Überall schossen Siedlungen aus dem Boden, die Urwälder wichen Feldern und Weideflächen, und die Straßen, die hinunter nach Monte Mor führten, waren größtenteils gut passierbar. Vor allem jetzt in der Trockenzeit.
Sie blickte Tayo flehentlich an. Ihre Eltern hätten viel zu viel Angst um sie, um zu verstehen, wie wichtig ihr dieser kurze Blick in die Vergangenheit war, aber Großvater musste sie einfach verstehen! Wenigstens ein Mal musste sie diesem Menschen in die Augen sehen.
Großvater schüttelte den Kopf. »Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, Kind.«
»Das will ich doch auch gar nicht«, flüsterte sie. »Ich will einfach nur verstehen, warum ...«
»Warum du bist, wer du bist? Warum du hier bist? Wohin du gehörst? Sieh hinter dich.« Cida folgte seinem Blick zu ihrem im Dunkeln liegenden Elternhaus. Es war ein zweistöckiges Holzhaus, von Palmen flankiert, dahinter die Ställe, das weite, grüne Land und die in der Dunkelheit auf den Koppeln stehenden Pferde.
»Deine Eltern sind dort, in diesem Haus, und was immer sie glauben werden, wo du bist – wenn sie auch nur ahnen, wo du wirklich hingehst, werden sie umkommen vor Sorge«, sagte Tayo. »Das hier ist dein Zuhause. Es ist aus viel Leid geboren, und auch du trägst es in dir. Es ist dein Erbe. Aber du kannst die Toten nicht wieder lebendig machen und die Uhren nicht zurückdrehen.«
»Ich muss es wissen«, beharrte sie.
Tayo nickte bedächtig. »Ja, vielleicht musst du das. Wirf einen Blick auf die Vergangenheit. Und dann versuch, sie endlich loszulassen.«
Cida nickte mit einem Kloß im Hals.
Seit dem Moment, in dem ihre Eltern ihr die Wahrheit gesagt hatten, waren auch die letzten ihrer kindlichen Illusionen gefallen. Sie wusste, wie glücklich sie hier lebte, wie frei und wie behütet vor den Reichen, den Mächtigen, den Adligen. Denen, die sich die Welt unter den Nagel gerissen hatten und sich einen Dreck um die scherten, die unter ihnen standen und ihrer Willkür ausgeliefert waren. Von so einem Menschen stammte sie ab, und es machte sie krank. Sie musste ihm in die Augen sehen, ein einziges Mal nur. Und dann wollte sie mit dieser Welt nie wieder etwas zu tun haben.
Cida und Yaris ritten die ganze Nacht, immer nach Süden. Die Straßen waren sandig, gesäumt von Grasland und im lauen Nachtwind wogenden Palmen. Manchmal sahen sie einen Fluss in der Dunkelheit schimmern. Ihr Weg führte über sanfte Hügel, und hin und wieder passierten sie still daliegende Siedlungen, die umgeben waren von weiten Getreide- und Reisfeldern. Hier und da grasten Rinder auf den riesigen, umzäunten Weideflächen.
In den frühen Morgenstunden, als die Luft schon nach Sonnenaufgang schmeckte, erreichten sie die deutsche Siedlung Monte Mor und kurz darauf die Pflanzungen der Fazenda Olivera.
Sie ritten die Wirtschaftswege entlang, schweigend. Es war Mai und die Kaffeeernte war in vollem Gange. Überall sah man die Arbeiter der Fazenda mit gebeugtem Rücken die reifen Kirschen von den Sträuchern pflücken. Sie sortierten sie gleich bei der Ernte, und nur die guten Kirschen fanden den Weg in die geflochtenen Körbe.
Cida war angespannt bis in die Zehenspitzen, aber irgendwann nahm sie doch den Blick von dem sandigen Weg, der sich vor ihnen durch die Pflanzungen schlängelte, und sah zu Yaris hinüber. Seine sonst so ansteckende Fröhlichkeit war wie fortgewischt. Stattdessen ließ er den Blick über die Gesichter der Arbeiter schweifen. Cida wusste, auch er haderte mit dem wenigen, was er über seine Eltern wusste. Noch etwas, was sie gemeinsam hatten.
Yaris war in einem katholischen Waisenhaus aufgewachsen. Sein Vater war ein Wanderarbeiter gewesen, der sich auf Plantagen wie dieser verdingt hatte, seine Mutter eine Angehörige der Tupi, einer der vielen Indianerstämme Brasiliens, gestorben bei seiner Geburt. Cida wusste, welche Fragen er sich stellte, stumm und mit düsterer Miene. Wie viele Indianer waren während der Kolonisation ermordet worden, dahingerafft von den Krankheiten, die die Einwanderer aus Europa eingeschleppt hatten, als Opfer der Sklaverei oder der blutigen Kämpfe, die sie um ihr Land hatten führen müssen? Und wie viele arbeiteten heute für einen Hungerlohn auf Plantagen wie dieser, weil man sie von ihrem Land vertrieben hatte?
»Warte hier auf mich«, sagte Cida, als das Herrenhaus in Sicht kam. Es thronte auf einem Hügel über den Pflanzungen, flankiert von Palmen. Kurz glaubte sie, Blutspritzer am schneeweißen Eingangsportal zu sehen – aber natürlich war das Einbildung. Sie erschauderte.
Yaris blieb zurück, als sie weiterritt. Sie spürte seine angespannten Blicke in ihrem Rücken und fragte sich, was zum Teufel sie hier tat. Wollte sie sich wirklich auf diese Weise quälen?
Sie setzte ihren Weg dennoch fort, über die von gleißendem Sonnenlicht beschienenen Pflanzungen, die staubigen Wirtschaftswege, bis sie die breite Zufahrt erreichte, die zum Herrenhaus führte.
Ein Mann auf einem kleinen, stämmigen Pferd kam heran. Er trug einen Strohhut und hatte von der Sonne gebräunte Haut. »Wohin des Weges, Senhorita?«, rief er.
Cida richtete sich im Sattel auf und erwiderte den unfreundlichen Blick des Aufsehers. »Ich suche Senhor Olivera. Sagen Sie ihm ...« Sie stockte. Ja, was? Was wollte sie hier? Einen Beweis dafür, dass das, was ihre Eltern ihr erzählt hatten, die Wahrheit war? Ihr Verstand zweifelte nicht daran, und dennoch weigerte sich ein Teil von ihr, es zu akzeptieren.
»Wer sucht nach mir?«, ließ sich da eine andere Stimme vernehmen.
Cida wendete Luana. Der Mann, der jetzt auf einem stolzen Rappen heranritt, mochte vielleicht sechzig Jahre alt sein. Tiefe Linien in einem strengen Gesicht, unnachgiebige Augen, die im Sonnenlicht gleißten wie Gold. Mutter hat recht gehabt, schoss es Cida durch den Kopf. Sie sah nicht aus wie dieser Mann. Und trotzdem erkannte sie sich in Gabriel Oliveras Zügen. In der Unerbittlichkeit in seinem Blick, in der fast schon Angst einflößenden Farbe seiner Augen, in seiner aufrechten Haltung. Sie hatte gefunden, was sie gesucht hatte. Da war sie, die Vergangenheit, blickte ihr ins Gesicht und erkannte sie im gleichen Moment.
Eine Augenbraue von Gabriel Olivera zuckte kaum merklich nach oben, bevor Cida sich endlich fasste.
»Niemand«, sagte sie. »Niemand sucht nach Ihnen.« Mit diesen Worten trieb sie ihre Stute an und preschte davon.
Bei Einbruch der Nacht erreichten sie das Gestüt.
Es lag ganz friedlich da unter dem Mond, der sich an diesem Abend nur schüchtern hinter den Wolken hervortraute und seinen Schein über die Pferde auf den Koppeln, das Holzhaus und die Wirtschaftsgebäude rechts und links davon legte.
Sie führten Luana und Raio, Yaris' gutmütigen Rappen, ganz leise auf den Hof. In einträchtigem Schweigen halfterten sie die Tiere ab, rieben sie trocken und brachten sie in ihre Boxen, wo schon Wasser und Heu für sie bereitstand.
Tayo war noch wach. Er war jetzt schon über achtzig Jahre alt und ging gebeugt, immer auf seinen Stock gestützt. Aber seine Augen waren wach wie eh und je. Er legte Cida kurz eine Hand auf die Schulter, so als verstünde er, wie sie sich fühlte. Wie ein Baum, sicher und fest verwurzelt in seiner Heimat, der nun bemerkt hatte, dass Ungeziefer längst begonnen hatte, an seinen Wurzeln zu nagen. Sie drückte seine Hand und wusste, dass sie nichts zu sagen brauchte. Er verstand. Sie hatte die Vergangenheit gesehen, und es tat weh. Sie fühlte sich nicht vollständiger als zuvor.
Gerade, als sie die Tür von Luanas Box schloss, erschien ein Schatten an der Stalltür und verdeckte das Mondlicht. Cida rutschte das Herz in die Kniekehlen. »Papa«, flüsterte sie.
Johann Engel deutete ein Kopfschütteln an. Kurz wanderte sein Blick zu Yaris. »Wir unterhalten uns morgen«, sagte er nur.
»Es war meine Idee«, erklärte Cida schnell.
Johann sah zwischen seiner Tochter und dem Stallburschen hin und her und seufzte. »Ich sagte, wir sprechen morgen darüber.« Mit diesen Worten wandte er sich ab und ging hinaus.
Cida berührte Yaris kurz am Arm.
Er schenkte ihr ein schiefes Grinsen. »Glaub mir doch, er entlässt mich nicht.«
»Pass bloß auf, Junge«, ließ sich Johann von draußen vernehmen. »Noch habe ich nicht entschieden, was ich mit dir mache. Am besten, ich lasse dich für den Rest deines Lebens Mist schaufeln.«
Yaris' Grinsen wurde noch eine Spur breiter. Er deutete eine Verbeugung in Cidas Richtung an und lachte, als sie die Augen verdrehte. »Gute Nacht, Senhorita.«
Sie berührte kurz das Grübchen an seiner Wange. Sie war nicht gut darin, in Worte zu fassen, was sie fühlte, aber der zärtliche Ausdruck in seinen Augen verriet ihr, dass diese kleine Geste ihm alles sagte. Danke, dass du für mich da warst, heute. Danke, dass du immer da bist. Yaris war Zuhause. So wie Großvater, so wie ihre Eltern. Obwohl sie sich eingeredet hatte, dass sie keine Wahl gehabt hatte, lastete das schlechte Gewissen auf ihr. Das Letzte, was sie wollte, war, ihren Eltern wehzutun.
Sie holte tief Luft. Dann folgte sie ihrem Vater.
Eine Weile liefen sie schweigend nebeneinander her und blickten ihrem Zuhause entgegen. Cida schluckte. Alles an diesem Ort war richtig. Es war so friedlich hier. Nur sie selbst war es, die einfach nicht passen wollte. Alles, was sie wollte, war, dass die Vergangenheit aufhörte, ihren Schatten über ihr Zuhause zu werfen. Sie wollte nicht jede Nacht wach liegen und sich quälende Fragen stellen. Aber sie konnte ihre Gedanken nicht zum Schweigen bringen, ihre dummen, widerspenstigen Gefühle nicht entwirren.
»Es tut mir leid«, sagte sie irgendwann in die Stille hinein.
Ihr Vater blieb stehen und sah sie an. »Tu das nie wieder. Was hast du dir dabei gedacht, ohne ein Wort zu verschwinden? Wir waren krank vor Sorge.«
»Es tut mir leid«, wiederholte sie.
Sie hatte gedacht, dass es vielleicht aufhören würde, wenn sie sich dem stellte, was sie verfolgte: ihrem Vater. Stattdessen war passiert, was Großvater vorausgesagt hatte: Die Zeit ließ sich nicht zurückdrehen, was geschehen war, war geschehen. Sie hatte jetzt den Beweis, nach dem sie gesucht hatte. Der letzte Zweifel war ausgeräumt. Sie hatte sich selbst in seinen Augen gesehen, und jetzt war etwas in ihr mehr denn je überzeugt, dass sie all das hier gar nicht verdiente. Die Liebe ihrer Eltern, die glückliche Kindheit, die sie statt des Mädchens geführt hatte, das auf dem Hügel hinter dem Haus begraben lag. Nicht einmal Yaris. Entsetzt bemerkte sie, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Wütend wischte sie sie weg, aber es kamen immer neue nach.
Papa sagte nichts, nahm sie nur wortlos in den Arm.
»Es tut mir leid«, sagte sie noch einmal, und dieses Mal meinte sie nicht nur ihr Verschwinden. »Ich wollte doch nur ...«
»Ich weiß, was du wolltest«, erwiderte Johann Engel. »Ich weiß es, Cida. Ich mag nicht ...« Er schob sie ein Stück von sich weg, und sie sah, wie er das Gesicht verzog. »Ich mag nicht dein richtiger Vater sein, doch ich weiß trotzdem, wonach du gesucht hast.«
»Er ist nicht mein Vater!«, stieß sie hervor. Jetzt flossen die Tränen ungehindert. »Das war er nie! Ich musste ihm einfach ... in die Augen sehen. Ich musste sehen, dass er existiert. Ich wünschte, es wäre nicht so. Ich wünschte, ich wäre deine richtige Tochter.«
Er umarmte sie noch einmal. »Du bist meine richtige Tochter. Blut hin und her.«
Cida nickte. Sie musste endlich damit aufhören, darüber nachzudenken. Was spielte es schon für eine Rolle, woher sie stammte? Wichtig war, wo sie jetzt zu Hause war.
»Es tut mir auch leid, dass ich euch nichts von Yaris erzählt habe«, fügte sie hinzu, als sie das Haus fast erreicht hatten.
»Du entschuldigst dich oft heute«, brummte Papa.
»Ich habe ja auch Grund dazu«, erwiderte Cida zerknirscht. »Doch bitte, lass es nicht an Yaris aus. Er ist davon überzeugt, dass du ihn magst.«
»Ich bin wirklich wütend, dass ihr uns an der Nase herumgeführt habt«, sagte ihr Vater. »Dieser kleine ...« Er schnaubte und schüttelte den Kopf.
»Hast du was dagegen?«, fragte Cida.
Er blickte sie überrascht an. »Dagegen, dass ihr gelogen habt? Ja. Aber davon abgesehen ...« Er schien einen Moment nachzudenken. »Er ist ein guter Kerl, und er hat eine ehrliche Arbeit. Wenn ihr zwei euch gern habt ... Das ist schon in Ordnung. Doch bevor ich euch meinen Segen gebe, werde ich ihm das Leben zur Hölle machen. Vor allem, wenn ... Du bist doch nicht schwanger, oder?«
Cida lachte. Sie hatte ihren Vater nie derart verlegen erlebt. »Nein«, beruhigte sie ihn. So weit war es zwischen ihr und Yaris noch nicht gekommen. »Und überhaupt, über solche Dinge rede ich lieber mit Mama.«
»Gott sei Dank«, murmelte er.
Sie lachte erneut, stockte dann aber. Schlagartig war das schlechte Gewissen wieder da. Sie musste unbedingt mit ihrer Mutter sprechen. »Wo ist sie?«, fragte sie und sah sich um. »Im Haus?«
Johann schüttelte den Kopf. »Nein.« Er deutete auf den Hügel, der von hier aus nur teilweise zu sehen war. »Geh ruhig zu ihr.«
Lotte Engel stand auf der Kuppe des Hügels und blickte in die Ferne. Noch immer war es Nacht. Es war warm, und ein sachter Windhauch spielte an ihrem dunklen Haar. Nach Osten hin standen drei Gedenksteine auf dem Hügel. Cida las die Inschriften, wie sie es so oft schon getan hatte. Ines. Filipa. Helena.
Ihre Mutter drehte sich nicht zu ihr um, obwohl sie ihre Schritte gehört haben musste. Cida blieb stehen, und lange flüsterte nur der Nachtwind zwischen ihnen.
Irgendwann straffte Lotte die Schultern und wandte sich zu ihr um. »Tu das nie wieder.«
Cida bemerkte, dass ihre Mutter geweint hatte. Und da war er wieder, der Schmerz in ihren Augen, wenn sie sie ansah. Er war immer da.
»Es tut mir leid, dass du sie verloren hast«, flüsterte Cida und blickte hinab auf das Kindergrab. »Ich wünschte ...«
Ihre Mutter schüttelte den Kopf. »Jedes Mal, wenn ich dich ansehe, sehe ich sie«, sagte sie irgendwann.
Cida schluckte, wollte etwas antworten, wusste nicht, was.
Lotte Engel fuhr schon fort: »Ich stehe hier und bitte sie um Rat, und es kommt keine Antwort. Und seit du die Wahrheit kennst ... Es tut mir so leid, dass du sie nie kennenlernen konntest. Sie hätte nicht sterben dürfen. Nicht auf diese Weise. Nicht für mich. Sie hat dich geliebt. Das musst du wissen. Und du bist ihr ...« Lotte fuhr sich über das Gesicht, lachte und schluchzte gleichzeitig. »Du bist ihr so ähnlich!«
Erst jetzt begriff Cida, dass ihre Mutter nicht von Helena, ihrer Tochter, sprach. »Ich habe Angst, dass ich wie er bin«, flüsterte sie.
Ihre Mutter schüttelte den Kopf. »Ihr habt die gleichen Augen. Doch das ist alles. Alles, was zählt, hast du von ihr.« Sie holte tief Luft und fasste Cida bei den Händen. »Manchmal mache ich mir Sorgen deswegen. Immer eigentlich. Deine Mutter ist um meinetwillen gestorben, und manchmal ... Du bist in so vielem wie sie, Cida. Hin und wieder jagt mir das Angst ein.«
Kapitel 3
Die Wochen zogen ins Land, die Sonne schien heiß auf den Hof der Engels herab. Als es September wurde, färbten sich die Ähren des Weizens, den sie auf einem kleinen Feld hinter dem Haus anbauten, golden, und die ersten Regenschauer zogen über die grünen Hügel, die sich in alle Richtungen bis zum Horizont erstreckten.
Die Engels versorgten sich selbst. Sie zogen Gemüse in einem Garten hinter dem Haus, Süßkartoffeln, Rote Beete und Steckrüben, und hielten sich neben den Pferden auch ein paar Rinder und ein überaus schlecht gelauntes Schwein.
In den ersten Jahren hatte die Landwirtschaft das Überleben der kleinen Familie gesichert: Es hatte viele Jahre gedauert, bis Lotte und Johann Engel genug Geld gehabt hatten, um ihre Pferdezucht zu beginnen. Jetzt florierte das Geschäft, und sogar aus São Paulo kamen wohlhabende Kunden, um die prächtigen Tiere zu erwerben, die noch von den Pferden abstammten, die Großvater Tayo vor vielen Jahren bis zu den Engels gefolgt waren. Ursprünglich stammten sie von der Fazenda Olivera, aber nachdem die ehemaligen Sklaven gegen ihren vormaligen Besitzer, den grausamen Gabriel Olivera, revoltiert hatten und ein Feuer über die Plantage hinweggefegt war, waren die scheuen Tiere in alle Himmelsrichtungen geflohen. Schließlich waren sie draußen in der Wildnis Tayo begegnet.
Es hatte lange gedauert, bis Cidas Eltern die ersten Vollblüter hatten verkaufen können, denn die Tiere waren teuer, und viele Farmer aus der Region konnten sich die Haltung solch anspruchsvoller Tiere weder leisten, noch konnten sie sie für die tägliche Arbeit auf ihren Höfen gebrauchen. Deshalb hatten die Engels begonnen, Mangalarga zu züchten, eine brave brasilianische Pferderasse, die ihren Ursprung, wie man sagte, am Hofe des portugiesischen Königshofs hatte. Die Zucht der Mangalarga hatte schnell Geld in die leeren Kassen gespült, denn sie waren beliebte Reitpferde mit einem ganz besonders weichen Gang und einem freundlichen Gemüt.
Trotzdem waren die Engels keine reichen Leute. Sie waren hart arbeitende Grundbesitzer, die nicht annähernd so viel Land besaßen wie die Plantagenbesitzer, die ganz besonders im Süden Brasiliens, den Regionen São Paulo, Paraná, Santa Catarina und Mato Grosso do Sul Zucker, Tabak und Kaffee anbauten.
Sie hatten mit weniger als fünfzehn Hektar hier, im fruchtbaren Norden der Region São Paulo, begonnen – nur mit einem Stamm edler Pferde und ihrer eigenen Hände Arbeit. Und auch jetzt, da die Ernte ins Haus stand, arbeiteten sie alle wie selbstverständlich mit ihren wenigen Angestellten und den Saisonarbeitern auf dem Feld, um die Ernte einzufahren.
Zur Erntezeit brauchten sie jede Hand, denn teure Maschinen, wie sie jetzt schon auf manchen der großen Pflanzungen eingesetzt wurden, konnten sie sich nicht leisten. Also ernteten sie die Ähren mit Sicheln und Sensen, schwitzen in der prallen Sonne und freuten sich darauf, am Abend bei einem Schwarzbier im Hof zusammenzusitzen und den Tag ausklingen zu lassen.
Cida warf Yaris ein Lächeln zu. Er war auf dem Feld bei ihrem Vater, dem anderen Stallburschen Mika und einigen Wanderarbeitern, die für die Ernte auf dem Hof der Engels unterkommen würden, während sie mit den anderen Frauen das geerntete Getreide zu Garben band.
Nachdem das Tagewerk getan und die Ernte eingefahren war, lief Cida zur Koppel und lachte, als Luana den Kopf über den Zaun streckte und sie mit einem vorwurfsvollen Schnauben begrüßte. »Bist du etwa wütend, weil ich dich heute noch gar nicht beachtet habe?«, fragte sie und streichelte die weichen Nüstern der Schimmelstute.
Luana machte den Hals lang und drückte ihr den Kopf gegen die Schulter.
»Ist ja schon gut!« Cida warf einen Blick in den Himmel, der noch immer strahlend blau war. Kein Wölkchen war zu sehen, und es war drückend heiß. Es würde noch Stunden dauern, bis in den Abend hinein, bis die Luft sich ein wenig abkühlen würde und vielleicht der ein oder andere zarte Windhauch bis in diesen Winkel der Welt gelangen würde.
»Siehst du, du hast gewonnen, du Sturkopf«, sagte sie und öffnete das Tor zur Koppel. Die Stute kam ihr sogleich entgegengetrottet. »Wir machen noch eine Runde.«
Ohne sich darum zu scheren, dass sie schmutzig und verschwitzt war und eigentlich dringend ein Bad benötigt hätte, streifte sie die Sandalen von den Füßen, schwang sich barfuß auf Luanas Rücken und drückte ihr die Fersen in die Flanken.
Sie galoppierte den staubigen Weg hinab, der zum Hof führte, und schon bald war sie umgeben von grünem Land, während Luanas Hufe den roten Sand der Straße aufwirbelten. Vor ihr erstreckten sich bewaldete Hügel und weite Felder, und am Wegesrand standen Jupati-Palmen, Gummibäume, Brasilkiefern und mannshohe Farne. Wenn man tiefer ins Landesinnere ritt, wo es feuchter war, sah man sogar winzige Orchideen auf den Bäumen wachsen.
»Was meinst du?«, fragte Cida und klopfte Luana den Hals. Sie waren an einer Weggabelung angekommen. Ein schmaler Pfad führte von der Straße weg und einen bewaldeten Hügel hinauf. »Wollen wir noch nach Lino sehen?«
Lino war ein Faultier; Cida hatte es während eines ihrer Ausritte entdeckt, als es noch ein Baby gewesen war. Sie bezweifelte zwar, dass Lino ein Geist ihrer Vorfahren war – das hatte Großvater Tayo behauptet, aber nur, um sich über Ayana lustig zu machen, die an Geister glaubte und ihn für diese Bemerkung sehr böse angesehen hatte –, doch Cida fand das Faultier immer an der gleichen Stelle.
Als sie ihren üblichen Pfad einschlug, bemerkte sie die Spuren von Pferdehufen. Sie runzelte die Stirn. Für gewöhnlich kamen hier nur selten Menschen entlang, denn die einzige Farm weit und breit war die ihrer Eltern. Sie folgte dem Pfad trotzdem, bis er schließlich schmaler wurde und in einem lichten Stück Regenwald endete.
Cida versammelte Luana und ließ sie in einen gemächlichen Trab fallen. Hier musste man aufpassen, nicht nur wegen der Lianen, sondern auch, weil es einen schmalen Flusslauf gab und sie den Verdacht hegte, dass sich im dunklen Wasser der ein oder andere Kaiman verstecken könnte.
Sie fand die Stelle, an der Lino für gewöhnlich herumhing, aber dieses Mal konnte sie ihr Faultier nirgendwo entdecken. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn und verscheuchte eine lästige Fliege, während sie sich aufmerksam umsah. Die Sonne stand jetzt schon tiefer, und das ganze Land war wie in goldenes Licht getaucht.
Da erklang ein Schnauben. Luana stellte die Ohren auf, und Cida schnalzte nach kurzem Zögern mit der Zunge und ritt in die Richtung, aus der sie das Geräusch vernommen hatte. »Oi?«, rief sie, erhielt jedoch keine Antwort.
Sie fand das Pferd, einen hübschen Braunen, gesattelt und mit gut gefüllten Satteltaschen, aber keinen Reiter. Es war an einem Baum festgebunden und verscheuchte mit seinem Schweif ein paar aufdringliche Fliegen. Als Cida von Luanas Rücken sprang, schnaubte der Wallach und kam ihr ein paar Schritte entgegen, um sich zwischen den Ohren kraulen zu lassen. »Du bist aber hübsch«, sagte Cida auf Portugiesisch. »Wo ist denn dein Reiter?«
Das Pferd gab nur ein Schnauben zur Antwort, und sie seufzte und blickte sich um. Wer kam denn auf die Idee, ausgerechnet hier zu rasten? Entweder ein Fremder oder ein Idiot, dachte sie, oder beides. Es würde bald dunkel werden, und in diesem Land verbrachte man die Nacht besser nicht draußen. Sie rief noch einmal, erhielt jedoch nach wie vor keine Antwort, und so machte sie sich nach kurzem Zögern auf die Suche.
Sie musste nicht lange suchen. Kaum war sie ein paar Schritte gegangen, erklang ein Platschen, nur ein paar Schritte von ihr entfernt. Sie machte noch einen Schritt, schob einen großen Farn zur Seite – und prallte gegen einen festen Körper.
Cida stolperte und rutschte im Schlamm aus. Eine Hand packte sie am Oberarm und bewahrte sie vor dem Fall, und ehe sie sich's versah, blickte sie in das Gesicht eines Mannes.
Eine Sekunde lang starrten sie einander einfach nur an. Der Fremde war groß und schlank, mit weißblondem Haar und grauen Augen. »Sieh mal einer an«, murmelte er auf Deutsch. Seine Hand lag noch immer an ihrem Oberarm, und er war ihr so nah, dass sie das belustigte Funkeln in seinem Blick sehen konnte. »Wen haben wir denn da?«
Das holte sie aus ihrer Starre. Sie machte sich los, so abrupt, dass er einen Schritt zurückstolperte – und im schlammigen Uferbereich ausrutschte. Im nächsten Augenblick saß er im Schlamm und starrte sie so verblüfft an, dass sie beinahe gelacht hätte. Stattdessen verschränkte sie die Arme vor der Brust und trat ein paar Schritte zurück, während er sich auf die Beine kämpfte.
Als er aus dem Fluss watete, wischte er sich einmal mit beiden Händen über das schlammbespritzte Hemd. Zwei Handabdrücke blieben auf dem weißen Leinenstoff zurück, und jetzt entkam ihr doch ein Lachen.
»Also wirklich«, sagte der Fremde und kam mit großen Schritten die Böschung hoch. Zu ihrer Überraschung wirkte er nicht das kleinste bisschen ärgerlich, sondern vielmehr erheitert. Dann warf er ihr ein nachsichtiges Lächeln zu. »Na, bei so einem hübschen Gesicht werde ich wohl Gnade vor Recht ergehen lassen müssen. Wie ist dein Name?«
Sie verschränkte die Arme vor der Brust und funkelte ihn an. Am liebsten hätte sie ihn zurück ins Wasser gestoßen.
»Ich vergaß«, fuhr er fort, winkte ab und ging an ihr vorbei zu seinem Pferd. »Du verstehst natürlich kein Wort. Mein Portugiesisch ist allerdings ziemlich schlecht, daher ...« Er drehte sich halb zu ihr um und deutete eine Verbeugung an. »Daher werde ich meiner Verehrung wohl nur mimisch Ausdruck verleihen können.« Er zwinkerte ihr zu und brachte das Fass damit endgültig zum Überlaufen.
»Schade, dass gerade kein Krokodil unterwegs war«, sagte sie und ging zu Luana, die schon ungeduldig auf sie wartete. »Ich hätte zu gern gesehen, wie es Sie in den Hintern beißt, Senhor.«
»Warten Sie!« Er kam ihr nach, als sie sich auf Luanas Rücken schwang. »Sie sprechen Deutsch!«
Sie schnaubte. »Monte Mor ist nur ein paar Kilometer von hier entfernt, Senhor. Die meisten Menschen in dieser Gegend sprechen Deutsch. Leben Sie wohl.«
»Warten Sie, bitte.« Er hob beide Hände und warf ihr ein weiteres Mal sein charmantes Lächeln zu. »Ich habe Sie keinesfalls kränken wollen – ganz im Gegenteil. Ich habe mich verlaufen.«
»Was Sie nicht sagen.«
Seine Mundwinkel zuckten. »Hübsch und ein freches Mundwerk noch dazu. Obwohl ich Ihretwegen Bekanntschaft mit dem Fluss gemacht habe, muss ich zugeben, mir gefällt diese Fügung des Schicksals.«
Eigentlich wollte sie Luana die Fersen in die Flanken drücken und davonreiten. Dieser Kerl reizte sie bis aufs Blut. Nur die Tatsache, dass er vermutlich die Nacht nicht überleben würde, wenn sie ihn jetzt sich selbst überließ, hielt sie davon ab. »Was haben Sie hier draußen verloren, Senhor?«, rief sie ihm zu. »Monte Mor liegt in dieser Richtung.« Sie deutete nach Süden.
»Nein, nein, daher komme ich ja.« Er fuhr sich durch das Haar und blickte sich dann um, mit einem so hilflosen Ausdruck im Gesicht, dass ihre Wut über sein arrogantes Verhalten sich etwas legte. »Ich habe mir das Ganze irgendwie anders vorgestellt. Wie ein großes Abenteuer.« Jetzt wandte er sich ihr zu. »Ich suche ein Gestüt, das hier ganz in der Nähe liegen soll. Angeblich wird es von einem Ehepaar Engel geführt. Sie wissen nicht zufällig, wie ich dorthin komme?«
Sie hob die Augenbraue. »Was wollen Sie denn von den Engels?«
Sein Gesicht hellte sich auf. »Sie wissen also, von wem ich spreche! Wunderbar! Ich ziehe schon seit Tagen durch dieses Land ... Ich sage Ihnen, dieser Hof ist wirklich nicht leicht zu finden.«
Das hat auch seine Gründe, dachte sie. In dieser Gegend lebten viele Deutsche, doch dieser Fremde machte sie misstrauisch. »Erzählen Sie mir erst, was Sie wollen«, verlangte sie. »Sonst überlasse ich Sie hier draußen den Krokodilen.«
»Es handelt sich um eine ... nun, eine Familienangelegenheit, Senhorita«, antwortete er. »Mehr kann ich Ihnen nicht sagen, fürchte ich.« Er räusperte sich und deutete zum zweiten Mal während dieser Begegnung eine knappe Verbeugung an. »Wenn ich mich vorstellen darf ... Leutnant Karl von Bütow. Ich komme im Auftrag eines wichtigen Mannes nach Brasilien.«
Ihre Augenbrauen wanderten noch etwas höher. »Und wer ist dieser wichtige Mann, Senhor?«
»Graf Friedrich von Neuenstedt, Senhorita. Und ich bin mir sicher, er würde sich erkenntlich zeigen, wenn Sie mich aus meiner unangenehmen Lage befreien und zum Hof der Engels eskortieren würden.« Er schenkte ihr ein Lächeln. »Bestimmt sind Sie dort angestellt, nicht wahr? Wenn Sie mich aus diesem Wald führen, verspreche ich Ihnen, dass ich Ihnen genug bezahle, um ein ganzes Jahr lang nicht mehr arbeiten zu müssen.«
Sie wollte ihm den Hals umdrehen. Unbedingt. Es war sein Glück, dass sie neugierig auf das war, was er ihren Eltern zu berichten haben könnte.
»Kommen Sie, Senhor Bütow.« Sie wartete, bis er sich auf den Rücken seines Wallachs geschwungen hatte. »Und wenn Sie sich für meine Hilfe wirklich erkenntlich zeigen wollen, schlage ich vor, Sie halten den Mund, bis wir angekommen sind. Sonst verfüttere ich Sie vielleicht doch an ein Krokodil.«
Er schloss zu ihr auf und ließ ein leises Lachen hören. »Ich habe nicht geahnt, dass ich hier draußen auf derart faszinierende Gesellschaft treffen würde. Verraten Sie mir Ihren Namen?«
Sie schnalzte mit der Zunge, und Luana setzte sich in Bewegung. »Cida.«
»Cida«, wiederholte er. »Ein schöner Name.« Sie spürte seinen Blick auf sich, sah jedoch nicht in seine Richtung. Sie konnte nicht sagen, warum ihre Wangen auf einmal zu glühen begannen.
Als sie den Hof erreichten, ging die Sonne gerade unter. Cida sprang von Luanas Rücken und zupfte ihren Rock zurecht, während der Besucher aus Deutschland sich aufmerksam umsah. »Ein schöner Ort. Sind Sie hier aufgewachsen?«
Sie nickte, und wieder einmal ertappte sie ihn dabei, wie er sie betrachtete. Als sich ihre Blicke trafen, wanderte wieder dieses überhebliche kleine Lächeln über sein Gesicht. »Sie denken doch nicht immer noch daran, mich an ein Krokodil zu verfüttern, oder, Senhorita?«
Cida schüttelte den Kopf. »Nein. Aber es gibt in diesem Land ja auch noch Jaguare, Würgeschlangen, Skorpione ...«
Er lachte auf. »Verhalten Sie sich wichtigen Gästen gegenüber immer so frech?«
Sie schnaubte. »Ob Sie ein wichtiger Gast sind, wird sich erst noch zeigen.«
Sein Lächeln vertiefte sich, als wüsste er etwas, was sie nicht wusste. »Sie machen sich keine Vorstellung, Senhorita. Nicht, dass Ihre Dienstherren Sie am Ende dafür tadeln, dass sie es so sehr an Respekt mangeln lassen. Doch keine Sorge ... ich werde mit Freuden ein gutes Wort für Sie einlegen.«
Bevor sie darauf etwas nicht allzu Schmeichelhaftes erwidern konnte, erklang die Stimme ihrer Mutter. »Cida!«
Erst jetzt bemerkte sie, wie nah Karl von Bütow und sie einander gekommen waren. Sie warf ihm einen bösen Blick zu, den er wiederum mit einem spöttischen Lächeln quittierte.
Lotte Engel kam heran, wie üblich mit staubigen Röcken und zu einem lockeren Knoten gebundenem Haar. Fragend sah sie zwischen ihrer Tochter und dem Gast hin und her. »Was ist denn hier los?«
»Frau Gräfin von Eichberg«, sagte Karl von Bütow zu Cidas Überraschung und deutete eine Verbeugung an. Er schien Lotte sofort erkannt zu haben. »Mein Name ist Leutnant Karl von Bütow. Sie sind wahrlich nicht leicht zu finden. Ihr reizendes Dienstmädchen war so freundlich, mich hierherzuführen.«
Lotte sah einen Moment erschrocken aus. Sie tauschte einen Blick mit Cida, die immer noch kurz davor war, den werten Herrn Leutnant zu erwürgen.
»Ich fürchte, ich muss Sie enttäuschen, Herr Leutnant von Bütow«, sagte sie dann. Sie klang vorsichtig. »Die Gräfin von Eichberg gibt es schon lange nicht mehr. Ich habe wieder geheiratet und heiße jetzt einfach nur Charlotte Engel.«
Karl von Bütow zog die Augenbrauen hoch. »Also haben Sie wirklich einen Bürgerlichen geheiratet? Nun ...« Ihm war anzusehen, was er davon hielt.
Cidas Mutter verschränkte die Arme vor der Brust. »Was führt Sie nach Brasilien, Herr Leutnant?«
»Es handelt sich um eine private Angelegenheit«, antwortete er mit einem Blick auf Cida. »Und ... bevor ich Sie über den Grund meines Hierseins informiere, würde ich es sehr zu schätzen wissen, wenn ich ein warmes Bad und eine Möglichkeit bekäme, mich umzuziehen.«
»Ein Bad würde Ihnen wirklich nicht schaden«, bemerkte Cida und warf Karl von Bütow ein süßes Lächeln zu.
Er presste kurz die Lippen aufeinander und blickte sie mit einer Mischung aus Belustigung und Ärger an. Na warte, schien sein Blick zu sagen, was sie noch mehr zum Lächeln brachte.
Lotte Engel sah ein weiteres Mal zwischen ihrer Tochter und dem Neuankömmling hin und her, und Cida bemerkte, dass ihre Mutter sich mit aller Kraft ein Lachen verbiss. Sie konnte sich nicht zurückhalten und verfiel in einen spöttischen Knicks. »Verzeihen Sie mein vorlautes Mundwerk, Frau Gräfin.«
Jetzt begann Lotte zu lachen. Cida fiel ein, als sie den verdatterten Blick ihres Gastes bemerkte.
»Hier gab es anscheinend ein Missverständnis«, erklärte Lotte schließlich und legte Cida einen Arm um die Schultern. »Herr Leutnant von Bütow, darf ich Ihnen meine Tochter, Cida Engel, vorstellen?«
Ein Ausdruck der Überraschung huschte über sein Gesicht, und ein Hauch von Rosa legte sich über seine Wangen. Doch er hatte sich sogleich wieder im Griff. »Fräulein Engel, es ist mir eine Freude, dass wir einander nun auch offiziell vorgestellt werden«, sagte er galant und ergriff ihre Hand, um einen Kuss auf ihre Fingerknöchel zu hauchen.
Cida entzog sich ihm eine Spur zu hastig und verschränkte die Arme vor der Brust. »Na, kommen Sie, Senhor Bütow«, meinte sie, als sie sich wieder gefangen hatte. »Bringen wir erst einmal Ihr Pferd in den Stall. Und dann schaue ich mal, ob ich Ayana überzeugen kann, ein Bad für Sie einzulassen.«
Es war schon dunkel, als der Gast aus Deutschland sein Bad beendet hatte und nach draußen in den Hof kam, wo die Familie Engel mit Tayo, Ayana und Yaris im Schatten der großen Palme saß. Cida spielte Dame gegen ihren Großvater, und Ayana und Yaris saßen daneben und beobachteten jeden Zug mit Argusaugen, während Lotte und Johann sich mit gedämpften Stimmen unterhielten.
Auch ein paar Saisonarbeiter waren noch auf den Beinen, tranken Schwarzbier in der Nähe des Stalles und unterhielten sich angeregt. Hin und wieder schallte lautes Lachen herüber.
»Guten Abend«, sagte Karl von Bütow zu den Anwesenden und schaute von einem zum anderen. Dabei blieb sein Blick an Cida hängen.
Sie betrachtete den Gast misstrauisch, was dieser beantwortete, indem er ihr zuzwinkerte. Sie funkelte ihn an, und seine Mundwinkel zuckten. Aus den Augenwinkeln sah sie, dass auch ihr Vater das Zwinkern bemerkt hatte, denn er bedachte den Gast mit einem finsteren Blick.
Cida wusste genau, was er von jemandem wie Karl von Bütow halten musste: Ihm war an der Nasenspitze anzusehen, dass er den jungen Mann am liebsten in hohem Bogen vom Hof geworfen hätte. Adliger Besuch aus Deutschland konnte nichts Gutes bedeuten. Nicht ohne Grund hatte Charlotte von Eichberg, spätere Charlotte Engel, ihre Spuren verwischt, so gut es ging.
»Leutnant von Bütow«, begann Johann Engel jetzt und erhob sich, um dem Besucher die Hand zu schütteln. »Es ist uns eine Ehre, Sie auf unserem Hof zu begrüßen.«
Karl von Bütow erwiderte den Händedruck mit einem blasierten Lächeln. »Herr Engel, ich freue mich, hier zu sein. Einen schönen Hof haben Sie ... und eine reizende Familie.«
Cidas Vater nickte knapp. »Es liegt mir fern, unhöflich zu sein, Herr Leutnant«, erwiderte er. »Aber nun interessiert mich doch, was Sie nach Brasilien – und auf unseren Hof führt.«
Der Gast lächelte unverbindlich. »Natürlich. Nur ...« Er blickte einmal in die Runde. »Es handelt sich um eine sehr delikate Familienangelegenheit, daher ...«
»Wir gehen ins Haus«, erklärte Lotte. Sie war blasser als gewöhnlich, und Cida begann zu argwöhnen, dass ihre Mutter längst ahnte, warum dieser überhebliche Mensch den weiten Weg von Deutschland nach Brasilien angetreten hatte, um sie zu finden.
Johann hob kurz die Augenbrauen, dann nickte er. Auch er war sichtlich angespannt. »Am besten, wir gehen in die Küche.«
»Dann nehmt das Geschirr mit«, bestimmte Ayana auf Portugiesisch und drückte Johann eine leere Schüssel in die Hand, aus der sie vorhin noch Feijoada, Ayanas köstlichen Bohneneintopf, gegessen hatten.
»Ich erledige das schon«, erklärte Cida hastig und machte sich daran, die Schüsseln einzusammeln. Sie hatte längst nach einem Vorwand gesucht, bei dieser Unterhaltung dabei sein zu können.
Sie drückte Ayanas Arm und gab ihr einen Kuss auf die Wange. »Jetzt musst du Großvater für mich schlagen«, sagte sie und deutete auf das Spielbrett.
Ayana zwinkerte ihr verschwörerisch zu, nahm den Platz Tayo gegenüber ein und beugte sich über das Spiel.
»Aber ...« Karl von Bütow hatte anscheinend genug von ihrer Unterhaltung verstanden, um jetzt missbilligend die Augenbrauen zu heben. »Bei allem Respekt, doch die Themen, die wir zu besprechen haben, sind wohl nicht für die Ohren einer jungen Dame bestimmt.«
»Ich werde schon nicht in Ohnmacht fallen«, gab Cida zurück und ging voran, ohne sich um den ärgerlichen Blick des Leutnants zu scheren.
In der Küche machte sie sich daran, ganz langsam aufzuräumen, während ihre Eltern sich mit Karl von Bütow am Tisch niederließen.
»Nun«, begann Cidas Vater. »Sie haben ja ein großes Geheimnis um den Grund Ihres Hierseins gemacht. Also? Wir hören.«
Der Leutnant von Bütow räusperte sich. »Und das aus gutem Grund, Herr Engel. Ich komme am besten sofort zur Sache.« Er wandte sich an Lotte. »Ich denke, der Name von Neuenstedt sagt Ihnen etwas?«
Cidas Mutter wurde noch eine Spur blasser. »Ganz recht.«
Karl von Bütow nickte beifällig. »Nun, es ist ebenjene Familie, in deren Auftrag ich nach Brasilien gereist bin.« Er blickte Lotte prüfend an. »Ursprünglich ging es bei meinen Nachforschungen um das spurlose Verschwinden Ihres Mannes, Graf Andreas von Eichberg. Wie Sie vielleicht wissen, verschwand er vor etwa einundzwanzig Jahren spurlos, und zwar irgendwo in Amerika. Hier in Brasilien, um genau zu sein. Der alte Graf von Neuenstedt suchte viele Jahre lang nach einer Spur von Andreas von Eichberg. Nach seinem Tod vor zwei Jahren erbte sein ältester Sohn Friedrich nicht nur seine Besitzungen, sondern auch diese schier ausweglose Suche. Er heuerte mich an – und nun bin ich hier.«
Cida, die bis zu diesem Moment fein säuberlich Schüssel für Schüssel gespült und abgetrocknet hatte, hielt inne und drehte sich zu ihren Eltern und Karl von Bütow um.
Ihr Vater hatte die Unterarme auf den Tisch gestützt, und Cida sah, dass er vor Anspannung bebte. Ihre Mutter Lotte hingegen war mittlerweile so bleich wie der Tod.
Cida dachte mit einem Schaudern an die sterblichen Überreste des Grafen von Eichberg, die in irgendeinem Sumpf von Monte Mor lagen. Mit klopfendem Herzen musterte sie Karl von Bütow und verfluchte dabei stumm ihre eigene Dummheit. Sie hätte ihn nicht hierherbringen dürfen. Ihre Eltern hatten immer befürchtet, dass dieser Tag kommen würde: der Tag, an dem jemand aus der Vergangenheit auftauchen würde, um den Tod des verschollenen Grafen Andreas von Eichberg zu sühnen.
»Warum sind Sie hier?«, fragte Lotte schließlich leise.
Karl von Bütow straffte sich kaum merklich. »Während meiner Nachforschungen überprüfte ich verschiedene Passagierlisten von Schiffen, die während der späten 1880er-Jahre aus Deutschland ausliefen. Sie können sich meine Aufregung vorstellen, als ich die Namen Charlotte und Johann Engel auf einer der Listen fand. Ich konnte natürlich nur vermuten, dass Sie es sind – aber ich glaube nicht an Zufälle, also folgte ich der Spur. Erst versuchte ich, mit den offiziellen Stellen hier in Brasilien zu kommunizieren, doch das war nicht so einfach. Ich erfuhr lediglich, dass Ihr Schiff niemals in Rio de Janeiro angekommen ist. Ich stellte irgendwann fest, dass ich auf diese Weise keine Antwort bekommen würde. Also schickte mich der Graf von Neuenstedt nach Brasilien, um persönlich nachzuforschen.
Ich reiste daher nach Rio und fand dort heraus, dass die Passagiere der Amanha 1887 in Santos registriert worden waren – allerdings wurde das in Rio nie so aufgezeichnet. Die wenigen Unterlagen, die noch existierten, waren ein heilloses Durcheinander und unvollständig noch dazu. Das hat es schwierig gemacht.«
Karl von Bütow runzelte die Stirn. »Da lobe ich mir die preußische Bürokratie. Nun, jedenfalls ... Von Santos aus habe ich mich dann durchgefragt. Es hat eine Weile gedauert, doch dann hörte ich von einem Gestüt in der Nähe der deutschen Kolonie Monte Mor ... Ich machte mich also auf den Weg nach Norden, und heute ...« Er sah Cida an. »Heute begegnete ich Ihrem Fräulein Tochter. Eine der erfreulicheren Begegnungen auf meiner Reise, so viel kann ich Ihnen versichern.«
Nach seinem Bericht war es eine ganze Weile still.
»Was wollen Sie von uns?«, fragte Cidas Vater schließlich. Er sprach ganz leise. »Was will die Familie von Neuenstedt? Wir haben Ihnen nichts zu sagen.«
Karl von Bütow lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Trotz des drohenden Tonfalls seines Gastgebers wirkte er gelassen, fast schon belustigt. »Keine Sorge, Herr Engel. Ich bin nicht in Brasilien, um Ihrer Familie Schwierigkeiten zu machen. Sehen Sie: Der Graf von Eichberg wurde vor vielen Jahren für tot erklärt, und der junge Graf von Neuenstedt ist als sein nächster männlicher Verwandter nun der Besitzer von Gut Rosenthal. Er interessiert sich für seine Familiengeschichte. Das ist alles. Nennen wir es ...« Ein feines Lächeln. »... einen kostspieligen Zeitvertreib.«
»Nun, hier werden Sie nichts finden«, erwiderte Johann Engel. »Wir wissen nichts über das Schicksal des Grafen von Eichberg, und wir haben auch keinerlei Interesse an diesen alten Geschichten. Wenn Sie nur deshalb hier sind ...«
»Ich habe Sie gefunden, oder etwa nicht?«, sagte Karl von Bütow. Immer noch lag dieses gelassene Lächeln auf seinem Gesicht. »Das ist an und für sich schon ein großer Erfolg für den Grafen von Neuenstedt. Wenn Sie nicht möchten, dass ich weiterspreche, Frau Engel, werde ich das respektieren. Aber ich habe im Zuge meiner Nachforschungen auch einige Dinge herausgefunden, die Sie interessieren dürften.«
Cida musterte ihn verstohlen. Er wirkte wie elektrisiert – als wäre dies der interessanteste Tag seines Lebens. Seine Augen funkelten, und das ließ ihr Misstrauen weiter anwachsen. Irgendetwas stimmte nicht mit diesem Kerl.
»Und was haben Sie herausgefunden?«, fragte Lotte.
Ihr Gast räusperte sich. »Wieso fangen wir nicht bei Ihrer Familie an? Bei Ihren Eltern und Ihrem Bruder?
Alle Farbe wich aus Lottes Gesicht. »Was wissen Sie?«, flüsterte sie.
Eine Gänsehaut wanderte über Cidas Körper, trotz der drückenden Hitze, die das Land auch jetzt, am Abend, noch fest im Griff hatte. Sie wusste, ihre Mutter hatte jahrelang versucht, etwas über das Schicksal ihrer Eltern und ihres Bruders Franz von Breskow herauszufinden – jedoch erfolglos. Die Briefe, die sie mit äußerster Vorsicht über eine polnische Freundin verschickt hatte, waren unbeantwortet geblieben. Es war, als hätte die Familie von Breskow niemals existiert. Nach langen Jahren erfolgloser Suche hatte Lotte Engel ihre Bemühungen schließlich eingestellt, auch in der Angst, Feinde aus der Vergangenheit könnten sie über die Nachverfolgung der unter falschem Namen verfassten Briefe hier in Brasilien aufspüren.
Der Leutnant von Bütow verschränkte die Hände auf der Tischplatte. »Ich werde wohl am besten ganz am Anfang beginnen. Im Sommer 1887, nach Ihrer Flucht aus Pommern, wurden Ihre Eltern sowie Ihr Bruder Franz von Breskow zu Feinden des Staates erklärt. Sie wurden festgesetzt und zu Zuchthausstrafen verurteilt: Ihre Eltern bekamen jeweils fünf, Ihr Bruder wegen wiederholter Fahnenflucht fünfzehn Jahre. Ihr Titel und ihr Vermögen wurden ihnen vom Kaiser selbst aberkannt. Eine unschöne Sache, schließlich ist der adlige Stand heilig. In diesem Falle jedoch war eine andere Lösung schlicht undenkbar; immerhin hat Ihre Familie sich des Staatsverrats schuldig gemacht. Das Gut ging schließlich in die kaiserliche Verwaltung über.«
Ihre Mutter war während der Erzählung des jungen Leutnants noch blasser geworden. Sogar aus ihren Lippen war die Farbe gewichen. Papa tastete nach ihrer Hand und starrte währenddessen Karl von Bütow wütend an – so als wäre dieser allein schuld an dem Schicksal der Familie von Breskow.
Cida musterte den jungen Mann. Seine Miene hatte sich kaum verändert. Von dem offenkundigen Zorn ihres Vaters ließ er sich anscheinend nicht beunruhigen.
Irgendwann schien Cidas Mutter sich wieder einigermaßen gefasst zu haben. »Was ist danach mit meiner Familie geschehen?«, fragte sie. »Wissen Sie darüber etwas?«
Karl von Bütow nickte. »Ihre Eltern ... Mein aufrichtiges Beileid, Frau Engel. Ihre Eltern starben noch während der Haft. Ihr Vater erlag im Jahr 1887 einem Herzanfall. Ihre Mutter verschied im Winter 1891 infolge einer Lungenentzündung, ein paar Monate vor ihrer Entlassung.«
Lotte Engel klammerte sich an die Hand ihres Mannes. Dieser sah jetzt nicht mehr wütend aus, sondern musterte stattdessen besorgt seine Frau.
Schließlich wandte sich Cidas Mutter wieder an Karl von Bütow, der die Szene schweigend beobachtet hatte. »Und mein Bruder?«
»Er wurde vor einigen Jahren aus der Haft entlassen«, antwortete Karl von Bütow. »Danach verschwand er, und man hörte für eine lange Zeit nichts mehr von ihm. Bis zum Dezember letzten Jahres.«
Cida hielt den Atem an. Konnte das sein? Würde ihre Mutter vielleicht nach all den Jahren der Ungewissheit mit ihrem Bruder wiedervereint werden?
Karl von Bütow straffte sich. »Wie ich schon sagte, lange Zeit wusste niemand, wo Franz Breskow sich aufhielt oder ob er überhaupt noch am Leben war. Erst im vergangenen Jahr habe ich erfahren, dass es eine Person gab, die anscheinend ihre letzten Jahre damit zugebracht hat, Franz Breskow aufzuspüren: Ihr Name ist Annemarie Brieger.«
Lotte Engel schnappte nach Luft. »Mamsell Brieger! Natürlich! Aber warum hätte sie denn nach Franz suchen sollen?«
Cida gab es auf, ihre Neugier verbergen zu wollen. Sie lehnte sich mit verschränkten Armen gegen die Spüle und sog jedes Wort in sich auf, das Karl von Bütow von sich gab.
Dieser wirkte auf einmal grimmig. »Bevor ich weiterspreche, Frau Engel, müssen Sie verstehen, dass Mamsell Brieger in den letzten Jahren immer ... verwirrter geworden ist. Sie hat bis zu ihrem Tod im letzten Winter auf Gut Rosenthal gedient, doch mit ihren bald siebzig Jahren war sie dafür eigentlich zu alt. Sie war sehr zerstreut. Manchmal kam sie hoch in die Räume der Herrschaft und wusste auf dem letzten Treppenabsatz nicht mehr, weshalb sie den Gang gemacht hatte. In der gleichen Zeit muss sie begonnen haben, Nachforschungen über den Verbleib Ihres Bruders anzustellen ... und schließlich ist es ihr tatsächlich gelungen, ihn aufzuspüren.«
Der junge Leutnant räusperte sich. »Am letzten Weihnachtsfest verschwand sie dann von Gut Rosenthal. Ihren ... Leichnam fand man ein paar Tage später im Wald, nahe eines kleinen Dorfes – viele Kilometer von Gut Rosenthal entfernt. Sie muss den ganzen Weg zu Fuß gelaufen sein.« Er schüttelte den Kopf. »Der Graf von Neuenstedt und seine Familie hatten Weihnachten auf Gut Rosenthal verbracht. Als man dort von Mamsells Verschwinden erfuhr, wurden natürlich sofort Suchtrupps organisiert. Doch niemand hätte sich je denken können, dass sie einen so weiten Weg gegangen ist, allein, zu Fuß, in ihrem hohen Alter, durch die Eiseskälte und die verschneiten Wälder.
Ich habe dann versucht, in Erfahrung zu bringen, was sie an diesen einsam gelegenen Ort verschlug – und hatte bald meine Antwort. Franz Breskow lebt dort, in einem Dorf namens Krackow. Am ersten Weihnachtstag stand Mamsell Brieger vor seiner Tür – mitten in der Nacht. Sie sagte etwas sehr Rätselhaftes. Dann ging sie davon, in den Wald. Und kam nicht wieder zurück. Ihr Bruder ist ... versehrt, Frau Engel. Er konnte ihr nicht folgen.«
»Was hat Mamsell Brieger meinem Bruder vor ihrem Tod anvertraut?«, fragte Cidas Mutter schließlich.
»Wie bereits erwähnt, sie war verwirrt«, antwortete Karl von Bütow nach kurzem Zögern. »Sie sagte, und ich zitiere: Helena von Eichberg ist am Leben.«
Stille. Für kurze Zeit waren sie alle wie erstarrt.
»Mama?«, flüsterte Cida irgendwann. Lottes Hand war zu ihrer Brust gefahren, ihre Augen hatten sich geweitet.
»Wie können Sie es wagen?« Johann war aufgestanden. »Sie haben keine Ahnung, was Sie hier anrichten. Verlassen Sie dieses Haus. Auf der Stelle.«
Karl von Bütow ignorierte ihn und wandte sich stattdessen an Lotte. »Frau Engel, ich versichere Ihnen, das Misstrauen Ihrer Familie kann ich verstehen. Aber ich lüge nicht.«
Johann Engel schob sich zwischen den Besucher und seine Frau. »Ich sagte ...«
»Lass ihn ausreden, Papa«, bat Cida. Es tat ihr weh, ihre Mutter so zu sehen. Ihr Verlust hatte nie aufgehört, sie zu quälen. Wenn es jetzt auch nur die geringste Möglichkeit gab zu erfahren, was damals wirklich geschehen war, dann mussten sie diesem Mann zuhören – ganz gleich, wie sehr er Cida auf die Palme brachte.
Langes Schweigen, alle Blicke lagen auf Lotte Engel, die schließlich kaum merklich nickte, ohne einen von ihnen anzusehen.
Cidas Vater atmete tief durch und setzte sich wieder.
»Frau Engel, ich weiß nicht, ob das, was Mamsell Brieger Ihrem Bruder in dieser Nacht anvertraut hat, die Wahrheit ist«, fuhr Karl von Bütow fort. »Aber Graf Friedrich von Neuenstedt ist fest entschlossen, die Geheimnisse seiner Familie zu lüften. Er hat mich angewiesen, jeden Stein umzudrehen, und das habe ich getan. Ich habe Sie gefunden. Und wenn ich hier in Brasilien fertig bin, werde ich in Erfahrung bringen, was damals wirklich mit Ihrer Tochter geschehen ist. Das verspreche ich Ihnen.«
Nach dem Gespräch in der Küche ging Cida hinaus und sog die kalte Nachtluft tief in sich ein. Die Worte ihres Besuchers hallten noch in ihr nach, und sie sah noch immer den Gesichtsausdruck ihrer Mutter vor sich. Wie war das alles nur möglich?
Sie blickte hinüber zu dem Hügel, auf dem ihre Eltern nicht nur ihrer leiblichen Mutter Filipa, sondern auch Helena von Eichberg einen Grabstein gesetzt hatten. Was, wenn sie wirklich am Leben war? Was würde das bedeuten? Sie versuchte, sich Helena von Eichberg vorzustellen. Wenn sie am Leben war – wer mochte sie dann heute sein? Wusste sie, dass sie als Baby von ihrer Mutter getrennt worden war?
Der Klang von Schritten riss sie aus ihren Gedanken.
»Fräulein Engel«, sagte Karl von Bütow und trat zu ihr.
»Herr Leutnant ...«
Er wandte sich ihr mit einem verschmitzten Lächeln zu. »Ich weiß, es ist spät ... doch wären Sie vielleicht so freundlich, mich etwas auf dem Hof herumzuführen? Ich würde ihn mir gern ansehen.«