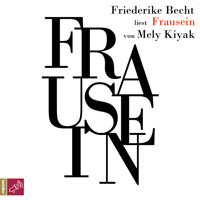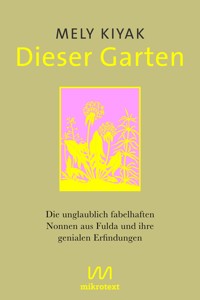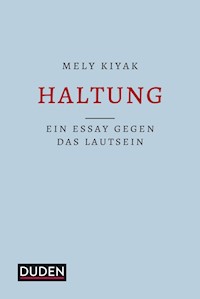12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mikrotext
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Ich hoffe auf Zeichen, Erkenntnis, irgendwas. Aber hier fährt nur die Straßenreinigungsmaschine auf und ab."
Mely Kiyak spaziert aufmerksam durch die Zeit. Mit unnachahmlich gewitzter Stimme und poetischem Blick begegnet sie dem Leben und schreibt mit: Gespräche mit Handwerkern, Freude in der Philharmonie, große Lust auf Landschaft, Lyrik und andere Lektüren. Auch Veränderungen im gesellschaftlichen Klima nimmt sie wahr, ohne zu beschönigen – und bleibt ihrem Schreibauftrag immer treu. Nicht verzagen, nicht verhärten. Gute Momente sind eine fabelhafte Hymne auf den Alltag und ein großes Lob der Menschlichkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Das Buch
Die Autorin
Titelseite
2 vorangestellte Zitate
Gute Momente
Lesetipp
Über den Verlag
Das Buch
„Ich hoffe auf Zeichen, Erkenntnis, irgendwas. Aber hier fährt nur die Straßenreinigungsmaschine auf und ab.“
Mely Kiyak spaziert aufmerksam durch die Zeit. Mit unnachahmlich gewitzter Stimme und poetischem Blick begegnet sie dem Leben und schreibt mit: Gespräche mit Handwerkern, Freude in der Philharmonie, große Lust auf Landschaft, Lyrik und andere Lektüren. Auch Veränderungen im gesellschaftlichen Klima nimmt sie wahr, ohne zu beschönigen – und bleibt ihrem Schreibauftrag immer treu. Nicht verzagen, nicht verhärten. Gute Momente sind eine fabelhafte Hymne auf den Alltag und ein großes Lob der Menschlichkeit.
Die Autorin
Mely Kiyak ist Autorin und vielfach ausgezeichnet. Unter anderem mit dem Theodor-Wolff-Preis, dem Kurt-Tucholsky-Preis und zuletzt mit dem Heinrich-Mann-Preis der Akademie der Künste. Zuletzt erschienen bei Hanser Frausein (2020), Werden sie uns mit FlixBus deportieren? (2022) und Herr Kiyak dachte, jetzt fängt der schöne Teil des Lebens an (2024) und Thomas Mann. Deutsche Hörer! (2025) im S. Fischer Verlag. Dieser Garten (2024) und Gute Momente (2025) erschienen im mikrotext Verlag.
Mely Kiyak
Gute Momente
Die Liebe zum Wunderbaren gehört eigentlich den Poeten.Johann Wolfgang von Goethe
Das wichtigste Buch ist der Mensch.Hacı Bektaş Veli
Noch einmal die Alleen entlanglaufen, wo das Licht eine Schneise durch die Kronen bildet und ein Schwarm Vögel in die Luft hinaufwirbelt. Noch einmal ins Becken gleiten und ein paar Bahnen schwimmen. Einmal noch über die Felder blicken und am Friedhof vorbeiradeln, wissend, ab hier sind es noch zweiundzwanzig Minuten bis nach Hause. Noch einmal in das Vorvorgestern hinabsteigen, wo die Kindheit in Kapiteln beschrieben fein säuberlich in die Gedanken gelocht und abgeheftet sind. Wo Mutter schimpft, weil die Wäsche noch nicht aufgehängt ist, und Vater sich schützend vor uns stellt. Wo Mutter in die Schule geht und uns den Weg mit einer Machete durch das Dickicht von Vorurteilen frei schlägt, und Vater meint, ein gemeinsamer Besuch in der Eisdiele sei ebenso wichtig für die Zukunft. Aber dann ist auch gut. Zwinge mich, im Hier weiterzumachen. Hier müssen noch ein Dienstag und Mittwoch und Donnerstag bewältigt werden, das Wochenende und folgende.
Wortschutt. Umgeben von der manipulativen Sprache der Werbeindustrie, der von Politagenturen ausgedachten, zugrunde gerichteten Parteisprache des Miesmachens und Fehlerbeschwichtigens, der Heilsversprechen oder Tod androhenden theistischen Sprache, dieser durch so viele Münder durchgenudelten zweckerfüllenden Sprache, in der die Codes und Chiffren das Sagen haben, fließen wir durch die Worte. Und durch das Internet. Wo das Leben als eine Ansammlung von Links in Bio, Hinweisen, Hashtags zusammengefasst ist, wo das Mittelmaß aufpoliert durch grelles Licht noch durchschnittlicher leuchtet als, so vermute ich, geplant. Da liegen sie. Verkümmerte und amputierte Wortstummel, Silbenstumpf. Am späten Nachmittag, wenn ich an den Tisch zurückkomme, gilt es, diese Wörterhalden in einem gewaltigen Akt der Amnesie gleichsam wie Hundescheiße am Schuh an der Schwelle zum privaten Gedanken abzustreifen. Du willst fliegen? Du musst alles hinter dir lassen. Einen Spalt finden und rasch in die Geschichten schlüpfen. Erinnern als Widerstand, erzählen, unbeugsam, daran denken, wie Emin amcas Foto auf Seite Eins veröffentlicht wurde, wie er kopfunter in der Baugrube lag, Beine und Füße in den Himmel gestreckt, ein Schlappen hing am Fuß. Große Überschrift: Wer kennt diesen Mann? Ich erkannte den Schlappen, wir alle erkannten diesen Schlappen, rennen auf die Polizeiwache, rufen, rufen, wo ist er?, er gehört zu uns, diesen Schlappen hatten wir ihm gekauft und sanft über seine Füße gezogen, zurück dahin. Den Wegrand mit Anekdoten bepflanzen, unaufhörlich erschüttern und erschüttern lassen. Die Geschichten. Habe schon so viel Verrücktes, Unwahrscheinliches versucht und lande doch wieder in meinen mit sieben Prozent ermäßigt umsatzversteuerten Geschichten, weil, und ich betone das hier gerne Silbe für Silbe: es nicht anders geht.
Liebe ist, so sagen die Pessimisten, eine Insel im Meer des Unmöglichen. Liebe ist, so sagen die Praktiker, eine Entscheidung. Liebe, watt soll ditte sein?, fragt mein Nachbar Herr Krause, der mit seiner Frau seit sechs Jahrzehnten verheiratet ist. Ick hab für sowatt keen’ Kopp. Wenn man jung ist, hat man sich eine Frau zu suchen, findet er, weil alleene is doch ooch nüschte.
Meine Freundin Devrim wird vierzig und träumt von einem tollen Mann, mit dem sie eine große Familie gründen möchte. Sie kommt gar nicht auf die Idee, dass beides gleichzeitig möglicherweise nicht mehr klappen könnte. Und Cate, von der ich nicht glaubte, dass sie sich so bald von ihrem Liebeskummer erholen würde, hat in der Zwischenzeit schon wieder zwei neue wilde Lieben gehabt. Doch jedes Mal, wenn sie meint, dass aus dem Date mehr werden könnte als nur ein Liebesabenteuer, stellt sie nach kurzer Zeit fest, dass bei Nacht die Dinge so viel einfacher sind und bei Tageslicht alles nur kompliziert.
Liebe, so staune ich, will bei manchen einfach nicht klappen. Und bei anderen geschieht sie wie nebenbei. Ich habe auch keine Ahnung, warum das so ist, und als Ratgeberin tauge ich nicht. Aber eine Sache fiel mir doch auf. Alle meine Freundinnen, die sich mit ihrer Selbstkritik zerfleischen, sich selbst nie gefallen wollen, die immer noch etwas finden, das sie optimieren oder verschönern könnten, werden im Augenblick der Liebesanbahnung auf groteske Weise wählerisch und ungnädig. Kaum jemand ist gut genug für sie. Plötzlich empfinden sie sich als unfehlbare Gottheiten. Bei Şirin ist das so, bei Emrah und sogar bei dem über siebzigjährigen Walter. Sie sezieren ihr Gegenüber in kleinste Einheiten und rezensieren derart vernichtend, dass aus dem Subjekt der Begierde ein in die Tonne getretenes Objekt wird.
Nebenbeibeobachtungen sind das. Keine Soziologie noch Menschenkenntnis. Aber so wie ich glaube, dass ein Schriftsteller in die Verse fallen kann und ein Philosoph in Erkenntnis, kann die Einsamkeit durch das Dickicht der dunklen Versuchungen seinen Weg ins Freundliche finden. Man muss es vielleicht wollen, das Meer des Möglichen.
Dort, wo ich oft dran denke, zünden die alten Männer ihre Zigaretten noch mit Streichhölzern an. Dabei streichen sie das Zündholz nicht etwa im ausholenden Bogen, als würden sie Geige spielen, sondern wischen rasch und kurz über das Zündblatt und beugen sich dann mit der Kippe im Mund in die halb geöffnete Faust. Verharren einen Moment und machen ein paar Probepaffer. Das Streichholz werfen sie beiläufig, aber lässig von sich, richten sich auf und klopfen eventuell ein paar Tabakkrümel vom Breitbandcord oder der fein gestreiften Wollhose. Diese Herren, sagte ich schon, dass es alte, uralte Männer sind?, sehen im Gesicht wie faltiges Atlasgebirge aus. So einen amca sah ich auf dem Ku’damm, vor Yves Saint Laurent, wie er seinen otobüs verpasste und sich die Wartezeit mit seiner sigara verkürzte. Er trug gebügelte Heimat und bewegte sich wie Vergangenheit.
Yalancı bahar, erklärt Vater mir das Phänomen, das Rosen viel zu früh knospen, und alle anderen Pflanzen Wochen zu früh saftiggrün herausschießen lässt. Der falsche Frühling tut nur so, als ob. Es werden noch die späten Februarwinde vom Meer erwartet. Bis zum April werden sie die Böden kühlen. Alles, was bis dahin grünte, wird dahin sein.
Die Welt wirbelt falsch herum, versucht Vater sich in Wolkenkunde. Dann legt er auf. Er wird nun seinen Korb nehmen, es ist Sonntag, er will zum pazar. Es gilt die brüksel lahanası nicht zu verpassen, den Brüsseler Kohl, den er noch aus Deutschland kennt und so sehr mag. Wie er wohl mittlerweile aussieht, der alte baba, der mit seinen kleinen, braunen Händen jeden Rosenkohl am Marktstand einzeln inspizieren und hoffen wird, dass ihn eine ägäische Hausfrau anspricht und fragt: Mein Herr, wie bereiten Sie es zu? Er kann dann antworten, meine Dame, ich blanchiere ihn und anschließend serviere ich ihn in Butter geröstet mit knusprigen Mandelblättern. Dann wird er sich erinnern, dass Inflation herrscht, und nachschieben: Man könnte auch alte Brotbrösel knusprig braten, das schmeckt noch köstlicher. Die Mandeln aus der vergangenen Ernte taugen ohnehin nichts. Das sind gerade seine Themen. Das Wetter, die Preise auf dem Markt, die ganze kleine Welt der großen Sorgen.
Ich war çok ama çok berührt, als Vater anrief und mitteilte, dass Onkel Turhan immer noch lebt. Es war nämlich so: Cousine Leyla hatte, überorganisiert wie sie ist, das Essen für das Begräbnis für den nächsten Morgen bestellt, weil ihr die Ärzte gesagt hatten, es dauere allenfalls ein paar Stunden noch, keineswegs erlebe Onkel Turhan den Sonnenaufgang. Bei solchen Temperaturen bringen sie die Toten gar nicht erst in die Kühlkammern, sondern waschen und beerdigen sie sofort. Also saß die Trauergemeinde am nächsten Morgen unter dem großen Feigenbaum und aß Reis mit Huhn. Onkel Turhan gurgelte derweil aber noch an den Geräten. Das ist nun drei Wochen her und ganz Karlıova spricht vom Reis mit Huhn, dem ersten und einzigen Leichenschmaus ohne Leiche, und meine Cousine ist stocksauer, weil der Arzt, wie sie sagt, „nur Scheiße“ erzählt habe.
Leyla hat im Krankenhaus rumgeschrien, wir nehmen den Vater mit, wir nehmen ihn derhal mit, der lebt sicher noch yüz yıl, also hundert Jahre, und wie sie an seinem Bett rüttelt und der Arzt sie aber aus dem Zimmer scheuchen will und die Krankenschwestern zur Hilfe eilen, um die sterbende Geisel zu befreien und meine hala auch noch kommt und rumschreit, fliegt Onkel Turhans Seele unbemerkt aus dem Zimmer, fliegt über den Feigenbaum hinauf in den Himmel, und ich schaue gerade aus dem Fenster raus, hier in Berlin, und sehe seine Seele an der Mercedes Benz Arena vorbeifliegen. Ich sage, Vater, leg auf, er hat es geschafft, Onkel Turhan macht gerade seine Abschiedsrunde, und Vater lacht und meint, ne işi var orada?, ist er Tourist oder tot?, und ich winke Onkel Turhan zu und flüstere: Du musst jetzt heim, die drehen sonst alle richtig durch.
Nun endlich besucht der Frühling das Jahr. Man merkt es daran, dass an der großen Kreuzung in Berlin Prenzlauer Berg die Jongleure stehen. Während der Rotphase stellt sich ein Artist vor die Ampel und wirft drei Keulen in die Luft. Natürlich landet, wie alle Frühlinge zuvor, keine einzige wieder in seinen Händen. Schnelles Einsammeln der Jonglierkeulen vom Asphalt, kurze übertrieben knackige Verbeugung vor dem Publikum. Dann läuft er rasch los, um die Gage an den Autofenstern einzutreiben. Die Autofahrer drücken auf ihre elektrischen Fensterheber, damit die Scheiben rechtzeitig oben sind, bevor der Künstler seine offene Hand reinsteckt.
Das hier ist Berlin. Hier müsste man während der Rotphase eine Operation am offenen Herzen zeigen, um Interesse zu ergattern. (Knete würde trotzdem niemand spendieren. Dazu müsste die OP von einem blinden Pudel durchführt werden, damit hier einer was springen lässt.)
Nach den Eisheiligen kommt die eigentliche Attraktion. Dann wird ein anderer Jongleur auf der Kreuzung stehen. Sobald die Ampel auf Rot schaltet, schnallt er vor den Augen der Autofahrer seine Beinprothese ab und beginnt einbeinig mit Reis gefüllten Stoffbällen zu jonglieren. Auch er – natürlich! – kann nicht jonglieren. Mühsam kriecht er Frühjahr für Frühjahr mit seinem Stumpf über den Asphalt und hebt theatralisch die Bälle auf und die Arme in die Höhe, „es hat nicht sollen sein“.
Das kann das Berliner Publikum natürlich gar nicht gut leiden. Die ganze Bein-dran Bein-ab-Aktion weckt natürlich gigantische Erwartungen. Es wird mit Lichthupe gebuht und manch ein Trucker ruft genervt vom Bock herab: „Zisch ab, du Vogel!“ Dem einbeinigen Artisten macht das nichts aus. Er humpelt stoisch die Autos ab, in der Hoffnung, Kasse zu machen. Denn immer gibt es diese eine Person, die wahrscheinlich Sozialpädagogik studiert hat und attestiert, dass er „ditt janz janz toll jemacht hat“, richtig dufte, „wie Sie sich nicht unterkriegen lassen“, und zwei Euro zahlt. Berliner Frühling. Violette Krokusse, jonglierende Dilettanten. Es geht jetzt langsam los.
Vater schickt seinen Newrozgruß. Erst auf kurdisch, dann auf türkisch. Newroz und Nevruz. Später wird er auch noch auf Deutsch schreiben. Vater denkt an alle Kinder, Sprachen, Übersetzungen. Irgendjemand in der Familiengruppe wird auf Englisch antworten.
Was wir uns eigentlich an diesem Neujahrstag sagen wollen, werden wir uns nicht schreiben können. Mit Newroz feiern wir den Frühling und Jahresbeginn. Newroz war und ist immer politisch. Meine Grußbotschaft an meine Freunde wird „Hoffnung, Liebe, Widerstand“ heißen und „Vergesst nicht den Mut, das Lachen, das Feuer“. In der Familiengruppe lasse ich den Widerstand und die Hoffnung weg. Aus dem Feuer mache ich Trost. Aus dem Mut Narzissen und Hyazinthen.
Zu Newroz lassen sie Leute von der Straße verschwinden. Plündern die Telefone, spitzeln die Nachrichten durch. Schlucken die Freiheit, als würden sie ein Glas Wasser trinken. Will nicht schweigen und vergessen und so tun, als gäbe es unser Fest nicht. Als gäbe es uns nicht. Will aber auch nicht gefährden, keinen Ärger machen. Hilflos senden wir uns Bilder von Blumen in Gelb, Rot, Grün, hin und her. Und erinnern uns gegenseitig daran: Löscht die Blumen!
Alfons hat ein Ziehharmonikagesicht. Selbst wenn er keine Zweifel oder Bedenken hat, bebt die Stirn in tiefen Falten, die beiden Straßen von seiner Nase zum Kinn sind zwei vertrocknete Flussbetten. Er ist wie eine Ödon-von-Horvath-Figur, inszeniert von Christoph Marthaler an der Volksbühne Anfang der 2000er-Jahre. Alfons Stimme knarzt, als wären seine Stimmbänder alte Dielen. Wenn man ihn fragt, wie es ihm geht, knarrt er, ja Gott, wie geht es einem? Die meisten Menschen lassen sich von dieser Art Antwort, die daraus besteht, die Frage nicht zu beantworten, einschüchtern und hauen sofort ab. Auch deshalb sitzt Alfons oft alleine. Selbst in Familienrunden wirkt er, als hätte er von innen abgeschlossen. Ob er grübelt oder zuhört? Niemand weiß es. Wahrscheinlich nicht mal Alfons, ja Gott, was grübelt man denn so?
Neulich packte mich der Kampfgeist oder irgendein anderes albernes Motiv. Ich sagte, Alfons, du siehst schlecht aus. (Er sah wirklich schlecht aus.) Ich dachte mir, fragste mal so ungehörig intim, penetrant und plump, wie es nur geht. Alfons, was genau fühlst du? Er schaute mich erschrocken aus seinen freundlichen, wässrig blau leuchtenden Augen an und ächzte ungeölt aus seinen Alfonsdielen: Ja Gott, was fühlt man genau?
Ich ging nicht weg. Richtig genial war ich. Ich schaute, er schaute. Und kurz bevor ich dachte, nee, das halte ich doch nicht durch, ich verschwinde, nahm er seine knorrige Hand und strich sie über sein von den vielen Bestrahlungen zerfurchtes Krebsgesicht. Ich konnte richtig sehen, wie die Ziehharmonika in glatt aussah, bevor er sein Gesicht losließ und die alten Flussbetten sich wieder bildeten. Alfons hatte offenbar tief in seiner Gefühlslandschaft gestöbert und kam mit diesem tollen Satz empor, der genauso auch aus Kasimir und Karoline oder Geschichten aus dem Wiener Wald stammen könnte.
Alfons sagte: Es drückt alles auf die Moral.
Abends um elf liegen die Obstblüten wie weißes Konfetti neben der vierspurigen Straße. Alle paar Meter steht heiteres, friedliches Bürgersteigvolk mit Flaschen in der Hand herum. Vor dem nächsten Späti ist gerade Pause, drinnen läuft zweimal die Woche Stand-Up-Comedy. Morgen, das weiß ich, weil das hier immer so ist, wird ein aufgebrachter Straßenbahnfahrer aus dem offenen Fenster ein paar Touristen als Fotzen beschimpfen und der taubstumme Conrad mit seiner Straßenkehrmaschine pünktlich um die Mittagszeit um die Ecke vom kurdischen Gemüseladen abbiegen. Wir werden sicher ein paar Minuten schwatzen. Er wird mir Fotos von seinem Sohn zeigen und vergnügt fragen, ob ich wieder was geschrieben habe.
Die Gebärde dafür ist nicht, wie man denken könnte, imaginäres Tippen auf einer Tastatur, sondern ein Streichen mit den Fingerspitzen über die geöffnete Innenfläche der anderen Hand. Vor dem Penny werden ein paar verlorene Gestalten das wahrscheinlich zwölfte Bier trinken und der Pfennigladen, wo es natürlich keinen Artikel für unter einem Euro gibt, wird Putzschwämme, Sitzpolster und Papiertüten draußen als verführerisches „Komm se rin und koofen se“-Angebot drapieren. Aber noch ist nicht morgen, noch ist es kurz vor Mitternacht, und eine Nachtigall zwitschert im Strauch und sucht eine Braut. Die gelbe Tram donnert über die Gleise, und ich laufe nach Hause, wo keine Überraschung auf mich wartet oder irgendwas, das mich daran hindert, mein Leben so zu führen, wie ich es will. Wieder kann ich mein Glück kaum fassen. Dass ich ein Zuhause habe, ein Bett, etwas zu essen, und dass mir niemand an den Kragen will. Dass ich eine Straße habe, die ich entlanggehen kann, hier ein Baum ist und da ein Briefkasten, der dreimal am Tag geleert wird. Nichts an diesem Gefühl ist originell, aber alles daran aufsehenerregend.
Ach ja, in diesem einen Lokal tanzen junge Leute Swing, vielleicht ist es auch Boogie-Woogie, und tragen Schuhe, wie man sie in den 1960er-Jahren trug. Und noch etwas, in Istanbul hat die Erde gebebt. Dieses Mal brauchte ich um niemanden weinen.
Wie war ich als junger Mensch? Mit vierzehn oder fünfzehn. Wenn man glaubt, dass zwanzig noch ewig hin ist? Ich kann mich erinnern, was ich von meiner Tante zu Weihnachten bekam (einen Föhn von Braun). Aber wie habe ich gefühlt? Wie dachte ich über das Glück nach? Und darüber, wie es wohl ist, wenn man Schulden hat oder ein Kind verliert. Was dachte ich über Helmut Kohl? Dachte ich irgendwas über ihn? Meine Vergangenheit ist wie ein Buch, von dem ich weiß, dass ich es schon viele Male las, aber ich habe die Details vergessen. Ich kenne noch ungefähr den Plot. Sonntagabends um halb sieben holten wir frische Milch vom Bauern. Die reichte für die ganze Woche. Für den Frühstückskakao und den Joghurt, den wir selbst ansetzten. Montags und mittwochs war Schwimmtraining. Manchmal fuhr ich danach bei der alten Tante Erika vom Roten Kreuz vorbei. In ihrem Wohnzimmer lagen in einem Glas Schokoladenriegel von Merci. Ich durfte mich bedienen, aber ich mochte keine Schokolade. Ihr zuliebe ließ ich ein Stück Sahnenougat im Mund verschwinden und spülte schnell mit einem Schluck Sauerkirschsaft nach. Saft mochte ich auch nicht. Wir wurden zu Maschinen erzogen. Hätte man uns einen Stein zum Essen angeboten, wir hätten ihn gegessen. Keine Allüren. Wie fand ich das? Sicher habe ich mich mit den Cousinen darüber kaputtgelacht. Und was wir nicht weglachen konnten, darüber weinten wir nachts. Aber still. Heimlich. Denn wenn wir weinten, brach es den Eltern das Herz. Sie dachten dann immer, das sei, weil wir arm sind. Aber ausgerechnet über zu wenig Geld weinten wir nie. Einmal weinte ich ein ganzes Jahr. Jede Nacht. Nach dem Lesen. Ich löschte das Licht und ließ die Tränen laufen. Dann drehte ich das nasse Kissen auf die andere Seite und schlief ein. Das war ein schlimmes Jahr. Zu viele Tote. Eine Nachbarin brachte uns einen Plattenspieler und Platten. Meine Mutter legte tagsüber Elvis auf. Sie ließ die Nadel auf die Stelle fallen, wo Can’t Help Falling in Love begann, und wiegte sich in Puschen und um sich selbst geschlungenen Armen hin und her. Mein Vater schleppte sich gebrochen mit gebeugtem Haupt in die Fabrik. In diesem Jahr pflückte ich den ganzen Sommer Erdbeeren auf dem Feld und kaufte von dem Geld ein Waffeleisen. Ich backte uns frische Waffeln. So lange bis irgendwann fast niemand mehr sehr traurig war, sondern höchstens nur noch halb. Da war schon fast Winter. Dann stellte ich das Waffeleisen ganz hinten in den Schrank. Als ich zum Studium auszog, legte meine Mutter mir das Waffeleisen ins Gepäck. Helmut Kohl war mir, glaube ich, egal.
Im April jährt sich der Tod meines Beinahe-Landsmanns Rolf Dieter Brinkmann zum fünfzigsten Mal. Es bleibt zu befürchten, dass es wieder keine Gala geben wird, auf der man ihn ehrt, keinen ARD-Brennpunkt, keine Sondersendung, keine Schweigeminute am Berliner Stern, wo die Fahrzeuge halten und die Fahrer aussteigen. Fast bin ich mir sicher, dass auch der Bundespräsident kein Wort über ihn verlieren wird. Im Februar, so teilte mir Brinkmanns Hamburger Verlag mit, werde meine Hausbibel Westwärts 1 & 2, um bislang unbekannte Gedichte erweitert, neu erscheinen. Und, oh Jesus, ich kann es nicht glauben, eine Biografie, endlich! Noch habe ich in jedes Buch, in jede Serie, eine Zeile von Rolf Dieter abi in meinen Text geschmuggelt, gehen in ein anderes Blau, weiße Tusche auf weißem Papier, in den ersten Kriegstagen zusammengefickt, ich bin nur da, weil es einen Krieg gab – kann mir nicht helfen, muss stoppen angesichts von so viel Not, Sehnsucht, Wut und Lust am Festhalten, weil auch die Wörter machen weiter.
Irgendjemand meinte mal, der Brinkmann schreibe wie Benn, aber das ist dummes Zeug. Keiner dieser Schreibtwie-Sätze hat in der Kunst Gültigkeit. Wenn einer etwas macht, wie irgendjemand anderes es auch tat, dann handelt es sich um einen Kopisten, einen Stimmenimitator, um einen, der sich kostümiert. Es ist nur so, dass er den Benn viel und vielleicht auch gerne las. Nicht mal Rolf Dieter Brinkmann ist wie Rolf Dieter Brinkmann, denn jede Erzählung, jeder Einfall, jede neue Zeile, Melodie und Sprach- und Sprechreim sind anders und nie da gewesen. Und ja, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, er war Deutschrapper. Er war ein König. Er war ein Von und Zu der Verzweifelten. Er war einer von uns.
Die Buchhandlungen werden hoffentlich einmal das Richtige tun. Hee Thalia, ihr gottlosen Analphabeten, räumt die Etagen leer, schmeißt für ein Wochenende Kerzen, Lesebänder, Teddys und den ganzen Schrott von den Tischen und pflastert die Quadratmeter mit Brinkmann und anderer Lyrik von all unseren toten Helden, die nur deshalb überleben, weil wir an Gedichte nicht mit dem üblichen Bumsfallera-Anspruch à la „Rilke ist toll“ rangehen, sondern die Sache ernst nehmen, kardiologisch betrachten, gewissermaßen. Weil wir nur deshalb deutsch denken können, weil es Leute wie Rolf Dieter gab, die uns beibrachten, deutsch zu leiden und zu schreiben. Er kam aus Vechta, er und ich stapften durch das gleiche Moor, Bruchhausen-Vilsen, Bassum, Diepholz, das war unsere poetische Provinz, von dort lernten wir Zeilen stechen, so wie andere Spargel und Torf. Ich bin jetzt erschöpft. Nicht gewöhnt, Marketing zu machen. Aber es hat halbwegs geklappt. Ich hoffe, dass ihr jetzt alle verstanden habt, was zu tun ist.
Er ist immer der erste Anrufer. Herzlichen Glückwunsch, kızım, und, so schön, dass du auf die Welt gekommen bist. Mein Vater trägt seinen Geburtstagsstrauß an Wünschen vor. Mögen alle meine Wege offen sein, möge mein Fuß kein Hindernis berühren, hızırs Hand ruhe schützend auf mir. Dann geht er die Organe einzeln durch. Beim Augenlicht beginnt er und schluchzt gleich los, bei Lunge und Leber fängt er sich, beim Herzschlag angekommen, hat er sich längst wieder im Griff. Er fasst noch einmal zusammen: ganze Körper, ganze Gesundheit, ganz lange hoffentlich!
Das Protokoll duldet keine Unterbrechung, keine Zwischenrufe oder Fragen.