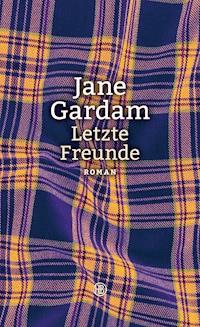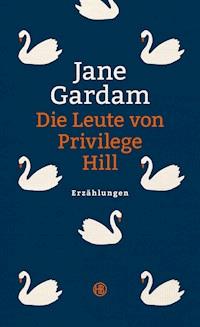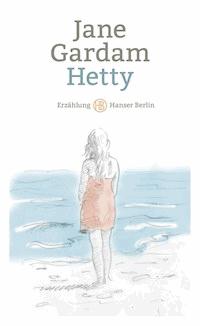Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit "Gute Ratschläge" beweist Jane Gardam einmal mehr ihre erzählerische Meisterschaft: Einer der geistreichsten und unterhaltsamsten Briefromane, die Sie je gelesen haben. Eliza, 51, schreibt Briefe an Joan, die Nachbarin, die offenbar ihren Mann und ihre Kinder verlassen hat, und die sie eigentlich kaum kennt. Briefe mit besten Ratschlägen – voller ungeschminkter Wahrheiten, schlafwandlerisch sicher gesetzter Seitenhiebe und Exzentrik. Antwort bekommt Eliza nie, was ihre Schreibwut eher anstachelt. Als ihr Mann Henry plötzlich auszieht, geraten die Briefe zu immer wilderen, fiebrigen Bekenntnissen einer zutiefst einsamen, in ihrem Leben gefangenen Frau, der nicht unbedingt zu trauen ist. Mit „Gute Ratschläge“ beweist Gardam einmal mehr ihre erzählerische Meisterschaft und den scharfen Blick für die grausame Scheinheiligkeit der postviktorianischen Gesellschaft, in deren diskretem Schweigen manches unschöne Geheimnis schlummert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Mit »Gute Ratschläge« beweist Jane Gardam einmal mehr ihre erzählerische Meisterschaft: Einer der geistreichsten und unterhaltsamsten Briefromane, die Sie je gelesen haben.Eliza, 51, schreibt Briefe an Joan, die Nachbarin, die offenbar ihren Mann und ihre Kinder verlassen hat, und die sie eigentlich kaum kennt. Briefe mit besten Ratschlägen — voller ungeschminkter Wahrheiten, schlafwandlerisch sicher gesetzter Seitenhiebe und Exzentrik. Antwort bekommt Eliza nie, was ihre Schreibwut eher anstachelt. Als ihr Mann Henry plötzlich auszieht, geraten die Briefe zu immer wilderen, fiebrigen Bekenntnissen einer zutiefst einsamen, in ihrem Leben gefangenen Frau, der nicht unbedingt zu trauen ist. Mit »Gute Ratschläge« beweist Gardam einmal mehr ihre erzählerische Meisterschaft und den scharfen Blick für die grausame Scheinheiligkeit der postviktorianischen Gesellschaft, in deren diskretem Schweigen manches unschöne Geheimnis schlummert.
Jane Gardam
Gute Ratschläge
Aus dem Englischen von Monika Baark
Hanser Berlin
Für Rhododendria
For she’s the Queen
Of the Tambourine
The Cymbals and the Bones
Music Hall Song
7. Februar
Liebe Joan,
ich hoffe, wir kennen uns gut genug, dass ich das sagen darf.
Ich finde, du solltest versuchen, das mit deinem Bein zu vergessen. Ich glaube, es ist etwas Psychologisches, Psychosomatisches, und Charles nimmt es furchtbar schwer. Es macht sowohl ihn als auch dich zum Gespött und ihr ruiniert euch euer Leben.
Bitte gib dir mal einen ordentlichen Ruck, ja? Vergiss deine ganzen Wehwehchen. Das Leben ist etwas Wundervolles, Joan. Diese großartige Tatsache ist mir bei meiner Arbeit mit den Sterbenden klar geworden.
Deine treue Freundin
Eliza (Peabody)
***
17. Feb.
Liebe Joan,
ich hatte dir letzte Woche einen kurzen Brief geschrieben und frage mich, ob er vielleicht verlorengegangen ist? Ich weiß, wir beide kennen uns noch nicht sehr lange und sind erst seit ein paar Jahren Nachbarinnen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dir sehr nahe zu sein. Vielleicht, weil wir uns zum ersten Mal in der Kirche begegnet sind. Ich erinnere mich, wie da plötzlich diese neue und mir doch irgendwie vertraute Frau im Seitenschiff saß, an deinen glasklaren, leicht feindseligen Blick. Es war, als hättest du einfach durch irgendeine Lichtspiegelung auf einmal dort Gestalt angenommen. Ich weiß noch, dass du dich weder hingekniet noch den Kopf gebeugt hast. Und als du an der Kirchentür gefragt wurdest, ob du dich irgendwo einbringen oder die Blumen übernehmen wolltest, hattest du plötzlich diesen Blick, und seitdem habe ich dich nie wieder in der Kirche gesehen.
In meinem Brief bin ich vielleicht von einer Freundschaft ausgegangen, die nicht ganz so eng ist wie in meiner Vorstellung, und habe mir bezüglich deines Beins vielleicht zu viel herausgenommen? Bitte verzeih mir, wenn ich übers Ziel hinausgeschossen bin, aber es schmerzt mich sehr, Charles so bedrückt zu sehen. Ein Mann, dessen Frau mit knapp fünfzig ein unbestimmtes Beinleiden hat, läuft Gefahr, zur Witzfigur zu werden.
Warum kommst du nicht mal vorbei? Ich koche gerade Orangenmarmelade und habe einen wirklich tollen Kniff entdeckt, um die weißen Häutchen in den Griff zu kriegen, der vielleicht auch für dich interessant sein könnte. Die Marmelade wird dadurch herrlich durchscheinend.
Deine treue Freundin
Eliza
***
6. März
Liebe Joan,
inzwischen sind mehr als vierzehn Tage vergangen seit meinem kurzen Brief wegen deines Beins, und ich weiß ja, dass du einen Hund hast, der Briefe frisst, daher habe ich mich nur gefragt, ob er und meine zweite kurze Botschaft verlorengegangen sind? In letzter Zeit scheint dich niemand gesehen zu haben, nicht mal Charles, und die Fenster von Nummer 34 sind alle verschlossen. Ich habe Henry gebeten, darauf zu achten, als er gestern Abend mit Toby um die Laternen zog, und er meinte, Licht habe auf alle Fälle gebrannt, aber ich denke, es könnte auch nur eine Zeitschaltuhr gewesen sein? Vielleicht seid ihr überraschend verreist?
Solltest du meine Briefe nicht bekommen haben, wollte ich nur sagen, wie leid mir das tut mit deinem Bein, mit dem es trotz der vielen Arztbesuche wohl einfach nicht besser wird. Von meiner Arbeit im Hospiz weiß ich, wie traurig es ist, wenn alle Behandlungen nichts bringen. Aber, wie ich immer zu meinen Sterbenden sage, diese Dinge können psychosomatisch bedingt sein, selbst kurz vor Toresschluss, und lassen sich manchmal leicht durch ein Gespräch ins Lot bringen, entweder mit einer Fachkraft, gern über den National Health Service — wobei ich sicher bin, dass Charles da niemals geizen würde —, oder einfach mit einer netten, fürsorglichen Person wie mir.
Ich wär mit Freude jederzeit bereit dazu. Charles sagte mal, du seist in Oxford ein sehr hübsches Mädchen gewesen, und wir finden es wirklich schlimm, dich in diesem Zustand zu sehen — mag die Krankheit nun seelisch oder körperlich sein.
Sei so gut und schreib mir zurück. Henry nimmt den Brief jetzt mit auf seine Laternenrunde.
Deine dir wohlgesinnte Freundin
Eliza
***
20. März
Liebe Joan,
gerade habe ich Charles den Hügel hinunter zur Arbeit gehen sehen, und er wirkt sehr verhärmt. Ich habe versucht, dich anzurufen, aber es geht niemand ans Telefon. Nun befürchte ich, dass du vielleicht ernsthaft krank bist, und ich will nur zu gerne tun, was ich kann, außer dienstags-, mittwochs- und freitagsvormittags, wenn ich bei meinen Sterbenden bin, und mittwochnachmittags, da habe ich Frauenzirkel. Dort werde ich dir wohl kaum über den Weg laufen, wie du von Beginn an klargestellt hast!! Gleich bei unserer zweiten Begegnung hast du mir mit deiner herrlich unumwundenen Art deutlich gemacht, was du von all den braven »Gattinnen« hältst. Du wolltest nichts davon wissen, als ich dir erklärt habe, dass unsere netten Treffen keineswegs nur für die Ehefrauen von erfolgreichen Männern sind, sondern für alle, die nicht voll im Berufsleben stehen und fest daran glauben, dass die Aufgabe der Frau das Heim ist, und Gott und die Ehe und das Stellunghalten — was du natürlich tust. Alle haben immer gesagt, du seist unheimlich gut darin, »dranzubleiben«. Dein Garten ist unkrautfrei und dein Hund immer wunderschön sauber — genau wie dein Auto. Und du bist eine so gute Freundin und Nachbarin, und Mutter natürlich, ein Gebiet, das mir vollkommen fremd ist.
Ich habe für dein Bein gebetet, Joan, und hoffe, dass ich dich mit meinem ersten Brief, falls du ihn bekommen hast, nicht verärgert habe. Ich bin ja leider sehr unverblümt. Bei uns im Zirkel heißt es immer, ich sei »unverblümter als ein Steingarten« — du siehst, wir haben hier ein paar ganz gewitzte Damen —, und ja, ich nenne das Kind beim Namen. Sogar im Hospiz. Aber du kannst dir sicher sein, es würde mich überhaupt nicht stören, Joan, wenn du dich deshalb aufregtest. Die Patienten regen sich oft über mich auf. Neulich hat einer gesagt: »Noch so ein Spruch, und ich rufe nach Schwester Phyllida.« Aber ich verkrafte alles, Joan, alles, was du sagen willst, bei der Liebe unseres Herrn, der all unsere Sünden auf sich genommen hat. Und bitte versteh mich richtig, ich will gar nicht ausschließen, dass dein Bein dir zu schaffen macht. Psychosomatische Erkrankungen sind oftmals schmerzhaft. Natürlich weiß ich das nur vom Hörensagen, ich hatte so eine Krankheit noch nicht, tatsächlich war ich in meinem ganzen Leben noch nie krank, aber ich bete, dass dies meiner Authentizität (wie man heute sagt) keinerlei Abbruch tut, geschweige denn der Sympathie, die ich stets für meine kranken Freundinnen empfunden habe, zu denen auch du zählst, liebe Joan. Deine Abwesenheit in den letzten Wochen hat mich wirklich traurig gemacht. Ich denke ständig daran. Es bestärkt mich nur umso mehr in meinem Wunsch, dir zu helfen.
Deine liebevolle Freundin E
PS: Anne Robin hat mir gestern erzählt, sie hätte dich neulich von weitem im Armyshop gesehen, ich weiß also, dass du immerhin auf den Beinen bist. Henry hat mir versprochen, Charles heute im Finanzministerium anzurufen, da ihr keinen Anrufbeantworter habt und niemand reagiert, wenn man anruft oder an die Tür klopft. Wir möchten euch gern zum Essen einladen. Bitte sagt zu — und lass dich nicht von mir ärgern. Ich habe mich sogar schon gefragt, ob du mich vielleicht mal begleiten und dich ein wenig mit den Sterbenden befassen möchtest? Ich bin sicher, Mutter Ambrosine hätte nichts dagegen, nur müsstest du vielleicht die Beinschiene unter einer Hose oder einem langen Rock verstecken.
Oder mittags mal auf einen Drink? Oder Lunch im Little Greek?
Herzlich E
***
1. April
Liebe Joan,
ich schicke diesen Brief an die erste Anschrift auf der Liste, die du dem armen Charles vor etlichen Wochen, wie mir scheint, auf dem Tisch in der Diele dagelassen hast. Erst gestern ist es uns gelungen, mit Charles Kontakt aufzunehmen — gut einen Monat, nachdem du ihn verlassen hast. Ich habe die ganze Nacht wachgelegen, mir den Kopf zerbrochen und um Vergebung gebetet, falls mein Briefchen etwas mit deinem Verschwinden zu tun gehabt hat. Was ich mir einfach nicht vorstellen kann. Es war nur eine Geste, ein Angebot in gutem Glauben von Freundin zu Freundin. Meist schreibe ich, was mir gerade in den Sinn kommt, im Vertrauen auf den Willen Gottes.
Es war sehr schwierig, aus Charles etwas herauszubekommen, als wir es endlich geschafft hatten, ihn zu einer Mahlzeit hierher zu locken — die er dann kaum anrührte. Er hat abgenommen, ist dünner als je zuvor, ich bin sicher, er isst nur noch Tiefkühlkost, und die Kinder, wie mir scheint, genauso. In meinen vorigen Briefen habe ich nicht erwähnt, Joan, dass Simon und Sarah außerordentlich schlampig herumlaufen, kein Ethnolook oder gebleichte Haare oder eigentümlich rasiert, wie es nur normal wäre, sondern schlampig. Sie kommen von der Schule nach Hause und essen mitten auf der Straße irgendetwas aus Tüten, und sie haben Päckchen dabei, in denen Strohhalme stecken. Die Päckchen werfen sie einfach ins Gebüsch.
Charles ist außer sich, Joan. Zumindest ist er, um ganz ehrlich zu sein, sichtlich untergründig außer sich. Nun zeigt er ja, das weiß ich, nur ungern seine Gefühle. Oder überhaupt. Nur du allein, Joan, kannst ermessen, was er wohl gerade durchmacht: Erst stellst du ihn bloß mit deinem Bein und läufst mit deinen Sainsbury-Tüten herum, weil du nicht mehr Auto fahren kannst. Und dann die Demütigung, dass du ihn verlässt. Und zwar mit dem Auto, wenn ich es recht verstehe! Und, wie er uns dann schließlich erzählte, mit ordentlichen Schuhen und ohne Beinschiene, die du offenbar im Bett zurückgelassen hast. Wie ein Totem. Ein böser Scherz. Ein Akt der Gehässigkeit.
Ich habe naturgemäß gemischte Gefühle, was diese Sache betrifft, denn mein Brief hat einerseits viel Gutes ausgelöst. Du hast die Beinschiene abgeworfen, Joan. Auch wenn ich das in meinen Briefen nicht ausgeführt habe — genau dafür habe ich um deinetwillen gebetet. Ich habe mich dem Thema in mehreren Gebetssitzungen gewidmet, in der Kirche und hier und da bei mir zu Hause. Was ich jedoch nicht verstehen kann, ist, wie der Herr meinen Hinweis auf die Psychosomatik des Beins punktgenau aufgreifen und dir gleichzeitig erlauben konnte, mit dem Abwurf der Beinschiene den lieben Charles bis ins Mark zu treffen.
Armer, verwirrter Charles. Er hat uns gesagt, du hättest die Liste der Postfächer und Konsulatsnummern auf dem Tisch in der Diele neben meinem ersten Brief liegenlassen, und quer darüber eine Art Metapher: eine Kornähre. Ich wüsste gern, wie du um diese Jahreszeit an eine Kornähre gekommen bist, es sei denn, sie stammt aus dem Kaninchenkäfig der Gargerys; oder was sie uns sagen sollte. Keine Nachricht, sagte Charles, in irgendeiner anderen Form, nicht mal ein Kuss oder ein Lebwohl.
Ich muss dir das jetzt mal sagen, Joan: Ich glaube, du bist krank. Ich weiß, die ganze Sache fing damit an, dass ich dir geschrieben habe, du seist nicht krank, aber als wir heute im Zirkel darüber gesprochen haben, waren wir der einhelligen Meinung, dass du HILFE brauchst. Eine Frau, die ein so wundervolles Haus verlässt, zwei so lebhafte Kinder, Charles’ ganzes Geld und den lieben genügsamen Charles selbst, muss krank sein. Wir haben ihn gefragt, ob er nicht eine Zeitlang bei uns wohnen möchte, und er hat im Prinzip nicht abgelehnt. Er denkt darüber nach. Die Kinder, sagt er, seien durchaus in der Lage, auf sich selbst aufzupassen, und nähmen ihn ohnehin gar nicht wahr, jetzt, so kurz vor den A-Levels. Ich kann ihnen ja auch immer schnell eine Quiche rüberbringen.
Und das ist die andere Sache, Joan. Die A-Levels. Wie konntest du Simon und Sarah so kurz vor den A-Levels im Stich lassen? Eins weiß ich, obwohl ich selbst keine Kinder habe, nämlich, dass das die Zeit ist, in der junge Leute die Liebe einer Mutter besonders brauchen. Wir leben in Zeiten harter Konkurrenz.
Ich versuche, dir nicht böse zu sein, Joan. Ich versuche nur einzuordnen, was du getan hast, und es im Verhältnis zu dem großen, ernsten Schlussakt des Lebens zu betrachten, nämlich dem Tod. Ich habe mit einem meiner Patienten im Hospiz darüber geredet, oder sagen wir, ich habe geredet und er hat mich dabei angesehen, mit einem Auge. Er hat mir voller Weisheit zugehört. Wir können so viel von den Sterbenden lernen, Joan, vor allem, dem Leben nicht allzu viel abzuverlangen — diesem Leben. Türkei, Afghanistan, Nepal, China — das war etwas für viktorianische Frauen, Joan. Es gibt keine Notwendigkeit für uns, diesen mutigen Weg erneut einzuschlagen. Heute muss die moderne und emanzipierte Frau den inneren, spirituellen Weg für sich finden, und dafür braucht man nicht in den Orient zu gehen. In der Woodlands Road gibt es vorzügliche Meditationskurse. Du bist keine siebzehn mehr, Joan.
Das alles habe ich Mutter Ambrosine unterbreitet, aber du weißt ja, wie zynisch die wirklich guten Seelen klingen können. Mutter Ambrosine sagte: »Diese Joan und ihr Treiben scheint Sie ja sehr zu beschäftigen, Eliza«, und das ist wahr. Ja, sie beschäftigt mich. Ich wüsste einfach nur zu gerne, warum, liebe Joan. Warum und wie in aller Welt du einen so attraktiven und liebevollen Mann wie Charles nach all den ruhigen Jahren verlassen konntest.
Alles Liebe, deine E
***
10. Mai
Liebe Joan,
ich schreibe dir hiermit an die Prager Botschaft, die an dritter Stelle auf deiner Liste steht, und wenn du dort bist, hoffe ich, dass du es schaffst, dir ein paar Sehenswürdigkeiten anzuschauen und Fotos zu machen. Wie ich höre, gibt es in Prag sehr hübsche Puppentheater, ein ideales Thema für einen Vortrag bei unserem Frauenzirkel. Könntest du eventuell sogar Dias machen? Ich schreibe dir in gutem Glauben. Wenn ich’s recht verstehe, hat Charles noch gar nichts von dir gehört, und wenn er abends zum Essen kommt, was inzwischen fast täglich der Fall ist, herrscht eine stillschweigende Übereinkunft, nicht über dich zu sprechen. Über die Kinder reden wir schon, da sie fast mit dabei sind. Wir hören von drüben ihren Partylärm, selbst wenn wir noch beim Essen sind. Er kaut einfach vor sich hin. Die Partys gehen bis tief in die Nacht.
Ich mache mir Sorgen um Sarah. Neulich bin ich ihr auf der Straße begegnet und habe sie dazu beglückwünscht, zur Vertrauensschülerin gewählt worden zu sein, und alles, was sie dazu sagte, war: »Übel, oder?« Ich frage sie immer, und auch Simon, wenn ich ihn sehe: »Gibt’s was Neues?«, aber Sarah starrt mich inzwischen nur noch an, und der arme Simon ist immer gleich weg auf seinem Rad mit dem Plastikradio über dem Lenker, aus dem Brahms schallt.
Ich muss dir alles über S und S erzählen, Joan, Prag hin oder her. Es ist deine Pflicht, davon zu erfahren. Ich glaube ernsthaft, dass Simon Drogen nimmt. Er hat dieses unbestimmte Strahlen, und irgendetwas ist mit seinen Schulterblättern. Außerdem — das habe ich auch Charles schon erzählt —, habe ich Sarah neulich abends sehr spät mit einem jungen Mann nach Hause kommen sehen, und sie hat ihn mit reingenommen. Auf jeden Fall lief (nach einiger Zeit) Musik, und es war Mozart, aber es war nach ein Uhr morgens.
Joan, es gibt doch Mutterpflichten. Wie kannst du deine Kinder in dieser Phase ihres Lebens im Stich lassen? Ich werde dir das Gleiche noch mal an deine Folgeadresse schreiben, wobei ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, wie lange der Brief nach Kurdistan unterwegs sein wird.
Charles verbringt jetzt sehr viel Zeit mit Henry, und ich glaube, dass Henry ihm ein bisschen hilft. Wie du weißt, trägt Henry sich, seit er Lektor geworden ist, mit dem Gedanken, in den Kirchendienst einzutreten — sobald er aus dem Auswärtigen Dienst ausgeschieden ist. Fürs erste lernt er, Seelsorger zu sein, und ich denke, Charles profitiert davon.
Charles isst jetzt wieder gut, das wird dich bestimmt freuen. Er und Henry sitzen nach dem Abendessen zusammen und reden ziemlich viel. Sie sprechen leise, und ich sitze an meinem Wandbehang.
Liebe Joan, ich frage mich manchmal, ob du gegangen bist, weil du gehofft hast, du könntest Charles eifersüchtig machen? Lass dir gesagt sein, in dem Fall war die Hoffnung vergebens. Nachdem ich ihn letzte Woche in der Kirche beim Singen beobachtet habe — sein langes, asketisches Gesicht, seine große Nase, seine dezente Brille —, kann ich dir versichern, er wird nie eine andere Frau angucken.
Wenn er der Typ dafür wäre — ich sage es dir ganz unverblümt, wie immer —, wenn er das wäre, und es wäre ja ganz normal für einen gesunden Mann seines Alters, sich anderweitig zu trösten, würde er sich sicherlich an mich wenden. Es ist ja nun mal so, dass ich mit meinem Aussehen die Männer in den Bann ziehe. Das ist keine Selbstgefälligkeit, sondern Tatsache. Ich verstehe mich einfach mit Männern. Früher sagte Henry immer, ich hätte schlicht einen Startvorteil: »Kleine Brüste, lange Beine, schwarze Augen, rote Haare.«
Anfangs zumindest komme ich gut mit ihnen aus. Wenn sie mich zum ersten Mal den Sterbenden vorstellt, sagt Mutter Ambrosine immer: »Nicht reden, Eliza. Lassen Sie sie einfach nur schauen.« Das hat manchmal auch etwas Betrübliches. Mein Aussehen ist eine ziemliche Belastung, selbst jetzt noch mit fünfzig. Ich habe es nie für etwas Sinnvolles einsetzen können. Früher hat Herny immer gesagt, ich hätte eigentlich zum Stummfilm gehört oder zum Zirkus als Reifenartistin. Letzteres ist ein kurioser und fantasievoller Gedanke.
Jedenfalls, Joan, schielt Charles nicht in meine Richtung. Ich denke, es hat in seinem Leben nie eine andere Frau gegeben als dich. Er lebt für den Tag deiner Wiederkehr, und deiner Erklärung.
Ihm ist auch klar, Joan, dass du ihn nicht wegen eines anderen Mannes verlassen hast — wobei ich nicht glaube, dass er ohne mein Nachfragen überhaupt auf die Idee gekommen wäre. Er vertraut dir von Grund auf. Anne Robin sagte, im Armyshop habe sie dich ein Einpersonenzelt und einen einzelnen Schlafsack kaufen sehen, und du habest dich nach nur einer Waffe zur Selbstverteidigung erkundigt. Du wirst ganz bestimmt allein reisen.
Ich werde dir weiterhin schreiben, Joan, da ich mich in gewisser Weise für dich verantwortlich fühle. Ich weiß, dass du dich bald wieder an das echte Alltagsleben erinnern wirst, und an den lieben Charles. Solltest du es wirklich bis nach Kurdistan schaffen, da gibt es meines Wissens Teppiche. Ich hoffe, dass du dir einen kaufst. Er würde in der Diele sicher fabelhaft aussehen. Wie Henry und ich in unseren langen Jahren im Ausland festgestellt haben, ist es immer gut, sich etwas mit nach Hause zu nehmen, wofür das Land berühmt ist. Das sind bessere Andenken, als sich auf das zu verlassen, was man im Kopf hat oder aus Büchern weiß mit ihrer allgemeinen Aura von Romantik. Trink nur um Himmels willen keine Ziegenmilch. Damit kenne ich mich wirklich aus.
Deine Eliza
***
12. August
Liebe Joan,
ich lege diesen Brief dem Paket bei, um das du in deinem Brief gebeten hast, wobei, wäre der Brief nicht in deiner Handschrift gewesen, die ich von deinen Weihnachtskarten vor Urzeiten her kenne, und hätte er nicht ein »Foto des Überbringers« enthalten, hätte ich besagten Überbringer niemals in mein Haus gelassen. Aber er ist mein erster Kurde seit langem gewesen.
Er ist sehr hübsch, muss ich sagen. Und sehr jung. Schade, dass er so wenig Englisch spricht und etwas ungelegen kam. Charles, Simon und Sarah waren gerade zur hereingeschneit, um uns die großartigen Neuigkeiten zu überbringen, dass Sarah am St Hilda’s College in Oxford angenommen wurde und Simon in Cambridge einen Musikpreis gewonnen hat!! Die jungen Leute sind schon komisch heutzutage. Als der Kurde ins Haus spazierte, standen S und S ungerührt da, Sarah zog gähnend Bücher aus dem Regal und warf sie auf den nächstbesten Stuhl, und Simon ließ seine Hosenträger schnalzen. Charles hatte Champagner mitgebracht und Henry uns gerade eingeschenkt. Natürlich boten wir dem Kurden auch ein Glas an, und er leerte es in Windeseile, um daraufhin einen Flachmann aus seiner Tasche zu ziehen und uns reihum eine klare Flüssigkeit in unsere Gläser zu träufeln. Auch den Kindern. Obwohl sie natürlich strikt abstinent und völlig grün hinter den Ohren sind, tranken sie ihr Glas leer und begannen sich auf einmal für den Rest des Abends mit dem Kurden zu verabreden, obwohl ich gehofft hatte, alle würden zum Essen bleiben, und mittlerweile ein Blumenkohlauflauf in der Mikrowelle seine Runden drehte.
Zusammen mit dem Kurden zogen sie krakeelend die Straße hinunter Richtung U-Bahn und Londoner Nachtleben, vermute ich. Nach dem Essen sahen wir uns die Nachrichten an und ich sagte: »Charles, wie kannst du so ruhig bleiben, nach allem, was passiert ist?« Henry meinte: »Charles ist einfach ein ruhiger Mensch.« Dann sagte ich — ich denke fast, es lag an der Flüssigkeit aus dem Flachmann —: »Aber wie kannst du so ruhig bleiben, Charles, wo deine Frau in eurem Volvo Richtung Himalaya fährt und dieser merkwürdige Mann hier auftaucht, um ihren Schmuck abzuholen?«
Charles wirkte richtig niedergeschlagen, Joan, und als ich das sagte, gingen er und Henry hinüber in die Kirche. Nach einer Weile kam dein Freund — von wegen Freund, Joan, dein Liebhaber, ich bin ja nicht von gestern — allein zurück und verhielt sich sehr eindeutig. Er versuchte mich hinauf in eines der Zimmer zu drängen. Zum Glück tauchten ungefähr in dem Moment Henry und Charles wieder auf und zwangen ihn, sich auf die Wohnzimmercouch schlafen zu legen. Am nächsten Morgen war er immer noch da und rührte sich nicht, und die halbe Hausbar lag verstreut um ihn herum. Nachmittags gegen drei, das heißt vor wenigen Minuten, verfrachteten wir ihn in seinem noch halb angetrunkenen Zustand vor die Tür, und nun sitzt er mit dem Kopf in den Händen auf den Stufen vorm Haus, während ich diesen Brief fertigschreibe. Dann will er gehen.
Ich sagte: »Das kannst du nicht machen, Charles, du kannst ihm nicht ihren Schmuck mitgeben. Sie nimmt dich aus wie eine Weihnachtsgans — denk an dein Auto und das alles.« Da sagte Charles: »Das Auto hat sie geschasst und sich einen Jeep gekauft« — einfach so. Also muss er mit dir in Kontakt gewesen sein, was man mir ruhig mal vorher hätte sagen können.
Jedenfalls fühle ich mich ganz elend und werde diesen Brief hiermit beenden.
Mit freundlichen Grüßen
Eliza
***
10. November
Liebe Joan,
drei Monate sind vergangen, und ich schreibe dir nach Thailand, in der Hoffnung, dass dies deine nächste Anlaufstelle ist. Ich denke fast, du wirst einige Zeit in Kurdistan geblieben sein, um deinen Schmuck in Empfang zu nehmen. Ich war eine Zeitlang zu krank — vor Kummer —, um dir zu berichten, wie diese skurrile Episode ausging.
Aber vielleicht jetzt.
Nachdem ich einen Brief an dich beendet hatte, von dem ich nicht weiß, ob du ihn jemals bekommen wirst, ging ich hinaus vor die Tür, um dem Kurden das Päckchen zu geben. Charles hatte von drüben die kleine viktorianische Lackschachtel geholt, die auf dem Kaminsims in deinem Schlafzimmer stand und zwischen den Potpourrischälchen, der Emailleuhr, der Pflasterdose mit dem Schriftzug »Rosen, Tulpen, Gerbera, unsre Lieb’ blüht immerdar« bestimmt eine traurige kleine Lücke hinterlassen hat. Das KANNST DU NICHT ALLES SCHON VERGESSEN HABEN, Joan! Der arme, gute Charles!
Ich kippte den Schmuck in ein Kaffeesäckchen von Harrods, und während ich damit zugange war, standen Charles und Henry gleichzeitig auf und gingen. Zu dem Kurden sagten sie kein Wort und stiegen ungezwungen plaudernd hinter vorgehaltenen Aktentaschen über ihn hinweg. Ich sagte zu dem offenbar namenlosen Kurden: »Wie Sie damit durch den Zoll kommen wollen, weiß ich beim besten Willen nicht«, und er bewies, dass er doch etwas Englisch beherrschte, denn er öffnete das smaragdgrüne Kleid, das er über seiner Hose trug, entblößte seinen Brustkorb und hängte sich den Beutel zwischen die Brusthaare. Dann küsste er mir die Hand und entschwand. Auf der anderen Straßenseite kamen Richard Baxter und Dulcie gerade vom Einkaufen und er legte schützend den Arm um sie.
Joan.
Joan — ich bin alles in allem längst nicht so dämlich, wie ich immer tue.
Ich überreagiere, nicht wahr?
Joan, ich habe Angst. Ich weiß nicht warum.
Joan, meinst du nicht, du solltest Charles wenigstens von irgendwoher mal anrufen? Er ist so ein guter Mensch.
Alles Liebe, deine Eliza
***
20. November? — ich weiß es nicht
Liebe Joan,
es ist drei Uhr morgens und ich bin allein im Haus, denn Henry und Charles nehmen an einem theologischen Wochenendkursus teil. In Nummer 34 ist alles dunkel.
Joan, ich muss dir etwas sagen. Ich bin in Charles verliebt. Bitte, bitte komm zurück. Ich wollte nicht, dass das passiert. Ich habe niemanden, den ich um Rat fragen kann, bis auf die Nonnen und die Sterbenden.
Ich will niemandem den Mann wegnehmen.
Eliza
***
Samstag, den ? Nov.
Liebe, gute Joan,
ich bin absolut überwältigt von deinem wunderbaren Geschenk, das mich gerade aus Kambodscha erreichte. Unvorstellbar, dass du es bis nach Angkor Wat geschafft hast, und ich kann nur hoffen, dass du gut auf dich aufpasst. Die politische Lage dort ist seit mindestens zwanzig Jahren instabil, wenn nicht noch länger. Ich selbst war nie dort. Dabei wollte ich immer so gern.
Ich habe nie in meinem Leben etwas Schöneres besessen als dieses herrliche goldfarbene Gewand. Ich sitze da und drücke es an mich und streiche über den Stoff. Kein Wort dazu, außer »von Joan« — ich wünschte mir wirklich, du hättest einen Brief beigelegt. Ich möchte so gern etwas über den Kurden erfahren, und ob die Ohrringe und Perlen gut angekommen sind. Ich nehme an, du hast sie verkauft, wenn du dir so glamouröse Geschenke leisten kannst. Charles spricht nicht darüber, wie du dich seiner Meinung nach finanzierst. Simon habe ich mal direkt darauf angesprochen, und er sagte: »Ganz einfach, sie hat das Tafelsilber mitgehen lassen«, aber das glaube ich auf gar keinen Fall.
Ach, Joan, was für ein Kleid! Wann soll ich es bloß anziehen? Ich habe Henry vorgeschlagen, uns nächstes Jahr fürs Glyndebourne-Festival Karten zu besorgen, nur wir drei, aber er und Charles standen da und starrten mich an, als wäre ich verrückt. Beide werden von Tag zu Tag asketischer. Als sie heute früh zur Arbeit aufbrachen, ging ich nach drüben, um nach Sarah Ausschau zu halten, die gerade für ein paar Tage zu Hause ist. Ich fand sie ganz allein unten am Gartenhaus auf der Terrasse, sie stand zwischen den Dahlien und allerletzten Rosen und spielte Querflöte, und die Bienen summten noch alle, als hätte der Winter vergessen, Einzug zu halten.
Mitten im Takt hielt sie inne. Sie sagte: »Eliza!«
Ich sagte: »Oh, spiel bitte weiter, Sarah, das war herrlich«, und sie sagte: »Erst wenn ich den Schock überwunden habe.« Sie besah mich von allen Seiten und sagte: »Mir hat sie auch eins geschickt, aber deins ist besser. Du Glückspilz. Wohin führt Henry dich in diesem Fummel aus — zum Großen Diözesenball?«
Also musste ich die Sache mit einem Lachen abtun.
Vielen, vielen Dank, liebe Joan,
deine treue Freundin
Eliza
***
25. Dezember
Liebe Joan,
es ist Weihnachten, nachmittags, und ich sitze ganz hinten im Wohnzimmer und schreibe und und schaue auf den schneebedeckten Garten. Die Straße ist sehr ruhig, da die meisten mit ihren Familien irgendwo hingefahren sind oder beim Spaziergang durch den Park ihr Weihnachtsessen verdauen. Den Heiligabend habe ich bei den Sterbenden verbracht. An Heiligabend geben sie sich immer besonders große Mühe — die Nonnen, meine ich. Es geht recht fröhlich zu. Freitag war die Weihnachtsfeier des Frauenzirkels, und ich hatte dein Kleid an. Leider konnte Henry nicht mit mir hingehen, weil er parallel seine eigene Bürofeier hatte. Charles war ebenfalls auf einer derartigen Veranstaltung, also ging ich allein als »Hilfskraft« und bediente am Buffet. Ich bekam sehr viele Komplimente wegen des Kleides, und einigen — aber nicht allen — erzählte ich, woher ich es habe. Denjenigen, denen ich unterstelle, dass sie sich immer noch sehr über deine Aktion echauffieren, habe ich lieber nichts erzählt.
Nach dem Aufräumen bin ich allein und ziemlich spät nach Hause gekommen, denn das Auto sprang nicht an und ich musste zu Fuß gehen. Hatte ich dir schon von meinem neuen Auto erzählt? Henry hat es mir auf Charles’ Rat hin gekauft. Charles versteht nicht allzu viel von Technik, nicht wahr? Oder sagen wir, er versteht etwas von Technik, wendet sein Wissen aber nicht auf technische Dinge an. Er ist auch kein sehr gesprächiger Mann, nicht wahr? Nicht dass ich gesprächige Männer gewohnt wäre. Henry ist über die Jahre immer schweigsamer geworden, und da dies ein sehr bedeutsamer Brief werden wird, Joan, will ich ebenso unverblümt sein wie damals in meinem verhängnisvollen Brief aus dem Frühjahr.
Ich glaube, es ist an der Zeit, dir mitzuteilen, dass Henry eigentlich nicht für die Ehe taugt. Das ist aber nicht der Grund, warum wir keine Kinder haben. Es war eine Vernunftentscheidung, die wir vor Jahren gefällt haben. Die ganze Apparatur ist noch da, ganz normal, zumindest soweit ich das beurteilen kann. Ich habe sie seit Jahren nicht gesehen, und die einzig andere, die ich kenne, die mir, nun ja, förmlich ins Gesicht sprang, ist die an Michelangelos David in Florenz, die natürlich aus Marmor und beängstigenderweise überlebensgroß ist. Aber das, womit ich jetzt konfrontiert bin, hat mit diesen ganzen Sachen nichts zu tun. Henry interessiert sich einfach nicht für Frauen. Ihm fehlt jede Neugierde. Einmal habe ich zu ihm gesagt: »Frauen stehen unter der Herrschaft des Mondes«, und sein Gesicht straffte sich vor Grausen. Er sagte: »Ich fürchte, Eliza, du willst den Mond haben«, und ich erwiderte: »Was die Liebe betrifft, stimmt das wohl«, und er schüttelte sehr energisch seine Times zurecht.
Ziemlich bald nach unseren Flitterwochen hörte er auf, mich als etwas Berührenswertes zu sehen, Joan, obwohl sich damals die Leute auf der Straße nach mir umgedreht haben. Wenn mir Männer hin und wieder Blumen schickten — na ja, meist nur aus Höflichkeit, nach einer Einladung zum Dinner —, öffnete er dem Boten die Tür und sagte: »Eliza — Blumen. Hast du die Hundeleine gesehen?«
Als die ersten Monate vorbei waren, lagen wir zusammen im Bett wie zwei Steinfiguren, Ritter und Dame auf einem Kirchengrab, Hand in Hand vielleicht, doch die Beine gekreuzt, die Nasen gen Himmel. In jeder Ehe wird es ja mit Sicherheit den Moment geben, in dem man sich den anderen als gesonderte Person denkt, nicht wahr? Eine Frau sollte für ihren Mann immer sie selbst und immer etwas Besonderes sein, und sei es nur als die Frau, die er mal geliebt und auserkoren hatte, um die er gebuhlt und die ihn betört hatte, die er zumindest als angemessen erachtet hatte. Nicht aber Henry. Ich erinnere mich an uns beide in unserem ersten Haus in St John’s Wood in den frühen Sechzigerjahren. Das Haus wurde kaum von uns bewohnt, da wir so viel im Ausland waren, doch ich erinnere mich, dass wir damals sehr glücklich waren wegen des herrlichen Gefühls von Sicherheit und Verheißung. Es funktionierte. Es war nicht nur eine Studentenromanze gewesen, die im üblichen Chaos endete. Es war eine gute Zeit. Doch schon da war ich nichts Besonderes mehr.
Letztes Jahr haben wir uns neue Betten gekauft. Weißt du noch? Ich bin ganz sicher, dass du dich daran erinnerst, denn genau in dem Moment fing ich an, mich für dich zu interessieren. Ich sah, wie du während der Lieferung dastandst und zusahst. Dann bist du schnell in dein Auto gesprungen.
Es ist ein feierlicher Augenblick, Joan, wenn das erste Ehebett davongetragen wird. Leb wohl, du Schlachtfeld, leb wohl, ihr Hügel und Täler. »Leb wohl, du Feld und grüner Hain, wo Nymphen sich ergötzt’.« Eine Nymphe war Henry nun nicht gerade. Ich denke immer noch — nein, dachte —, ich könnte eine sein.
Henry stellte die neuen Betten getrennt voneinander auf, eins an jeder Zimmerwand, und sagte: »Sieht das so nicht viel besser aus? Passen perfekt, wie maßgefertigt.« Und so war es. Die Betten passten perfekt. Aber es drängte sich mir der Eindruck auf, Joan, dass mit dieser Aussage irgendetwas Wichtiges unterschlagen wurde.
Ich sprach Henry darauf an. Ungefähr zur gleichen Zeit, als ich dir den albernen Brief schrieb und gestand, mich in Charles verliebt zu haben, den du hoffentlich nie bekommen hast. Obwohl es im Grund egal ist, weil ich mir vorstellen kann, was du gedacht hast, als/falls du ihn gelesen hast: »Das wollen wir doch mal sehen.«
Du hast recht. Ich kann mir jetzt vorstellen, was du in den letzten Jahren mit Charles durchgemacht haben musst.
Nach der Sache mit den Betten begann Henry in ganz London und den Vororten, sogar in North Londen, auf Tausende von Gebetsveranstaltungen zu gehen. Mir war aufgefallen, dass er aufgehört hatte, Eier zu essen. Es war ein privater Scherz zwischen uns beiden. Als Schuljunge waren sie seine Leib- und Magenspeise. Seine Mutter sagte immer: »Du Glückliche, du wirst nie zu kochen brauchen, du kannst ihm immer ein Ei vorsetzen.« Eine irgendwie widerliche Bemerkung, fand ich, aber sie war ja auch eine irgendwie widerliche Frau. Nun, möge Gott mir vergeben, denn sie ist tot. Jedenfalls hörte er auf, Eier zu essen.
Dann wurde mir bewusst, dass er offenbar gar nicht mehr aß. Er stocherte in seinem Essen herum. Aber er trank. Und wie er trank. Und er trank immer weiter. Eine Zeitlang. Dann gab er erst den Mitternachts-Whisky auf, und dann den Wein. Einige Wochen lang saß er, wenn ich zu Bett gegangen war, unten und hörte trinkend und nicht mehr trinkend seine Tonbänder. Es gab ein bestimmtes Requiem — ich kann mich nicht entsinnen, welches, jedenfalls nicht das von Lloyd Webber. Es brandete durchs Haus, unheilvolle und ewig währende Trauer. Aus Nummer 34 drangen die schiefen Akkorde von Simons und Sarahs kakophonischen Gegenstücken. Die Noten verschmolzen. Es schrillte und wummerte, und die Bewohner der Rathbone Road horchten. Hin und wieder kam Charles rüber und saß mit Henry in seinem Arbeitszimmer, und auch sie hörten die Requiems.
Dann, irgendwann, es muss ungefähr September gewesen sein, gab Henry das Trinken auf. Ganz und gar. Henry hatte schon lange ein eher zerstreutes Interesse an Sex. Es war immer hin und wieder mal passiert. Eine halbherzige Sache, aufs Geratewohl. Man spürte, wie die Klänge des Requiems sein Dasein durchdrangen. Schlaff wie eine Fahne an einem windstillen Tag ließ er sich hängen, und irgendwann war es ganz vorbei mit dem Sex. Ich hatte keine Lust, es anzusprechen. Nur einmal fragte ich an einem leuchtend blauen Morgen beim Aufstehen: »Weißt du noch, die Gascogne?«, aber alles, was ihm mit grauem Gesicht dazu einfiel, war: »Eliza, wir sind alte Leute.«
Den Patienten im Hospiz fiel auf, dass ich bedrückt aussah. Barry, mein Lieblingspatient, meinte: »Sie sehen aus, als müsste Sie mal einer in den Arm nehmen. Legen Sie sich doch zu mir«, und hob die Bettdecke an. Er lachte, weil ich rot wurde. Er kitzelte es aus mir heraus — was los war. Na ja, nicht direkt. Ich erzählte ihm nicht alles. Er sagte nur: »Ist der Ofen aus bei der grauen Eminenz? Oder«, fragte er, »gefällt er Ihnen nicht mehr?«
Ach, Joan, das gab mir zu denken. Es gab mir zu weinen. Barry reichte mir ein Taschentuch aus einer Box, und noch eins und noch eins. Ich sagte: »Ich weiß nicht, was mit mir los ist«, und er erwiderte: »Ich schon, altes Haus. Sie haben noch nicht angefangen.
Einfach noch nicht angefangen«, sagte er und schloss die Augen. »Das Leben«, sagte er. »Denken Sie mal drüber nach. Stellen Sie nicht so viele Fragen, und noch was, Eliza, reden Sie nicht so viel. Aber fangen Sie an zu leben, bevor ich damit aufhöre.«
Tja, nachdem er dem Sex abschwor, schwor Henry auch mir ab. Vollständig. Anders kann ich es nicht beschreiben. Er zuckte zusammen und wandte sich ab, wenn ich mich schnäuzte. Schloss gequält die Augen, wenn ich mit Freundinnen telefonierte. Jeden Abend hörte ich, wie die Haustür ins Schloss fiel, und aus der Küche oder vom oberen Treppenabsatz sah ich ihn wie eine Katze ins Haus schleichen, seine Aktentasche abstellen und einen Blick in den Garderobenspiegel werfen. Einen sehr betrübten Blick, Joan. »Ähem, ähem«, sagte er dann.
Anfangs grunzte er in meine Richtung, bevor er sich in sein Arbeitszimmer setzte und die Tür hinter sich zuzog. Eines Abends kam er dann nach Hause und hatte einen elektrischen Wasserkocher und ein Heizöfchen dabei. Wortlos. Bald kam eine kleiner Elektrokocher hinzu. Ein »Baby Belling«. Ab da schlief er in seinem Arbeitszimmer.
Vor, ach, drei Monaten bin ich rübergegangen zur Nummer 34, um Charles darauf anzusprechen. Ich klingelte. Keine Antwort, also ging ich ums Haus herum in den Garten, spähte durch die Fenster. Alles war zu, Joan. Joan — wenn du dein Wohnzimmer sehen könntest. Nicht dass es unaufgeräumt wäre — jetzt, wo Simon und Sarah meist nicht da sind, gibt es niemanden, der Unordnung macht. Charles verbringt sein Leben damit, einen Feldzug gegen die Unordnung zu führen. »Pyjamas kommen in die Schublade mit der Aufschrift Pyjamas«, usw. Ich presste die Stirn gegen das Küchenfenster und sah, dass überall Zettelchen klebten, auf denen »Mülltüten«, »mehr Unkrautvernichter« und »Dahlien kommen Freitag« stand.
Doch das Haus ist tot. Tot. Alles sauber und stumm und tot. Alles verstaubt, weil Angela vor Monaten gekündigt hat. Sie sagte, sie grusele sich und sehe dich ständig irgendwo im Haus, noch ohne Beinschiene, wie du lachend und langbeinig die Treppe runter- und raus zu deinem Auto flitzt. »Geister«, sagte sie. »Ich tippe, sie ist irgendwo im Haus, im Keller verscharrt«, aber dafür musste sie sich bei mir entschuldigen. Traurig ging ich zu deiner Haustür zurück und klingelte noch einmal demütig, und diesmal ging Charles recht schnell an die Tür. Andächtig stand er vor mir. Er bat mich nicht ins Haus. Ich erzählte ihm nur ein bisschen von Henry, und er war keinerlei Hilfe. Ich sagte: »Tut mir leid, mit meinen Problemen zu dir zu kommen, wo du schon genug eigene hast.«
»Genug eigene?«
»Joan.«
»Joan kann mich mal«, sagte er.
Ich war geschockt, unsagbar geschockt, Joan. Mir wurde ganz anders.
»Joan kann mich mal«, sagte er und knallte mir die Tür vor der Nase zu.
Nun, das Ende vom Lied war, dass Henry an diesem Weihnachtsnachmittag ausgezogen ist, um mit Charles zusammenzuleben.
Sie sagten es mir nach dem Weihnachtsessen. Charles ergriff das Wort, während Henry oben war und seine Sachen packte, und als Henry nach unten kam, sagte Charles: »Ich hab’s ihr gesagt, Henry«, und Henry sah auf seine Schuhe. Russell and Bromley. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit war ich bis nach Piccadilly gefahren, um sie zum Schuster zu bringen, und einen Monat später noch mal, um sie abzuholen. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Er sagte: »Tut mir leid, Eliza. Ich schreib dir. Ist alles mit dir — es ist doch alles in Ordnung, oder?«
»Je weniger an diesem Punkt gesagt wird, desto besser«, sagte Charles und bugsierte ihn behutsam weiter. »Ich bringe ihn im neuen Jahr vorbei, dann könnt ihr die Modalitäten klären.« Und weg waren sie.
Ich sah ihnen vom Fenster aus nach — vom Fenster zur Straße, nicht vom Gartenfenster aus, wo ich jetzt sitze und schreibe, mit Blick hinaus in den verschneiten Garten, wo die Äste der hohen Bäume geriffelt sind von Schnee und die Vögel mit ihren Füßen Stacheldrahtmuster auf dem Rasen hinterlassen. Draußen vor dem Wohnzimmerfenster ist der Schnee verhunzt und braun, wo die Leute — die Gillespies und Hardwicks und Gargerys und Oatses und Baxters und Robins — nach dem Frühstück zu ihrem jeweiligen Weihnachtsessen losgezogen sind, meist mit Wagenladungen voller Kinder. Ich dachte, gut, dass Simon und Sarah Ski fahren sind. Mit etwas Glück wird das alles vorbei sein, wenn sie zurückkommen.
Ich bitte dich — Joan! Das ist doch Irrsinn. Es ist doch wohl keiner von beiden, du weißt schon, vom anderen Ufer. Homosexuell. »Schwul« wie man heute sagt. Ich kenne niemanden, der weniger schwul ist als Charles und Henry. Wobei man natürlich nie ganz sicher sein kann. Alles Erbmasse. Aber ich meine nur, sie sind beide so kopflastig. Was soll denn das Finanzministerium denken, und Henrys Kollegen? Vielleicht ist es nur etwas Altmodisches wie bei Sherlock Holmes und Watson. Immerhin sind beide recht viktorianisch. Warum sollten zwei Männer nicht zusammenleben? Es können ja heute nicht mal zwei Frauen zuammenleben, ohne dass alle denken, sie hätten was miteinander. Wären Charles oder Henry verwitwet, wären sie genau der Typ Mann, der am liebsten im Albany wohnen würde. Aber als Nachbarn. Es gibt Männer, die träumen allen Ernstes davon, während ihre Ehefrauen ihre Hemden bügeln und ihren Speiseplan zusammenstellen und ihre Post beantworten, ohne sich zu fragen: »Und wer macht das alles dann für mich?« Woher ich das alles weiß? Ich, die unmögliche Eliza, Königin der Vorstadt? Ich weiß es einfach.
Ich bitte dich, Joan. Stell sie dir vor, die beiden zusammen nebeneinander in einem Bett. Oder gar noch mehr!
Sie sind aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ihre Väter, Joan. Männer in Machtpositionen, die an eine privilegierte, exklusive Männerwelt glauben, mit Butler und altem Geld, Gratis-Jagdgesellschaften, High Tables, an denen sie stundenlang beim Portwein sitzen und keinen Gedanken an die Arbeiterklasse verschwenden, geschweige denn das Wort an sie richten müssen. Und weißt du was, Hase? Sie haben recht. Diese Welt gibt es.
Es ist eine Welt, in der man nur sehr wenige Menschen kennt, und diese wenigen einem so ähnlich sind, dass Worte überflüssig sind, man verständigt sich über vertraute Laute. Deswegen gibt es diesen Typ Engländer noch, und deswegen ist er so rundum zufrieden, sitzt indifferent in seinem Londoner Herrenclub, denn immer, wenn sein Blick auf die anderen indifferenten Gestalten in ihren tiefen Armsesseln fällt, schaut er in den Spiegel. Was für Tempel das sind auf der Pall Mall, Joan! Groß wie der Kreml. Die Frauen, die die Dienstbotenräume betreten dürfen, müssen gesondert essen, aus einer gesonderten Küche, die so dreckig ist, dass das Tischset am Teller kleben bleibt, wenn der Kellner kommt, um ihn abzuräumen. Irgendwo in diesen Herrenclubs, jenseits der politischen Diskussionen, jenseits des Gemurmels über die neuesten Nachrichten, tauchen Geister auf — lang verstorbene Kricketspieler, alle mit ihren großen goldenen Alibifrauen. Und irgendwo in den Köpfen der sinnierenden Mitglieder gibt es eine treu ergebene, müßige Frau, eine FRAU eben, Gehilfin, Versatzstück, Anhängsel, Mutterersatz. Alle würden es abstreiten, aber es ist wahr, und erst heute ist es mir aufgegangen.
In Charles wie auch in Henry erstrecken sich endlose Weiten des Schweigens, der Undurchschaubarkeit und Geheimniskrämerei, und ich war immer bereit, das fraglos hinzunehmen. In Henrys Beruf gibt es vieles, das er ganz und gar für sich behalten muss. Es ist sein Leben jenseits des Berufs, das mich, wie ich gerade feststelle, zur Weißglut bringt: die traditionelle Vorstellung von der Ehefrau, die zu akzeptieren hat, dass er auf gewisse Weise vornehmen Abstand wahrt. Einen bewussten Abstand. Kein Außen-vor-Sein, wie wir alle in gewisser Weise außen vor sind.
Ich habe ihm sicher das Leben schwer gemacht. Anscheinend mache ich immer alles falsch. Ich springe in die Bresche, wenn die himmlischen Heerscharen vor Angst zur Salzsäule erstarren. Zum Beispiel im Hospiz. Ich habe oft damit gerechnet, gefeuert zu werden, und vermute, dass ich deshalb so wenig mit den Sterbenden und mehr mit dem Einräumen der Geschirrspülmaschine zu tun habe. Es gibt aber auch Sterbende, die nicht an mir Anstoß nehmen. Barry sagt: »Wissen Sie, was Sie sind, altes Haus, Sie sind die reine Medizin.« Es würde mich nicht wundern, wenn Barry wieder gesund würde, falls es dich interessiert — wobei das ein Geheimnis ist, das ich mir nicht mal selbst eingestehe.
Ich frage mich, Joan, wo du bist. Ich wünschte, du würdest einfach hereinspaziert kommen und wir könnten reden, wobei, wenn ich ganz ehrlich bin, es wäre mir gar nicht recht. Das Schreiben hat eine Distanz zwischen dir und mir geschaffen, und ich kann mich kaum an dein Gesicht erinnern. Neulich habe ich von dem Kurden geträumt und bin weinend aufgewacht. Ich frage mich, was er dir eigentlich bedeutet hat, wie viele andere es gab und wie weit du mit ihnen gegangen bist? Hast du dich einfach auf Männersuche begeben? War’s nur Midlife-Lüsternheit? Ach, aber das glaube ich nicht. War deine Flucht durch die Wechseljahre ausgelöst? Du hast immer so gescheit und vernünftig gewirkt, unbehelligt von allem Dunklen. Joan — erklär du’s mir.
Nun wird es dunkel in der Rathbone Road. Ich sollte mich auf den Weg ins Hospiz machen, falls Barry verstorben ist, oder Ähnliches. Heute würde mich nichts wundern. Es würde zur Hiobsstimmung dieses Tages passen. Aber vielleicht ist schon genug passiert für einen einzigen Weihnachtstag.
Könntest du mir schreiben —?
Ich werde diesen Brief in den Briefkasten vor dem Little Greek einwerfen, wenn ich mit den Hunden gehe, auch wenn es noch Tage dauern wird, bis er geleert wird, immerhin haben wir Weihnachten. Joan, wenn du mir jetzt schreiben und ein bisschen von dir erzählen könntest. Bald wirst du in Dhaka sein, meiner alten Heimat. Vielleicht könnte ich sogar kommen und dir ein bisschen Gesellschaft leisten? Es wäre mir ein großes Vergnügen. Mir geht es nicht so furchtbar gut in letzter Zeit.
Fröhliche Weihnachten wünsche ich dir.
Deine Freundin Eliza
***
? Januar
Liebe Joan,
der schwarze Weihnachtstag ist jetzt gut einen Monat her, und zwischen den Briefen war eine lange Pause. Ich muss mich wohl fragen, warum ich dir weiterhin schreibe. Du warst eigentlich nie meine Freundin. Von unserer ersten Begegnung an, als dein untadelig offenes Gesicht einen wachsamen Ausdruck annahm, wusste ich, dass du um meine Freundschaft lieber einen Bogen machen wolltest. Ich ahnte, dass du alles das in mir sahst, was du um beinahe jeden Preis vermeiden musstest.
Wie ich dich beneidete, wenn ich manchmal — oft — am Fenster stand. Du warst immer so beschäftigt, immer unterwegs in deinem kleinen Auto, deine Haustür stand immer offen, dein Haus war immer voller Leute. Junge, sorglose Leute. Lange Lunchpartys. Benefizpartys im Garten. So gut organisiert, und dabei so zwanglos. Wie du jeden Tag Punkt Viertel vor drei mit deinem Hund vor die Tür bist und um halb vier wieder zu Hause warst. Immer genau richtig gekleidet mit deiner mädchenhaften Frisur. Auch als du langsam grau wurdest, sahst du immer noch jung und sexy aus. Und wie du gelacht hast — gelacht und gerufen und gewinkt, während du sechsmal am Tag, wenn nicht öfter, in dein Auto gesprungen bist. Dein Lachen war in der ganzen Rathbone Road zu hören. Wir lauschten deinem Lachen — wie mir heute scheint — mit einem mulmigen Gefühl.
Und dann wurde ich wohl Zeuge sämtlicher Stadien deiner Desillusionierung, wobei ich sie nicht gleich als solche erkannte. Ich versuchte freundlich zu sein, wurde jedoch immer von diesem, etwas zu strahlenden Blick abgeschmettert, und dann folgte ein ablehnender und, wenn du erlaubst, recht überheblicher und wütender Seitenblick. Er gefiel mir nicht, genauso wenig die Art, wie du angefangen hast, deine Oberlippe hochzuziehen, so müde, so lebensmüde warst du geworden. Es grenzte an ein höhnisches Grinsen. Es war ein höhnisches Grinsen. Ich hatte Erbarmen mit dem Grinsen und betete für dich.
Vermutlich habe ich bei dir nur beobachtet, was in weniger dramatischer Form bei vielen Frauen unseres Alters in der Rathbone Road zu sehen war: Langeweile, Überdruss, Erkenntnis. Die reichen, gebildeten Engländerinnen aus der Mittelschicht, die endlich der Strapazen des massenkompatiblen Lebens müde sind, schauen morgens in den Spiegel und sehen das Gesicht einer Frau in den mittleren Jahren. Und sind unfähig, sie zu grüßen.
Die einzige, die ich komplett ausnehmen kann von alldem, ist Marjorie Gargery, die das Glück hat, beharrlich in den schulischen Leistungen ihrer Kinder aufzugehen. Da sie mit ihren Kindern einen weiten Bogen geschlagen hat, ist Marjorie für viele Jahre in Sicherheit. Sam, wenn du dich erinnerst, ist gerade erst fünf, und alle vier Mädchen gehen noch zur Schule. Hepzibah wird, klug, wie sie ist, bei Marjorie durch mehrere akademische Grade hindurch für Spannung und Mitfiebern sorgen, bis hin zu der aufregenden Frage, ob sie es zur Professorin schafft oder nicht. Gladiola ist ein fruchtbares Kind und wird viele kluge Kinder gebären, und mit etwas Glück kann Marjorie sie bis zu ihrem Tod in ihrer Entwicklung begleiten. Die großen Rätsel der Pubertät stehen diesen Mädchen natürlich noch ins Haus. Wer weiß, ob sie nicht alle am Ende auf die Schule pfeifen. Emma sah neulich höchst verwegen aus, fand ich. Sie murmelte irgendetwas von der National Front. Und Grizel und ihre Sportlehrerin sind recht dicke Freundinnen geworden.
Seit deinem Weggang hat sich das Verhalten der Bewohner der Rathbone Road gelockert, Joan. Ich meine jetzt nicht in moralischer Hinsicht. Ich meine, dass wir eigentlich mehr miteinander reden. Deine Flucht hat zu einer Spaltung in der Straße geführt. Einige sind nachdenklicher geworden, andere treten offensiver auf. Anne Robin trägt neuerdings ein riesiges langes rundlich geschnittenes Kleidungsstück, das an eine Aubergine oder das Umstandskleid einer Sultanin erinnert. Es bedeckt ihren ganzen Körper, was an und für sich gar keine schlechte Sache ist. Andere sind noch verbohrter geworden, vor allem die Frauen über fünfzig, die Memsahibs, die »altehrwürdigen Gattinnen«. Zwei von ihnen habe ich vorige Woche auf einer unserer Sherry-Partys getroffen, und man kam auf dich zu sprechen. Ich sagte, du fehltest mir sehr, und Lady Gant erwiderte, sie hoffe, nun ja, du seist glücklich, wo immer du jetzt stecktest, sie zweifle aber doch ein wenig daran und mehr habe sie dazu nicht zu sagen. Ich sagte zu Anne Robin: »Also gab es Gerede«, und Anne sagte: »Einige von uns haben die Zähne gezeigt.« Sie strich über ihr glockenförmiges Kleid und sagte: »Es gibt einen Code, den wir hier nach wie vor einhalten.«
Warum, Joan, zeigen Frauen anderen Frauen, die sich von ihren Männern verabschiedet haben, die Zähne? Lady G konnte Charles nicht ausstehen. Tut mir leid, aber ich denke, das ist dir nicht neu. Offenbar wegen damals, als er ihr auf einem Grillfest bei den Gargerys etwas zu nah gekommen ist. Ach nein — das kann nicht sein. Das hätte ihr eher gefallen.