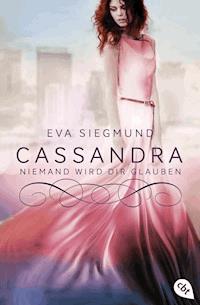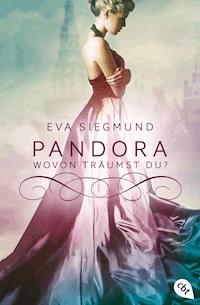9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Die H.O.M.E.-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Erwacht aus einem perfekten Traum?
Die siebzehnjährige Zoë hat ein perfektes Leben: Sie besucht eine Eliteakademie, gemeinsam mit ihrer großen Liebe Jonah. Doch plötzlich findet sie sich in einem heruntergekommenen Krankenhaus wieder. Angeblich lag sie zwölf Jahre im Koma und fragt sich nun verzweifelt: War alles nur ein Traum? Gemeinsam mit Kip, dessen Bruder Ähnliches durchlebt hat, deckt Zoë ein atemberaubendes Geheimnis auf. Sie muss sich entscheiden, auf welcher Seite sie steht und ob sie ihr perfektes Leben wirklich zurückhaben will …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Ähnliche
© Random House/Isabelle Grubert
DIE AUTORIN
Eva Siegmund, geboren 1983 im Taunus, stellte ihr schriftstellerisches Talent bereits in der 6. Klasse bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb unter Beweis. Nach dem Abitur entschied sie sich zunächst für eine Ausbildung zur Kirchenmalerin und studierte dann Jura an der FU Berlin. Nachdem sie im Lektorat eines Berliner Hörverlags gearbeitet hat, lebt sie heute als Autorin an immer anderen Orten, um Stoff für ihre Geschichten zu sammeln.
Mehr über cbj und cbt auf Instagram unter @hey_reader
Eva Siegmund
Das Erwachen
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Januar 2019
© 2019 by Eva Siegmund
© 2019 by cbj Kinder- und Jugendbuchverlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Carolin Liepins, München
Umschlagmotive © Shutterstock (shanghainese, Melkor3D, nouskrabs, kwest, faestock, Valua Vitaly, Arthur Kosyak, Sergivy Zavgorodny, paultarasenko, elenovsky)
Außenlektorat: Catherine Beck
MI · Herstellung: UK
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-22639-8V002
www.cbj-verlag.de
»Of course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean that it is not real?«
– Albus Dumbledore
Das kleine Mädchen stand im Regen auf der Wiese und schrie sich die Seele aus dem Leib. Es steckte in einem alten, pinkfarbenen Nachthemd, die rechte kleine Faust umklammerte das Ohr eines triefnassen Stoffhasen.
»Mama!«, schrie das Mädchen, so laut es konnte. Die Tränen, die seine Wangen hinabliefen, vermischten sich mit dem Regen, der unablässig vom Himmel prasselte. Rotz lief aus der Nase des Kindes in den verzweifelt verzerrten Mund.
»Mamaaaaaaaa!« Ihr Kopf war so rot, dass er kurz vor dem Platzen stehen musste; wie eine verknautschte Kirschtomate. Die kleinen nackten Füße des Kindes versanken fast im matschigen Rasen. Sie schniefte, hustete, verschluckte sich in ihrer Panik immer wieder an dem einen Wort, das sie so lange brüllen würde, wie sich noch Luft in ihren kleinen Lungen befand.
Etwas entfernt von ihr stand ein prächtiges altes Haus, dessen Eingangstür sich in diesem Augenblick öffnete. Doch das Mädchen bemerkte es nicht, es hatte die Äuglein vor Angst so fest zusammengepresst, wie es nur konnte.
Eine schlanke Frau erschien auf der großen Treppe, die zur Haustür hinaufführte. Sie hatte ein Handtuch über die Schulter gelegt und spannte einen Regenschirm auf. Die Frau steckte in einem schwarzen Trainingsanzug mit ebenfalls schwarzen Turnschuhen und ging nun zielstrebig auf das brüllende Kind im Garten zu.
Als sie das Mädchen erreicht hatte, wickelte sie es ohne Umschweife in das große Handtuch und begann, es trocken zu rubbeln. Die Kleine erschrak so sehr, dass sie kurz die Augen öffnete. Als sie das Gesicht der Frau erblickte, weiteten sich ihre Augen panisch.
»Mamaaaaaaa!« Ihre Stimme war mittlerweile so schrill und hoch, dass es wohl niemanden überrascht hätte, wenn sie damit die Glasscheiben des großen Gebäudes zum Bersten gebracht hätte.
»Na na na«, sagte die Frau brüsk, während sie das Kind weiter trocken rubbelte. »Wer wird denn hier so schreien?«
Das Mädchen öffnete das rechte Auge, ganz langsam und vorsichtig, um die Frau zu beobachten.
»Du bist Zoë, nicht wahr?«
Das Mädchen nickte langsam.
»Hallo Zoë.« Die Frau lächelte, doch dem Mädchen war anzusehen, dass es dem Lächeln nicht über den Weg traute. Der Blick der Frau wanderte zu dem Stoffhasen, der traurig und nass von der Hand des Kindes baumelte.
»Und wer ist das?«
»Walter«, flüsterte das Mädchen und schluchzte laut, doch die Frau lächelte noch breiter.
»Hallo Walter«, sagte sie. »Ich bin Dr. Jen. Und ich werde mich um dich und deine Freundin Zoë kümmern, in Ordnung?«
Die Worte machten Eindruck auf die kleine Zoë, sie hörte augenblicklich auf zu schluchzen. Ihr Blick wurde skeptisch und wachsam.
»Wo ist meine Mama?«, fragte sie, doch die Frau ignorierte die Frage. Stattdessen nahm sie das Kind auf den Arm und machte sich mit ihm auf den Weg ins Haus.
»Kommt, ihr beiden«, sagte sie. »Wollen wir doch mal sehen, ob Fräulein Nagel einen Tee für uns hat.«
Ich trat aus der Dunkelheit der Vorhalle hinaus auf die Wiese und blinzelte, weil sich meine Augen nur langsam an das Licht im Garten gewöhnten. Wie immer, wenn ich vorher Stunden im Simulator absolviert hatte, brauchte das seine Zeit. Mein Blick wurde noch von vereinzelten tanzenden, dunkelblauen Punkten durchzogen.
»Zoë!«, hörte ich eine vertraute Stimme nach mir rufen und drehte den Kopf. Da saß Jonah, direkt hinter dem Brunnen unter einer dicken, alten Eiche, und winkte mir zu.
Ich nahm mir eine Weile, um ihn zu betrachten, und fragte mich nicht zum ersten Mal, wie es dieser Mensch nur schaffte, die Luft zu sein, die ich atmete, und mir gleichzeitig täglich den Atem zu rauben.
Lächelnd ging ich zu ihm hinüber, gab ihm einen Kuss und setzte mich neben ihn.
»Jen hat dich mal wieder ganz schön lange schuften lassen«, stellte er fest und begann wie immer, in meiner Tasche zu kramen.
»Sie will eben sichergehen, dass ich uns nicht alle ins Verderben steuere!«, gab ich zurück, doch Jonah hörte mich kaum.
»Hast du den Aufsatz für Gefechtsstrategie?«, wollte er wissen, und ich nickte, während ich nach seiner Wasserflasche griff.
»Mein Tablet ist ganz hinten in der roten Mappe«, sagte ich und nahm einen großen Schluck. Dann streckte ich mich mit einem wohligen Seufzer auf der Wiese aus. Das war fast so gut wie schlafen.
»Wie war es bei dir?«, fragte ich, und er grinste. Jonah hatte ein Grübchen in der rechten Wange, das einen echt fertigmachen konnte. Nur in der rechten. Manchmal fragte ich mich, ob ich ihm deswegen alles durchgehen ließ, doch so genau wollte ich darüber lieber nicht nachdenken.
»Wie soll es gewesen sein?«, fragte er. »Ich habe einen nach dem anderen auf die Matte geschickt. Erst Connor, dann Nick und dann noch ein paar abgefahrene Kreuzungen aus Riesenschweinen und Seelöwen.«
Ich kicherte. »Welche Simulation?«
»Regenwald.«
Jonah zog sein Tablet hervor und begann, den Aufsatz von meinem Gerät abzuschreiben.
»Denk dran, es umzuformulieren«, mahnte ich.
»Es wissen doch sowieso alle, dass ich von dir abschreibe. Du bist der Kopf der Klasse, also bist du auch der Kopf der Mission, so einfach ist das.« Er schenkte mir ein entwaffnendes Lächeln. »Und da ich mit dem Kopf der Mission zusammen bin, wäre es eine enorme Ressourcenverschwendung, wenn ich mir diese Tatsache nicht zunutze machen würde. Ressourcenverschwendung ist eine der fünfundneunzigtausend Todsünden, das weißt du doch.«
»Aha«, sagte ich und konnte mir ein Lachen nicht verkneifen. »Und warum musst du dann überhaupt deine Hausaufgaben machen?«
»Damit der Rest des Teams nicht eifersüchtig auf meine Privilegien ist.« Er schenkte mir einen amüsierten Seitenblick. »Nur weil ich mit dem Kapitän ins Bett gehe, heißt das noch lange nicht, dass ich meine Pflichten vernachlässigen darf.«
»Aber deiner Argumentation folgend …«
»Es geht darum, das Protokoll zu wahren, Zoë«, murmelte Jonah zerstreut. Ihm war anzusehen, dass er gerade angestrengt versuchte, einen meiner Endlossätze zu vereinfachen. Endlossätze waren meine Spezialität.
»Als Kapitän und Leiterin der Mission könnte ich dir auch einfach befehlen, deine Aufgaben selbst zu erledigen!«
Jonah streckte die rechte Hand aus und zwickte mich in die Seite. »Das könntest du tun, aber dann würde ich dich nie wieder küssen.«
»Das wäre tatsächlich unendlich grausam.«
»Hmhm. Überleg es dir also gut, wir müssen es noch ein wenig miteinander aushalten. Den Rest unseres Lebens, um genau zu sein.«
»Ich werde daran denken«, lachte ich und ließ meine Hände gedankenverloren über das frisch gemähte Gras gleiten.
Eine Weile hörte man nur Jonahs Finger, die über seine externe Tastatur huschten. Es war mir ein Rätsel, warum sich jemand, der so schnell tippen konnte, trotzdem so vehement gegen jegliche Art der Kopfarbeit wehrte. Natürlich kämpfte Jonah lieber, als zu recherchieren und dröge Aufsätze zu schreiben, aber all das war Teil unserer Arbeit.
Während er schrieb, betrachtete ich den blauen, beinahe wolkenlosen Himmel, der sich über das Akademiegelände spannte. Wahrscheinlich wusste ich mehr als alle anderen Schüler über den Himmel, den Kosmos, Galaxien, Sterne und Planeten, und doch war mein Wissen nur abstrakt. Wenn ich nach oben schaute, konnte ich mir kaum ausmalen, was dort alles existierte.
»Ich kann mir nicht vorstellen, diesen Ort jemals zu verlassen!«, murmelte ich irgendwann.
Jonah klappte sein Tablet zu, legte sich neben mich und zog mich an sich. »Das ist ein bisschen ungünstig in unserer Situation, findest du nicht? Streng genommen tun wir alles, um von hier fortzukommen.«
»Ich weiß das«, erwiderte ich. »Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, nicht in der Akademie zu leben. Ich meine, kein Mensch weiß, was da draußen ist.«
»Meine Denkmaschine«, murmelte Jonah und küsste mich in den Nacken. »Hör auf, darüber nachzugrübeln. Es ändert doch sowieso nichts.«
»Fragst du dich denn nie, was uns erwartet?«
»Du meinst, außer Schlamm, Riesenschweinen und dreiköpfigen Klapperschlangen?«
Ich schnalzte mit der Zunge. »Dreiköpfig?«
»Habe ich dir das nicht erzählt? Schmitz hatte bei der Wüstensimulation gestern wohl schlechte Laune.«
Allein der Gedanke an so ein Tier ließ mich erschaudern. Manche Dinge wollte ich mir einfach lieber nicht vorstellen. Dann nahm ich doch lieber den Regenwald. Nach allem, was wir wussten, war der ohnehin das wahrscheinlichste Szenario.
»Das meine ich nicht«, nahm ich den Faden wieder auf. »Und das weißt du.«
Jonah umfasste mein Kinn sanft mit zwei Fingern und zwang mich, ihn anzusehen. Sein sonst fast immer fröhliches Gesicht war ernst, der Blick in den hellblauen Augen ungewohnt intensiv.
»Ich will dir mal was sagen, Zoë Alma Baker. Es ist mir scheißegal, was dort draußen auf uns wartet.«
Ich runzelte ungläubig die Stirn. »Wirklich scheißegal?«, fragte ich, und Jonah nickte.
»Vollkommen. Weil das Einzige, was zählt, ist, dass du bei mir bist.«
Augenblicklich hatte ich einen Kloß im Hals. Jonah sprach selten über seine Gefühle.
»Meinst du das ernst?«
Das Lächeln kehrte in sein Gesicht zurück, als hätte es jemand angeknipst. »Absolut. Wie soll ich denn überleben, wenn ich nicht weiß, wie man essbare Pflanzen bestimmt oder unter widrigen Bedingungen Feuer macht?«
Ich boxte ihn gegen die Hüfte und er jaulte übertrieben laut auf.
»Sie sind ein unverschämter Mistkerl, Leutnant Schwarz«, tadelte ich ihn. »Wenn das noch einmal vorkommt, muss ich Sie melden.«
Jonah biss mich sanft in den Hals und küsste mich erneut.
»Und was wird mir vorgeworfen?«, raunte er und rollte sich auf mich.
Ich kicherte, weil mich seine Bartstoppeln am Hals kitzelten. »Ungebührliches Verhalten«, gluckste ich und versuchte, ihn von mir runterzuwerfen, doch ich hatte keine Chance. Jonah war besonders gut im Nahkampf.
»Kapitän Baker!« Die Stimme meiner Ausbilderin Dr. Jen Jacobs durchschnitt den Augenblick. Jonah verdrehte die Augen und gab mich frei.
»Anwesend!«, rief ich und griff nach meiner Tasche.
»Noch drei Minuten bis zum Ausdauertraining.«
»Die immer mit ihren drei Minuten«, murmelte Jonah ungehalten. »Normale Ausbilder sagen fünf Minuten vorher Bescheid. Aber nein, Fräulein Eisenschenkel ist der Auffassung, 180 Sekunden seien vollkommen ausreichend.«
Ich wollte mich aufrappeln, doch Jonah hielt mich am Ärmel meiner Trainingsjacke fest.
»Sehen wir uns heute Abend?«
»Ich …«
»Ach komm schon. Wir waren ewig nicht zusammen aus!«
Ich dachte an den Berg Aufgaben, der auf meinem Schreibtisch wartete, und die Schachpartie, die ich schon seit Wochen mit Professor Clarius spielen wollte. Doch Jonahs Blick setzte mich im wahrsten Sinne des Wortes matt.
»Einverstanden«, lachte ich. »Um acht im Greenhouse?«
Jonah nickte. »Ich liebe dich, Zö.«
»Ich liebe dich mehr.«
Er lächelte mir noch mal zu, dann gab er mich endgültig frei, und ich hastete über den Rasen zurück in das Akademiegebäude. Ich würde zu spät kommen und Dr. Jen würde mich diese Verspätung büßen lassen. Vermutlich mit Liegestützen, weil sie wusste, wie sehr ich das hasste. Aber das war es wert.
Wenn wir erst einmal gestartet waren, würde Dr. Jen mir nie wieder vorschreiben können, was ich zu tun oder zu lassen hatte. Dann hatte ich das Sagen.
Um mich herum war es pechschwarz und der Lärm war ohrenbetäubend. Ein schriller Pfeifton lag in der drückend heißen Luft, hydraulisches Stampfen war zu hören, und es roch nach Schweiß und Desinfektionsmitteln. Hatte es etwa einen Zwischenfall gegeben? Oder war das hier eine neue Form der Simulation? Doch eigentlich fühlte es sich echt an; nach all den Jahren auf der Akademie erkannte ich eine Simulation eigentlich immer, so gut sie auch gemacht war. Die Simulatoren rochen anders.
Ich wollte nach der Pistole an meinem Waffengürtel greifen, aber irgendwas hielt mich zurück. Ich war an den Handgelenken gefesselt und auch die Füße konnte ich nicht rühren. Doch schon diese kleinen Bewegungen bereiteten mir solche Schmerzen, dass mir schwindelig wurde. Mein Kopf dröhnte, meine Glieder brannten wie Feuer. Da erst begriff ich, was geschehen war – jemand hatte mich gefangen genommen, die Mission war in Gefahr. Fieberhaft versuchte ich, mich an irgendwas zu erinnern, doch es gelang mir nicht. In meinem Kopf herrschte Chaos und nur ein einziger klarer Gedanke: Jonah. Wo war Jonah?!
»Leutnant?«, rief ich, doch meine krächzende Stimme wurde von dem Lärm um mich herum geschluckt. Ich atmete tief durch und versuchte es erneut. Dabei wahrte ich den förmlichen Ton. Nur für den Fall, dass ich mich doch in einer Prüfungssimulation befand. »Leutnant Schwarz, wo sind Sie? Fähnrich Langeloh?« Ich bekam keine Antwort, von keinem der beiden. Was war geschehen, was hatten sie mit uns gemacht?
Hektisch riss ich den Kopf herum, doch zunächst sah ich nichts außer blinkenden roten Lichtern, die sich bis zur Unendlichkeit zu wiederholen schienen. Quälend langsam gewöhnten sich meine Augen an die Dunkelheit, doch allmählich konnte ich hier und da Bewegungen wahrnehmen. Als ich etwas erkannte, zuckte ich zusammen. Das konnte nicht sein! Es sah aus, als wäre ich umgeben von sich ruckartig bewegenden Puppen. Der ganze Raum war voll davon.
Panik stieg in mir hoch. »Jonah!«, rief ich noch mal, lauter jetzt. »Sabine! Wo seid ihr?«
Doch statt einer Antwort legte sich mir eine dicke, schwere Hand auf den Mund und presste meinen Kopf fest nach unten. Im selben Augenblick verstummte der schrille Pfeifton und mein Kopfschmerz ließ deutlich nach.
»Hey, ganz ruhig!«, raunte eine tiefe Stimme dicht an meinem Ohr.
Ich stemmte meinen Kopf mit aller Kraft gegen die Hand des Fremden, sodass meine Schneidezähne ein Stück Fleisch erwischten, und biss zu. Der Knorpel knirschte zwischen meinen Zähnen, und ich musste ein Würgen unterdrücken, als mir Blut in den Rachen lief. Doch ich ließ nicht locker.
Der Mann atmete heftig, gab aber sonst keinen Laut von sich. Offenbar wollte er nicht entdeckt werden. Er war auf der Hut, das könnte ein Vorteil sein.
»Wenn du nicht loslässt, muss ich dich umbringen«, stöhnte der Mann leise. »Nicht gern, aber ich würde es tun.«
Nur widerwillig ließ ich von ihm ab. So eine Chance bekam ich sicherlich nie wieder. Doch er war eindeutig in der besseren Position.
Ein vermummtes Gesicht schob sich in mein Blickfeld. Ich konnte nicht viel erkennen. Nur dass sich die roten Lichter in einer randlosen Brille spiegelten.
»Braves Mädchen«, keuchte er. »Es fällt dir vielleicht schwer, das zu glauben, aber ich bin auf deiner Seite. Ich bin hier, um dich rauszuholen.«
Ich fühlte ein Stechen an meinem Hals und kurz darauf ein scharfes Brennen, das sich durch meine Adern schob. Schon bald konnte ich meine Augen nicht mehr offen halten.
»Vertrau mir«, flüsterte der Mann in mein Ohr.
Das Gesicht von Dr. Jen schob sich in mein Bewusstsein. Ihre dunklen Haare trug sie wie immer zu einem festen Knoten gebunden, die makellose Haut spannte sich über die hübsch operierte Nase.
Sie bedachte mich mit einem strengen Blick. »Vertraue niemandem«, sagte sie.
»Wieso rufst du mich an?«
»Ich …«
»Ich habe dir doch schon tausend Mal gesagt, dass du unter dieser Nummer nicht anrufen sollst!«
»Entschuldige, aber …«
»Warte kurz, ich muss mal eben hier raus. Scheiße, die Sitzung fängt gleich an.«
»Es ging nicht anders.«
»Gut, hier kann ich reden. Also? Was ist jetzt schon wieder los? Hast du wieder einen deiner Schützlinge verloren?«
»Das könnte man so sagen.«
»Was ist passiert?«
»Zoë Baker ist verschwunden.«
»Hilf mir auf die Sprünge.«
»Der Kapitän.«
»Scheiße. Und was soll das heißen: Sie ist verschwunden?«
»Genau das, was ich sage. Ich habe gerade meine Kontrollrunde gemacht. Ihr Bett ist leer.«
»Das ist unmöglich.«
»Aber wahr. Ich habe alles abgesucht. Sie ist nicht hier. Ihre Bettwäsche ist voller Blut, eine ziemliche Sauerei.«
»Ihr Blut?«
»Wessen sonst?«
»Kann sie abgehauen sein?«
»Wie soll sie das denn gemacht haben?«
»Keine Ahnung. Du sagst doch immer, dass sie so gut ist.« »Natürlich. Sie ist die Beste, die ich je gesehen habe. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie sich eigenhändig abkoppeln kann.«
»Also hatte sie Hilfe.«
»Oder jemand hat sie entführt.«
»Nenn es, wie du willst. Auf jeden Fall hat sie jemand rausgeholt. Damit will ich mich auch gar nicht lange aufhalten. Wo steckt sie denn jetzt?«
»Das weiß ich nicht. Ihr Tracker wurde deaktiviert.«
»So ein gottverdammter Mist.«
»Sag ich ja. Ich hätte nicht angerufen, wenn es kein Notfall wäre.«
»Es ist ein Riesennotfall. Könnten wir die Sache zur Not auch ohne sie durchziehen?«
»Ohne Zoë? Ich glaube nicht. Seit wir den ersten Offizier verloren haben, ist Baker unsere einzige Chance. Wir hätten dieses Risiko damals nicht eingehen dürfen.«
»Hätte, hätte. Das hilft uns jetzt auch nicht. Du musst sie finden.«
»Das ist mir auch klar.«
»Uns läuft die Zeit davon.«
»Das ist mir ebenfalls klar, Hannibal.«
»Benutz diesen Namen gefälligst nicht. Nicht über diese Leitung.«
»Entschuldige. In Ordnung.«
»Du hast mich aus einer Krisensitzung geholt. Die wichtigsten Staatsmänner Europas treffen sich heute in Brüssel, um zu diskutieren, wie sich die Apokalypse noch abwenden lässt. Ich glaube nicht, dass es überhaupt Hoffnung gibt. Das eskaliert hier bald, die Stimmung ist so was von gereizt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hol das Mädchen zurück und koppel sie wieder an. Und zwar pronto.«
»Ich hoffe nur, ihr Gehirn übersteht das überhaupt.«
»Wieso sollte es nicht?«
»Es ist nun mal nicht vorgesehen, dass ihr jemand einfach so den Stecker zieht. Keine Ahnung, was passiert, wenn ich sie wieder mit dem System kopple. So was habe ich vorher noch nie gemacht. Sie war jetzt zwölf Jahre angeschlossen, Herrgott noch mal!«
»Glaubst du, sie hat Schaden genommen?«
»Ich hoffe nicht.«
»Hast du einen Verdacht, wer dahinterstecken könnte?«
»Vielleicht der Alte?«
»Das glaube ich nicht. Der setzt doch nicht seinen fetten Arsch und die goldene Karriere aufs Spiel. Außerdem hat er die Hosen voll. Die Menge an Schlafmitteln, die er jeden Abend nimmt, würde einen jungen Bullen zur Strecke bringen.«
»Vielleicht hast du recht. Aber sonst fällt mir auch niemand ein. Es weiß doch fast keiner, dass wir hier sind.«
»Okay, da ist natürlich was dran. Also behalte ich den Alten vorsorglich auch im Auge.«
»Rede mal mit ihm.«
»Auch das. Lass das meine Sorge sein und kümmer dich um das Mädchen.«
»Ich werde Geld für all das brauchen. Und Hilfe. Ich schaffe das nicht allein.«
»Jetzt verlier mal nicht die Nerven. Du holst dir jetzt erst einmal ein Prepaid-Handy, mit dem du mich anklingelst. Ich rufe dich zurück, sobald ich kann.«
»Okay.«
»Behalte einen kühlen Kopf. Du kennst das Mädchen besser als jeder andere Mensch. Du hast sie praktisch großgezogen. Also wirst du sie auch finden.«
»Diese Stadt hat acht Millionen Einwohner. Und das sind nur die legalen.«
»Ich bezahle dich nicht so gut, weil ich dich für Mittelmaß halte. Du wirst sie finden. Und du bringst sie zurück.«
»Es gibt keinen anderen Weg.«
»Nein, den gibt es nicht. Und ich muss jetzt Schluss machen. Tu, was ich dir gesagt habe.«
»Okay.«
Zuerst war da wieder dieser Pfeifton. Nicht ganz so schrill und laut wie beim letzten Mal, dafür wieder direkt an meinem Ohr. Dann blinzelte ich und das gleißende Licht traf mich wie Tausende Scheinwerfer. Überall grelles hartes Weiß, als wollte man mich blenden. Es hatte keinen Zweck, ich musste die Augen wieder schließen. Meine Hände ballten sich zu Fäusten. Innerlich wappnete ich mich schon gegen eine quälende Verhörsituation, als ich bemerkte, dass ich gar nicht mehr fixiert war. Meine Hände und Füße ließen sich frei bewegen, obwohl ich das Gefühl hatte, dass jeder Zeh mehrere Tonnen wog.
Hastige Schritte drangen an mein Ohr und der Pfeifton verstummte.
»Sie ist aufgewacht«, hörte ich eine weibliche Stimme aufgeregt flüstern.
»Ehrlich?«, fragte eine zweite erstaunt. »Na so was. Ich dachte, sie würde es nicht schaffen.«
»Hol den Doktor«, sagte die erste, und leichte Schritte entfernten sich hastig.
»Zoë, können Sie mich hören?« Natürlich konnte ich das, ich war schließlich nicht taub.
»Haben Sie keine Angst, es ist alles in Ordnung. Der Doktor wird gleich hier sein.«
Doktor? Wieso Doktor? Ich brauchte keinen Arzt, ich brauchte meine Waffe und einen sicheren Internetzugang.
Ich versuchte zu sprechen, doch mehr als ein ersticktes Röcheln war meinen Stimmbändern nicht abzutrotzen. Noch einmal versuchte ich, die Augen zu öffnen, doch erneut wurde ich zu stark geblendet, um es auszuhalten. Um wenigstens irgendetwas zu tun, begann ich, wild zu zappeln.
Kleine, aber kräftige Hände drückten mich an den Schultern nach unten. Erst jetzt nahm ich wahr, dass ich auf etwas Weichem lag.
»Sch… beruhigen Sie sich, es ist alles in Ordnung.«
Das glaubte ich weniger.
Ich hörte, wie feste schnelle Schritte einen Gang entlang auf mich zukamen, das selbstbewusste Auftreten einer Autoritätsperson. Instinktiv streckte ich den Rücken durch und versuchte, Haltung anzunehmen. Dabei knackte meine Wirbelsäule bedrohlich laut. Wie dicke Äste, die unter Kampfstiefeln zerbersten.
»Mein Gott, Mädchen. Schließt die Vorhänge«, hörte ich eine männliche Stimme poltern, und kurz darauf verdunkelte sich die Welt vor meinen geschlossenen Lidern.
»Sie hat ihre Augen seit einer Ewigkeit nicht geöffnet«, raunte der Mann. »Daran hättet ihr denken müssen.«
»Entschuldigen Sie, Doktor«, sagte die Frau betreten, die vorher mit mir gesprochen hatte.
Doktor?
»Ist schon gut. Holen Sie ihr etwas zu trinken. Und reichern Sie es an!«
Ich schlug erneut die Augen auf, doch diesmal war es etwas angenehmer. Das Zimmer, in dem ich mich befand, war abgedunkelt, es bereitete mir weniger Schmerzen als zuvor, und nun konnte ich auch endlich sehen, wo ich mich befand.
Es war eindeutig ein Krankenzimmer, doch die Einrichtung war schäbig und abgegriffen, die Geräte schienen aus dem letzten Jahrhundert zu stammen, und über die vergilbten Wände zogen sich daumendicke Risse. Der Mann, der in einem abgewetzten, weißen Kittel auf der Kante meines Bettes saß, lächelte mich voller Wärme an.
»Hallo Zoë. Ich bin Doktor Akalin«, sagte er und legte seine Hand auf meine. Ich zog sie augenblicklich weg.
Dann holte ich Luft, um etwas zu erwidern, doch der Arzt hob mahnend die Hand. »Nicht. Erst müssen Sie etwas trinken. Wenn Sie jetzt sprechen, könnten Sie Ihre Stimmbänder verletzen. Kommen Sie erst einmal richtig zu sich.«
Ich starrte ihn wütend an, doch mir blieb nichts weiter übrig, als mich zu fügen. Meine Stimmbänder brauchte ich schließlich noch.
Endlich kam die Krankenschwester mit einem Glas Wasser in der Hand zurück. Sie war noch sehr jung, nicht viel älter als ich. Als sie das Glas auf dem kleinen Tisch neben mir abstellte, lächelte sie mir freundlich zu. Wo war ich denn hier gelandet? Wieso waren alle so nett zu mir?
Ich streckte die Hand aus, um nach dem Wasserglas zu greifen.
»Sind Sie sicher, dass Sie das schaffen?«, fragte der Arzt besorgt, und ich runzelte verärgert die Stirn. Wenn der wüsste, wozu ich in der Lage war, würde er solche blöden Fragen gar nicht erst stellen. Warum wusste er es nicht?
Doktor Akalins Augen verfolgten gespannt, wie ich nach dem Glas griff und es zum Mund führte. Meine Hände zitterten leicht, doch davon abgesehen funktionierte alles so, wie es sollte.
»Erstaunlich«, murmelte er leise, und ich fragte mich, was daran so erstaunlich war.
Das Wasser war lauwarm und schmeckte merkwürdig, dennoch leerte ich das Glas in einem Zug. Ich trank so gierig, dass mir links und rechts Flüssigkeit aus den Mundwinkeln rann, doch das kümmerte mich nicht.
Dann räusperte ich mich, um zu testen, wie sich mein Hals nun anfühlte. Viel besser. Das Glas behielt ich vorsichtshalber in der Hand. Wenn ich mich verteidigen musste, war es besser als nichts.
»Wo bin ich?«, fragte ich krächzend und fuhr mir mit dem Handrücken über den Mund.
»Auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Berlin Mitte«, antwortete der Arzt, während er von meinem Bett aufstand und sich einen Stuhl heranzog.
Berlin? Was um alles in der Welt hatte ich hier verloren? Die Akademie lag außerhalb von Köln.
»Was ist mit Jonah?«
Der Arzt legte den Kopf schief und betrachtete mich eine Weile. Er schien seine Antwort genau abwägen zu wollen. Heiße Angst schoss mir in die Glieder. Wenn ich im Krankenhaus lag – wo war dann Jonah? Was war passiert?
»Ist das Ihr Bruder?«, fragte er schließlich und brachte mich damit völlig aus dem Konzept.
»Was?«
»In Ihren Akten steht, dass Sie einen Bruder haben.«
»Da müssen sich Ihre Akten irren. Ich habe keinen Bruder. Jonah ist mein …« Im letzten Augenblick dachte ich, dass ich einem Fremden besser nicht anvertrauen sollte, was Jonah für mich war. »Leutnant«, schloss ich deshalb.
Bei diesem Wort schossen die Augenbrauen des Arztes erstaunt in die Höhe.
»Leutnant?«, fragte er nun seinerseits merklich verwirrt.
»Ja, Leutnant«, bestätigte ich scharf und setzte in Gedanken hinzu: ›Und die Liebe meines Lebens.‹
»Er müsste mit mir zusammen hier angekommen sein. Ich will sofort wissen, wo er ist und ob es ihm gut geht.«
Nun bildete sich eine tiefe Falte auf Doktor Akalins Stirn. »Zoë, niemand ist mit Ihnen hier angekommen.«
»Das kann nicht sein. Wir bleiben immer zusammen. Er würde mich niemals zurücklassen.« Ich wurde mit jedem Wort ein bisschen lauter, bis ich kurz davor war, zu brüllen.
Beschwichtigend hob der Arzt die Hand. »Das wollte ich damit auch gar nicht sagen.«
»Ach nein?« Nun überschlug sich meine Stimme. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass sich ein Grüppchen Schaulustiger vor der Zimmertür gebildet hatte. Doktor Akalin waren die Zuschauer auch nicht entgangen. Er stand auf und schloss mit einem verärgerten Blick in Richtung der Krankenschwestern die Tür.
»Was wollten Sie denn sonst damit sagen?«, fuhr ich fort, den Blick fest auf sein Gesicht geheftet.
Der Arzt massierte sich die Schläfen und sah mich anschließend lange an.
»Ich weiß nicht, ob …«, begann er vorsichtig, doch ich schnitt ihm das Wort ab.
»Ich will jetzt wissen, was hier los ist. Sofort!«
»Vielleicht warten wir besser, bis Ihre Familie hier ist.«
»Familie? Ich habe keine Familie. Schon gar nicht hier in Berlin. Wovon reden Sie überhaupt?«
Akalin kniff sich in die Nasenwurzel. »Okay … okay. Der Reihe nach. Wissen Sie, wer Sie sind?«
Ich schnaubte. »Steht das etwa nicht in Ihrer dämlichen Akte? Ich heiße Zoë Alma Baker, ich bin 17 Jahre alt und Kapitänsschülerin an der H.O.M.E.-Akademie.«
Der Arzt schüttelte den Kopf.
»Sie sind Zoë Alma Baker«, sagte er langsam. Für meinen Geschmack zu langsam. »Aber Sie sind sicherlich keine Schülerin an irgendeiner Akademie. Sie wurden vor 17 Jahren in Berlin geboren und haben die Stadt noch nie verlassen.«
Ich fing an zu lachen. »Woher wollen Sie das wissen? Sie kennen mich doch überhaupt nicht!«
Er seufzte. »Weil Sie seit zwölf Jahren das Krankenhaus nicht verlassen haben, Zoë. Sie lagen im Koma.«
Ich starrte ihn eine Weile fassungslos an, dann schüttelte ich den Kopf. Jetzt hatte ich wirklich genug gehört. Egal, was hier gespielt wurde, ich würde nicht mitmachen. Sie würden allesamt noch bereuen, mir jemals begegnet zu sein. Als könnte man mich so leicht hinters Licht führen. Ich war nicht ohne Grund Kapitänsanwärterin. Mein Atem ging schwer, meine Finger schlossen sich so fest um das Glas, dass die Knöchel weiß hervortraten. Ich würde ihnen zeigen, mit wem sie sich hier anlegten.
Mit voller Wucht schlug ich das Trinkglas auf den Rand des Beistelltisches, Scherben spritzten zu allen Seiten, und im Handumdrehen hatte ich eine scharfe Waffe in den Fingern. Genau das, was ich brauchte. Langsam stieg ich aus dem Bett und ging mit dem Glas in der Hand auf den Mann los, der sich als Arzt ausgab. Doch das hier war ganz sicher kein Mediziner, auch wenn er seine Rolle ziemlich überzeugend spielte. Nun, ausgebildet wurden wir schließlich alle, nicht wahr?
»Es reicht mir jetzt mit Ihnen«, zischte ich. »Ich will sofort wissen, für wen Sie arbeiten und wo meine Mannschaft ist.«
Akalin wurde blass um die Nasenspitze und wich zurück. Militärisch ausgebildet war er schon mal nicht.
»Ich kann verstehen, dass Sie aufgebracht sind«, stammelte er.
»Aufgebracht ist kein Ausdruck«, gab ich zurück. »Raus damit: Was ist Ihre Mission?«
»Meine Mission ist es, das Leben meiner Patienten zu schützen. Ich bin Arzt! Ich flehe Sie an, Zoë. Beruhigen Sie sich, legen Sie das Glas weg und hören Sie mir zu.«
»Ich werde Ihnen zuhören«, sagte ich. »Aber meine Waffe werde ich ganz sicher nicht aus der Hand legen. Das können Sie vergessen.«
Akalin nickte.
»Ich werde Ihnen beweisen, dass ich die Wahrheit sage, in Ordnung? Aber Sie müssen mir ein bisschen dabei helfen. Sind Sie so lieb?«
Ich dachte eine Weile nach, dann nickte ich knapp.
Akalin atmete erleichtert aus. »Gut. In Ordnung. Also … Können Sie sich bitte beschreiben? Wie sehen Sie aus?«
Mir entfuhr ein ungeduldiges Schnauben. Für so einen Mist hatte ich eigentlich keine Zeit. »Ich bin einen Meter siebzig groß, habe dunkelbraune, schulterlange Haare und braune Augen.«
»Und ihre Statur?«, fragte der Arzt.
Ich zuckte die Schultern. »Muskulös, schlank. Drahtig, so sagt man doch? Die Ausbilder legen Wert darauf, dass wir gut in Form sind.«
Akalin sah mir fest in die Augen. »Ich werde jetzt die Tür des Schrankes neben mir öffnen. Okay?«
Wozu sollte das gut sein? Hatte der Mann darin etwa seine Waffen versteckt? Ich verlagerte mein Gewicht und brachte mich so in Angriffsposition. »Nur zu!«
Er zog am Türknauf des hellbraunen Schrankes, der neben ihm stand. Die Tür schwang auf, und jetzt sah ich zu meiner Überraschung, dass sich auf der Innenseite ein Spiegel befand. Akalin drehte die Tür so, dass ich hineinsehen konnte.
Ich schnappte nach Luft. Das, was ich dort sah, konnte ich nicht glauben.
Da stand ein Mädchen mit einem abgebrochenen Glas in der Hand in einem blauen Nachthemd. Ihr Schädel war kahl rasiert und fleckig, ihre Arme und Beine dünn wie Bleistifte. Sie war so mager, dass sich die blauen Adern an Kopf und Armen deutlich abzeichneten.
Voller Entsetzen starrte ich sie an. Der Boden unter meinen Füßen fühlte sich auf einmal nicht mehr fest an; er schwankte bedrohlich und konnte jederzeit wegbrechen. Und dann geschah es. Ich fiel, fiel unendlich tief in ein schwarzes Loch, das mich schlucken und nie wieder freigeben würde. Meine Welt zerfiel, und die Stille, die dabei entstand, dröhnte in meinen Ohren. Dennoch blieb ich stehen, wo ich war. Auf nackten Füßen vor einem alten Holzschrank, und starrte in einen Spiegel. Das konnte nicht sein. Ich erkannte mein Gesicht, aber ich erkannte mich nicht.
Eine ganze Weile hoffte ich, endlich aus diesem Albtraum zu erwachen oder aus der Simulation geholt zu werden. Doch nichts geschah. Zaghaft hob ich den linken Arm und der Arm im Spiegel bewegte sich mit. Ich hob die rechte Augenbraue, die Vogelscheuche im Spiegel hob die linke.
»Sagen Sie mir noch einmal, wo ich bin«, flüsterte ich nach einer halben Ewigkeit.
»Sie sind im Universitätsklinikum Berlin Mitte«, sagte Akalin mit ruhiger Stimme. »Sie sind in Sicherheit.«
»Nein«, entgegnete ich, den Blick noch immer auf den Spiegel geheftet. »Ich bin in der Hölle.«
Obwohl draußen schönster Sonnenschein herrschte, war der Garten wie leer gefegt. Wahrscheinlich fand in der großen Aula gerade eine Informationsveranstaltung statt. Mist! Hatte ich das etwa vergessen? Es sah gar nicht gut aus, wenn der Kapitän zu spät zu solchen Veranstaltungen auftauchte. Leise fluchend beschleunigte ich meine Schritte.
Die langen Flure der Akademie lagen im Dunkeln, doch ich hielt mich nicht damit auf, Licht zu machen. Diese Gänge kannte ich in- und auswendig. Die Sohlen meiner Trainingsschuhe quietschten leise auf dem Linoleumboden, während ich in Richtung Aula rannte.
Als ich vor der großen Doppelflügeltür stand, wusste ich, dass ich richtiggelegen hatte. Drinnen war eine Versammlung im Gange – die dunkle Stimme von Direktor Martin drang durch die Scheiben zu mir heraus. Ich atmete ein paar Mal tief durch, da ich es vermeiden wollte, den Raum völlig abgehetzt zu betreten. Das schickte sich für meine Position ganz und gar nicht. Ich bewahrte immer Haltung, auch wenn es mir das Genick brach.
Dann stieß ich die Tür auf und ging hindurch.
Ich hatte mit einem großen Auftritt gerechnet, doch keiner der Anwesenden nahm auch nur ansatzweise Notiz von mir. Alle dreißig Schüler sowie sämtliche Ausbilder der Akademie waren anwesend. Sie schauten nach vorne zur Bühne, wo der Direktor an einem Pult stand und eine Rede hielt. Mir fiel auf, wie leise alle waren. Nur hier und da war ein Schluchzen oder unterdrücktes Schniefen zu hören. Augenblicklich bekam ich es mit der Angst zu tun. Hier war etwas passiert! Meine Augen suchten den Raum nach Jonah ab, und ich brauchte nicht lange, bis ich ihn zwischen Connor und Nick in der ersten Reihe entdeckte. Seine Schultern bebten und Connor hatte seine Hand tröstend auf Jonahs Rücken gelegt.
So schnell es die Höflichkeit zuließ, ging ich den Mittelgang zwischen den Stuhlreihen entlang nach vorne. Ich musste zu Jonah.
Doch so weit kam ich gar nicht, denn als ich mich der Bühne näherte, erkannte ich, was hier los war. Vor dem Pult, an dem Direktor Martin stand, waren Blumen und Kerzen um einen Bilderrahmen herum drapiert. Das hier war eine Trauerfeier. Und aus dem Bilderrahmen heraus lächelte mir mein eigenes Gesicht entgegen. Das konnte nicht wahr sein. Sie trauerten um mich!
»Aber …«, stammelte ich, während Gänsehaut über meinen gesamten Körper kroch. »Ich bin doch hier!«
Ich entdeckte meine beste Freundin Sabine nicht weit entfernt und hastete zu ihr hinüber. Sie weinte bitterlich. Als ich sie an der Schulter berühren wollte, glitt meine Hand einfach durch sie hindurch.
Mein Herz klopfte wie wild, ich begriff nicht, was gerade mit mir geschah. Verzweifelt versuchte ich, andere Mitschüler auf mich aufmerksam zu machen, doch ich konnte keinen von ihnen berühren. Niemand nahm mich wahr, keiner hörte mich.
»Ich bin hier«, schrie ich nun, so laut ich konnte. »Ich bin nicht tot. Ich lebe!«
»Zoë?« Jemand rüttelte an meiner Schulter.
»Zoë, wach auf!«
Ich fuhr hoch und blickte in das besorgte Gesicht von Schwester Miriam. Im nächsten Augenblick sah ich den Schrank, den abgewetzten Linoleumboden, die Risse in den Wänden.
Ich war nicht zu Hause, sondern in der Klinik. Doch wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich lieber tot in der Akademie gewesen als lebendig hier.
Frustriert ließ ich mich in die Kissen zurücksinken und wischte mir den Schweiß von der Stirn.
»Wieder einer dieser Albträume?«, fragte Miriam, und ich nickte.
Die Schwester strich mir über den stoppeligen Kopf, und ich ließ es geschehen, weil ich sie mochte. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, dass Miriam kein Gramm Bösartigkeit in sich trug. Nur deswegen versuchte ich, meine Wut nicht an ihr auszulassen. Alle anderen in diesem Krankenhaus hatten allerdings nicht so viel Glück.
»Es muss scheiße sein, sich nicht einmal auf den eigenen Kopf verlassen zu können«, sagte sie sanft, und ich lachte kurz auf. Das hatte sie erstaunlich präzise auf den Punkt gebracht.
»Aber du solltest nicht so hart zu ihm sein. Er hat dich jahrelang am Leben gehalten.«
Ich schwieg. Wie eigentlich die meiste Zeit in den letzten Tagen. Es kostete mein Gehirn gewaltige Anstrengungen, einzuordnen und zu verarbeiten, was hier gerade mit mir geschah. Ich war auch immer noch nicht sicher, was ich glauben sollte, was Wahrheit und was Fiktion war, was real war und was sich mein Gehirn nur ausgedacht hatte. Wem oder was ich glauben sollte.
Und da mich eigentlich immer, wenn ich den Mund öffnete, irgendwer vom Personal mitleidig ansah, hatte ich mich aufs Nicken und Kopfschütteln verlegt. Im Augenblick schien mir das am sichersten zu sein.
Miriam beobachtete mich eine Weile abwartend, dann kramte sie das strahlendste Lächeln hervor, das sie finden konnte, und gab mir einen Klaps auf den Oberschenkel.
»Es ist jedenfalls gut, dass du wach bist«, sagte sie fröhlich. »Ich habe dir was zum Anziehen mitgebracht. Wir werden dich jetzt duschen und ein bisschen hübsch machen, es wartet eine Überraschung auf dich.«
»Was denn? Spaghetti mit Tomatensoße?«, rutschte mir heraus. Mein Tonfall war zynisch und Schwester Miriam sah mich leicht verletzt von der Seite an.
Doch das war mir egal, weil mein Herz gerade unendlich wehtat.
Als wir noch klein waren, hatte es an der Akademie manchmal samstags Spaghetti mit Tomatensoße gegeben. Normalerweise wurden wir mit Vitaminen, angereicherten Shakes und Säften vollgepumpt, weshalb Spaghetti mit Tomatensoße für uns der Himmel auf Erden waren. Wie Sommerferien auf einem Teller. Bis heute war es ein Insider zwischen Jonah und mir.
Den es angeblich nicht gab. Weil mein Kopf ihn sich nur ausgedacht hatte. Augenblicklich presste ich die Kiefer aufeinander, um nicht schreien zu müssen.
Ich konnte so einiges akzeptieren. Dass ich jetzt in Berlin leben musste, dass mein Körper an einen alten Klappstuhl erinnerte, dass ich meine Mission niemals antreten würde. All das war schon schlimm genug, aber dass Jonah nie wirklich existiert hatte, dass ich ihn niemals wiedersehen sollte, konnte ich einfach nicht hinnehmen.
Wenn mein Herz erst anfing, daran zu glauben, würde es für immer brechen. Das wusste ich genau.
Und das war der zweite Grund, warum ich mich die meiste Zeit in Schweigen hüllte. Ich wollte nicht, dass sie mit mir sprachen. Wollte vermeiden, dass sie wieder anfingen, mir zu erklären, dass mein Gehirn zwölf Jahre lang einfach alles getan hatte, um mich bei Laune zu halten. Dass alles, was ich war und wusste, einer Fantasie entsprungen war und mein ganzes Leben nur ein Trugbild. Schon beim Gedanken an den Gedanken daran wurde mir schlecht.
Ich ließ mich von Miriam bereitwillig unter die Dusche stellen und einseifen. Mittlerweile hatte ich gelernt, dass Berlin ein Wasserproblem hatte, weshalb sie mich in Rekordzeit von oben bis unten abschrubbte. Ich kam mir vor wie in einer Waschanlage. Man merkte, dass sie so was öfter machte, da sie unbeschreiblich effizient war.
Anschließend steckte sie mich in eine viel zu weite Hose, die sie mit einem alten Gürtel dazu brachte, sich an meinen Hüften festzuhalten, und einen fadenscheinigen Wollpullover, der angeblich zuvor ihrer kleinen Schwester gehört hatte, mir aber einige Nummern zu groß war. Ich sah aus, als würde ich mich auf einen Undercover-Einsatz bei einer Obdachlosenkolonie vorbereiten.
Miriam stellte das Rückenteil meines Bettes auf und ich setzte mich auf die Matratze. Die ganze Zeit über strahlte sie wie ein Suchscheinwerfer.
Ich war gespannt auf das, was nun kommen würde, hatte aber trotzdem keine Lust zu fragen.
Irgendwann ließ sie mich allein. Weil ich so unendlich müde war, schloss ich für einen Moment die Augen und döste.
Als ich Geräusche und gedämpfte Stimmen hörte, schlug ich sie wieder auf und zuckte vor Schreck zusammen.
Da standen sie.
Doktor Akalin und drei Fremde. Eine kleine Frau in einem rot-weiß gestreiften Kleid, das augenscheinlich schon viele Jahre alt war. Sie knetete ein Taschentuch und hatte Tränen in den Augen, während sie mich anstarrte, als sei ich nicht weniger als ein Weltwunder. Neben ihr standen lächelnd ein großer, hagerer Mann mit Dreitagebart und sanften Augen und ein junger Kerl mit dunkelbraunem Strubbelkopf und eckigem Kinn, der dem älteren Mann sehr ähnlich sah. Er hatte die Hände tief in den Hosentaschen vergraben und blickte mich abwartend und mit einem schiefen Lächeln an.
Etwas an diesem Lächeln berührte mich, es löste etwas in mir aus, doch ich konnte es nicht greifen. Er war der Einzige von den dreien, der mir vage bekannt vorkam. Meine Augen suchten nach Doktor Akalin, der meinen Blick ruhig erwiderte.
»Das ist deine Familie, Zoë«, sagte er sanft, doch ich erschrak trotzdem.
›Meine Familie‹. Ich probierte das Wort in Gedanken an wie ein Paar neuer Schuhe. Sie passten nicht, doch ich konnte nicht sagen, ob sie mir zu groß oder zu klein waren.
Noch einmal musterte ich die Menschen, die am Fuße meines Bettes standen. Die beiden Erwachsenen waren mir völlig unbekannt, auch wenn ich zugeben musste, dass eine gewisse Ähnlichkeit zwischen der Frau und mir bestand. Oder vielmehr bestehen könnte, wenn ich wieder ein paar Kilo zugenommen hatte. Sie sah der Erinnerung ähnlich, die ich an mich selbst hatte und die laut Doktor Akalin gar keine richtige Erinnerung war.
»Kann sie nicht sprechen?«, fragte der Junge nun, der wohl mein Bruder sein musste. Nachdem ich aufgewacht war, hatte der Arzt einen Bruder erwähnt. Der Klang seiner Stimme verstärkte das vertraute Gefühl, das ich ihm gegenüber hatte, ein leichtes Kribbeln machte sich in meinem Bauch breit.
Doktor Akalin zog amüsiert die Augenbrauen hoch.
»Oh, sie kann sprechen, davon durfte ich mich selbst überzeugen. Sie tut es nur sehr selten.«
Der Junge wandte mir den Kopf zu und grinste mich an. Dabei lag so viel echte Wärme und Freude in seinem Blick, dass ich ihn einfach ins Herz schließen musste.
»Hallo Äffchen«, sagte er, und seine Stimme zitterte leicht.
Und auf einmal, ganz plötzlich, wusste ich mit absoluter Sicherheit, wie er hieß.
»Hallo Tom«, murmelte ich.
Der Frau entfuhr ein lautes Schluchzen und der Mann legte ihr beschützend einen Arm um die Schulter. Es war ein rührender Anblick.
»Erstaunlich«, hörte ich Dr. Akalin murmeln, was mich ihn fragend anblicken ließ. Er räusperte sich. »Dein Gehör ist erstaunlich scharf, weißt du das?«, fragte er mit einem verschmitzten Lächeln, das die Krähenfüße in seinen Augenwinkeln deutlich hervortreten ließ. Diese Falten waren der Teil seines Gesichts, den ich am meisten mochte – sie sahen aus wie Sonnenstahlen, die sich von seinen warmen, dunklen Augen in alle Richtungen ausbreiteten.
Natürlich wusste ich, dass ich ein außergewöhnliches Gehör hatte. Dr. Jen hatte das mehr als einmal hervorgehoben. Schließlich war ich nicht nur aufgrund meiner schulischen Leistungen, sondern auch wegen meiner körperlichen Eigenschaften zum Kapitän der Mission auserwählt worden. Doch ich hütete mich, etwas Derartiges auch nur zu erwähnen. Stattdessen fragte ich: »Das haben Sie sicher nicht gemeint. Also?«
»Es ist erstaunlich, dass du dich an deinen Bruder zu erinnern scheinst, sogar seinen Namen kennst. Die meisten Leute in deiner Situation leiden an massivem Gedächtnisverlust.« Er sah mich durchdringend an. »Aber wir beide wissen ja schon, dass du eine außergewöhnliche Patientin bist.«
»Als sie noch klein war, habe ich sie jeden Abend ins Bett gebracht«, sagte Tom, und seine dunklen Augen lagen dabei nur auf mir. »Ich habe ihr immer vorgelesen. Sie hat es geliebt, konnte gar nicht genug von all den Geschichten bekommen.« Er schluckte. »Als die Dürre kam und ihr Fieber immer schlimmer wurde, habe ich den ganzen Tag an ihrem Bett gesessen und ihr vorgelesen, bis mein Hals so wund war, dass ich nicht mehr sprechen konnte, während meine Eltern verzweifelt versucht haben, Wasser aufzutreiben. Meine Stimme war das Letzte, was sie gehört hat, bevor …« Toms Stimme zitterte und er brach seine Erzählung mitten im Satz ab. In seinen Augenwinkeln sah ich ein verräterisches Glitzern.
Doktor Akalin hob interessiert eine seiner dicken Brauen. »Das könnte der Grund sein, warum sie sich an Sie erinnert. Wissen Sie zufällig noch, was sie ihr vorgelesen haben, als sie ins Koma fiel?«
Tom schenkte seinen Eltern einen entschuldigenden Seitenblick, dann antwortete er: »Ich habe ihr immer vorgelesen, was ich selbst am liebsten mochte. Kindergeschichten waren uns beiden schnell viel zu langweilig. Wir haben die ganzen Klassiker der Abenteuerliteratur zusammen gelesen. Harry Potter, Die Tribute von Panem, Der Marsianer, Die drei Sonnen …«
»Musste das sein, Tom?«, hörte ich den großen Mann fragen. »Du warst damals selbst kaum alt genug, um diese Romane zu lesen.«
»Ich dachte doch, dass sie mich ohnehin nicht mehr hören kann. Ihr Fieber war schon so hoch …«
»Sie sollten Ihrem Sohn keinen Vorwurf machen«, schaltete sich Akalin nun wieder ein. »Es ist gut möglich, dass er Zoë mit genau diesen Geschichten das Leben gerettet hat.«
Die Frau schluchzte erneut und drückte sich ein Taschentuch auf die Augen, das auch schon bessere Tage gesehen hatte. Der Griff des Mannes um ihre Schultern verstärkte sich. Ich sah es an den Sehnen, die unter seiner ledrigen Haut hervortraten.
»Wie das?«, fragte er den Arzt mit ruhiger, dunkler Stimme.
»Sagen wir, Zoë hat die ganzen Jahre des Komas nur überlebt, weil sie einen Grund dazu hatte. Sie hatte einen Grund, weiterzuleben.« Die Augen fest auf mich gerichtet, redete er weiter: »Ihre Tochter hatte eine Mission.«
Ich wusste, was er mir sagen wollte, und wandte den Blick hastig ab. Er sollte nicht sehen, wie sehr mich seine Worte aufwühlten.
Der Arzt wandte sich wieder an meine Besucher. »Es wird das Beste sein, wenn ich Ihnen alles Weitere in meinem Büro erkläre. Dort kann ich uns auch einen schönen, heißen Tee machen. Zoë macht zwar erstaunliche Fortschritte, doch sie braucht nach wie vor viel Ruhe.«
Die Männer nickten. Tom schenkte mir noch ein aufmunterndes Lächeln, dann machte er kehrt, um Dr. Akalin aus dem Zimmer zu folgen, sein Vater dicht hinter ihm. Nur die Frau schien mich noch nicht verlassen zu wollen. Während die anderen sich entfernten, machte sie ein paar Schritte auf mich zu und griff nach meiner Hand.
Mein erster Impuls war, die Finger wegzuziehen, doch der Ausdruck in ihrem Gesicht hielt mich im letzten Augenblick davon ab.
In ihrem Blick lag eine Mischung aus Glück, Trauer und Angst von solcher Intensität, dass ich ihr einfach nicht wehtun konnte. Nur weil ich sie nicht kannte, hieß das nicht, dass ich ihr Böses wollte. Etwas an ihren Augen milderte die Wut, die seit meinem Erwachen unentwegt in meinem Innersten gebrodelt hatte. Sie war sanft und verletzlich, wie ein kleiner Vogel.
»Zoë, mein Schatz«, flüsterte sie mit halb erstickter Stimme. »Erinnerst du dich denn gar nicht mehr an mich?«
Ich starrte sie eine Weile einfach nur schweigend an. Diese Frage konnte ich ihr nicht beantworten. Weder wollte ich ihr die Wahrheit sagen, noch wollte ich sie anlügen. Beide Antwortmöglichkeiten kamen mir unendlich falsch vor. Doch mein Schweigen schien sie stark zu verunsichern, ich sah, wie ihr wieder Tränen in die Augen traten. Dass ich für ihr Glück so sehr verantwortlich zu sein schien, war unangenehm. Darum hatte ich nicht gebeten. Akalin, so dachte ich wütend, hätte mich auf diesen Besuch vorbereiten müssen. Doch auch das war nicht ihre Schuld. Ich entschied mich schließlich für einen Mittelweg – nicht Lüge und nicht Wahrheit – und hob die Hand, um angestrengt meine Schläfen zu massieren.
»Ich … Es tut mir leid. Ich weiß es einfach nicht«, antwortete ich, und die Frau lächelte.
Ihr Mann tauchte hinter ihrem Rücken auf und legte eine der großen Hände sanft auf ihre Schulter.
»Komm Liebling. Zoë braucht Ruhe.«
Sie drückte noch einmal meine Hand, bevor sie nickte und losließ.
»Aber sicher doch. Wir haben alle Zeit der Welt, wenn du erst wieder zu Hause bist.«
Ich versuchte, ihr Lächeln zu erwidern, doch es gelang mir nicht, weil ihre Worte in meinem Kopf dröhnten wie ein Donnerschlag.
›Zu Hause.‹
Völlig egal, welchen Ort sie damit meinte, eines stand mit absoluter Sicherheit fest: Diese Frau war nicht in der Lage, mich nach Hause zu bringen. Wie es aussah, gab es in diesem verdammten Krankenhaus überhaupt keinen Menschen, der solch eine Heldentat vollbringen konnte.
Doch wenn ich wieder richtig gesund war, das wusste ich, würde ich mit ihnen gehen müssen. Mit diesen drei Fremden in ein fremdes Zuhause, ein fremdes Leben. Und es war das Allerletzte, was ich wollte.
Für alle Menschen, denen ich in den letzten Tagen begegnet war, schien ich ein Wunder zu sein. Für Dr. Akalin war ich ein akademischer Durchbruch, für die Menschen, die gerade mein Zimmer verließen, war ich die tot geglaubte Tochter und Schwester, und für das Krankenhauspersonal war ich jemand, der es verdient hatte, nach Strich und Faden verwöhnt zu werden, einfach nur, weil ich atmete. Weil ich so viel durchgemacht hatte, ließen sie meine Wutausbrüche und Attacken klaglos lächelnd über sich ergehen und sprachen im Flüsterton darüber, wie schwer ich es doch hatte, wenn sie dachten, dass ich sie nicht hören konnte. Doch mir entging nichts – ich war das Gesprächsthema der gesamten Station. Ständig steckte jemand unter irgendeinem Vorwand den Kopf in mein Zimmer, um mich zu begaffen. Meine Anwesenheit schien sie allesamt prächtig zu amüsieren.
Mir machte die Gesellschaft dieser Leute umgekehrt allerdings keine Freude, ganz im Gegenteil: Sie machte mich wahnsinnig. Jeder von ihnen war ein Riss in meiner Realität, meinem Herzen, meinem Leben. Sie zerpflückten all das, was ich bis vor Kurzem noch für die Wahrheit gehalten hatte, in konfettigroße Fetzen. Ihre schiere Existenz trat meine ganze Welt mit Füßen.
Der einzige Grund für mich, nicht verrückt zu werden, waren meine Erinnerungen an Jonah, an unsere Liebe. Ob es sich um echte oder eingebildete Erinnerungen handelte, war mir egal – ich liebte ihn mit jeder Faser meines Herzens, ich liebte ihn mit meinem Körper, dessen kleine Härchen sich beim Gedanken an sein Lachgrübchen aufstellten, liebte ihn mit den heißen Tränen eines Menschen, der seinen Partner an den Tod verloren hatte. Mich kümmerte nicht, was Akalin sagte. Für mich hatte Jonah existiert, ich hatte ihn gerochen, geschmeckt und gefühlt. Ich hatte ihn bei mir gehabt und nun war er fort. Obwohl sich dieser Schmerz anfühlte, als würde er mich niemals mehr verlassen, mich nachts quälte und tagsüber betäubte, war Jonah meine Zuflucht. Und da ich nicht zulassen konnte, dass auch er mir endgültig genommen wurde, hatte ich mir bereits vor Tagen geschworen, kein Sterbenswort mehr über ihn zu verlieren. Es reichte schon, dass ich ihn Akalin gegenüber erwähnt hatte. Seine Worte hätten ihn mir beinahe weggenommen. Doch ich weigerte mich, ihn mir nehmen zu lassen. Jonah lebte in meinem Kopf und in meinem Herzen. Und solange das so war, fiel ich nicht auseinander.
Als die Tür endlich hinter Dr. Akalin ins Schloss fiel, rollte ich mich frustriert auf dem Bett zusammen, wobei ich die Knie so fest an den Körper drückte, wie ich nur konnte. Indem ich mich selbst zu einer Kugel formte, schloss ich die Außenwelt aus. Dann hatte ich das Gefühl, eine Einheit zu sein, etwas Rundes, und nicht tausend eckige Splitter, die niemand mehr zu einem sinnvollen Ganzen zusammensetzen konnte. Bei mir selbst war ich sicher, jedenfalls so sicher, wie ich überhaupt sein konnte. Ich hatte nur noch mich.
Mit aller Macht versuchte ich, mich auf Jonah zu konzentrieren, und als das nicht funktionierte, murmelte ich meinen Namen, meine Einheit, Dienstgrad und Mission wie ein Mantra, doch es hatte keinen Zweck. Meine Gedanken kehrten immer wieder zu dem zurück, was gerade geschehen war. Toms Erzählungen von der Zeit vor meinem Koma waren für Akalin die ultimative Erklärung dafür, wie sich mein Hirn hatte ausdenken können, dass ich mich auf einer militärischen Mission befand. Ich hatte in seinen Augen gelesen, dass in dem Bild, das er von mir hatte, gerade etwas an seinen Platz gefallen war und er nun klarer erkennen konnte, womit er es zu tun hatte. Für ihn war das Rätsel nun gelöst. Und ein Teil von mir glaubte, dass er recht hatte. Weil es so schrecklich logisch war.
Diese widerlich ruhige, sachliche Stimme, die mir immer wieder zuraunte, ich solle Vernunft annehmen. Doch ich wollte keine Vernunft annehmen – bei der Vorstellung, zu akzeptieren, dass es keine Realität außer dieser gab, barsten Kopf und Herz entzwei. Ich presste meine Stirn gegen die Kniescheiben, schloss die Augen und atmete langsam ein und aus, doch es war zu spät – ich hatte diese dunklen Gedanken schon wieder zugelassen. Mein Herz raste, und kalter Schweiß begann, mir Stirn und Achseln herabzulaufen. Nein, nein, nein, nein, dachte ich verzweifelt und presste den Kopf so fest gegen meine Knie, dass es schmerzte. Ich wollte das nicht, versuchte, die Panik zurückzudrängen, die sich anschlich wie ein hungriges Tier. Ich hasste sie. Panik machte mich schwach, saugte mich aus und ließ mich noch hilfloser erscheinen, als ich war. Nicht nur hilflos, nein, sogar verrückt.
»Mein Name ist Zoë Alma Baker«, murmelte ich. »Ich bin Kapitän der H.O.M.E.-Mission II b, Eliteschülerin der H.O.M.E.-Akademie, verlobt mit Jonah Schwarz … Jonah…«
Meine Stimme war nur noch ein klägliches Flehen. Die Worte fanden nur mühsam den Weg durch mein Schluchzen. Ich fühlte, wie sich unter mir ein Abgrund auftat, hörte, wie eine Stimme flüsterte: ›Du bist verrückt, Zoë. Es gibt keine H.O.M.E.-Akademie und auch keinen Jonah. Du bist wahnsinnig geworden, Zoë. Nicht mehr ganz dicht. Und ganz allein.‹
Ich presste die Augen fest zusammen und schrie. Schrie alles aus mir heraus, die ganze Panik, die mein Innerstes bis zum Bersten ausfüllte, so laut, dass ich das Gefühl hatte, mein Kopf müsste platzen. Mein Hals wurde rau, und mir ging die Luft aus, doch ich schrie weiter. Solange der Schrei meinen Kopf ausfüllte, war dort kein Platz für andere Dinge. Schreckliche Dinge.
Nur am Rand nahm ich wahr, dass die Tür aufflog und sich Hände beruhigend auf meine Arme legten. Ich stieß sie weg, schlug und trat wie wild um mich, vor meinen Augen und in meinem Herzen nur noch heißes, pulsierendes Rot. Ich hatte keine Schmerzen – ich war der Schmerz.
Schließlich fühlte ich das mittlerweile vertraute Stechen einer Nadel, gefolgt von einem Brennen, das durch meine Adern kroch.
Sekunden später wurde es endlich ruhig.
»Ich bins«
»Na endlich!«
»Ich habe dir doch gesagt, dass hier der Busch brennt. Europa droht auseinanderzubrechen.«
»Ist es wirklich so schlimm?«
»Wenn du mich fragst, ja. Spanien gibt sich mit den Hilfsleistungen, die die nordeuropäische Allianz angeboten hat, nicht zufrieden. Vor allem in Südspanien sterben die Leute wie die Fliegen. Dort fließt seit Monaten kein Wasser mehr.«
»Verflucht. Und du meinst, dass sie wirklich angreifen?«
»Verwundete Raubtiere sind immer am gefährlichsten. Sie habe nicht mehr viel zu verlieren. Oder glaubst du, dass sich irgendwann der Wind dreht und die Hitze den Süden verlässt?«
»Steck mich jetzt bloß nicht mit diesen Klimaleugnern in einen Topf. Ich weiß doch auch, dass es ernst ist. Ich bin nur nicht so nah dran wie du.«
»Die Italiener haben sich den Spaniern angeschlossen. Denen geht es zwar noch etwas besser, weil sie gute Entsalzungsanlagen haben, aber die können nicht alle Einwohner versorgen. Die alte Regierung hat sich überworfen und jetzt sind Hardliner an der Macht.«
»Kommt mir bekannt vor. Und Strauß will seine Kommunikationsstrategie nicht ändern?«
»Er möchte eine Massenpanik vermeiden. Wo sollten die Leute denn auch groß hin?«
»Hm.«
»Ich weiß aus sicherer Quelle, dass beide Staaten ihre Stützpunkte verlegt und in Alarmbereitschaft versetzt haben.«
»Das klingt kritisch.«
»Es geht nicht mehr lange gut. Wir müssen die Sache mit den Kindern durchziehen, die wir haben. Es bleibt uns nichts anderes übrig.«
»So war das alles nicht geplant.«
»Das ist mir klar. Uns allen ist das klar. Aber wenigstens haben wir so noch eine Chance.«
»Aber nicht ohne Zoë. Ich kenne die Kinder, ohne sie klappt das nicht. Und sie ist auch die Einzige, die die notwendigen Manöver durchführen kann.«
»Was ist denn mit diesem Leutnant Schwarz?«
»Auf keinen Fall. Er ist ein guter Kämpfer, aber er kann nicht bis drei zählen.«
»Wieso haben wir ihn dann dabei?«
»Du hast ihn noch nicht ringen sehen.«
»Also zurück zu Zoë. Bist du schon weitergekommen?«
»Ich habe sie lokalisiert.«
»Wo ist sie?«
»In der Charité. Im bewachten Bereich.«
»Wie zur Hölle ist sie dort hingekommen?«
»Meine Informantin sagte, sie wurde in einem kritischen Zustand eingeliefert. Mehr wusste sie nicht.«
»Willst du sie da rausholen?«
»Das wäre keine so gute Idee. Sie ist ein kleiner Star, weil sie nach zwölf Jahren wieder aus dem ›Koma aufgewacht‹ ist. Sogar die Zeitungen schreiben über sie, die halbe Stadt kennt ihren Namen. So was ist seit vielen Jahren nicht mehr vorgekommen. Das halbe Krankenhaus behält sie im Auge. Wir wollen keine Aufmerksamkeit.«
»Aber sie vertraut dir doch. Sie kennt dich.«
»Da wäre ich mir nicht so sicher. Wir haben keine Kenntnis darüber, was passiert, wenn man jemanden abkoppelt. Keine Ahnung, woran sie sich erinnert, ob sie mich überhaupt erkennen würde. Was sie von ihrer Zeit auf der Akademie noch weiß und was nicht. Auch glaube ich nicht, dass es eine gute Idee wäre, wenn sie mich hier sieht.«
»Warum nicht?«
»Weil es sein könnte, dass sie dann durchdreht. Nicht, dass sie dann ein Realitätsparadox erleidet.«
»Kannst du das ein bisschen ausführen?«
»Du kennst es doch sicher auch: Wenn man seinem Rechner zu viel zumutet, zu oft und zu schnell auf die Tasten haut oder zu viele Prozesse gleichzeitig anschiebt, hängt er sich auf.«
»Natürlich.«
»Stell dir vor, Zoë ist dein Rechner.«
»Okay, wenn du meinst, dann musst du eben dafür sorgen, dass sie dich nicht erkennt.«
»Ich halte das sowieso für besser. Schließlich werde ich nicht vermeiden können, dass es Zeugen gibt. Und für Zoë ist es ohnehin das Beste.«
»Wie ist ihr Zustand?«
»Erstaunlich gut, wenn man bedenkt, was sie gerade durchmachen muss.«
»Dann ist sie die Richtige.«
»Das glaube ich auch. Hannibal, ich habe nachgedacht.«
»Spuck’s aus.«
»Wir wissen, wo sie ist, und sie kommt von selbst da auch nicht weg. Eigentlich ist doch alles in Ordnung.«
»Na ja. Wir brauchen sie aber am Interface.«
»Das ist mir schon klar. Aber so können wir beobachten, wie sie auf eine Abkopplung reagiert und sich in einer für sie fremden Situation zurechtfindet. Später muss sie das schließlich auch.«
»Jetzt macht daraus nicht so ein ›Glück im Unglück‹-Ding. Ich bin heute nicht in der Stimmung für so was.«
»Ist ja schon gut. Aber aus wissenschaftlicher Sicht finde ich durchaus interessant, was gerade mit ihr passiert. Wenn sie sich in dieser Situation gut schlägt, dann wird alles andere für sie ein Kinderspiel.«
»Das hier ist aber keine Laborsituation mehr, Cleo. Das ist bitterer Ernst. Wir können nicht mehr wie bisher einfach machen und schauen, wie die Kinder reagieren. Wir brauchen jeden von ihnen. Und wir brauchen sie sicher und in körperlich guter Verfassung.«
»Was glaubst du, wie viel Zeit uns noch bleibt, bis die Blase platzt?«
»Bis es Scheiße regnet?«
»Hm.«
»Schwer zu sagen. Zwei Wochen, vielleicht drei.«
»Also setze ich Cato und Brutus in Aktion?«
»Das habe ich vorhin schon selbst erledigt. Wir müssen schnell und entschlossen sein. Sonst war alles umsonst und wir gehen mit dem sinkenden Schiff unter.«
»Ich denke trotzdem nicht, dass es eine gute Idee wäre, sie aus dem Krankenhaus zu holen.«
»Vermutlich hast du recht damit. Aber wenn sie draußen ist, musst du schnell sein. Ich komme in einer Woche nach Berlin. Dann erwarte ich, dass die Sache erledigt ist und alles wie geplant stattfinden kann. Bis dahin hältst du mich auf dem Laufenden. Ich will alles wissen.«
»Verstanden.«
Mein Zimmer auf der Akademie war nicht groß – es passten ein Schrank, ein Schreibtisch mitsamt Stuhl und ein Bett hinein, aber die prall gefüllten Bücherregale mussten sich schon über meinem Kopf wie ein Ring über die Zimmerwände ziehen, da für ein stehendes Regal kein Platz mehr gewesen wäre.
Ich lebte hier, seit ich aus dem Schlafsaal ausgezogen war – bis zum zehnten Lebensjahr hatten wir alle gemeinsam in einem großen Raum geschlafen; zumindest die Mädchen zusammen mit den Mädchen, die Jungs mit den Jungs. Ich hatte den Schlafsaal, die seltsame Intimität und die Tatsache, dass ich dort nie richtig allein sein konnte, nie gemocht. Auch hatte ich mich nicht an den getuschelten Lästereien beteiligt oder zu denen gehört, die heimlich weinten und von ihren Freundinnen im Flüsterton getröstet wurden. Ich hatte keine Box mit geschmuggelten Süßigkeiten unter dem Bett, die ich kichernd mit den anderen nachts vertilgte, und ich war nie dazu eingeladen worden, an einer der nächtlichen Partys teilzunehmen. Doch gehänselt oder gequält hatte mich auch niemand, obwohl auch so was an der Akademie nicht selten vorkam. Mein ganzes Leben lang hatte ich immer ein wenig außen vor gestanden und mein Zimmer spiegelte diese Tatsache auf die deutlichste Art wider.