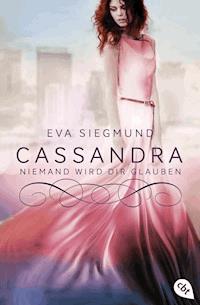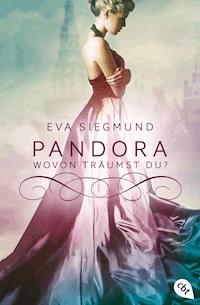9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Utopia Gardens
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Rasant, düster, außergewöhnlich: Im Techno-Thriller »Sodom« verwandeln nicht nur durch Prothesen optimierte »Cheater« die Straßen Berlins in einen tödlichen Dschungel. Berlin in einer nahen Zukunft: Wer sich nicht scheut, gegen rigorose Gesetze zu verstoßen, kann seinen Körper mithilfe illegaler Prothesen in eine tödliche Waffe verwandeln. Diese Kriminellen werden »Cheater« genannt. Seit ein Cheater Birols Vater ermordet hat, kennt der junge Mann nur noch ein Ziel: den »Käfig« – das Hauptquartier der Polizei von Berlin Mitte. Als Polizist kann Birol endlich selbst Jagd auf den Mörder seines Vaters machen. Doch im »Käfig« sind die Dinge keineswegs so, wie er es sich erhofft hat. Birols neues Team besteht aus der zum Strafdienst verurteilen Kratzbürste Raven und der schüchternen Polizeischülerin Laura, und seine älteren Kollegen sind entweder faul oder korrupt. Oder beides. Als der erste tote Cheater auftaucht, ahnen weder Birol noch Raven oder Laura, wie eng dieser Mord mit ihren eigenen dunklen Geheimnissen verknüpft ist – und mit dem Utopia Gardens. Der größte Club der Welt, in dem Nacht für Nacht die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen, bildet das Zentrum eines gewaltigen Sturms, der sich über Berlin zusammenbraut. »Die neuen Cops von Berlin Mitte: In ›Utopia Gardens‹ erzählt Eva Siegmund das dunkle Berlin von morgen – cool, vollkommen anders und unheimlich spannend. Ein starker Serienstart.« Veit Etzold »Sodom« ist der erste Band der Thriller-Reihe »Utopia Gardens«. Die Techno-Thriller erscheinen in folgender Reihenfolge: • Sodom • Gomorrha • Babylon
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Ähnliche
Eva Siegmund
Sodom
Thriller
Knaur e-books
Über dieses Buch
Berlin in einer nahen Zukunft: Wer sich nicht scheut, gegen rigorose Gesetze zu verstoßen, kann seinen Körper mithilfe illegaler Prothesen in eine tödliche Waffe verwandeln. Diese Kriminellen werden »Cheater« genannt.
Seit ein Cheater Birols Vater ermordet hat, kennt der junge Mann nur noch ein Ziel: den »Käfig« – das Hauptquartier der Polizei von Berlin Mitte. Als Polizist kann Birol endlich selbst Jagd auf den Mörder seines Vaters machen. Doch im »Käfig« sind die Dinge keineswegs so, wie er es sich erhofft hat. Birols neues Team besteht aus der zum Strafdienst verurteilen Kratzbürste Raven und der schüchternen Polizeischülerin Laura, und seine älteren Kollegen sind entweder faul oder korrupt. Oder beides.
Als der erste tote Cheater auftaucht, ahnen weder Birol noch Raven oder Laura, wie eng dieser Mord mit ihren eigenen dunklen Geheimnissen verknüpft ist – und mit dem Utopia Gardens. Der größte Club der Welt, in dem Nacht für Nacht die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen, bildet das Zentrum eines gewaltigen Sturms, der sich über Berlin zusammenbraut.
Inhaltsübersicht
Das Licht der Scheinwerfer schnitt durch die Dunkelheit des Studios wie der Strahl eines Leuchtturms. Raven kannte den Rhythmus genauso gut wie ihren eigenen Herzschlag. Alle fünf Sekunden streiften die kreisenden Lichtkegel ihre Fenster, erhellten alles für einen Augenblick. Dann wanderten sie weiter, über die bröckelnden Fassaden, erloschenen Straßenlaternen und stellenweise zerborstenen Fensterscheiben der Nachbarschaft – wieder zurück zu ihr.
Die meisten Leute, die sich in den heruntergekommenen, verlassenen Altbauten rund um das Gardens eingenistet hatten, hassten dieses Licht. Es fraß sich selbst durch die dicksten Vorhänge und raubte vielen erst den Schlaf, dann den Verstand. Doch Raven mochte es.
Sie saß gerne auf der tiefen Fensterbank im Dunkeln und blickte auf das riesige Gebäude jenseits der Scheibe, betrachtete das Treiben, das mit Einbruch der Nacht zunahm. Raven sah Menschen kommen und gehen, genoss es, zu wissen, dass einige von ihnen nicht sonderlich gerne dabei beobachtet wurden, wie sie das Utopia Gardens betraten. Sie beeilten sich, um möglichst schnell an der Security vorbei in den schützenden Club zu gelangen. Meist blickten sie dabei nicht einmal auf.
Unter ihnen fand man Politiker und Ärzte, Richter und Polizisten, kleine und große Gangster. Wenn sie die Security passierten und durch die schwere Stahltür traten, die sich direkt unter Ravens Fenster befand, wurden sie alle gleich. Vergnügungssüchtige Getriebene, die ihr gleichförmiges oder elendes Leben jenseits der Mauern des Clubs zurückließen. Sie streiften den Verfall der Altstadt und die Lügen der Neustadt von sich ab, wurden zu Wesen ohne Vergangenheit oder Zukunft. Bis sie durch ebendiese Türen zurück in die Realität gespuckt wurden.
Vielleicht waren die Scheinwerfer doch nicht wie das Licht eines Leuchtturms, dachte Raven. Leuchttürme halfen Seefahrern bei Sturm und Nacht, nicht an den Klippen zu zerschellen. Das Utopia Gardens jedoch war der Fels, gegen den die Berliner brandeten, um von ihm zerschmettert zu werden. Oder ein Schlund, der gnadenlos jeden verschluckte, der sich ihm näherte.
Und doch war das Gardens auch ihr Zuhause. Sie liebte die schummrigen Lichter, die alles weicher zeichneten, die allzu hübschen Bardamen in ihren kurzen Paillettenkleidern, die laute Musik. Dumpfe Bässe, die ihrem Puls den Rhythmus vorgaben und den ganzen Körper zum Vibrieren brachten, wilder Jazz, der einen förmlich zum Tanzen zwang, Bollywood-Beats, zu denen man sich so lange drehen konnte, bis Raum und Zeit zu einer glitzernden Masse verschwammen. Doch das Gardens war nicht einfach nur ein Club. Es war Disco und Jahrmarkt, Bordell und Shoppingmall, Arena und Wellnessoase. Hier fand jeder, was er suchte oder sich nie zu suchen gewagt hatte. Auf alle geheimen Fragen, die man draußen – wenn überhaupt – nur flüsterte, hatte das Gardens mindestens hundert Antworten.
Raven kannte das Gardens in- und auswendig, doch sie hatte mit der Zeit gelernt, welchen Bereichen sie besser fernblieb, wenn sie nicht den Verstand verlieren wollte. Raven tanzte, nahm weiche Drogen und besuchte diejenigen, die ihr am Herzen lagen. Und sie kaufte manchmal auf dem Schwarzmarkt des Fightfloors ein, wenn sie das, was sie für ihr nächstes Projekt brauchte, sonst nirgendwo beschaffen konnte. Alles andere ging sie nichts an.
Sie liebte, dass die Außenwelt im Gardens einfach keinen Platz hatte. Am Anfang eines jeden Besuchs war das, was draußen passierte, einfach nur weit weg. Und irgendwann wurde es dann vollkommen unwichtig. Verbrachte man ein paar Tage im Club, verlor man jegliches Zeitgefühl, und alles floss ineinander. Man existierte, man atmete, tanzte und lachte. Nichts sonst.
Tage waren nicht für Raven gemacht. Sie waren von allem zu viel. Zu viel Licht, zu viel Lärm, zu viel andere Menschen, auf die zu viel Licht fiel und die zu viel Lärm machten. Am Tag sah man die Schatten, nachts war alles gleich. Oder zumindest beinahe. Denn Raven war ein Wesen, das selbst im Dunkeln leuchtete.
Seit Jahren bewegte sie sich tagsüber kaum vor die Tür, doch bald würde sie es müssen. Sie würde dazu gezwungen sein, etwas zu etablieren, das andere Menschen »Alltag« nannten. Ausgerechnet. Seufzend schob sie den Brief, den sie die ganze Zeit abwesend in ihren Fingern hin und her gedreht hatte, in die Tasche ihres schwarzen Kittels. Am liebsten hätte sie die kommenden Stunden komplett im Club verbracht, doch sie hatte einen Kunden. Die Werkstücke, die sie für ihn angefertigt hatte, standen auf einem Tisch bereit und glänzten alle fünf Sekunden, wenn der Lichtkegel der Scheinwerfer durch den Raum strich. Ein leiser Abschiedsschmerz schlich sich in ihre Brust. Raven hing an ihren Kreationen.
Sie zuckte zusammen, als die Deckenlampe anging.
»Rave?«, rief eine Stimme in den beinahe leeren Raum hinein.
Raven entspannte sich wieder. Spencer war zurück; der einzige Mensch, der sie »Rave« nannte. Es war albern, aber sie mochte es. Alles war ihr lieber als ihr Geburtsname. Stöhnend glitt sie vom Fensterbrett, wobei sich winzige Teile des bröckeligen Lacks ablösten, der in Flocken zu Boden rieselte. Sie bewegte sich so geschmeidig, dass ihre Füße kaum ein Geräusch machten, als sie auf den alten Dielenboden trafen.
»Hier hinten!«, antwortete sie, und kurz darauf schob sich Spencers schlaksige Gestalt durch die alte Doppelflügeltür. Er ging immer ein wenig, als müsste er sich an Deck eines großen Schiffs gegen den Sturm stemmen. Das viele Tätowieren in gebückter Haltung hatte dazu geführt, dass er sich selten gerade hielt.
Er hauchte ihr einen Kuss auf die Wange und ließ seinen alten Lederrucksack geräuschvoll auf den großen Metalltisch knallen. Dabei wackelten die Werkstücke bedrohlich. Schnell lief Raven zu ihren Kunstwerken hinüber, um sicherzustellen, dass sie nicht umfielen. »Pass doch auf!«, schimpfte sie und schoss Spencer einen giftigen Blick zu. Der hob abwehrend die Hände.
»Ey, wer hat gerade Stunden auf dem Campus verbracht, um diesen verrückten etepetete Medizinstudenten das ganze Zeug aus den Rippen zu leiern?« Er zeigte auf seine Brust. »Moi!«
Raven winkte ab. »Und wer sorgt dafür, dass wir was zu beißen haben? Moi!«
»Hey, ich verdiene auch Geld!«
Raven schnaubte genervt. Dieses Gespräch würde sie jetzt ganz sicher nicht führen. »Hast du alles bekommen?«
Sie griff nach seinem Rucksack und öffnete vorsichtig die brüchigen Schnallen. Nacheinander holte sie Skalpelle, mehrere Spritzen und Ampullen mit Betäubungsmitteln, Nähzeug, neue Sägeblätter sowie mehrere Dutzend Arterienklemmen hervor, die sie ordentlich auf ihrem Rollwagen ausbreitete.
»Keine Klammern?«
Spencer schüttelte den Kopf. »Felix liegt flach. Keiner konnte mir sagen, wie lange.«
»Shit«, Raven biss sich auf die Unterlippe. Für das, was sie heute vorhatten, brauchte sie Klammern.
»Haben wir nicht mehr genug?«, fragte Spencer.
Raven drehte sich um und wühlte in der Schublade des alten Küchenbuffets herum, das an der Wand zum nächsten Zimmer stand. Sie zog drei Packungen hervor und legte sie auf die Ablage.
»Es sind noch ungefähr hundert. Das könnte reichen. Es könnte aber auch in die Hose gehen.«
Spencer zuckte mit den Schultern und gab ihr damit zu verstehen, dass sie es jetzt sowieso nicht ändern konnten. Und er hatte recht. Raven seufzte.
»Gut, dann decken wir mal ab.«
Gemeinsam rollten sie eine Bauplane aus, die sie mit Klebeband auf dem Holzboden fixierten. Die Kunden wurden von der Plane immer sehr verunsichert, aber Raven konnte es nicht ändern. Alte Blutflecken auf dem Boden würden sie sicher noch stärker verunsichern, und die Plane war wenigstens sauber.
Spencer und sie waren ein eingespieltes Team, sie taten das hier mittlerweile mehrmals im Monat. Meistens nachts, so wie heute. Raven hatte ihr Gehirn im Verdacht, vor Einbruch der Dunkelheit nicht richtig zu arbeiten.
Schließlich band sie sich die schneeweißen Haare zu einem kleinen Dutt und streifte sich ihre schwarze Kurzhaarperücke über. Dann setzte sie die schwarze Bauta auf. Dass diese Maske früher mal vom venezianischen Stadtadel getragen worden war, wusste heute so gut wie niemand mehr. Im Gardens jedenfalls waren Bautas weit verbreitet. Sie waren eine der wenigen Möglichkeiten, das Gesicht so zu verdecken, dass man unerkannt blieb, der Maskenträger aber immer noch sprechen, essen und trinken konnte. Wenn sie die Maske aufsetzte, verschwand Raven hinter Lagen aus schwarzem Stoff, schwarzen Haaren und schwarzem Holz. Sie glitt in den Schatten, wurde eins mit ihm. Verwandelte sich in Dark.
Er hatte Spiegelei zum Abendessen. Das war nicht ganz so gut wie Pizza, aber noch lange nicht so schlecht wie trockenes Brot mit feuchten Gedanken – sein übliches Abendessen.
Jep, die Dinge wandten sich eindeutig zum Guten für Bartosz. Für seine Augen hatte er zwar eine gewaltige Summe hinblättern müssen, was viel, viel Brot bedeutet hatte, aber fuck, die Dinger begannen, sich auszuzahlen. Niemand sah ihn kommen oder gehen. Er hatte es sogar geschafft, ein Apartment auszuräumen, während die Familie darin schlief. Keiner hatte es bemerkt! Wenn der Bruch heute gut ging, dann würde er sich Pizza kaufen. Eine ganze Kühltruhe voll. Und die Kühltruhe gleich mit.
Er pfiff bei dem Gedanken fröhlich vor sich hin und betrachtete seine Spiegeleier prüfend. Die Ränder kräuselten sich im Fett. Bartosz musste immer sehr viel Öl nehmen, weil seine Pfanne dermaßen verkratzt war, dass sonst alles anbuk. Wollte er sein Eigelb flüssig? Auf jeden Fall sollte er dran denken, eine neue Pfanne mitgehen zu lassen. Reiche Leute hatten immer Pfannen, oder nicht? Sogar wenn sie niemals selbst kochten, sondern sich alles liefern ließen, hatten sie Pfannen. Damit ihre Freunde dachten, sie würden kochen, wenn sie zu Besuch kamen. Wahrscheinlich gingen die sogar selbst in die großen Luxuskaufhäuser, damit sie sich gegenseitig beim Pfannenkaufen beobachten konnten.
Bei der Vorstellung, wie zwei reiche Weiber sich voreinander zwischen den Regalen einer Küchenabteilung versteckten, musste er lachen, was ihn wiederum husten ließ. Der Schleimklumpen, den er daraufhin in die verkalkte Spüle spuckte, war kotzgrün. Bartosz verzog das Gesicht. Er hatte Dark das Geld gegeben, das er eigentlich für den Doc gespart hatte. Jetzt musste er wieder von vorne anfangen. Aber was machte das schon? Einen alten Knochen ruinierte so schnell nichts.
Bartosz stemmte die Hände in die Hüften und grinste vor sich hin. Er mochte seine neue Bleibe. Vor ein paar Wochen hatte er sich hier eingenistet, am südlichen Ende der Schönhauser Allee. Nicht so weit vom Gardens entfernt, aber trotzdem schon schön ruhig. Weil in dieser Gegend kaum was los war, wohnte hier kein Schwein mehr. Eine ganze Woche lang hatte er das Haus beobachtet. Außer ihm war niemand hier. Er mochte es so. Und dank seiner neuen Augen musste er auch kein Licht machen. So würde niemandem auffallen, dass er hier Wohnung bezogen hatte.
Seine neue Wohnung war trockener und heller als die alte. Im Vorderhaus, sodass er alles überblicken konnte. Darüber hinaus war sie wie die meisten, in denen Bartosz bisher gelebt hatte. Altbau mit Stuck und Dielen. Alte Kassettentüren aus Holz. Während der Jahrtausendwende euphorisch restauriert und schließlich zugunsten einer moderneren, sicheren Wohnung in Neuberlin verlassen. Kaufen wollte im alten Zentrum der Stadt schon lange niemand mehr.
Mittlerweile hatte er es sich recht nett gemacht. Sogar ein Sofa und einen Tisch hatte er aufgetrieben. Der alte Scheuer lieh ihm manchmal sein Auto, wenn er ihm dafür den Inhalt der Arzneischränke mitbrachte. Bei den reichen Pinkeln, die er beklaute, waren die Arzneischränke immer randvoll. Das Sofa, das er in Scheuers Kleinlaster transportiert hatte, hatte sicher ein Vermögen gekostet. Er stellte sich gerne vor, dass ein alter Sack seine wunderschöne Geliebte auf dem Sofa gevögelt hatte. Unwahrscheinlich war es nicht, er hatte es aus einem Büro geklaut. Die alten Manager schliefen doch alle mit ihren Assistentinnen, oder nicht? Aber jetzt hatte er das Sofa. Das gefiel ihm.
Bartosz klatschte die Spiegeleier auf seinen Teller und streute Salz darüber. Die meisten Menschen machten den Fehler, sie noch in der Pfanne zu salzen. Doch er wusste, wie man es richtig machte.
Sowieso war er schlauer als die anderen. Er war ein verdammter Robin Hood. Nahm es von den Reichen und gab es den Armen. Und er war das ärmste Schwein von allen.
Zufrieden setzte er sich auf die Couch und riskierte es zur Feier des Tages sogar, seinen Laptop aufzuklappen und den Livestream aus dem zweiten Untergeschoss des Gardens zu starten. Da war immer was los. Er hatte meistens kein Geld, um selbst hinzugehen, aber der Stream tat es ja auch. Gott, er liebte die Mädchen. Und ganz besonders liebte er Lin, die kleine, zierliche Asiatin mit den Katzenohren im Haar, die ihren Plüschschwanz wie ein Lasso kreisen lassen konnte. Wenn es nach ihm ginge, hätte die kleine Katze sehr viel mehr Sendezeit. Heute meinte es der Kameramann gut mit ihm, Lin bekam ein Close-up nach dem anderen. Dann also Spiegeleier und ein paar feuchte Gedanken.
Hinter ihm quietschte die Holztür seines Wohnzimmers ganz leise, doch er bekam es nicht mit, so sehr konzentrierte er sich auf das, was er gerade vor sich sah. Auch dem Knarzen der Dielen schenkte Bartosz keine Beachtung. Erst als er hinter sich ein Klicken hörte, drehte er sich um und starrte direkt in die Mündung einer schallgedämpften Pistole.
Ihm blieb keine Zeit mehr, die Hand aus der Hose zu ziehen.
»Ich werde mich nie an diesen Aufzug gewöhnen«, sagte Spencer kopfschüttelnd und streifte sich seine Affenmaske über.
Er selbst fand es unnötig, sich zu maskieren, mokierte sich darüber, aber letzten Endes beugte er sich Ravens Willen, auch wenn er ihr oft genug vorgehalten hatte, dass ihre Vorsicht an Paranoia grenzte. Aber Spencer lief ja auch dermaßen unbeschwert durch die Welt, dass Raven sich Tag für Tag aufs Neue wunderte, wie er es schaffte zu überleben. Meistens hatte er wohl einfach nur Glück. Er wurde leicht übersehen. Ein Luxus, der ihr nicht vergönnt war.
Raven vergrub ihre Hände in den Taschen des Kittels und trat ans Fenster. Während sie wartete, umspielten ihre Finger wieder das feste Papier. Alleine dass es ausgerechnet ein Stück Papier war, das ihr Leben völlig veränderte, fand sie absurd. Papier war etwas, womit man sich den Hintern ab- und Blut aufwischte. Etwas, in dem heiße Fritten serviert wurden, oder das in feuchteren Wohnungen von den Wänden schimmelte. Papier war unwichtig, billig und dreckig. Es war ganz sicher nicht lebensverändernd. Nun, in ihrem Fall leider doch. Die Gerichte in Altberlin waren so dermaßen armselig, dass sie, wahrscheinlich als einzige auf der ganzen verdammten Scheißwelt, noch mit Papier arbeiteten. Es fiel Raven schwer, diesen Wisch überhaupt ernst zu nehmen. Gut, sie hatte alle Informationen zusätzlich per Mail bekommen. Sonst würde sie den Brief wahrscheinlich verbrennen und so tun, als wäre niemals etwas gewesen.
Draußen im Gardens ging eine Seitentür auf. Ein junger Kerl wurde von zwei Security-Mitarbeitern aus dem Club über das matt glänzende Kopfsteinpflaster geschleift. Er stolperte immer wieder, versuchte, sich loszureißen, zappelte und schrie. Doch die halbe Portion hatte keine Chance, sich dem Griff der beiden Hünen zu entziehen.
»Sie kommen!«
Spencer nickte und öffnete die Wohnungstür einen Spaltbreit, damit sie lauschen konnten. Einer der Vorteile ihres Studios war, dass es im fünften Stock eines verlassenen Hauses lag, das nur sporadisch von Raven, Spencer und ein paar Freunden genutzt wurde. Kaum etwas verriet so viel über einen Kunden wie das, was im Treppenhaus auf dem Weg zu ihr vor sich ging.
Schon nach wenigen Augenblicken hörten sie den Typen wimmern.
»Bitte, sagt Mikael, dass ich Sonderschichten übernehme. Sagt ihm, dass ich das Geld beschaffe. Egal wie. Ich kann es auftreiben!«
»Du hattest genug Zeit dafür«, grunzte einer der Wachmänner. »Jetzt hör auf zu winseln.«
»Bitte, bitte, bitte«, hörte Raven ihn schluchzen und schloss für einen Moment die Augen. Diesen Teil hasste sie an ihrem Job. Sie hasste es, dass Mikael und Eugene ihre treuesten Auftraggeber waren, sie hasste es, dass sie Menschen zu ihr schickten, die ihre Kunst nicht zu würdigen wussten. Die schluchzten und bettelten und heulten, damit man ihnen nicht antat, wofür andere Leute viel Geld zu zahlen bereit waren. Raven mochte es nicht, wenn die Kunden heulten. Es irritierte sie. Lenkte sie ab. All ihre Liebe steckte in ihren Werkstücken. Es war ihr zuwider, dass sie so lange an etwas gearbeitet hatte, das nicht gewollt wurde. Die reinste Verschwendung.
Die drei waren nur noch zwei Stockwerke entfernt, als einer der Wachleute die Geduld verlor. Ein dumpfer Schlag erklang, gefolgt von einem lauten Aufheulen. Raven tippte auf eine gebrochene Nase. Nun, daran würde sich der Kleine gewöhnen müssen, bei der Karriere, die ihm bevorstand.
Als Miko und Sergej ihn schließlich ins Studio schleppten, lief ihm Blut aus seiner Nase über das Gesicht und tropfte auf sein schäbiges Hemd. Bingo, dachte Raven. Wenigstens hatte er aufgehört zu heulen. Stattdessen starrte er sie aus dunkelblauen Augen an, als sei sie der Teufel persönlich. Und für einige Leute war sie genau das.
»Dark, wir bringen dir hier einen von Mikaels Männern«, sagte Sergej und schubste den Kleinen vor. Die beiden Türsteher waren etwas außer Atem. Aufstiege wie diesen waren sie nicht gewohnt, jedenfalls nicht mit einer zappelnden, menschlichen Fracht. Es würde Raven nicht wundern, wenn sie in Neuberlin niedliche kleine Wohnungen mit niedlichen kleinen Familien bewohnten. Angeblich verdiente man als Muskelpaket an den Türen des Gardens gar nicht schlecht. Mikael und Eugene wussten, wo sie knausern durften und wo nicht. Loyale Türsteher waren für das Gardens überlebenswichtig. Verschwiegen mussten sie sein, Respekt einflößend und diszipliniert. Sie durften sich weder von Drogen noch von schönen Frauen verführen lassen. Alles in allem eine seltene Spezies im Dunstkreis des Gardens und gerade deswegen so teuer. Genau wie Raven.
Aus dem Augenwinkel beobachtete sie, wie sich Sergej mit speckigen Fingern den Schweiß von der Stirn wischte. Raven konnte einfach nicht verstehen, wie man seinen Körper so vernachlässigen konnte; gerade in diesem Job. Sie selbst legte großen Wert darauf, sich fit zu halten.
Raven nickte und deutete auf den Operationstisch, der unter einer hell leuchtenden Lampe stand. Miko packte den jungen Mann am Ärmel und zog ihn unsanft zum Tisch hinüber. »Rauf da!«, brummte der Türsteher und hob drohend die rechte Faust. Der Kleine legte sich zitternd und mit flehendem Blick auf die kalte Metallplatte.
Spencer fixierte ihn mit flinken Fingern, was den Kerl noch panischer werden ließ. Was dumm war, denn außer den Augen, die hektisch hin und her zuckten, den Fingern und Füßen, die unter den Fixierungen unkontrolliert zu zittern begannen, konnte er sich ohnehin nicht mehr richtig bewegen. Sie konnte sein Herz förmlich durch das Hemd hindurch schlagen sehen. Hoffentlich nässte er sich nicht ein.
Mit einer Handbewegung schickte Raven die Türsteher nach draußen. Hier konnte sie die Typen nicht gebrauchen. Spencer war der einzige Mensch, den sie, abgesehen von den Kunden, während einer Operation im Studio duldete. Was sie als Modder »Dark« hier tat, war nicht nur gefährlich und illegal, sondern forderte zudem ihre volle Konzentration. Außerdem wollte sie nicht, dass noch mehr Menschen wussten, wie sie beim Einsetzen der Werkstücke vorging. Ihre Methode war genauso geheim wie ihre Identität. Für Raven war es überlebenswichtig, dass es auch so blieb.
»Weißt du, was du heute von uns bekommst?«, fragte Spencer den jungen Mann, während er ihm eine Kanüle legte.
»K…kniegelenke«, antwortete dieser zitternd. Spencer nickte ruhig. »Die hammermäßigsten Kniegelenke, die diese Welt zu bieten hat.«
»Ich will sie aber nicht!«
Raven wandte sich ab und betrachtete noch einmal ihre perfekten Meisterwerke. So viel Arbeit. So viele durchwachte Nächte, nur damit jemand sagte »ich will sie nicht«.
»Wie heißt du?«, hörte sie Spencer fragen.
»Josh. Ich bin …« Spencer hob die Hand und brachte ihn damit zum Schweigen. »Nur deinen Namen. Mehr wollen wir von dir nicht wissen.«
Raven atmete unter ihrer Maske langsam aus. Am liebsten hätte sie von Mikaels Männern nicht einmal die Namen gekannt. Es fiel ihr leichter, wenn sie die Person auf dem Operationstisch vollkommen ausblenden konnte. Außerdem war es sicherer, so wenig wie möglich zu wissen. Doch die Kunden waren kooperativer, wenn man sie beim Namen nannte.
»Jetzt hör mir mal zu, Josh: Du weißt vielleicht, dass Mikael euch Losern die Betäubungsmittel nicht bezahlt. Ihr sollt etwas lernen, wenn ihr bei uns seid, verstehst du?«
Josh schluchzte laut und knallte seinen Kopf gegen das Metall des Tischs.
»Lass das«, sagte Spencer schroff.
»Wir sind keine Unmenschen, deshalb pumpen wir dir einen schönen Cocktail aus Diazepam und Novalgin in deinen Blutkreislauf. Ist auch gut so, damit wir besser arbeiten können. Wenn dein Herz so weiterschlägt, saust du hier alles voll.«
Josh verzog das Gesicht. Eine perfekte Illustration für das Wort »angstverzerrt«, dachte Raven.
»Ich will hier raus!«
Raven beobachtete schweigend, wie Spencer die Schultern des jungen Mannes nach unten auf den Metalltisch drückte und seine krumme Gestalt über ihn beugte, sodass er durch die Löcher in seiner Maske hindurch in Joshs Augen sehen konnte.
»Du kommst hier aber nicht raus. Von mir aus kannst du weiter über dein elendes Leben jammern, oder du kannst es annehmen wie ein Mann. So oder so wird sich nichts ändern. Kapierst du das?«
Es dauerte einen Moment, bis Josh leicht nickte.
»Das da drüben ist Dark. Du hast doch sicher schon von Dark gehört, oder?«
»N…natürlich.«
»Dark ist eine lebende Legende. Viele Leute reißen sich darum, von Dark behandelt zu werden, klar?«
Wieder ein Nicken.
»Wie ich schon sagte: Es liegt alles bei dir. Wenn du weiter so wimmerst, gibt es keine Schmerzmittel für den kleinen Josh. Eine einfache Regel.«
»Okay«, flüsterte Josh. Allmählich fügte er sich in sein Schicksal. Das Diazepam begann wohl zu wirken. Gut. Raven hatte keine Zeit für diesen Mist.
Spencer klopfte Josh kumpelhaft auf die Schulter. »Du bist gar nicht so blöd, wie du aussiehst.«
Josh verdrehte die Augen, gab aber keine Widerworte mehr.
»Na also. Dann kann es ja losgehen.«
Raven zeigte an die Decke, und Spencer sagte: »Wenn ich dir einen Tipp geben darf: Zähl die Risse in der Decke. Es sind wirklich viele, das dauert eine Weile. Schau auf keinen Fall nach unten.«
Raven ging zu ihrem alten Airplayer und tippte im Menü herum, bis sie fand, was sie gesucht hatte. Ihre Playlist für lange Operationen.
Die ersten Töne von Björks »Hyperballade« füllten den Raum aus, und Raven rollte die Schultern. Die meisten Leute in der Stadt liebten die Musik der 1920er. Seitdem irgendein Freak das alte Zeug in die Airmusic-Cloud hochgeladen hatte, konnte ganz Berlin nicht mehr genug davon bekommen. Aber Raven stand eher auf die Songs der Jahrtausendwende. Es war die Zeit, in der sie am liebsten gelebt hätte. Modern, aber noch nicht zu hektisch – mit dem heutigen Leben zwar schon am Horizont, aber noch zu weit entfernt, um es richtig einordnen zu können. Das letzte Luftholen vor dem kollektiven Wahnsinn. Wie musste Berlin damals gewesen sein, als die meisten Leute sich noch darum gerissen hatten, im Zentrum zu wohnen, und Neuberlin noch eine Sumpflandschaft gewesen war? Fröhlicher. Das mit Sicherheit. Und auf eine andere Art lebendig. Die Musik von damals erzählte Geschichten von gequälten Seelen und unerschütterlicher Liebe, aber auch von kreativen Köpfen, der Hoffnung junger Menschen und quirligen, bunten Großstädten. Heute war alles genau wie sie. Auf die eine oder andere Art dunkel.
Josh hatte die Augen geschlossen und atmete nun flacher. So unauffällig sie konnte, kippte sie den Operationstisch leicht, während Spencer begann, die Fußfesseln zu lösen und den Kunden zu entkleiden.
Dann stellte sie die Plastikschüssel unter den Ablauf. Venenklemmen hin oder her, es ging immer noch ordentlich was daneben. Sie war schließlich kein Chirurg.
»I go through all this, before you wake up«, hörte sie die wunderbare Stimme der isländischen Sängerin. Island. Raven hatte einmal Bilder von Island gesehen. Weite Landschaften mit Bergen, Schnee und Eis. Riesige Flächen ohne Häuser. Das sprengte ihre Vorstellungskraft. Raven war in Berlin geboren und hatte die Stadt seither noch nie verlassen. Mit ihren neunzehn Jahren hatte sie noch nicht ein einziges Mal den Horizont gesehen.
»To be safe up here with you.«
Es war zwar ein bisschen pathetisch, aber sie begann jede Operation mit diesem Song. Weil es stimmte. All das machte sie durch, um hinterher wieder safe zu sein. Ihr wiederstrebte dieser Teil ihres Jobs.
Lieber erschuf sie, als zu zerstören. Zwar kreierte sie bei den Operationen etwas völlig Neues, doch sie zerstörte auch das Alte. Und diese Zerstörung des Alten brachte Blut und Schmerzen mit sich, war anstrengend, langwierig und verstörend brutal. Es fiel ihr immer schwer, die aufsteigende Übelkeit in Schach zu halten.
Raven war zufrieden, wenn sie alleine zu Hause an ihren Werkstücken arbeiten konnte. Sie liebte es, wenn die Cyberprothesen am Ende genau so funktionierten, wie sie es von der ersten Zeichnung an geplant hatte. Wenn alles ineinandergriff und kleine Impulse kraftvolle Bewegungen auslösten. Auf alles, was danach kam, hätte sie lieber verzichtet.
Doch ein Gutes hatten solche Operationen: Sie erforderten volle Konzentration. Wenn sie arbeitete, wurde sie durch ein schwarzes Loch in eine andere Dimension gesaugt, in der es nur noch sie und ihre Aufgabe gab. Raven dachte nicht mehr an das Dokument in ihrer Tasche. Sie dachte nicht mehr an zu Hause, nahm das Kratzen der Perücke genauso wenig wahr wie den unangenehmen Geruch, den Joshs Angstschweiß verbreitete.
Unter einer Stuckdecke, die so rissig und bröckelig war, dass sie alle im Raum jeden Augenblick unter sich begraben konnte und direkt neben dem größten Club der Welt, in dem sich Tausende Menschen gerade die Nacht um die Ohren schlugen, setzte Raven den ersten Schnitt.
Es war gar nicht so einfach, ruhig zu bleiben. In der Schlange für den Zulassungstest zum Polizeidienst nicht allzu nervös, alt oder verdächtig auszusehen. Gleich würde sie ihren gefälschten Ausweis das erste Mal jemandem zeigen müssen, der vielleicht in der Lage war, den Unterschied zu erkennen. Natürlich war sie irrational, aber dieses Wissen half ihr nicht weiter. Verflucht.
Warum ausgerechnet Berlin? Hamburg hatte ja schon einen üblen Ruf, aber die Hauptstadt war deutlich schlimmer. Wahrscheinlich war das einfach der Job einer Hauptstadt. Mehr von allem zu sein.
Sie blickte sich um und hatte zum wiederholten Mal heute das Gefühl, in der falschen Schlange zu stehen. Und obwohl das ihr Leben ganz gut beschrieb, war es in diesem Moment keine Metapher. Laura kam sich tatsächlich vor wie in der Schlange für die Essensausgabe eines Gefängnisses. Mehr als die Hälfte der Leute sah aus, als gehörte sie eher hinter Gitter als auf die andere Seite. Rasierte Schädel, vernarbte Hände, Tätowierungen, Implantate und Plateauschuhe, wohin man blickte. Hektisch zuckende Augäpfel, zu große Pupillen, ausgeschlagene Zähne.
Ein paar von ihnen machten auf Laura den Eindruck, dass sie nur an dem Test teilnahmen, weil sie einen Job brauchten, der ihnen ihr kaputtes Leben finanzierte. Sie sahen furchtbar abgewrackt aus und starrten die meiste Zeit ins Leere. Wenn es weiterging, hoben sie kaum die Füße. Der Typ hinter ihr roch merkwürdig, nach Schweiß und alten Klamotten. Wie ein Putzlappen, der dringend in den Müll gehörte.
Sie starrte an die Decke, doch auch hier konnte sie sehen, was Altberlin ausmachte: Verfall. Konstant und allgegenwärtig. Die alten Häuser, die das Stadtbild in den früheren Wohnstraßen prägten, fielen buchstäblich auseinander – da machte diese Turnhalle einer Grundschule keine Ausnahme.
Die Deckenplatten, die sicher irgendwann einmal weiß gewesen waren, fehlten zu mindestens fünfzig Prozent. Überall guckten Kabel heraus, man sah die staubigen Metallträger, die alles zusammenhielten.
Die Schlange bewegte sich ätzend langsam voran. Zweimal stolperte sie über den PVC-Belag am Boden, weil dieser sich an einigen Stellen regelrecht vom Estrich schälte. Sie fragte sich, ob diese Halle überhaupt noch für Sportzwecke genutzt wurde oder ob es zu gefährlich war, weil den Kindern die Decke auf den Kopf krachen könnte. Und wie wahrscheinlich es wohl war, dass sie in den nächsten zwei Stunden einstürzte.
Laura wollte das Ganze so schnell wie möglich hinter sich bringen, wollte das Blatt mit den Aufgaben, die sie mittlerweile auswendig konnte, mit zu einem freien Platz nehmen, die Sache durchziehen und dann nichts wie raus hier. Bevor sie doch noch der Mut verließ. Irgendwie machte die ganze Atmosphäre sie nervös. Hier drin und in dieser Gesellschaft hatte sie nichts, was sie von ihren düsteren Gedanken abbringen konnte.
Fenne tot im schmalen Gang zwischen gestapelten Schiffscontainern, die schwarze Mütze über ihren hellblonden Haaren. Zu wenig Blut für einen tödlichen Schuss.
»Reiß dich zusammen, du tust das hier für sie«, versuchte sie sich zu sagen, während der Typ, der gerade an der Reihe war, in einen Streit mit der Beamtin geriet, die alle Bewerber registrierte.
Am Beginn der Schlange entwickelte sich ein Tumult, der zu einer Schlägerei ausarten konnte. Die Leute drängten nach hinten, und die ordentliche Menschenreihe geriet aus der Form.
Als der volltätowierte Unruhestifter schließlich von zwei Beamten an den Wartenden vorbeigeschleppt wurde, versuchte er, einen der Männer, die ihn mit sich schleiften, in den Arm zu beißen.
»Na dann herzlich willkommen bei der Berliner Polizei, wa?«, hörte sie ein Mädchen in der Schlange feixen. Die Flashtunnels in ihren Ohren waren so groß wie Lauras Handteller; ihre pink geschminkten Lippen bliesen eine enorme Kaugummiblase, die schließlich zerplatzte, als wollte sie ein Ausrufezeichen hinter den Scherz setzen. Auf ihre Bemerkung hin lachten einige der Umstehenden nervös, und das Mädchen grinste zufrieden. Sie konnte kaum älter als siebzehn sein, das Mindestalter für den Polizeidienst in Deutschland.
Das Alter, in dem Fenne und sie sich in Hamburg in eine ganz ähnliche Schlange eingereiht hatten. Verflucht. Jetzt nicht mehr dran denken.
Sie hätte überall hingehen können, nachdem sie aus Hamburg geflohen war. Sie hätte Deutschland sogar komplett den Rücken kehren können, immerhin beherrschte sie vier Sprachen fließend. Doch das hatte sie nicht über sich gebracht. Irgendjemand musste schließlich herausfinden, was in der Nacht im Containerhafen geschehen war. Das war sie Fenne schuldig. Und sich selbst, wenn sie die Hoffnung auf normalen Schlaf nicht endgültig begraben wollte. Das nagende Schuldgefühl kam jede Nacht angeschlichen und setzte sich in der Dunkelheit schwer auf ihre Brust. Völlig egal, was sie sich tagsüber einzureden versuchte.
Aber musste es ausgerechnet Altberlin sein? St. Pauli war ihr früher schon immer nicht ganz geheuer gewesen, doch das war ein Spaziergang im Vergleich zu dem hier. In Altberlin gab es den Käfig. Und es gab das Utopia Gardens. Den legendären Club, in dem alles existierte, was auf dieser Welt eigentlich nicht existieren sollte. Toleriert und ganz offen mitten in der Stadt. Auf dem Weg hierher hatte sie sogar ein Werbeplakat dafür gesehen. Sie konnte sich überhaupt nicht erklären, wie das möglich war. Pauli war wenigstens gewachsen, aber das Gardens war erbaut worden. Von berüchtigten Gangster-Brüdern, die sogar ihrer Großmutter ein Begriff waren. Der Oberbürgermeister hatte das rote Band zur Eröffnung zerschnitten und anschließend den Hausherren die Hände geschüttelt. Kein Mensch hatte sich darüber gewundert. Während sie sich hier so umsah, begann sie zu begreifen, warum.
Das Utopia Gardens war der letzte Ort auf der Welt, an dem sie sein wollte, und doch musste sie genau dorthin, wenn sie Fennes Spur folgen wollte. Aber zuerst musste sie in den Käfig, das Herzstück der Altberliner Polizei. Was sie, kurz gesagt, an diesem aschgrauen Nachmittag in die noch grauere Turnhalle geführt hatte.
Hoffentlich ging die Sache gut. Laura war nicht bereit, einfach so ausgebremst zu werden. Sie hatte noch keinen Plan B. Oder vielmehr war es exakt Plan B. B wie beschissenes Berlin.
Die Beamtin am Ende der Schlange warf nur einen kurzen Blick auf ihren gefälschten Ausweis und das polizeiliche Führungszeugnis, das sie sich noch in Hamburg besorgt hatte, aber keinen Blick auf Laura.
Laura nahm die Fragebogen und den bereitgestellten Filzstift entgegen und suchte sich einen freien Platz. Der Plastikstift sah billig aus und war himmelblau, was ihn maximal deplatziert wirken ließ. Doch sie wusste, warum hier Filzstifte verteilt wurden: weil ein Kandidat vor zwei Jahren einem anderen den Kugelschreiber glatt durch die Handfläche gerammt hatte. Nicht, dass so was mit Filzstiften nicht möglich war. Es war nur schwerer.
Auf das Zeichen der Beamtin hin drehten alle ihre Blätter um.
»Was macht Sie Ihrer Meinung nach zu einem guten Mitglied der Berliner Polizei?«, lautete die erste Frage. Laura legte den Kopf in den Nacken.
Nichts, dachte sie. Überhaupt nichts.
Dann atmete sie durch und schrieb etwas anderes.
Sie standen einander im Ring gegenüber wie antike Gladiatoren. Das war der Teil, den er ganz besonders mochte. Die Sekunden, bevor der Ringrichter das Kommando gab. Wie sie sich gegenseitig abzuschätzen versuchten. Die Körper des jeweils anderen scannten, um herauszufinden, was ihn außergewöhnlich machte. Wo seine Schwächen wohl liegen mochten. Seine Stärken. Vor allem ging es bei diesen Kämpfen sehr viel mehr um die Schwächen des anderen als um die eigenen Stärken. Doch das kapierten die wenigsten.
Wie bei einem Blind Date wussten die Kämpfer hier niemals, auf wen sie treffen würden, wenn man sie in den Ring führte. Es war wie Russisch Roulette, zwar ohne die Kugeln, doch nicht weniger tödlich.
Eigentlich mochte er den Club nicht sonderlich – im Gardens war ihm alles zu künstlich, zu viel, zu laut. Er schätzte es nicht, wenn sich etwas aufdrängte. Doch hier unten, auf dem Fightfloor des dritten Untergeschosses, war es anders. Diese fensterlose Welt auf halbem Weg zur Hölle war das Ehrlichste, was das Utopia Gardens zu bieten hatte. Und für ihn einer der sichersten Orte auf der ganzen Welt. Der enorme, kreisrunde Raum, in dessen Zentrum der hell beleuchtete Ring stand, war wie immer brechend voll. Auf den Rängen, die treppenförmig vom Ring aus nach oben führten, drängten sich die aufgeregten Zuschauer. An den Bars, die auf jedem Rang zu finden waren, beeilten sich die Bardamen, sämtliche Wünsche zu erfüllen, bevor der Kampf begann. Er selbst stand im Auge des Sturms. Direkt am Rand des Rings.
Die Leute scherten sich nicht um ihn, bemerkten ihn nicht einmal. Sie kamen aus Blutdurst und um Wetten abzuschließen, nicht, um einander anzugaffen. Und für Othello Sander war es eine wirklich willkommene Abwechslung, mal nicht angegafft zu werden.
Auf dem Fightfloor herrschte Gier. Nicht nach Neuigkeiten oder Gerüchten, sondern schlicht nach Geld. Jedem einzelnen Besucher stand sie in die Augen geschrieben.
Hier unten konnte er gefahrlos Geschäfte abschließen und Verabredungen wahrnehmen, die an der Oberfläche völlig unmöglich oder nur unter großen Schwierigkeiten realisierbar wären. Es war ein wundersames Phänomen, dass er hier unten Hunderte Zeugen hatte, die ihn doch allesamt ignorierten. Sie waren alle wie Kinder, die hofften, nicht gesehen zu werden, solange sie selbst nicht hinsahen. Bisher hatte es auch immer blendend funktioniert. Nichts, was er hier auf dem Fightfloor trieb, war jemals an die Oberfläche gelangt.
Und doch ging er das Restrisiko ein, dem sich andere Geschäftsleute und Prominente dadurch entzogen, dass sie lächerliche Masken trugen. Othello konnte sich nicht vorstellen, so tief zu sinken. Hier unten war doch jeder erpressbar – darauf fußte das gesamte System. Es ging nicht darum, seine Identität zu verbergen, sondern seine Motive. Die wunden Punkte. Genau wie beim Kampf im Ring. Aber auch das kapierten die wenigsten.
Sie verschanzten sich lieber hinter ihren Bautas und bildeten sich ein, auf diese Weise sicher zu sein. Wohin Othello auch blickte, überall sah er gut gekleidete Männer und Frauen mit den venezianischen Masken. Er wusste, dass sie nicht nur als Tarnung, sondern auch als Code dienten. Die Farben und Formen der Bautas drückten aus, was der Träger suchte. Menschen mit schwarzen Masken wollten einfach nur zuschauen; wer Gold trug, war auf der Suche nach einem Geschäft oder einer lukrativen Wette, Rot stand für Analsex, Silber für ein gleichgeschlechtliches Abenteuer und wer eine Bauta mit besonders langer, spitz zulaufender Nase trug, war auf der Jagd nach dem kulinarischen Kick. Nach Gerichten mit besonders exotischen Zutaten wie vom Aussterben bedrohten oder auf dem Teller noch lebenden Tieren.
Othello fand diese Form der Schwäche abstoßend. Wenn man etwas wollte und bereit war, diesem Bedürfnis nachzugehen, dann sollte man sich verdammt noch mal nicht dafür verstecken. Er hatte sich ja auch nicht versteckt. Sie waren die Oberschicht und standen somit an der Spitze der Nahrungskette jener Spezies, die sowieso an der Spitze der Nahrungskette stand. Menschen wie sie sollten überhaupt keine Angst haben.
Seine Hände spielten mit dem schweren Whiskyglas, der rechte Zeigefinger fuhr den exzellenten Musterschliff nach, während er für sich selbst zu entscheiden versuchte, auf wen der beiden Opponenten er im Zweifel wetten würde. Das machte er immer so. Er war nicht so dumm, sein Geld tatsächlich einzusetzen, doch er liebte es, recht zu haben. Othello war gut darin, andere Menschen zu lesen, und der Fightfloor war ein perfekter Ort, diese Fähigkeit zu trainieren. Also widmete er den Kämpfern im Ring einen Großteil seiner Aufmerksamkeit. Auch um die elenden und abgehalfterten Gestalten, die ihn umgaben, nicht wahrnehmen zu müssen.
Der Kleinere der beiden hatte Angst, das konnte man sehen. Sein Opponent war sicher nicht der Einzige, der die dunkelroten Narben kurz oberhalb der Knie bemerkt hatte. Offenbar war er noch nicht lange dabei; die Nähte waren noch nicht verblasst. Othello hoffte, dass es ein halbwegs ausgeglichener Kampf werden würde, er war zu feingeistig für Gemetzel und mochte es überhaupt nicht, wenn er Zeuge eines solchen wurde. Othello glaubte an Zivilisation und Fortschritt; er war überzeugt davon, dass Macht längst nicht mehr an physischer Stärke gemessen wurde, sondern an psychischer. Die Demonstration körperlicher Überlegenheit kam ihm primitiv, ja geradezu mittelalterlich vor. Und unästhetisch war es obendrein, vom Geruch ganz zu schweigen.
Die Glocke erklang und die Menge fing an zu toben. Der Lärm war schon nach wenigen Sekunden ohrenbetäubend, es entzog sich vollkommen Othellos Horizont, was einen Menschen veranlassen konnte, so zu brüllen, während zwei andere aufeinander eindroschen.
Wobei.
Es war schon eine ziemliche Show, die sie heute Abend zu sehen bekamen.
Der fette Kerl zeigte offenbar gerne, was er hatte; das Grinsen, das er aufgesetzt hatte, als er die Klingen an seinen Fersen und den Handrücken ausfuhr, hätte ihn glatt als Model für Plakatwerbung durchgehen lassen. Momente des ungekünstelten Glücks; so was sah man in Berlin eher selten.
Der Jüngere hatte seine Courage gefunden, er musste hart trainiert haben. Seine Tritte waren kraftvoll und so schnell, dass sie mit bloßem Auge kaum zu verfolgen waren. Es musste einer von Mikaels Männern sein. Der Boss hatte eine Schwäche für Kniegelenke. Sie waren ja auch praktisch. Vielseitig einsetzbar und schwer aufzuspüren. Nur fliegen war mit den Dingern nicht mehr drin, was jedoch für die meisten nicht registrierten Ersatzteile galt. Sie würden in den Ganzkörperscannern am Flughafen sofort bemerkt werden.
Die Geschwindigkeit und Kraft dieser speziellen Gelenke waren allerdings nicht normal. Sie überschritten die Grenzen des eigentlich Machbaren um ein Vielfaches. Othello presste die Kiefer aufeinander. Er könnte schwören, dass der junge Kerl keine Prothesen von Sander Medics trug. Dafür war er viel zu gut. Was Othello da gerade sah, war fast schon unmöglich, keiner in seinem Labor wäre fähig, so etwas zu entwickeln. Weder im Hinblick auf gesetzliche oder technische Möglichkeiten noch in Bezug auf seine Fähigkeiten. Dabei hatte er schon die besten Leute, die Deutschland auf seinem speziellen Berufsfeld zu bieten hatte. Das durfte doch nicht wahr sein!
Die Hand, die sein Glas hielt, begann leicht zu zittern. Und als er dann noch unweigerlich an seine Schwester dachte, wurde das Zittern stärker.
Schneller New Orleans Jazz dröhnte aus unsichtbaren Boxen. Die Luft war erfüllt von Anfeuerungsrufen der verschiedenen Wettlager und von Zigarettenrauch, der von den tief hängenden, alten Lampen angestrahlt träge durch den Raum waberte. Natürlich rauchte hier drin niemand, das hätten Eugene und Mikael niemals zugelassen. Der Rauch wurde künstlich erzeugt und durch versteckte Düsen in den Raum gepustet. Das war eine der Spezialitäten des Clubs: Es wurden perfekte Illusionen geschaffen. Die Bardamen trugen kurze Paillettenkleider mit passenden Hauben, das Sicherheitspersonal steckte in dunklen Anzügen, und ein jeder hatte seinen Hut tief in die Stirn gezogen. Der heilige Ernst, mit dem sie die Maskerade trugen, war kurz davor, in die Lächerlichkeit zu kippen, aber den Gästen schien genau das zu gefallen. In Berlin musste alles immer ein bisschen mehr sein, um das verwöhnte Publikum überhaupt noch zu erreichen.
Othello fühlte eine Hand in seinem Schritt und runzelte die Stirn.
»Was willst du, Nina?«, fragte er, ohne seinen Blick vom Kampf zu lösen.
Die Hand drückte zu. »Die Frage ist vielmehr, was du willst.«
Seufzend wandte sich Othello der Gestalt zu, die neben ihm stand.
Es fiel ihm immer schwer, sie anzusehen. Ninas Augen waren verstörend, das hatte er schon immer so empfunden. Er hatte keine Ahnung, ob sie etwas an ihnen hatte machen lassen oder ob sie Kontaktlinsen trug, damit die Augäpfel aussahen, wie sie aussahen. Genau wie der Rest von ihr erinnerten Ninas Augen in ihrem satten Grün mit dem schmalen, schwarzen Schlitz in der Mitte an eine Schlange. Und das war es auch, was Othello so faszinierte, an manchen Abenden sogar erregte: Im Gegensatz zu den anderen Mädchen im Gardens war sie nicht das Opfer, sondern der Jäger. Nina war unbezähmbar und wild. Exklusivmaterial für sehr reiche Gäste mit einem speziellen Geschmack. Sie hatte ihren Kopf frisch rasiert, ihr makelloser, kaffeebrauner Körper steckte in einem hautengen, grünen Nichts, aus dem ihre perfekt gemachten Brüste gerade weit genug rausblitzten, um ihn nervös zu machen. Das konnte er jetzt alles nicht gebrauchen.
»Verzieh dich!«, sagte er schroff, doch sie ließ nicht locker.
»Du freust dich doch auch, mich zu sehen«, säuselte sie ihm ins Ohr. Es war erstaunlich, dass es ihr überhaupt gelang, bei dem Lärm, der hier unten herrschte. Doch Nina war ein Vollprofi. Othello wusste nicht, ob sie den Club jemals verließ.
Nina lächelte leicht und schlug die Augen nieder. »Ich kann es spüren.«
Othellos Hals wurde trocken. Er würde sich von diesem Flittchen doch jetzt nicht aus dem Konzept bringen lassen! Auf keinen Fall durfte er ihr heute nachgeben. Beim letzten Mal hatte er sich geschworen, dass er es niemals wieder zulassen würde. Die Erinnerungen an seine Treffen mit Nina verdrängte er, so gut es ging. Nicht, weil sie so erregend wären, sondern, weil sie ihn abstießen. Sie war die einzige Frau, die er jemals angebettelt hatte. Und er verachtete nichts auf dieser Welt mehr als Demütigung. Der Grat zwischen Liebe und Hass war so schmal.
Sie allein war der Grund, warum er Mikael nicht auf die Kniegelenke seines Fighters ansprechen konnte. Früher wäre er einfach zu ihm hingegangen und hätte ihn konfrontiert, doch das ging jetzt nicht mehr. Er hatte sich im Netz des Gardens verfranst, war in ihm kleben geblieben wie eine Fliege. Jetzt musste er stillhalten; sonst kam die Spinne und fraß ihn auf. Wenn man sich einmal auf all das hier eingelassen hatte, gab es keinen Weg mehr hinaus. Ein schwacher Moment und alles zerfiel in seine Einzelteile. Kaum etwas bereute Othello mehr als seine Dummheit in Momenten der Schwäche. Für die Nina verantwortlich war.
Ein Aufschrei ging durch die Menge, und Othello riss den Kopf herum. Er musste einen spektakulären Schlag verpasst haben, der kleine Kerl blutete aus der Schulter. Verdammtes Weibsstück. Sie verdarb ihm sogar den Kampf. Hatte sie überhaupt eine Ahnung, was sie hier gerade riskierte? Seine rechte Hand löste sich vom Glas und schloss sich um Ninas Handgelenk. Es war schmal und zierlich, wie das eines Kindes. Er drückte so fest zu, wie er konnte, und sie ließ ihn los. In ihren Augen sah er kurz etwas Dunkles aufflackern – war es Wut oder Lust? –, bevor sie wieder lächelte. Nina hatte keine Angst vor ihm, und das war es, was ihn besonders an ihr erregte. Auch jetzt.
»Mach, dass du verschwindest!«, grollte er.
»Dafür musst du mich erst loslassen«, zischte sie zurück. Othello gab sie frei und stieß sie von sich. Sie stolperte, doch der Raum war zu voll, um hinzufallen. Ihre Lippen formten noch eine Beleidigung, doch er hatte sich längst wieder abgewandt. Er wollte sie nicht länger ansehen.
Der Kampf begann, ihn zu langweilen. Ganz offensichtlich hatte Nina ihn um die interessantesten Momente gebracht. Mittlerweile blutete der Kleine aus mehreren Wunden. Er sah erbärmlich aus. Als hätte er Todesangst. Doch Mikael würde schon nicht zulassen, dass er starb. Sein Körper war mittlerweile zu wertvoll. Othello rieb sich erschöpft übers Gesicht.
Vielleicht hätte er die Verabredung auf einen späteren Zeitpunkt verschieben sollen? Es war ein langer und anstrengender Arbeitstag gewesen. Andererseits kommunizierte er mit diesen Leuten so wenig wie möglich. Er konnte es sich nicht leisten, mit ihnen in Verbindung gebracht zu werden. Deshalb gab er auch keine Nummer heraus, unter der er zu erreichen war. Was allerdings die Gefahr mit sich brachte, dass er sich, falls etwas schiefgelaufen war, hier noch Stunden die Beine in den Bauch stehen würde.
Deshalb war seine Erleichterung auch recht groß, als er rund dreißig Minuten später spürte, wie etwas Schweres in seine Sakkotasche glitt. Othello nickte knapp, drehte sich aber nicht um. Er wollte nicht sehen, wer ihm das Päckchen gebracht hatte. Noch nie hatte er einen von ihnen gesehen. Nichtwissen war im Gardens der beste Schutz.
Der dritte Kampf des Abends hatte begonnen, aber Othello hatte genug gesehen. Außerdem wollte er noch einen Blick auf das Päckchen werfen, bevor er schlafen ging, und das war hier drin dann doch zu riskant. Wenn zwei Leute wussten, was er mit sich herumtrug, war das schon mehr als genug. Sein Blick glitt zu Mikaels Loge. Wie jede Nacht saß der ältere der beiden Metzger-Brüder ganz oben in seiner verglasten Einzelkabine auf einem weißen Ledersessel, eines der blutjungen Mädchen aus dem Salon Rouge auf dem Schoß. Othello nickte Metzger knapp zu und wartete, bis dieser ebenfalls nickte. Dann trank er aus und verließ den Fightfloor.
»Du hast was?«
Spencer schrie sie an. Normalerweise machte er so was nicht. Doch jetzt war er fuchsteufelswild – so wütend hatte Raven ihn noch nie gesehen. Natürlich hatte sie es ihm sagen müssen, doch sie hatte den Moment so lange wie möglich hinausgezögert. Raven hätte es ihm beichten sollen, nachdem Josh das Bewusstsein verloren hatte, dachte sie jetzt. Doch unter einem Streit hätte ihre Konzentration gelitten. Allerdings hätte es Spencer dann vielleicht nicht gewagt, sie derart anzupflaumen. Weil ja ihre Konzentration gelitten hätte.
Josh war vor einer halben Stunde abgeholt worden. Pacman, der größte Türsteher des Gardens, hatte ihn ohne viel Federlesens einfach über die Schulter geworfen. Raven hoffte, dass die Klammern hielten. Pacman war nicht zimperlich und hatte auf Spencers Mahnung, ein bisschen aufzupassen, nur mit einem Grunzen reagiert. Was war nur aus den guten alten ganzen Sätzen geworden? Subjekt, Prädikat, Objekt – mehr verlangte sie doch gar nicht.
Wenn Raven so darüber nachdachte, konnte sie sich nicht erinnern, ihn jemals sprechen gehört zu haben. Für eine Weile amüsierte sie sich selbst mit der Vorstellung, dass er eine hohe Piepsstimme hatte und deshalb so wenig sagte.
Gerade räumten sie alles auf. Reinigten das Besteck, wischten die Folie sauber und verstauten alles wieder im Küchenbuffet, damit Spencer am nächsten Vormittag seine arglosen Tattoo-Kunden empfangen konnte. Wenn welche kamen. Manchmal dachte Raven, dass er so schlecht in seinem Job war, dass es für alle ein Segen wäre, Spencer würde sich einen anderen suchen. Aber sprach sie das laut aus? Nein! Weil sie nicht zu den Leuten gehörte, die auf den Fehlern anderer herumritten. Immerhin mochte er, was er tat. Und das traf auf die wenigsten Menschen in dieser Stadt zu.
»Hey!« Er klatschte in die Hände, und Raven zuckte zusammen. »Ich rede mit dir!«
»Jetzt komm wieder runter!« Raven zog das Dokument aus ihrem Kittel und hielt es ihm hin. Mit angeekelter Miene nahm Spencer den Umschlag entgegen und zog das Gerichtsurteil hervor, das er hastig überflog. »Du hast eine Polizistin beklaut? Ernsthaft, Rave?«
Raven nickte. Sie wollte sich nicht kleinlaut fühlen, wollte sich nicht schämen. Das waren Emotionen aus ihrer Kindheit, die hier keinen Platz hatten. Schon gar nicht mit Spencer, verflucht. Die meiste Zeit nahm sie ihn ja nicht einmal richtig ernst. Aber sein Tonfall machte etwas mit ihr. Er ließ ihre Brust eng werden. Ließ sie daran denken, wie klein und leicht sie war. Fragil. Zarte Knochen und dünne Haut. Unwillkürlich fuhr sie mit der Fingerspitze über ihren Nasenrücken. Genau dort, wo der leichte Knick zu spüren war. Als die Erinnerungen kamen, wurde ihr kalt.
Und dann fiel ihr wieder ein, dass sie gerade Skalpelle reinigte. Sie war vielleicht klein, aber sie war sicher nicht mehr wehrlos. Ihre Finger schlossen sich um einen der Messergriffe. Langsam drehte sie sich zu Spencer um, der mit dem Umschlag in der Hand neben dem Operationstisch stand. Sie konnte sehen, dass er mit seinen Fingern blutige Abdrücke auf dem Dokument hinterlassen hatte. Shit.
Raven knallte das Skalpell auf die Anrichte, trat auf Spencer zu und riss ihm den Brief wieder aus der Hand.
»Pass doch auf, verdammt! Ich muss das Ding morgen abgeben!«
»Ja und?«
Raven atmete tief durch. Sie war sich vollkommen sicher, dass es leichter wäre, einem Rauhaardackel zu erklären, wo das Problem lag. Nur mit Mühe konnte sie sich zwingen, ihn anzusehen.
»Ich muss mit diesem Dokument morgen im Käfig aufschlagen, wenn ich meinen Dienst antrete. Und du verteilst gerade fröhlich blutige Fingerabdrücke darauf, weil du zu blöd oder zu stur bist, Handschuhe zu tragen!« Sie hatte sich vorgenommen, ruhig zu bleiben, aber irgendwie wollte es Raven nicht so recht gelingen. Die letzten Worte schrie sie beinahe.
Spencers Blick huschte zu den roten Blutspuren auf dem Papier.
»Ohhh.«
»Am Ende denken die, ich hätte vor Strafdienstbeginn noch schnell jemanden umgebracht.« Verärgert stopfte sie ihren Strafbefehl wieder in den Briefumschlag, wobei er mehrfach verknickte. Raven schnaubte. Papier.
»Strafdienst«, murmelte Spencer nachdenklich. »Davon habe ich noch nie gehört.«
»Ich auch nicht.« Raven steckte den Umschlag in ihren Rucksack. »Ist neu.«
»Scheiße Mann, was machen wir denn jetzt? Musstest du unbedingt …?«
Raven schnitt ihm das Wort ab. Sie hatte genug. Genug Blut für eine Nacht, genug gehört und genug gesagt. Und sowieso hatte sie schon genug Vorwürfe, dass es für ein ganzes Leben reichte. Wieso mussten Menschen überhaupt so viel reden?
»Spencer, halt die Klappe!«, sagte sie scharf, und Spencer klappte tatsächlich den Mund zu. Manchmal fragte sie sich, ob sie nur mit ihm zusammen war, weil er so wenig Probleme machte. Okay, vielleicht auch, weil sie sein Studio brauchte und weil er recht nützlich im Umgang mit den Kunden war. Auf den ganzen Rest könnte sie getrost verzichten.
Sie kniff sich in die Nasenwurzel.
»Ich bin müde, okay? Ich habe gerade zwei Kniegelenke eingesetzt. Das hat über sechs Stunden gedauert, ich habe noch nicht geschlafen, und morgen früh muss ich im Käfig antanzen. Tu mir also einen Gefallen und lass mich für eine Sekunde in Ruhe.«
Er stand da und starrte sie an, ganz offensichtlich unsicher, wie er reagieren sollte. Sein Mienenspiel war ein offenes Buch. Erst wollte er zu einem neuerlichen Streit ansetzen. Dann ließ er es aber doch bleiben. Gut.
»Das betrifft mich genauso wie dich, Rave«, sagte Spencer resigniert. »Wir haben einen Haufen Kunden in nächster Zeit. Wie sollen wir das denn alles schaffen?«
Raven fühlte, wie die Wut aus ihr wich, als hätte jemand den Stöpsel gezogen.
»Ich habe keine Ahnung. Nachts arbeiten?«
Er kratzte sich am Kopf. »Ich kann meine Kunden auf den späten Nachmittag legen und tagsüber schlafen.«
Raven nickte. »Ja, das wäre gut.«
»Und wann schläfst du?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Wenn ich tot bin?«
»Sehr witzig.«
Raven griff nach ihrer alten Lederjacke und schlüpfte hinein. Für ihre Begriffe hatte sie heute schon viel zu viel gesagt. Sie wollte nicht mehr reden. Schon gar nicht mit Spencer.
»Schau mich nicht so an. Ich habe keine Antworten für dich, Spencer. Manchmal ist das Leben einfach richtig scheiße, aber wir können es nicht ändern, okay?«
Spencer nickte knapp. »Aber du könntest wenigstens sagen, dass es dir leidtut. Immerhin hast du uns da reingeritten.«
Das wollte sie sich jetzt nicht auch noch anhören. Sie schulterte ihren Rucksack, kontrollierte, ob sie ihren Schlüsselbund und ihre Karten dabeihatte, und ging wortlos an Spencer vorbei bis zur Tür.
»Wo willst du denn jetzt hin?«
»Ich gehe rüber«, sagte sie knapp. »Wir sehen uns morgen Abend.«
Ihre Hand lag schon auf der Türklinke. Es war eine von denen, die sie so sehr mochte. Uralt und von den vielen Händen, die sie gedrückt hatten, blank poliert. Die Ränder der glänzenden Messingfläche waren jedoch pechschwarz. Raven wusste, dass es nicht Spencers Schuld war. Aber es war eigentlich nie seine Schuld. Weil er auch nie etwas tat, das irgendwie relevant war. Wer nichts macht, macht nichts falsch. Wer hatte das noch mal gesagt?
Und genau deswegen ertrug sie ihn jetzt nicht mehr. Ohne ein weiteres Wort zu sagen, drückte sie die Klinke hinunter und verschwand im Treppenhaus.
Was sie jetzt brauchte, war kein sinnloser Streit. Sie brauchte Zeit für sich. Ihre Freunde Nina, Lin, die von allen nur »little Cat« genannt wurde, und den stummen Cristobal. Vielleicht ein kleines Tütchen oder ein bisschen Meth. Auszeit für den Kopf.
Raven umrundete das große Gebäude, das sie immer ein wenig an das Kolosseum in Rom erinnerte. Wie sie Eugene und Mikael kannte, war das volle Absicht. Im Gegensatz zu seinem antiken Vorbild hatte das Gardens jedoch keine richtigen Fenster. Die großen, gebogenen Vertiefungen ließen den Club in verschiedenen Farben leuchten, die jeder Stammgast deuten konnte. Heute erstrahlte das Gebäude in leuchtendem Grün und Pink. Es war Dschungelnacht. Sehr gut. »Dreams of Asia« war das einzige Motto, das ihr noch ein bisschen lieber war. Raven hatte eine ausgeprägte Schwäche für Sushi.
Sie hastete durch den einsetzenden Nieselregen über die glitschigen Pflastersteine, vorbei an ein paar Gästen, die den Club gerade mit dem typischen verklärten Gesichtsausdruck von Menschen verließen, die eine ungeheuerliche Reise hinter sich hatten. Aus dem Augenwinkel bemerkte sie einen hochgewachsenen Mann in elegantem Anzug, der schnellen Schrittes auf eine wartende schwarze Limousine zuging. Als er den Lichtkegel einer Straßenlaterne passierte, glänzten die goldblonden Locken, die den Kopf wie einen Heiligenschein umrahmten. Othello Sander. Raven schmunzelte. Dann hatte Nina also nicht geblufft. Sie hatte sich tatsächlich den Medizinmagnaten geangelt. Und wieder einmal war Raven froh, dass nicht einmal ihre Freunde wussten, wer sie wirklich war. Alle im Gardens, Eugene und Mikael eingeschlossen, dachten, dass Raven die Einzige war, die mit Dark kommunizieren konnte. Die Mittelsfrau zwischen dem Club und dem legendären Modder. Was zu gleichen Teilen wahr und gelogen war.
Der Mitarbeitereingang war von außen fast nicht zu erkennen. Er verriet sich nur dadurch, dass links oder rechts davon eigentlich immer jemand aus der Küche stand und rauchte oder aufgebracht telefonierte. Die unscheinbare Metalltür daneben war wie der Kaninchenbau aus Alice im Wunderland, der die eine Welt mit der anderen verband.
Der Typ, der heute neben der Tür stand und rauchte, kam ihr nicht bekannt vor. Hellrote Haare und Sommersprossen, etwas untersetzt und mit einem offenen, fast fröhlichen Gesicht. Was machte einer wie der hier? Sie konnte das Poloshirt unter seiner Kochjacke ja förmlich riechen. Sein Kurzhaarschnitt sah viel zu teuer aus, die Hände wirkten, als hätte er sich noch nie geprügelt. Raven runzelte die Stirn. Alles an ihm sah nach Geld und Frischling aus. Meistens mochte Raven Frischlinge nicht, weil sie entweder dachten, dass sie es besser machen würden als alle anderen, oder schon von Anfang an resigniert waren, weil irgendwas Schlimmes sie in den Backstagebereich des Clubs gespült hatte.
Als sie sich ihm näherte, lächelte der Typ sogar. Raven rollte mit den Augen. Kurz war sie versucht, ihn zu fragen, wer er war und was zur Hölle er hier zu suchen hatte. Doch dann ließ sie es bleiben und schlüpfte durch die Tür. Er fragte sie noch nicht einmal, wer sie war, oder versuchte, sie am Betreten des Clubs zu hindern. Pussy. Sie gab ihm eine Woche.
Immer wenn Raven durch die Küche ging, kam sie sich vor wie in einem der alten Actionfilme. Sie hatte es schon so oft getan, dass sich eine regelrechte Choreografie etabliert hatte. Und die begann mit »Hey, Raven!« aus Billys Mund. Drei, zwei …
»Hey Raven!« Raven lächelte, denn wenn sie überhaupt noch für irgendjemanden ein Lächeln übrig hatte, dann für Billy. Sie hüpfte über die Getränkekisten, die im Weg herumstanden, wich dem nassen Handtuch aus, mit dem Roberta nach ihr schlug, fing den Apfel auf, den Billy ihr zuwarf. Versicherte, dass es ihr gut ging, und versprach, nachher noch einmal reinzuschauen, wenn der Trubel sich gelegt hatte.
Der Trubel legte sich nie. Und Raven schaute nie noch einmal in der Küche vorbei. Aber es war ein Ritual, und irgendwie gab es ihnen allen ein gutes Gefühl. Als hätten sie es in der Hand.
Diese Küche war die Zwischenwelt. Das Fegefeuer, wenn man so wollte. Hier vermischten sich der Lärm aus dem Erdgeschoss des Gardens mit den Geräuschen von klappernden Töpfen, zischenden Pfannen und dem Geplapper des Küchenteams. Es war immer warm, es roch gut, und es wurde mehr gelacht als draußen auf der Straße oder drinnen im Club.
Raven ging immer durch die Küche, niemals durch einen der offiziellen Eingänge. Nicht weil sie demonstrieren wollte, dass sie es konnte, sondern weil die Küche für sie die Schleuse war. Eine Stahltür als Trennung zwischen ihren beiden Welten war nicht genug.
Sie kam in den Bereich, über den die Kellner herrschten. Hier war sie weniger gern gesehen als in der Küche. Die Kellner rannten in ihren Uniformen mit schweren Tabletts hin und her, stritten mit irgendjemandem herum und beschwerten sich in einer Tour. Die Worte »schon wieder«, »Gast«, »kalt«, »hatte Kaviar bestellt«, »Schwachkopf« schossen wie Schrapnelle durch die Luft. Raven hatte noch nie begriffen, warum die Kellner sich für was Besseres hielten. Sie trugen doch nur Sachen durch die Gegend, die jemand anderes zubereitet hatte. Ihre dunklen Uniformen machten sie nicht zu etwas Besonderem, egal, wie sie sich aufführten. Deshalb tat es ihr auch nicht leid, dass sie störte.
Sich an den wütenden Kellnern vorbeizudrücken war wie ein Slalom. Damit verdiente sie sich noch einmal alles, was jenseits der nächsten Tür lag. Dieser wunderbaren Schwingtür, die mit jedem wütenden Kellner auch ein wenig von der Luft und den Geräuschen des Gardens in den langen Flur vor der Küche brachte.
Hinter der all das lag, was Raven in diesem Augenblick brauchte.
Sie wusste, dass es unvernünftig war. In nur sieben Stunden musste sie am Käfig sein und ihren Strafdienst antreten. Und sie hatte noch nicht geschlafen, geschweige denn geduscht. Unter ihren Fingernägeln klebte Joshs eingetrocknetes Blut. Ein Jahr. Ein gottverschissenes Jahr bei der Berliner Polizei. Sie wollte schreien, wenn sie nur daran dachte. Also dachte sie nicht mehr daran.
Denn das war erst morgen. Jetzt war jetzt.
Er lief jeden Tag zur Arbeit. Obwohl »rennen« es viel besser traf. Den ganzen Weg von seiner Wohnung im Wedding bis zum Käfig am Alexanderplatz – einmal quer durch die Mitte von Altberlin. Er rannte durch die Spuren der vergangenen Nacht, die zu so früher Stunde noch nicht vom Wind oder den Kollegen der Sitte weggeschafft worden waren.