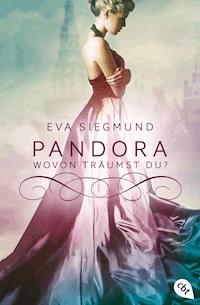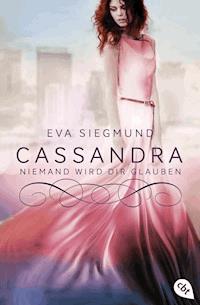
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: cbt
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Pandora-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Was tust du, wenn du alles verlierst?
Nachdem Liz und Sophie dem Sandmann entkommen sind, arbeitet Liz als Blog-Jounalistin bei
Pandoras Wächter. Nach einem kritischen Artikel über die Abschaffung des Bargelds wird sie verhaftet – sie soll den Chef der NeuroLink AG getötet haben. Alle Beweise sprechen gegen sie – aber ist sie wirklich eine Mörderin? Als Liz verurteilt und aus Berlin verbannt wird, bleibt ihre Schwester Sophie in der Stadt zurück. Nun ist es an ihr, die Wahrheit herauszufinden, doch bald ist auch Sophie in Berlin nicht mehr sicher.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 602
Ähnliche
DIE AUTORIN
Foto: © Random House/Isabelle Grubert
Eva Siegmund, geboren 1983 im Taunus, stellte ihr schriftstellerisches Talent bereits in der 6. Klasse bei einem Kurzgeschichtenwettbewerb unter Beweis. Nach dem Abitur entschied sie sich zunächst für eine Ausbildung zur Kirchenmalerin und studierte dann Jura an der FU Berlin. Nachdem sie im Lektorat eines Berliner Hörverlags gearbeitet hat, lebt sie heute als Autorin an immer anderen Orten, um Stoff für ihre Geschichten zu sammeln.
Mehr zur Autorin auch auf www.evasiegmund.de und Instagram @eva_siegmund_schreibt.
Von Eva Siegmund ist bei cbt bisher erschienen:
LÚM – Zwei wie Licht und Dunkel
PANDORA – Wovon träumst du?
Mehr zu cbt auf Instagram @hey_reader.
EVA SIEGMUND
CASSANDRA
Niemand wird dir glauben
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe Dezember 2017
© 2017 by Eva Siegmund
Dieses Werk wurde vermittelt durch die AVA international GmbH Autoren- und Verlagsagentur, Münchenwww.ava-international.de
© 2017 by cbt Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: Carolin Liepins
unter Verwendung verschiedener Motive von © Shutterstock (shanghainese, Soleiko, Dimitry A, Razoom Game, MAKSYM VLASENKO)
MI · Herstellung: eS
Satz: Kompetenzcenter, Mönchengladbach
ISBN: 978-3-641-21362-6V004
www.cbt-buecher.de
Pandoras Wächter I
Mein Sparschwein – Nachruf auf ein unterschätztes Tier
An meinem fünften Geburtstag schenkte mein Vater mir ein Sparschwein. Es war blau und riesengroß mit einer roten Schleife; ein paar Münzen klapperten verheißungsvoll im Inneren herum. Mein Vater erklärte mir, dass dieses Schwein nur für mein Geld da sei. Dass es alles, was ich durch den schmalen Schlitz hineinsteckte, behüten würde. Dass ich mir, wenn ich fleißig sparte, irgendwann tolle Dinge von meinem eigenen Geld würde kaufen können. Und dass ich – und nur ich allein – über das Geld im Inneren dieses Sparschweins verfügen konnte. Ich begriff: Das Sparschwein verhinderte, dass jemand anderes mir das Geld wegnahm. Ich habe es meine gesamte Kindheit über fröhlich und in dem Wissen gefüllt, dass es etwas gibt, das nur mir allein gehört. Es hat sich gut angefühlt.
Heute ist ein schwarzer Tag, denn heute ist mein Sparschwein gestorben. Und es ist nicht einfach so gestorben – es wurde ermordet. Nein, ich habe es nicht mit einem Hammer zerschlagen, weil ich den Schlüssel verloren habe oder weil ich zu alt für Sparschweine geworden bin. Mein Sparschwein musste sterben, weil es keinen Nutzen mehr hat. Und nicht nur mein Sparschwein, sondern alle Sparschweine Europas sind heute aus demselben Grund gestorben. Denn es gibt keine Münzen und keine Scheine mehr, mit denen man sie füllen könnte. In wenigen Jahren werden sich die Menschen kaum mehr daran erinnern, dass es jemals so etwas wie Sparschweine gab.
Und warum? Weil heute um Mitternacht die große europäische Währungsreform in Kraft getreten ist. Wer gestern noch mit den Münzen in seinem Geldbeutel das Brot beim Bäcker bezahlt hat, bekommt dafür heute nicht einmal mehr ein paar trockene Krümel. Wer sein Bargeld nicht ausgegeben oder zur Bank getragen hat, der hat Pech gehabt. Ab heute gelten die EZEs, die ›Europäischen Zahlungseinheiten‹. Und entschuldigt die Wortwahl, aber: Ich finde es zum Kotzen.
Es war schön, Geld in der Hand zu haben, es fühlen und zählen zu können. Nicht ohne Grund lernen Kinder den Umgang mit Geld mithilfe von Münzen und Scheinen aus Plastik. Geld ist eine verrückte, schwer zu erklärende Sache – Bargeld hat diese Sache für mich immer greifbarer gemacht. Und Bargeld bedeutet Freiheit – etwas, das ich in dieser Stadt, in Europa generell immer mehr vermisse. Und das macht mir nicht nur Angst, es macht mich auch stinksauer.
Es war großartig zu wissen, dass das, was ich erarbeitet habe, nur mir alleine gehört. Natürlich habe ich die letzten Jahre meist mit Kreditkarte gezahlt so wie alle anderen auch, aber dennoch hat mich der Gedanke beruhigt, dass ich jederzeit das ganze Geld von meinem Konto abheben und etwas Verrücktes damit anstellen könnte. Das geht jetzt nicht mehr. Befürworter sagen, die Reform schiebe illegalem Drogen- und Waffenhandel genauso einen Riegel vor wie der Geldwäsche. Auch unterbinde man damit die Entführungen von Kindern aus reichen Familien, ebenso wie von Transportschiffen vor den Küsten Afrikas. Terroristischen Vereinigungen werde es schwer gemacht, sich in Europa unbemerkt zu bewegen – natürlich das Totschlagargument schlechthin. Es muss nur einer kommen und laut genug ›Terrorismusbekämpfung‹ schreien und schon geben alle bereitwillig ihre Bürgerrechte an der Garderobe ab. Soll ich euch was sagen? Ich fühle mich stärker von den Politikern terrorisiert, die ›Terrorismus‹ sagen und dabei die Augenbrauen mahnend gen Himmel ziehen, als von Terroristen selbst.
Alles würde mit den Zahlungseinheiten sicherer, so heißt es, weil es ohne Bargeld keine anonymen Konten und keine anonymen Kontobewegungen mehr gibt. Und auch keine Geldkoffer mehr, die unbemerkt den Besitzer wechseln können. So viele Gangsterfilme sind nun mit einem Schlag veraltet. Aber das ist es nicht, was mich daran stört.
Natürlich ist Verbrechensbekämpfung eine gute Sache, aber ich unterstelle, dass sie nicht die Hauptmotivation für diese Reform war. Wie immer geht es eigentlich um Macht und Kontrolle. Den Entscheidungsträgern ist es nicht so wichtig, potenzielle Verbrecher und Terroristen zu kontrollieren, sondern es geht ihnen vielmehr darum, uns zu kontrollieren. Alles, was wir nun kaufen, wird genauso gespeichert werden wie Informationen darüber, wann und wo wir es kaufen. Unser Kontostand wird potenziellen Arbeitgebern und Vermietern genauso zur Verfügung gestellt werden wie Fremdbanken, die wir um Kredite bitten. Davon bin ich fest überzeugt. Von unseren wertvollen Kaufdaten will ich gar nicht erst anfangen.
Wir haben ein großes Stück unserer persönlichen Freiheit verloren – die meisten sogar, ohne es überhaupt zu bemerken.
Nicht das erste Mal in den letzten zwölf Monaten übrigens. Ja, ich rede von der ›Anti-Terror-Schutzzone‹. Warum habe ich nur das Gefühl, wir Wächter sind die Einzigen, denen es merkwürdig vorkommt, Berlin komplett einzuzäunen? Habt ihr denn alle kein historisches Gedächtnis?
Die Leute sagen: »Was ist so schlimm daran? Es ist doch nur zu unserem Schutz! Und im Gegensatz zu den Bürgern der DDR können wir jederzeit raus!«
Muss ich wirklich daran erinnern, dass die Bürger der DDR zu Beginn auch ›jederzeit rauskonnten‹, bis es irgendwann nicht mehr ging?
Muss ich wirklich erklären, was passieren kann, wenn das eigene Geld nur noch virtuell existiert, jede Zahlung aufgezeichnet wird und ein simpler Hack, ein simples Computervirus in Sekundenschnelle alles vernichten kann, wofür man gearbeitet hat?
Und darf ich euch daran erinnern, dass NeuroLink vor nicht allzu langer Zeit wegen des Skandals um sein Vorzeigeprodukt, den SmartPort, ziemlich in Verruf geraten ist und die meisten von uns sich infolgedessen den Internetchip wieder aus dem Kopf haben entfernen lassen?
Und jetzt?
Wer stellt die Scanner her, mit denen wir uns zukünftig ausweisen und bezahlen werden? Wer hat all unsere Fingerabdrücke, unsere Kontodaten, Kontostände und weiß, wann wir zuletzt welche Tamponmarke gekauft haben? Wer produziert die Wachdrohnen, wer bezahlt das Wachpersonal? Zu wem gehört die private Sicherheitsfirma, die in Berlin beinahe alles kontrolliert? Welches Unternehmen ist spezialisiert auf personalisierte Werbung?
Richtig. Die Antwort auf all diese Fragen lautet: NeuroLink.
Was ist falsch daran, das falsch zu finden?
Uns Wächtern wird manchmal vorgeworfen, dass wir Gespenster sehen, doch das hier sind keine Gespenster. Es sind ganz reale Gefahren. Die freiheitlichen Werte, die demokratische Grundordnung und die Rechtssicherheit – alles Dinge, die Europa einmal ausgemacht haben, hocken mit mir in einer dreckigen Ecke auf dem Boden und heulen. Doch ich will nicht untätig herumsitzen und darauf warten, dass man mir noch das letzte bisschen Freiheit wegnimmt. Ich will nicht wegsehen, nur um hinterher sagen zu können, dass ich ›das alles nicht gewusst‹ habe. Ich will mir selbst ins Gesicht sehen können.
Deswegen werde ich nicht aufhören, meine Finger in die Wunden unserer Gesellschaft zu legen. Ich werde auch weiter Geheimnisse haben und diese gegen alles und jeden verteidigen.
Ich werde wühlen, fragen, mich nicht einschüchtern lassen. Und wenn etwas schiefläuft, dann sorge ich dafür, dass ihr es als Erste erfahrt. Ich bin eure Augen, ich bin eure Ohren, und wenn es sein muss, dann bin ich auch euer Gehirn. Einer muss den Job ja machen.
Hochachtungsvoll,
Watchdog Taylor
Aus den Archiven von ›Pandoras Wächter‹
News of Berlin
Zum Inkrafttreten der Währungsreform
Für Taschendiebe ist heute ein trauriger Tag, denn in Zukunft werden sie sich ein neues Betätigungsfeld suchen müssen. Nachdem die Mitglieder der Europäischen Union vor sechs Monaten beschlossen haben, das Bargeld im gesamten Euro-Raum abzuschaffen, endet heute die Übergangsfrist. Unsere Währung ist somit in der Zukunft angekommen, ab heute gelten die europäischen Zahlungseinheiten, kurz EZEs genannt. Zum reibungslosen Ablauf der Zahlungen hat die Firma NeuroLink alle Geschäfte, mobilen Anbieter und Behörden kostengünstig mit Daumenscannern ausgestattet. Der Transfer der Daumendaten aller deutschen Staatsbürger auf den Server des Konzerns wurde von den Bürgerämtern durchgeführt und dank der Hilfe eines eigens bei NeuroLink eingerichteten mobilen Teams funktionierte auch bei dieser Umstellung alles wie am Schnürchen.
Die Zeiten, in denen wir im strömenden Regen zum nächstbesten Bankautomaten rennen mussten, zwecks Sperrung unserer geklauten Kreditkarte in der telefonischen Warteschlange unserer Hausbank festhingen und in denen Koffer mit Bargeld ihre zwielichtigen Besitzer wechselten, gehören nun endgültig der Vergangenheit an. Die Währungsreform macht es nahezu unmöglich, mit fremdem Geld zu bezahlen oder Schwarzgeldkonten einzurichten. So will Europa auch die Finanzierung von Terrorismus auf europäischem Boden erschweren bzw. unmöglich machen. Es wird sich bald herausstellen, ob diese Strategie Wirkung zeigt.
Sollten Sie noch Bargeld in Ihrer Wohnung oder in der Wohnung von Verwandten finden, so können Sie dieses nach vorheriger Anmeldung in der Zentralbank am Alexanderplatz innerhalb eines Jahres in Zahleinheiten umwandeln lassen.
Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie hier.
LIZ
Ich legte den Kopf auf meine Schreibtischplatte und atmete tief durch. Schon wieder einer dieser verrückten Tage in Berlin, von denen es in letzter Zeit mehr und mehr gab. Seitdem meine Schwester Sophie und ich in den Skandal um die Firma NeuroLink verwickelt gewesen waren, gab es in meinem Leben eigentlich keine normalen Tage mehr. Und so langsam ging mir das gewaltig auf die Nerven.
Nicht nur, dass die Politik verrücktspielte. Erst hatte man die Großstädte des vom Terrorismus gebeutelten Europas eingezäunt, Sicherheitsschleusen und Kontrollpunkte eingerichtet, anschließend war das Bargeld abgeschafft worden. Und kurz darauf hatten sie die Strafrechtsreform in Deutschland beschlossen, die in wenigen Tagen in Kraft treten würde. Eine Eilklage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte war heute gescheitert, nun war es unausweichlich.
Verbrecher wurden nicht mehr durchgefüttert, sondern einfach vor die Tür gesetzt – oder besser: vor die Stadt. Die Konten der Betreffenden wurden gelöscht und man konnte sehen, wo man blieb. Das würde Geld in die klammen Kassen spülen und man musste sich weder personell noch finanziell mit dem Abschaum der Gesellschaft beschäftigen. Alles in allem eine saubere Lösung, fanden viele.
Ich war natürlich, wie immer, dagegen und wollte heute als Erstes einen wütenden Artikel über die Reform für unseren Blog schreiben, doch ich konnte mich einfach nicht dazu aufraffen. Obwohl ich die Reform schrecklich und unmoralisch fand, kreisten meine Gedanken um etwas völlig anderes.
Vor mir auf dem Tisch stand mein Laptop. Wie jeden Morgen hatte ich mich bei meiner Ankunft in der Redaktion in unsere Redaktionscloud eingeloggt und meine Mails abgerufen. Es waren viele an diesem Mittwochmorgen, die meisten drehten sich um die Strafrechtsreform, obwohl natürlich die obligatorischen Morddrohungen und Liebesbriefe irgendwelcher Querköpfe auch nicht fehlen durften. Ich hätte nie für möglich gehalten, wie viele Typen sich die Mühe machten, einer anonymen Reporterin zu schreiben. Aber scheinbar war mein Deckname Anreiz für die wildesten Fantasien. Manchmal schickten die Männer sogar Fotos ihrer intimsten Teile. Alleine beim Gedanken daran rollten sich mir die Zehennägel hoch. Die meisten der Mails löschte ich, ohne sie genauer durchzulesen.
Doch eine Nachricht war mir an diesem Tag sofort ins Auge gesprungen und hatte mein Gehirn beinahe lahmgelegt. Denn der Absender war niemand Geringeres als Harald Winter, Vorstandsvorsitzender und Altvorderer von NeuroLink höchstpersönlich. Der alte Mann im silbernen Turm, der in unserer Redaktion nur ›Sauron‹ genannt wurde. Einer der reichsten und wichtigsten Menschen der Stadt und mein weißbärtiges fleischgewordenes Feindbild. Tag für Tag setzte ich mich für Datenschutz und Bürgerrechte ein – beides Dinge, die Winter mit Füßen trat und dafür sehr viel Geld kassierte. Es gab wohl kaum einen Konzern, der das Leben der Menschen so dramatisch verändert hatte wie NeuroLink. Und es gab wohl niemanden, der so verbissen gegen diese Firma anschrieb wie Pandoras Wächter und allen voran ich selbst.
Wir kämpften an zwei verschiedenen, völlig verhärteten Fronten und ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass Winter mir einmal persönlich schreiben würde. Und der Grund seiner Mail erst! Der Technikmogul bot mir ein Exklusivinterview über die Arbeit von NeuroLink und sein Lebenswerk an. Winter schrieb, dass es ein ganz bewusster Schritt sei, das Interview mir und niemand anderem anzubieten, da er auch für ›eine gewisse Kompensation‹ dessen sorgen wolle, was ›mir und meiner Familie widerfahren‹ sei. Er schlug für das Interview die große Jubiläumsfeier der Firma am Samstag vor und zwischen den Zeilen war deutlich herauszulesen, dass dieser Termin meine einzige Chance war. Er wollte das Interview auf seinem Hoheitsgebiet geben, in einem Moment, in dem das Unternehmen auf Hochglanz poliert sein würde. Ausgerechnet! Alleine deswegen fühlte ich einen heftigen Widerwillen gegen die ganze Sache. Ich hatte das merkwürdige Gefühl, ausgenutzt zu werden, als größter Triumph vorgeführt – das bockige Kind, das am Ende doch noch Einsicht zeigt.
Im Anhang der Nachricht fand ich eine Einladungskarte mit QR-Code. Der Code führte auf eine Seite, auf der ich meinen Daumenabdruck für den Zugang zur Party hochladen konnte – der Upload würde als Zusage gewertet, schrieb Winter. Beinahe hätte ich aufgelacht. Diese Einladung war so typisch NeuroLink, dass es beinahe wie eine Parodie wirkte. Und Ausdruck all dessen, was ich an dieser Firma so hasste. Augenblicklich überfiel mich ein gewaltiger Kopfschmerz.
Es klopfte und im nächsten Moment flog die Tür zu meinem Büro auf.
»Himmel, wie oft habe ich dir gesagt, dass Anklopfen nur etwas bringt, wenn man anschließend auch wartet, bis man hereingebeten wird!«, schimpfte ich.
»Tschuldigung, Lizzie«, sagte Marek und schenkte mir sein vertrautes schiefes Grinsen.
Wie jeden Morgen versetzte mir auch heute sein Anblick wieder einen Stich. Unser Chefredakteur stand in meinem Büro und sah mit seinen türkisblauen Augen, dem unschuldigen Blick und den strubbeligen blonden Locken wie immer aus, als sei er kurz davor, sich auf ein Surfbrett zu schwingen. Die coole Unbekümmertheit, die ich am Anfang so anziehend gefunden hatte, machte mich mittlerweile beinahe nur noch wütend. Warum nur hatte er immer so unerschütterlich gute Laune? Es gab dafür nicht den geringsten Grund, denn eigentlich ging alles den Bach runter. Natürlich wusste ich, dass er überhaupt nichts dafürkonnte. Ich war es, die sich verändert hatte – mein Leben war düsterer und komplizierter geworden. Genau wie mein Gemüt.
Seit dem Tod meiner Eltern vor drei Monaten hielt ich Marek auf Abstand. Streng genommen waren wir nie offiziell zusammen gewesen, also musste ich auch nicht Schluss machen, aber jeder hatte uns als Paar begriffen. Marek inklusive. Ich wusste, dass er verrückt nach mir war und ich mich ihm gegenüber schrecklich verhielt. Und ich … ich hatte nicht die Kraft, mich anständig von ihm zu trennen, und ließ ihn warten. Natürlich wusste ich, dass das nicht fair war. Aber mich interessierte momentan nur, dass die Arbeit der einzige Weg war, dem Schmerz davonzulaufen.
Da mir klar war, dass all das nicht Mareks Schuld war, rang ich mir ein Lächeln ab. »Ist schon gut«, sagte ich. »Jetzt bist du ja drin. Was gibt’s denn?«
Marek schloss die Tür und setzte sich auf die Lehne meines Besucherstuhls. Das machte er immer so. Er setzte sich nie auf die Sitzfläche.
»Verfluchter Mist mit der Strafrechtsreform!«, sagte er. »Das hätte niemals durchgehen dürfen.«
»Hmmm …« Ich nickte und Marek runzelte die Stirn.
»Was ist denn mit dir los? Die letzten Wochen hast du über nichts anderes gesprochen. Du musst doch rasend vor Wut sein!«
»Bin ich auch«, sagte ich, doch selbst in meinen Ohren klang das ziemlich lahm. Marek horchte auf.
»Ist etwas passiert?«, fragte er und gab sich alle Mühe, nicht alarmiert zu klingen.
Anstelle einer Antwort drehte ich meinen Laptop so, dass er die E-Mail von Harald Winter lesen konnte. Er pfiff durch die Zähne. »Donnerwetter. Wo kommt denn das jetzt auf einmal her?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich habe keine Ahnung. Vielleicht packt ihn auf die alten Tage doch noch sein Gewissen?«
Marek kratzte sich am Kinn. »Vielleicht. Liz, das könnte eine verdammt fette Story werden. Am Ende rückt er noch mit irgendwas raus!«
Das war tatsächlich kein abwegiger Gedanke. »Ja, ich habe gehört, dieser Claudius sägt kräftig an seinem Stuhl. Vielleicht will er mir etwas über seinen Technikchef erzählen. Wenn schmutzige Details auf unserer Webseite verbreitet werden, dann hat er genau das richtige Zielpublikum erreicht. Es ist immerhin schon recht merkwürdig, dass Winter mich um ein Interview bittet, nachdem ich NeuroLink seit knapp zwei Jahren für jede Stellungnahme wochenlang hinterherrennen muss.«
Es klopfte erneut und Sash stand in der Tür. Er sah wahnsinnig schlecht aus. Dunkle Ringe unter den Augen verrieten, dass er seit Wochen nicht mehr richtig geschlafen hatte, seine Haut war noch blasser als sonst und seine eigentlich enge Jeans hing an seinem Körper wie ein übergroßer blauer Müllsack. Es sah aus, als hätte er keinen Hintern mehr. Gegen das, was Sash und Sophie während ihrer Trennung durchgemacht hatten, war das mit Marek und mir der reinste Spaziergang. Sie hatten einander nicht geschont, während ich mich so gut es ging aus der Sache rausgehalten hatte. Sash war immer noch mein Freund und Arbeitskollege. Nur war er mittlerweile eben auch der Exfreund meiner Schwester. Die Zwillinge Karweiler / Kirsch hatten momentan kein Glück in der Liebe.
»Hey. Was ist denn hier los?«, fragte Sash und Marek grinste seinen besten Freund an.
»Rate mal.«
»Was denn?«, Sash zog eine Augenbraue nach oben.
»Harald Winter gibt Liz ein exklusives Interview.«
»Ist nicht dein Ernst!«, rief Sash aus und das erste Mal seit Wochen sah ich das vertraute aufgeregte Funkeln in seinen Augen.
»Moment, Moment«, schaltete ich mich ein und die Jungs sahen mich leicht verwirrt und erwartungsvoll an.
»Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich zusagen werde«, sagte ich.
»Machst du Witze?« Marek sprang von der Stuhllehne auf und brachte damit das Möbelstück ins Wanken.
»Das kannst du nicht machen, Liz«, pflichtete Sash ihm bei. »Was auch immer dahintersteckt, es könnte eine Riesenchance sein. So eine kommt nicht wieder.«
Ich atmete tief durch. Die beiden hatten recht. Obwohl sich alles in mir sträubte, mit diesem Mann zu reden, würde ich zusagen müssen. Zwar hatte mir Harald Winter im Gegensatz zum Sandmann nie persönlich etwas zuleide getan, dennoch war er in meinen Augen genauso verantwortlich für das, was mir und meiner Familie widerfahren war, wie der verrückte Wissenschaftler. Nun, vielleicht wollte er mir ja erklären, welche Rolle er selbst damals bei der ganzen Sache gespielt hatte.
»Ist ja schon gut«, seufzte ich. »Ich werde hingehen.«
»Darfst du jemanden mitbringen?«, fragte Marek und die Hoffnung, die in seinen Augen stand, verursachte mir ein tonnenschweres schlechtes Gewissen.
»Nein«, antwortete ich. »Der Code ist nur für einen Upload.«
»Schade. Ich hätte zu gerne einmal das neue NeuroLink-Gebäude von innen gesehen.«
»Und ich hätte gerne darauf verzichtet«, sagte ich. »Aber die Einladung ging personalisiert an mich. Du kannst mich leider nicht vertreten.«
Marek murmelte etwas, das wie ›Ich hätte da eher an begleiten gedacht‹ klang, doch ich ignorierte es. Stattdessen lenkte ich meinen Blick demonstrativ wieder auf meinen Bildschirm. »Na gut, dann werde ich mich mal anmelden«, sagte ich, und als die beiden keine Anstalten machten, sich zu erheben, wies ich mit dem Zeigefinger in Richtung Tür. »Ihr sitzt da, als würdet ihr darauf warten, dass ich euch was vortanze. Raus mit euch, ich muss arbeiten!«
Die beiden verließen mein Büro und ich atmete tief durch. Angst stieg in mir hoch bei dem Gedanken, auch nur das Gelände von NeuroLink wieder betreten zu müssen. Die Ereignisse der letzten zwölf Monate, so furchtbar und aufwühlend sie auch gewesen waren, hatten mir zumindest dabei geholfen, meine Familiengeschichte zu verdrängen. Den Mord an meiner Mutter, den Tod meines Vaters und das Abenteuer, das meine Schwester Sophie und mich um ein Haar ebenfalls das Leben gekostet hätte. Nun kam alles wieder hoch. Die Nachricht von Harald Winter hatte die Erinnerungen hervorgewühlt, wie ein Sturm, der Treibholz an die Küste schleudert.
Doch Marek und Sash hatten recht – zu solch einem Angebot konnte man nicht Nein sagen. Ich war mittlerweile eine angesehene Independent-Journalistin, meine Artikel wurden tausendfach geklickt. Solche Interviews waren Teil meiner Arbeit.
Also atmete ich noch einmal tief durch und lud meinen Fingerabdruck in die verschlüsselte Cloud des Unternehmens hoch.
News of Berlin
Die Revolution geht weiter.
Klage vor dem EuCHR gescheitert.
In den letzten fünfzehn Jahren hat sich Europa enorm verändert, das ist längst kein Geheimnis mehr. Und Deutschland war an dieser Entwicklung immer als starker Partner und Ideengeber, als treibende Kraft und verlässlicher Nachbar beteiligt. Unser Land war federführend beim Entwurf der Währungsreform und Vorreiter in Sachen Safe-City-Project. Doch die Errichtung der sicheren Städtezonen ist nicht spurlos an uns vorübergegangen. Unser einst so reiches Land steckt in finanziellen Schwierigkeiten und besonders die Megacity Berlin ist von dem Geldmangel betroffen, hat die Schutzzone um unsere Stadt doch die meisten Gelder verschlungen. Daher wurden bereits in der Vergangenheit Stimmen laut, die forderten, sich das Geld von denjenigen zurückzuholen, die Schutzzonen überhaupt erst notwendig gemacht haben: von Terroristen und Verbrechern.
Die Diskussion wurde erneut angestoßen von Helmfried Winkler, dem Fraktionsvorsitzenden der Zukunftspartei ZFD im Deutschen Bundestag. Winkler forderte die Wiedereinführung der Todesstrafe, mit dem Argument, dass man ›schändliche Subjekte‹ nicht auch noch ›durchfüttern‹ dürfe.
Die nach der gescheiterten Klage der linken Bundestagsfraktionen vor dem EuCHR heute in Kraft tretende Strafrechtsreform geht dem Hardliner Winkler zwar nicht weit genug, führt aber dennoch zu einschneidenden und weitreichenden Veränderungen.
Die Folgen der Reform fassen wir nun so kurz und knapp wie möglich für Sie zusammen:
1. Die Justizvollzugsanstalten der Städte werden am kommenden Freitag geräumt und Häftlinge, die wegen eines Kapitalverbrechens einsitzen, werden mit Bussen vor die Tore der Safe-City-Zones gebracht. Aus diesem Grund fahren an diesem Tag keine Busse der Berliner Verkehrsgesellschaften. Den Ersatzfahrplan werden wir rechtzeitig veröffentlichen. Häftlinge, die wegen weniger schweren Verbrechen und Vergehen einsitzen, haben hingegen Glück. Ihre restliche Freiheitsstrafe wird in eine Geldstrafe umgewandelt, sie werden mit Fußfesseln ausgestattet und dürfen sich die nächsten zwölf Monate in unserer Gesellschaft bewähren. Als einzige Haftmöglichkeiten verbleiben das Untersuchungsgefängnis und die Gefängniszellen an den Flughäfen.
2. Das Sanktionssystem wird vollständig von Freiheitsstrafe in Geldstrafe umgewandelt, mit der Möglichkeit des kompletten Kontoentzugs und Ausweisung aus einer Safe-City-Zone. Mit Exil geahndet werden unter anderem Mord, Vergewaltigung, schwere Körperverletzung, Bildung einer terroristischen Vereinigung, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie Freiheitsberaubung. Der komplette Strafkatalog steht auf der Webseite des Bundesjustizministeriums für Sie bereit.
3. Die ehemaligen Haftanstalten werden zu Sozialwohnungen umgebaut, die entsprechenden Pläne liegen vor. Die Justizreform sieht vor, die Sanktionsgelder sowohl in die Haushaltssanierung als auch in die Verstärkung der Sicherheit zu investieren. Ein Teil wird auch für den Umbau der JVA-Gebäude verwendet. Das Jugendgefängnis Plötzensee bleibt als Museumsgefängnis bestehen.
4. Für zusätzliche Sicherheit vor den außerhalb der Safe-City-Zones lebenden Verbrechern sorgen eine Fünf-Kilometer-Zone, die von den Verurteilten nicht betreten werden darf, ein Geschwader aus Wachdrohnen vom Typ SafetyWatch sowie die Aufstockung des gut geschulten Wachpersonals an den Außengrenzen unserer Städte.
5. Die Mitarbeiter der JVAs werden zu diesem Zweck zum großen Teil von der Security-Firma SafeSquad übernommen. Mitarbeiter, die das 60. Lebensjahr erreicht oder überschritten haben, erhalten eine der neu entstehenden Sozialwohnungen sowie eine Rente.
Ein Häftling kostet den Staat satte 40000 EZEs im Jahr – davon können zwei berentete JVA-Beamte gut leben.
Der Bundesminister für Justiz und Sicherheit wird heute Abend um 20.00 Uhr eine Pressekonferenz zum Thema abhalten. Den Stream zur Pressekonferenz können Sie ab 19.45 Uhr hier aufrufen.
SOPHIE
Es war bereits drei Uhr nachts, aber ich konnte einfach nicht einschlafen. So erging es mir in letzter Zeit öfter, wenn Liz ohne mich spät abends unterwegs war.
Seitdem ihre Adoptiveltern Leopold und Carlotta bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen waren, hatte sich Liz immer weiter von uns zurückgezogen. Die meiste Zeit des Tages verbrachte sie an ihrem Schreibtisch in der Redaktion von Pandoras Wächtern – sie verschanzte sich regelrecht dahinter.
Früher war sie unheimlich gerne shoppen gegangen oder mit Ashley und Carl von Party zu Party gezogen, doch wann immer einer der beiden nun bei uns anrief oder vorbeikam, musste ich ihn vertrösten. Liz hielt selbst ihre beiden besten Freunde auf Abstand.
Meine Schwester war eine der reichsten Bürgerinnen Berlins, war in der Upperclass aufgewachsen und hatte sich früher immer nach der neusten Mode gekleidet. Doch nun interessierte sie nichts mehr davon. Manchmal fragte ich mich sogar, was sie überhaupt noch interessierte. Und weil sie immer leichtsinniger und verschlossener wurde, machte ich mir Sorgen, wenn sie so spät noch in der Stadt unterwegs war.
Heute war es besonders schlimm, immerhin war sie der Einladung zur Jubiläumsparty von NeuroLink gefolgt – ausgerechnet der Firma, gegen die Pandoras Wächter schon immer anschrieben –, sogar schon, als unsere Mutter noch für den Blog tätig gewesen war. Die Firma, in der unser leiblicher Vater gearbeitet hatte, in der seine Frau gestorben war, die mithilfe eines dunklen Verbrechers Träume manipuliert und Menschen in den Krieg geschickt hatte. Für Liz und mich war NeuroLink nichts anderes als ›das Böse‹. Mir war von Anfang an nicht wohl bei der Sache gewesen und gerade musste ich mit aller Macht dagegen ankämpfen, vor Sorge nicht verrückt zu werden.
Ich hob die Hand und streichelte Schrödinger, meinen uralten Kater, der daraufhin ein leises Brummen hören ließ. Er klang wie ein kaputter Rasenmäher. Mein hässlicher Fusselkater, so hatte ich das Gefühl, war wirklich das Einzige, was sich in den letzten beiden Jahren nicht verändert hatte. Und dafür liebte ich ihn ganz besonders.
Draußen fuhr ein Auto die Straße entlang und hielt vor unserem Haus. Ich schlich zu den bodentiefen Wohnzimmerfenstern und erreichte sie gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie Liz aus einer dunklen Limousine gestoßen wurde und reglos auf dem Gehweg liegen blieb. Der Wagen fuhr mit quietschenden Reifen davon und ich fluchte innerlich darüber, dass ich das Kennzeichen nicht hatte lesen können.
Ich rannte zur Garderobe, zog mir einen Mantel über meinen Schlafanzug, schnappte meine Schlüsselkarte und hastete die drei Stockwerke hinunter. Als ich die Haustür öffnete, schnitt mir die kalte Nachtluft in die Lungen und ich bereute augenblicklich, keine Schuhe angezogen zu haben. Es herrschte ein strenger Winter in Berlin und in Windeseile spürte ich meine Füße nicht mehr.
Meine Schwester lag auf dem Kopfsteinpflaster vor unserem Haus und stöhnte leise. Als ich sah, dass sie an der Lippe und aus einer Wunde an der Stirn blutete, wollte mir das Herz stehen bleiben. War das passiert, als sie aus dem Auto auf den Bordstein gefallen war, oder hatte sie diese Verletzungen schon länger? Ich ging neben ihr in die Hocke.
»Liz? Was ist los mit dir? Was ist passiert?«
Doch meine Schwester antwortete nicht, lediglich ihre Lider flatterten ein wenig und Schweiß stand auf ihrer glühend heißen Stirn. Ich zerrte an ihren Armen und versuchte sie aufzusetzen, doch sie war so schwer wie ein nasser Mehlsack. Als es mir endlich gelang, kippte sie zur Seite und kotzte in unseren Vorgarten. Zum Glück war unsere Nachbarin, Fräulein ›Ich sehe alles und höre alles‹-Pietsch schon lange im Bett.
Offenbar hatte es Liz ein wenig geholfen, sich zu übergeben, denn nun schaute sie mich aus glasigen Augen verwirrt an.
»Was ist mit dir passiert, Liz?«, fragte ich noch mal. Ihre Lippen bewegten sich, doch sie brachte keinen Ton heraus, sondern blickte nur verwirrt und leicht gehetzt um sich, als wüsste sie nicht, wo sie sich befand. Ich beschloss, dass es am wichtigsten war, sie erst einmal nach oben zu bringen.
»Meinst du, du kannst aufstehen?«, fragte ich sie. Wir mussten beide dringend ins Warme, wenn wir uns nicht den Tod holen wollten. Liz nickte langsam.
Als ich diesmal an ihren Armen zog, half sie mit und kam schließlich stöhnend und sehr windschief zum Stehen. Ich legte mir ihren rechten Arm um die Schulter und schleppte sie ins Haus.
Endlich oben angekommen, setzte ich sie im Bad auf den Toilettendeckel. Meine Schwester sah so elend aus, dass mir beinahe die Tränen kamen.
»Wer hat dir wehgetan?«, flüsterte ich, mehr zu mir selbst, weil ich wusste, dass ich von ihr keine Antwort bekommen würde. Sie war noch immer ziemlich weggetreten.
Ich holte den Verbandskasten hervor, reinigte ihre Wunden so gut ich konnte mit ein paar Wattetupfern, die ich in den Müll warf. Während ich arbeitete, fiel mir auf, dass auch ihre Fingerspitzen voller Blut waren. Doch das war sicher ihr eigenes, versuchte ich mich zu beruhigen. Ganz bestimmt kam es von den Wunden in ihrem Gesicht.
Es gelang mir schließlich, Liz ins Bett zu stecken. Ich brachte sie noch dazu, eine HeadHealer mit einem großen Glas Wasser herunterzuspülen, dann schlief sie auch schon ein. Als sich ihre Augen schlossen, durchzuckte mich kurz die Panik, sie könnten sich nie wieder öffnen. Doch ich wischte den Gedanken ärgerlich beiseite. Sie atmete, ihr Herz schlug, meine Schwester war am Leben.
Ich saß noch eine Weile auf ihrer Bettkante und betrachtete sie. Sie war meine Zwillingsschwester und doch erschien sie mir heute fremder als jemals zuvor. Mich schmerzte sehr, dass ich keine Ahnung hatte, was bei NeuroLink passiert war. Ich hoffte inständig, dass sie morgen in besserer Verfassung sein würde; sonst müsste ich die Abscheu aller Wächter gegen staatliche Einrichtungen ignorieren und Liz in ein Krankenhaus bringen.
Früher hätte sie darauf bestanden, mich mit zu NeuroLink zu nehmen. Zur Not hätte sie mich einfach auf die Party geschmuggelt. Die wilde, impulsive Liz von früher hätte einen Weg gefunden, sie fand immer einen Weg.
Doch diesmal war sie ohne mich gefahren. Und war Stunden später erst wieder zu Hause aufgetaucht. Verletzt und weggetreten. Was auch immer an diesem Abend geschehen war, sie würde es mir erzählen, beruhigte ich mich. Morgen würde ich es wissen, ich musste sie nur ausschlafen lassen.
An diesen Gedanken klammerte ich mich. Doch ich konnte nicht verhindern, dass sich eine tiefe Unruhe in mir breitmachte. Etwas kam auf uns zu – das spürte ich. Für solche Dinge hatte ich schon immer sehr feine Antennen gehabt. ›Wer sich Sorgen macht, leidet doppelt‹, sagte mein Adoptivvater immer, doch ich konnte nicht verhindern, dass sich die dunklen Gedanken in mir festsetzten. Mein Pa war schon immer besonnener gewesen als die meisten Menschen, mich eingeschlossen. Vielleicht brachte das der Beruf des Restaurators einfach mit sich? Mit seiner Stimme im Ohr versuchte ich mich zu beruhigen und langsam ein- und auszuatmen, mich zu erinnern, dass es nichts gab, was ich jetzt noch tun konnte. Es war mitten in der Nacht, Liz war in Sicherheit und schlief tief und fest. Nichts anderes zählte.
Schließlich schlüpfte ich zu ihr unter die Bettdecke und kuschelte mich an sie. Liz roch nach teurem Parfüm, asiatischem Essen und nach sich selbst. Und nach etwas, das ich nicht zuordnen konnte, das mir aber vage bekannt vorkam. Metallisch und ein bisschen süß. Nach einer Sache roch sie jedenfalls definitiv nicht: nach Alkohol.
Ihr gleichmäßiger Atem beruhigte auch mich allmählich.
Ich schloss die Augen in der Hoffnung, dass der morgige Tag besser werden würde als der heutige.
Irgendwann schlief ich ein.
LIZ
Das Tier, das in meinem Kopf tobte, einen ›Kater‹ zu nennen, wäre eine bodenlose Untertreibung gewesen.
In meinem Schädel wohnte eine wilde Bestie, die in genau der Sekunde angefangen hatte zu wüten, in der ich die Augen aufgeschlagen hatte.
Es dauerte eine Weile, bis ich mich blinzelnd an die helle, kalte Wintersonne gewöhnt hatte, die durch die großen Fenster in mein Zimmer fiel.
Sophie lag neben mir und schnarchte leise, ihre Hände umklammerten ein Stück meines T-Shirts, als hätte sie Angst, ich könne ihr im Schlaf davonlaufen. Ich konnte mich gar nicht erinnern, dass sie zu mir ins Bett geschlüpft war; normalerweise wachte ich davon immer auf. Ich stutzte. Und warum trug ich überhaupt noch mein T-Shirt von gestern? Es war gar nicht meine Art, mit Straßenklamotten ins Bett zu gehen. Aber wahrscheinlich war ich zu müde für die übliche Bettroutine gewesen, was auch meinen tiefen Schlaf erklärte.
Vorsichtig, um sie dabei nicht zu wecken, löste ich den Stoff aus Sophies erstaunlich festem Griff. Ich wollte aufstehen und die Rollläden schließen, doch kaum war ich auf den Beinen, schoss mir heftige Übelkeit in den Magen und die Welt begann sich vor meinen Augen zu drehen. Ich musste rennen, um rechtzeitig ins Bad zu kommen. Im letzten Augenblick erreichte ich die Toilette und kniete mich davor, doch sosehr sich mein Magen auch zusammenkrampfte, es kam nichts heraus. Als die Krämpfe endlich aufgehört hatten, mich zu schütteln, tat mir der ganze Bauch weh.
Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich mich jemals zuvor so gefühlt hatte; und das, obwohl ich es in letzter Zeit häufiger mal mit dem Alkohol übertrieben hatte. Aber das, was ich gerade fühlte, war eine völlig andere Kategorie. Eine Mischung aus Kopfschmerz, Übelkeit und bodenloser Verzweiflung beherrschte meinen Körper und meinen Geist, ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren.
Auf zittrigen Beinen ging ich zum Waschbecken und schaute in den Spiegel. Automatisch sprang die MagicMirror-Funktion an, doch ich schaltete sie mit einem ärgerlichen Wischen wieder ab. Es störte mich nicht zum ersten Mal, dass der Bauherr die Wohnung zum Teil mit NeuroLink-Produkten ausgestattet hatte. Wenn der Spiegel jetzt mit meiner Gesichtsanalyse begann, würde das in einer handfesten Depression enden, denn ich sah furchtbar aus. Das vermeintlich menschliche Wesen, das mir aus rot geränderten Augen und mit fahler Haut entgegenstarrte, erkannte ich kaum. Meine feuerrot gefärbten Locken hingen mir zum einen Teil kraftlos und vorwurfsvoll ins Gesicht und klebten mir zur anderen Hälfte fettig am Kopf. Meine Lippe war mit getrocknetem Blut verkrustet, an meinem Haaransatz war ein tiefer Schnitt zu sehen. Ich hatte nicht den blassesten Schimmer, wo ich mir diese Verletzungen zugezogen hatte.
Sophie hatte einmal gesagt, ich sähe zu jeder Tageszeit aus wie ein Filmstar. Falls irgendwo eine Zombierolle besetzt werden sollte, war heute mein Glückstag.
Ich riss mich zusammen und drehte das kalte Wasser auf. Als ich die Hände unter den eisigen Strahl hielt, erschrak ich erneut. Meine Fingerspitzen waren bräunlich rot verfärbt, als hätte ich meine Hände in Blut getaucht – ich hatte es sogar unter den Fingernägeln. Hatte ich mir die Wunden etwa irgendwie selbst zugefügt? Was zur Hölle war gestern Abend passiert? Ich konnte mich nicht einmal mehr daran erinnern, wann oder wie ich nach Hause gekommen war.
Mit einer Nagelbürste und viel Seife schrubbte ich so lange an meinen Fingerkuppen herum, bis nichts mehr von dem Blut zu sehen war. Der hellrote Strudel, der sich im Waschbecken in Richtung Abfluss kringelte, roch danach. Bei dem Geruch drehte sich mir erneut der Magen um, ich hatte schon immer ein Problem mit Blut. Ganz im Gegensatz zu Sophie. Als wir unser Zwillings-Tattoo hatten stechen lassen, wäre ich beinahe umgekippt, während Sophie den Vorgang mit nahezu wissenschaftlicher Neugier die ganze Zeit über beobachtet hatte.
Wir hatten uns jede einen Flügel auf den Unterarm tätowieren lassen sowie unseren Geburtstag mit der Uhrzeit der jeweils anderen. Ich trug mein Tattoo am linken, Sophie am rechten Arm. Wenn wir einander an den Händen hielten, wurde ein Flügelpaar daraus – gemeinsam konnten wir fliegen.
Doch gerade fühlte ich mich, als könnte ich mich eigentlich überhaupt nicht mehr bewegen. Fieberhaft versuchte ich den gestrigen Abend zu rekonstruieren, doch ich erinnerte mich lediglich daran, das festlich geschmückte NeuroLink-Gebäude betreten zu haben. Der Rest war Schwärze – ein klassischer Filmriss. Was für ein Jammer. Da hatte ich die Gelegenheit zum Interview des Jahrhunderts und konnte mich hinterher nicht mehr daran erinnern. Irgendwie war das typisch für mich. Die großen Dinge setzte ich immer in den Sand. Hoffentlich waren wenigstens meine Aufzeichnungen brauchbar. Und hoffentlich hatte ich mich nicht allzu schlimm danebenbenommen. Immerhin war ich in meinem eigenen Bett neben meiner Schwester aufgewacht und nicht in einem völlig anderen Stadtteil neben einem fremden, schnarchenden Kerl. Gerade wollte ich nirgendwo anders als daheim sein.
Ich nahm eine Kopfschmerztablette und kuschelte mich wieder zu Sophie unter die Decke. Keine Macht der Welt würde mich dazu bringen, heute noch einmal das Bett zu verlassen.
Dachte ich zumindest.
Denn das Nächste, was ich hörte, war ein ohrenbetäubender Knall. Sophie und ich schreckten beinahe zeitgleich aus dem Schlaf hoch und starrten einander an. Zwar waren wir seit der Gefangenschaft auf der BER-Brache ohnehin ziemlich schreckhaft und litten beide unter Albträumen, doch der Knall, den wir gerade gehört hatten, war echt.
Als ein zweiter Knall ertönte, war ich bereits wach genug, um zu begreifen, dass gerade jemand unsere Tür eintrat.
In Windeseile waren wir beide auf den Beinen und rannten ins Wohnzimmer. Ich war so geistesgegenwärtig, mir in der Küche noch ein langes Messer zu schnappen. Wer immer es auch wagte, hier einzudringen, hatte die Rechnung ohne mich gemacht, ich war bereit, mich zur Wehr zu setzen. Doch als die Tür aufflog, erkannte ich schnell, dass es nicht etwa Einbrecher waren, denen wir uns gegenübersahen, sondern Polizisten.
Sechs schwer bewaffnete Beamte in schwarzen gepanzerten Uniformen stürmten unsere Wohnung. Noch bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte mir einer von ihnen das Messer aus der Hand getreten und mich zu Boden geworfen. Ich schlug so hart auf dem Parkett auf, dass es mir sämtliche Luft aus den Lungen presste – ich konnte nicht einmal schreien.
Das hätte mir auch nichts genützt, ich hörte und fühlte bereits, wie mir Handschellen angelegt wurden.
Meiner Schwester hingegen war offenbar nicht die Luft weggeblieben. »Was wollen Sie hier?«, hörte ich sie schreien. Ihre Stimme verriet, dass sie kurz davor war, in Panik zu geraten. »Lassen Sie mich sofort los!«
Ich drehte den Kopf und sah, dass sich Sophie in genau der gleichen Lage befand wie ich. Sie lag mit auf den Rücken gedrehten Armen nicht weit von mir entfernt am Boden.
Gruselig fand ich, dass die gesamte Aktion nur wenige Sekunden gedauert hatte und die Polizisten währenddessen kein einziges Wort gesagt hatten. Bisher hatte ich immer geglaubt, dass Beamte in so einer Situation wie die Irren herumschreien oder einem nüchtern die Rechte vorlesen. Ich fühlte, wie sich der Polizist neben mir erhob und mich an den Schultern grob nach oben zog. Mein Magen verkrampfte sich und es kostete mich all meine Willenskraft, mich nicht auf unseren Garderobenläufer zu übergeben. Auch Sophie stand nun auf den Füßen. Sie sah mich fragend an, doch ich wusste genauso wenig wie sie, was hier los war.
»Wer von Ihnen beiden ist Elisabeth Ingrid Karweiler?«, fragte nun einer der Beamten.
Ich schluckte. War ja klar, dass sie wegen mir gekommen waren. Warum sollte auch jemand meine Schwester verhaften?
Ich räusperte mich. »Das bin ich.«
Der Beamte trat zu mir und schob mir einen Scanner unter den rechten Daumen. Es piepte und ich wusste, dass nun die Informationen über meinen Namen, Geburtsdatum und -ort sowie meine Meldeadresse auf dem Bildschirm erschienen. Die Bürgerdatenbank war die neuste Errungenschaft der fruchtbaren Beziehung zwischen der Bundesregierung und der NeuroLink AG.
»In Ordnung«, sagte der Mann und Sophies Handschellen wurden wieder gelöst. Nun stand sie etwas verloren in unserem Wohnzimmer herum und rieb sich die Handgelenke. Meine Schwester blickte mich an und ich hielt ihrem Blick schweigend stand, unfähig, auch nur ein Wort zu sagen.
Diese Aufgabe übernahm jemand anderes für mich.
»Elisabeth Ingrid Karweiler, Sie sind verhaftet. Sie sind dringend tatverdächtig, den Vorstandsvorsitzenden von NeuroLink, Harald Winter, mit fünf Messerstichen getötet zu haben.«
Ich hörte die Worte zwar, doch ich konnte sie nicht begreifen. Winter war tot? Wie konnte das sein? Gestern Abend war er doch noch am Leben gewesen. Fieberhaft kramte ich in meinem Gedächtnis nach einer Erinnerung an das Interview mit dem mächtigen Firmenchef – nach irgendetwas, das mir bestätigte, dass ich mit dem Mord nichts zu tun hatte. Doch ich fand nichts. Dort, wo der gestrige Abend hätte sein sollen, befand sich nur ein leeres schwarzes Loch.
Mehr noch: Ich hatte ein Motiv, ich hatte die Gelegenheit und ich hatte definitiv Blut an meinen Händen gehabt, als ich heute früh aufgewacht war. Man musste nicht Sherlock Holmes sein, um mich für schuldig zu halten.
Ich drehte den Kopf und sah, dass Sophie mich fassungslos, ja beinahe verletzt anstarrte. Ihre Gedanken gingen offensichtlich in eine ähnliche Richtung. Wie gerne hätte ich ihr jetzt gesagt, dass alles nur ein Irrtum war, der sich sicherlich bald aufklären würde, hätte wer weiß was dafür gegeben, sie in den Arm nehmen und beruhigen zu dürfen, doch die großen Pranken des Polizisten hielten mich an Ort und Stelle fest und der Zweifel lähmte meine Zunge. Eine weibliche Beamtin fing an, meine Füße in Schuhe zu stecken und diese zu binden. Keiner von uns wies sie darauf hin, dass es nicht meine, sondern Sophies Schuhe waren. Dann legte sie mir meinen alten Kamelhaarmantel um – der Stoff fühlte sich auf meiner Haut wie eine Botschaft aus vergangenen Zeiten an. Als ich noch reich und glamourös gewesen war – und nicht reich und merkwürdig. Mir schoss durch den Kopf, dass ich froh war, dass weder meine Eltern noch Juan oder Fe diese Szene mit ansehen mussten. Es war schlimm genug, dass Sophie sie mitbekam. Ich fühlte mich unendlich schuldig und schämte mich, ohne genau zu wissen, wofür eigentlich.
Die Beamten durchsuchten nun wenig zimperlich unsere Wohnung, was mir sonderbar egal war. Was sie als beweiswürdig erachteten, steckten sie in Säcke und Tüten und beschrifteten alles. Mein Laptop wanderte in eine Tüte, genau wie mein Handy und die Klamotten von gestern Abend. Am Ende musste Sophie eine Liste unterschreiben, die ihr unter die Nase gehalten wurde. Sie schaute nicht einmal hin.
»So, Abmarsch«, rief der Mann, der hinter mir stand, schließlich und Panik stieg in mir hoch. Was würde nun mit mir geschehen?
Sophie sah mich an und weinte leise. »Liz?«, fragte sie schließlich und mir wollte das Herz brechen, weil ich wusste, was in dieser Frage alles mitschwang.
Kommst du wieder?
Hast du ihn umgebracht?
Was soll ich jetzt tun?
Nur die dritte unausgesprochene Frage konnte ich ihr beantworten. »Ruf den Anwalt an, Stuhldreyer«, sagte ich und hörte, dass meine Stimme zitterte.
Wie gerne hätte ich ihr noch mehr gesagt. Dass sie keine Angst haben sollte, dass ich sie lieb hatte, dass sicher alles gut werden würde. Doch nichts davon kam mir über die Lippen.
Sophie nickte. Im nächsten Augenblick wurde ich aus der Wohnungstür geschoben, die Treppen hinunter und raus auf die Straße.
Diverse Nachbarn hatten sich zum Gaffen versammelt, doch ich gab mir Mühe, sie nicht anzusehen. Ich betrachtete stattdessen meine Füße, die wie von Zauberhand ihren Dienst verrichteten, während der Rest meines Körpers und meines Geistes wie abgeschaltet wirkte. Die Schnürsenkel des rechten Schuhs schleiften durch den frisch gefallenen Schnee, weil die Beamtin sie schlampig gebunden hatte. Ich konzentrierte mich auf die kleine Spur, die sie hinter sich herzogen.
Fast war ich froh, dass ich in den großen Van steigen konnte, der auf dem breiten Gehweg für uns bereitstand. Er gaukelte mir eine Sicherheit vor, die es für mich nicht mehr gab. Doch ich war bereit, seinen Lügen zu glauben. Im Innern des Wagens nahmen mich zwei Beamte in die Mitte und wir fuhren los. Wohin auch immer.
SOPHIE
Nachdem die Polizei meine Schwester abgeführt hatte, konnte ich mich eine Weile nicht rühren. Mein Gehirn versuchte, zu verarbeiten, was gerade geschehen war. Ich stand nur da und starrte auf die Tür, die schief in den Angeln hing und sich ohne Reparatur nicht mehr würde schließen lassen. Mir schossen derart viele Dinge durch den Kopf, dass ich einfach nicht wusste, was ich zuerst tun sollte.
Einen Schreiner rufen, der die Tür reparierte? Mich anziehen? Marek anrufen? Joan oder Fe? Den Anwalt? Es gab einfach zu viele Möglichkeiten, wie man mit einer unmöglichen Situation umgehen konnte. Und diese Überforderung lähmte mich.
Erst als Herr Schubert, unser Nachbar von nebenan, seinen runden Kopf durch die Tür steckte, erwachte ich aus meiner Starre.
»Ach du liebe Zeit, was ist denn hier passiert?«, fragte er eine Spur zu besorgt. Mir war klar, dass es mehr Neugier war als echte Sorge, die ihn zu mir herübertrieb. Er reckte den Hals im Versuch, noch mehr von der Wohnung sehen zu können. Wahrscheinlich hatte er die ganze Zeit über am Fenster geklebt und gesehen, wie Liz abgeführt worden war – ich konnte ihm seine Neugier nicht verdenken, der Krach hätte selbst Tote aufgeweckt. Doch ich wollte jetzt auf keinen Fall mit ihm reden. Und noch weniger wollte ich mit weiteren Nachbarn interagieren.
»Es ist alles in Ordnung, Herr Schubert«, sagte ich deshalb und versuchte, möglichst selbstsicher und unbeschwert zu klingen. »Bitte entschuldigen Sie die frühe Störung.«
Herrn Schubert war anzusehen, dass ihn diese Antwort enttäuschte, doch das wollte er sich natürlich nicht anmerken lassen.
»Schon gut«, brummte er und wollte sich gerade wieder in seine Wohnung verziehen, als mir einfiel, dass ich ihn bitten könnte, meine Wohnungstür zu schließen. Er kam meiner Bitte missmutig nach.
Als sich die Tür endlich geschlossen hatte, sank ich innen daran herab und starrte ohne etwas zu sehen auf unsere große graue Couch. Ich wollte weinen, doch es kamen keine Tränen. In meinem Körper herrschte Wasserknappheit – zu groß war der Schock über das, was soeben passiert war.
Sie hatten meine Schwester mitgenommen. Der Mensch, der mir geschworen hatte, mich niemals zu verlassen – verhaftet wegen Mordes. Ich hatte das Gefühl, dass sich hier die Geschichte einen grausamen Scherz erlaubte. Unser leiblicher Vater hatte auch wegen Mordes hinter Gittern gesessen – es hieß, er hätte unsere Mutter umgebracht. Die Wahrheit war erst lange nach seinem Tod ans Licht gekommen – seine eigene Rehabilitation hatte Sebastian Zweig nicht mehr miterlebt.
Tausend Gedanken kreisten durch meinen Kopf und machten es mir schwer, mich zu konzentrieren. In meinem Zimmer hörte ich mein Handy klingeln, doch ich beachtete es nicht. Ich war einfach noch nicht bereit, mich der Realität zu stellen.
Wie sehr hatte ich nach der Geschichte mit dem Sandmann gehofft, gemeinsam mit Liz ein normales, ruhiges Leben führen zu können. Studieren, arbeiten, Kinder bekommen. Das komplette, spießige Programm. Zuckerguss und Sahnehaube.
Stattdessen hatte ich nun eine wegen Mordes verhaftete Zwillingsschwester, einen fusseligen Kater und eine Hündin mit Verdauungsbeschwerden. Und eine Luxuswohnung, die mir kalt, leer und unangemessen vorkam.
Liz und ich hatten sie damals zwar gemeinsam eingerichtet, doch ich hatte ihr in den meisten Fällen die Entscheidung überlassen, da sie in solchen Sachen mehr Erfahrung und deutlich mehr Meinung hatte als ich. Das Ergebnis war, dass ich nun das Gefühl hatte, in der leeren Wohnung meiner Schwester zu stehen, in der ich immer nur Gast gewesen war. Ich fühlte mich merkwürdig fehl am Platz – wie eine Fremde im eigenen Leben.
Da ich wusste, dass ich etwas unternehmen musste, riss ich mich zusammen und rief den Anwalt an. Leopold Karweiler hatte uns seine Nummer zu unserem achtzehnten Geburtstag gegeben. Hatte er geahnt, dass wir sie eines Tages brauchen würden? Herr Stuhldreyer war einer der besten und berühmtesten Strafverteidiger Berlins. Er versprach, sich sofort auf den Weg zu machen und um Liz zu kümmern.
Als das erledigt war, beschloss ich, mich erst einmal zu duschen. So übernächtigt und geschunden, wie ich mich fühlte, konnte ich mich auf keinen Fall einer der anderen Aufgaben stellen. Doch aus irgendeinem Grund traute ich mich nicht, das Wohnzimmer zu verlassen. Die Tür, die schief und provisorisch in den Angeln hing, machte mich nervös. Ein Teil von mir erwartete, dass sie erneut aufschwingen und weitere Polizisten kommen würden, um mich ebenfalls mitzunehmen. Doch nichts passierte. Da ich mich dennoch nicht aufraffen konnte, schob ich schließlich mit einiger Kraftanstrengung das Sofa vor die Tür. Es tat gut, sich zu verschanzen, auch wenn ich wusste, dass diese Barriere im Ernstfall nichts ausrichten würde und ich mich gerade vor mir selbst lächerlich machte.
Dann endlich ging ich ins Bad. Ich schluckte, als ich das Chaos sah, das die Polizisten hier angerichtet hatten. Alle Schubladen waren aufgerissen, die Inhalte auf dem Fußboden verstreut.
Etwas an diesem Durcheinander erregte meine Aufmerksamkeit, doch ich konnte zunächst nicht genau sagen, was es war. Mein Gehirn arbeitete nervtötend langsam und die Gedanken tanzten zudem wild in meinem Kopf herum – ich bekam sie kaum zu fassen.
Dann begriff ich: Sie hatten zwar alles durchwühlt, den Mülleimer aber offensichtlich nicht angetastet. War das nicht ein bisschen merkwürdig? Warfen nicht alle Verbrecher nach der Tat die wichtigsten Beweismittel weg? Ich klappte den Deckel auf und vergewisserte mich – soweit ich das erkennen konnte, war der Inhalt unangetastet; auch die blutigen Wattebäusche von gestern Nacht lagen noch darin. Ich setzte mich auf den Wannenrand und dachte nach.
Was wusste ich? Ich wusste, dass meine Schwester gestern Abend zum NeuroLink-Gebäude aufgebrochen war, um ein Interview mit Harald Winter zu führen. Ich wusste, dass Winter ermordet worden war – erstochen, um genau zu sein. Und ich wusste, dass ich meine Schwester heute Nacht völlig weggetreten vor unserer Wohnung gefunden hatte. Dort, wo sie von einem schwarzen Wagen einfach abgeladen worden war. Kaum bei Bewusstsein und mit blutigen Fingern.
Ich schloss die Augen und zwang mich zur Konzentration. Wusste ich, dass meine Schwester den Mann nicht getötet hatte? Nein, das hoffte ich nur.
Sie war nicht sie selbst gewesen in der vergangenen Nacht, so viel stand fest. Vielleicht war sie nur betrunken gewesen, doch sie hatte weder betrunken gewirkt noch sonderlich nach Alkohol gerochen. Vielleicht hatte sie stark unter Schock gestanden, weil sie nicht verarbeiten konnte, was sie gesehen oder getan hatte?
Wenn sie auf der Party wirklich den Gastgeber getötet hatte – warum hatte sie dann jemand in einem Auto nach Hause gefahren? Warum hatte man sie nicht festgehalten und sofort die Polizei gerufen? Das passte doch nicht zusammen.
Eines stand fest: Es gab eine Menge offener Fragen. Zwar hoffte ein Teil von mir, dass sich auf dem Revier alles aufklären und Liz heute Abend nach Hause kommen würde, doch wenn ich ehrlich war, glaubte ich nicht daran. Überhaupt wusste ich nicht, was ich glauben konnte oder sollte. Doch in den letzten Jahren hatte ich gelernt, immer vom Schlimmsten auszugehen. Die Vergangenheit, die wir so verzweifelt hinter uns zu lassen versucht hatten, holte uns gerade wieder ein. Sie hatte nur geschlafen, gelauert, auf einen Moment gewartet, in dem sie uns wieder zeigen konnte, dass wir keine Chance hatten, ihr zu entkommen. Es gab keinen Weg, sich ihr zu entziehen.
Ich riss mich zusammen und holte eine Gabel und eine Plastiktüte aus der Küche. Behutsam bugsierte ich die blutverkrusteten Wattetupfer, mit denen ich wenige Stunden zuvor noch Liz’ Wunden gereinigt hatte, in die Tüte. Ich würde sie zur Analyse geben – Marek oder Sash kannten bestimmt jemanden, der das schnell und diskret erledigen konnte.
Sollte sich herausstellen, dass Liz gestern Abend extrem betrunken gewesen war, konnte ihr das vielleicht helfen. Es war das Einzige, was ich im Moment für sie tun konnte.
LIZ
Sie brachten mich direkt zum Strafgericht nach Moabit. Ich erkannte das Gebäude sofort, als sie mich aus dem Van steigen ließen– es war eines der eindrucksvollsten Gerichtsgebäude Berlins. In der fünften oder sechsten Klasse hatte ich das Gericht mit der Schule besucht– Pflichtprogramm für alle Berliner Kinder. Damit man von klein auf lernt, was passiert, wenn man aus dem Rahmen fällt. Es fühlte sich an, als wäre es ein anderes Leben gewesen. Ich fragte mich, ob diese Schulausflüge in Berlin noch immer Pflicht waren oder ob es in Zukunft gepanzerte Busfahrten durch das Brandenburger Umland für die Kleinen geben würde, bei denen sie Verbannte begaffen sollten wie Tiere im Zoo.
Zwar wunderte es mich, dass sie mich hierher und nicht in mein Bezirksgefängnis brachten, doch vielleicht war das ja auch ein Teil der Strafrechtsreform, die vor wenigen Tagen in Kraft getreten war. Ich musste zugeben, dass ich mir wegen der Aufregung über das Interview mit Winter nicht mehr die Zeit genommen hatte, den gesamten Gesetzestext durchzulesen, obwohl ich es mir immer wieder vorgenommen hatte. Nun hieß es wohl für mich ›learning by doing‹.
Ich wurde in ein Zimmer geschoben, in dem mir sämtliche persönlichen Sachen abgenommen wurden. Da ich direkt aus dem Bett heraus verhaftet worden war, ging das sehr schnell, denn ich hatte nichts bei mir, was sich großartig zu protokollieren gelohnt hätte. Kurz dachte ich daran, wie uns der Notar damals die Sachen übergeben hatte, die unserem Vater nach seiner Verhaftung abgenommen worden waren. Der Apfel fiel offensichtlich nicht weit vom Stamm. Doch irgendwas an der Tatsache, dass Sebastian Zweig diese Prozedur ebenfalls durchgemacht hatte, beruhigte mich. Ich fühlte mich schlagartig nicht mehr ganz so alleine. Vielleicht stand ich ja gerade genau dort, wo er damals gestanden hatte, und dieser Vorraum war wie ein Portal, das sein und mein Leben miteinander verband.
Nach der Registrierung nahmen mich zwei mürrische Matronen ins Schlepptau und gingen mit mir in den Keller des Gebäudes. Ich fröstelte, als ich die bis unter die Decke gefliesten Räume betrat, die früher vermutlich als Sanitärräume für die Häftlinge gedient hatten. Hier und da ragten verrostete Duschköpfe aus der Wand, stumpfe Spiegel zeugten von einer Zeit, als es noch keinen MagicMirror gegeben hatte, der einem verriet, wie man sich am besten schminken oder frisieren sollte. Alles sah alt und abgegriffen aus – auf diese traurige Art schäbig, die nur öffentliche Gebäude ausstrahlen konnten. Über allem lag eine gespenstische Stille; nur die Geräusche unserer Sohlen hallten durch die Gänge. Eigentlich hatte ich genug von alten, verlassenen Gängen – genug, dass es für den Rest meines Lebens reichte. Doch natürlich interessierte sich hier niemand dafür, wie ich mich gerade fühlte. Ich fragte mich, was wir ausgerechnet hier unten zu suchen hatten.
Doch schon hinter der nächsten Abzweigung, die wir nahmen, klärte sich dieses Rätsel auf und ich staunte nicht schlecht, als ich sah, worauf wir nun zusteuerten. Ich musste zweimal hinsehen, als wir den riesigen Kellerraum mit Gewölbedecke betraten, denn mein Gehirn brauchte eine Weile, um den Anblick zu verdauen: Im Keller des Gerichtsgebäudes standen mehrere hell erleuchtete Baucontainer. Es war wie ein Haus im Haus.
Als mich die beiden Frauen über die Schwelle des ersten Containers schoben, hatte ich das Gefühl, eine fremde Welt zu betreten, denn der Kontrast hätte größer gar nicht sein können. Hier war alles hochmodern eingerichtet, pieksauber und wirkte beinahe schon steril. Mehrere Männer und Frauen in Uniformen, die keine Abzeichen aufwiesen, saßen an Tablets oder Bildschirmen und tippten geschäftig auf ihren Tastaturen herum. Das waren bestimmt die ehemaligen Vollzugsbeamten, die nun vom Security-Arm von NeuroLink übernommen worden waren. Sicherlich hatte man es in der Kürze der Zeit nicht geschafft, allesamt adäquat einzukleiden. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass eine Frau sich kurz an die Schläfe tippte, bevor sie zu sprechen begann. Ohne Zweifel trug sie noch einen der in Verruf geratenen SmartPorts. Mir wurde noch kälter. Alles hier roch förmlich nach NeuroLink.
Ich wurde von zwei weiteren Frauen in Empfang genommen, die mich in einen Container im hinteren Bereich des Komplexes führten. Der Raum war spärlich eingerichtet, nur an den Wänden standen einige Handwagen herum, die denen beim Friseur nicht unähnlich waren. Die Gerätschaften, die darauf herumlagen, kannte ich nicht, doch allein ihr Anblick machte mich nervös. Ich fühlte, dass mein Herz heftig zu pochen begann, und versuchte, mich zu beruhigen. Auf keinen Fall wollte ich ihnen zeigen, dass ich Angst hatte.
Eine der beiden Frauen befahl mir schließlich, mich auszuziehen. Als ich nach wenigen Augenblicken nackt vor ihnen stand, begannen sie, ein scheinbar genau einstudiertes Programm abzuspulen, in einer Geschwindigkeit, als wäre der leibhaftige Teufel hinter ihnen her.
In Windeseile wurden mir die Fingernägel geschnitten, eine Haarsträhne ausgerissen und ich wurde in eine klebrige Decke gewickelt.
»Was ist das denn?«, fragte ich, doch anstelle einer Antwort rissen sie mir mit vereinten Kräften die Decke wieder vom Leib und ich hatte das Gefühl, als würde mir die gesamte obere Hautschicht mit abgerissen.
Ich schrie auf und hätte schwören können, im Mundwinkel einer der beiden Frauen ein Lächeln zu sehen.
»Das gehört zur Spurensicherung«, sagte sie knapp und ich verstand. Wahrscheinlich war das eine neue Methode, Fasern, Haare und Hautpartikel zu sichern. Effektiv, aber schmerzhaft.
Schließlich steckten sie mich in etwas, das mich verdächtig an einen alten Schlafanzug erinnerte, und gaben mir Plastikschuhe zum Reinschlüpfen. Spätestens jetzt fühlte ich mich wie ein hochoffizieller Häftling. Oder wie ein frisch gerupftes Suppenhuhn.
Merkwürdig war, dass mir keiner Fragen zum Verlauf des gestrigen Abends stellen wollte. Sie spulten ein offizielles Protokoll mit mir ab, doch eine Befragung schien hier nicht vorgesehen zu sein. Aber wahrscheinlich wollten sie warten, bis mein Anwalt erschien. Oder sie waren schlicht nicht befugt, mir Fragen zu stellen. B-Klasse-Polizisten, sozusagen.
Am Ende der Prozedur wurde ich kreuz und quer durch verlassene Gänge geführt. Zwar hatte ich früher schon gewusst, dass dieses Gebäude riesig war, doch mit solch einem gewaltigen Ausmaß hatte ich trotzdem nicht gerechnet. Wenn mich die beiden Beamtinnen jetzt verließen, würde ich vermutlich nie wieder den Weg zurückfinden. Nicht, dass ich das überhaupt wollte.
Unser Weg endete in einem anderen Teil des Gerichts, der viel steriler und moderner auf mich wirkte. Wahrscheinlich war das die Untersuchungshaftanstalt, an der ich schon so oft vorbeigefahren war. Man hatte sie erst vor wenigen Jahren modernisiert. Doch was mich wirklich irritierte, war die gespenstische Stille, die auch hier über allem lag. So groß wie Berlin war, müsste das Untersuchungsgefängnis eigentlich voller Menschen sein.
»Warum ist hier niemand?«, murmelte ich vor mich hin und eine der beiden Frauen neben mir schnaubte.
»Vor der Justizreform wurden alle Fälle abgeurteilt. Es sollte keine Überschneidungen oder Rechtsunsicherheiten geben.«
Nun verstand ich. Es war gut möglich, dass ich der erste Einwohner Deutschlands war, der nach neuem Recht behandelt wurde. Die Ironie dessen entging mir natürlich nicht.
Endlich wurde eine Zellentür aufgeschlossen, die kurz danach mit einem lauten Knall hinter mir ins Schloss fiel. Ich war allein. Und fühlte mich einsamer als je zuvor in meinem Leben.
Eine einzelne Leuchtstoffröhre erhellte unerbittlich die Realität, in der ich mich nun befand. Die Zelle wirkte wie eine etwas größere Flugzeugtoilette, alles schien aus einem einzigen weißen Kunststoffstück zu bestehen. Auf einem schmalen Vorsprung lag eine noch schmalere, in Plastik geschweißte Matratze, daneben ragte ein Waschbecken aus der Wand, das nicht größer war als ein Kuchenteller, und direkt neben dem Waschbecken befand sich eine Toilette – ohne Klobrille, ohne Deckel. Alles war so weiß, dass mir schon nach kurzer Zeit die Augen brannten. Hier gab es nichts, woran sich mein Blick hätte festhalten können.
Ich legte mich auf die schmale Pritsche, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und wartete darauf, dass ich zum Gespräch mit meinem Anwalt gerufen wurde, doch nichts dergleichen geschah. Eigentlich müsste er längst hier sein – Sophie hatte ihn sicher sofort angerufen. Mit aller Macht versuchte ich, mich nicht verrückt zu machen, doch in dieser schrecklichen Zelle war das gar nicht so einfach.
Ich fragte mich, was sie gegen mich in der Hand hatten. Die Polizisten waren keine vierundzwanzig Stunden nach dem Mord in unsere Wohnung gestürmt – es musste etwas geben, das mich schwer belastete. Vielleicht gab es im Gebäude von NeuroLink Videoüberwachung? Und falls ja: Was war auf diesen Aufzeichnungen wohl zu sehen?
Natürlich fragte ich mich, ob ich den Mord begangen hatte. Und das Schlimmste an meiner Situation war, dass ich genau diese Frage nicht beantworten konnte. Ich konnte es mir nicht vorstellen, hätte nie gedacht, dass ich einen Mord begehen könnte – doch wer dachte das vorher schon von sich? Es tat weh, an Sophie zu denken, darüber wie es ihr wohl gerade ging. Ich hatte das merkwürdige Gefühl, meine Schwester im Stich gelassen zu haben.