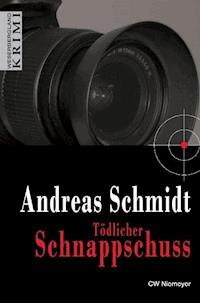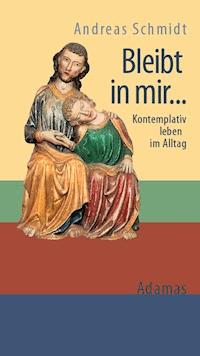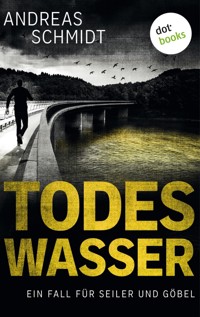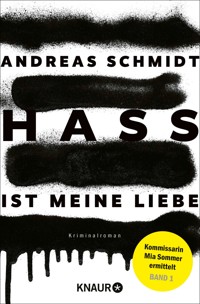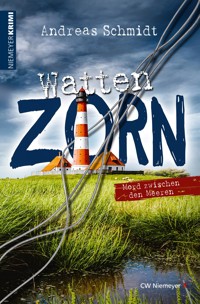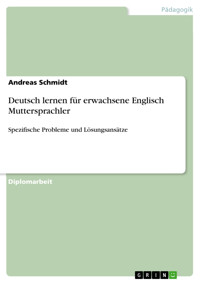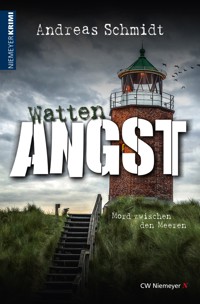6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: RheinMosel-Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein bankrotter Flughafen, einst als amerikanische Air Base genutzt, gerät immer wieder in die Schlagzeilen: Warum hat die Landesregierung der Betreibergesellschaft den Flughafen für einen symbolischen Euro abgekauft? Geht es tatsächlich nur um den Erhalt der rund sechstausend Arbeitsplätze, oder birgt der ehemalige Militärflughafen ein düsteres Geheimnis, das unter keinen Umständen gelüftet werden darf? Die Kripo in Trier hat die Ermittlungen bereits eingestellt, doch es kehrt keine Ruhe ein zwischen Rhein, Mosel und Hunsrück. Verseuchtes Trinkwasser und eine rätselhafte Mordserie rufen Bernd Kaltenbach, den unkonventionellen Reporter des "Rhein Mosel Express", auf den Plan. Seine erste Spur führt nach Koblenz. Plötzlich ist Kaltenbach tiefer in den Fall involviert, als es ihm selber lieb ist. Doch es gibt kein Zurück: Warum wurde der Ortsbürgermeister des idyllischen Moseldorfes Enkirch während eines Bootsausfluges auf der Mosel erschossen? Wusste er zu viel? Fest steht nur, dass er ein Gegner des Flughafens war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Im Verlag CW Niemeyer sind bereits
folgende Bücher des Autoren erschienen:
TodesDuft
Tödlicher Schnappschuss
WattenMord
WeserTod
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über http://dnb.ddb.de
© 2012 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hameln
www.niemeyer-buch.de
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Carsten Riethmüller
unter Verwendung von Motiven von shutterstock.com
Druck und Bindung: AALEXX Buchproduktion GmbH, Großburgwedel
Printed in Germany
ISBN 978-3-8271-9481-7
E-Book-Konvertierung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm
E-Book ISBN 978-3-8271-9828-0
Der Roman spielt hauptsächlich in einer bekannten Region zwischen Rhein, Mosel und Hunsrück, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Über den Autor:
Andreas Schmidt ist verheiratet und Vater zweier Kinder, er lebt und arbeitet mit seiner Familie in Wuppertal. Die Leidenschaft für das Schreiben entdeckte er als Jugendlicher; so schrieb er als Schüler diverse Kurzgeschichten und arbeitete an Schülerzeitungsprojekten mit. Nachdem er zahlreiche Heftromane für große Verlage geschrieben hatte, gab er 1999 mit „In Satans Namen“ sein Krimi-Debüt. 2002 gelang ihm mit „Das Schwebebahn-Komplott“ der Durchbruch. Inzwischen sind sechs Wuppertal-Krimis, eine Anthologie sowie der Thriller „Mein ist die Nacht“ erschienen. Seit 2008 ist er hauptberuflich als Autor und Texter für verschiedene Agenturen und Verlage sowie als Freier Redakteur tätig.
Mehr über Andreas Schmidt und seine Aktivitäten erfahren Sie unter www.andreasschmidt.org
Für meine Familie.Vier sind es.
EINS
Er liebte die stillen Abendstunden an seinem Fluss. Wenn die Hektik des Tages von ihm abfiel und er endlich wieder durchatmen konnte. An lauen Sommerabenden gab es für ihn nichts Schöneres, als mit dem Boot hinauszufahren und den atemberaubenden Anblick der sanft ansteigenden Weinberge und der grünen Hügel im Hintergrund zu genießen. Die bunten und windschiefen Fachwerkhäuser schmiegten sich an die Hügel der Hunsrück-Ausläufer und erschienen dem Betrachter wie Teil einer liebevoll gestalteten Modellbaulandschaft. Als hätte sich ein begnadeter Künstler mit seinen Farbtupfen in der Landschaft verewigt, so wirkten die Blüten der Geranien in den Blumenkästen der Häuser am Ufer.
Wilfried Gerber ruderte bis zur Mitte des Flusses, dann legte er die beiden Ruder ins Boot und streckte die Beine von sich. Er ließ den Blick über das atemberaubende Moselpanorama schweifen. Aus der Ferne vernahm er das Singen von Lkw-Reifen. Als er den Kopf nach links wandte, sah er einen Sattelzug, der in Richtung Trier unterwegs war und eine Kette von Pkws hinter sich herzog.
Der Kleinkrieg auf der Bundesstraße am Moselufer interessierte ihn nicht im Geringsten. Die seichten Wellen der Mosel plätscherten gegen den hölzernen Rumpf seines Bootes, über seinem Kopf zog ein Greifvogel kreischend seine Bahnen. Wilfried Gerber schloss die Augen und atmete tief durch. Der laue Wind duftete nach Wein und Früchten. Diesen Duft gab es nur hier, in seiner Heimat. Hier lagen seine Wurzeln, hier fühlte er sich geborgen. Als Ortsbürgermeister des kleinen Moseldorfes Enkirch kümmerte er sich neben seinem Beruf noch um die Belange des Dorfes. Wilfried Gerber war an der Mosel aufgewachsen, und er würde sicherlich auch hier sterben.
Ein Geräusch ließ ihn auffahren. Wilfried Gerber öffnete die Augen und suchte das Moselufer ab. Er befand sich in der Mitte des Flusses, kurz vor Pünderich. Linker Hand erhob sich die Steillage der Pündericher Marienburg; majestätisch thronte das Gemäuer auf dem Bergrücken. Rechts erblickte Gerber bereits die kleine Imbissecke an der Einfahrt des Campingplatzes. An den Tischen herrschte kein Betrieb, was ihn verwunderte. Normalerweise traf man sich hier abends zu einem kühlen Bier, doch heute war der Imbiss verwaist. Der Fährmann hatte pünktlich um 17 Uhr den Fahrdienst eingestellt; wer jetzt noch an das andere Moselufer gelangen wollte, musste bis Zell fahren, um die Brücke zu nehmen. An dieser Stelle war die Mosel rund vierzig Meter breit, und er befand sich noch immer fast genau in der Mitte des Flusses. Ein Auto parkte mit laufendem Motor und geöffneten Türen beim Anleger, doch von einem Boot, das hier zu Wasser gelassen werden sollte, fehlte jede Spur. Der Fahrer des Autos lehnte lässig zwischen Dach und Türe und blickte durch die gespiegelten Gläser seiner Sonnenbrille genau in Gerbers Richtung.
Am Ufer waren zwei Schwäne auf der Suche nach Nahrung. Sie ließen sich weder von dem Mann am Auto noch von Gerber aus der Ruhe bringen. Nachdem die großen Vögel beides neugierig betrachtet hatten, setzten sie ihre Futtersuche am Ufer fort. Heute gab es keine Touristen, die sie mit trockenem Brot fütterten. Gerber glaubte in der Stille sogar das leise Schnattern der Schwäne zu hören.
Gerber spürte, dass hier etwas nicht stimmte. Sein Puls beschleunigte sich, als er den zweiten Mann, anscheinend den Beifahrer des dunklen Kombis, erblickte. Er stand neben einem Busch am Ufer, dessen Zweige bis ins Wasser reichten. Von den Fachwerkhäusern in seinem Rücken und von der Promenade aus war der Mann nicht zu sehen – er hatte seine Position mit Bedacht gewählt, so viel stand für Gerber fest. Der Fremde führte nichts Gutes im Schilde. Er blickte in Gerbers Richtung, verharrte nahezu regungslos an der Stelle. Jetzt hob er den rechten Arm. In seiner Hand blitzte im Licht der tief stehenden Sonne ein metallischer Gegenstand auf, den Gerbers geschulter Blick sofort als Waffe erkannte.
Die Absicht der Männer am Moselufer stand zweifellos fest: Gerber sollte sterben.
Der Mann setzte an, blickte über die Zielvorrichtung aufs Wasser, genau in Gerbers Richtung.
Gerber schien es, als wäre die Welt unter einer Schallschutzglocke verschwunden. Tödliche Stille umgab ihn, die nur vom Glucksen des Wassers, das gegen den Rumpf schwappte, unterbrochen wurde.
Der Hahn der Waffe klickte überlaut.
Gerber spürte, wie ihm siedend heiß wurde. Panisch blickte er sich um. Auf dem Wasser war er ausgeliefert, daran bestand kein Zweifel. Weglaufen oder ducken konnte er sich nicht, um dem Schützen auszuweichen. Und mit dem kleinen Boot konnte er keine Haken schlagen. Dennoch wollte sich Gerber seinem Schicksal nicht widerstandslos ergeben. Ein gehetzter Blick ins Wasser. Der Fluss führte nicht sonderlich viel Wasser, doch die Flucht zu Fuß würde ihm wohl auch nicht gelingen. Und ob er schwimmend noch das Ufer erreichen würde, wagte er zu bezweifeln. Auf der Mosel fühlte er sich wie auf dem Präsentierteller. Selbst wenn er das Boot als Schild nutzen würde, war er dem Geschoss schutzlos ausgeliefert, denn die dünne Wandung bot keinen Schutz vor einer Kugel.
Wilfried Gerber riss die Arme hoch. „Machen Sie keinen Unsinn“, gellte seine Stimme über den Fluss.
Eine Antwort erhielt er nicht. Der Mann am Ufer entsicherte die Waffe, und Gerber konnte trotz der Entfernung genau erkennen, wie sich der Zeigefinger des Fremden um den Abzug krümmte. Trotz der Panik, die ihn ergriffen hatte, saß er wie gelähmt in seinem Boot und war nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen. So war er zu einem Zuschauer in einem tödlich ausgehenden Spiel geworden.
Der Schuss peitschte durch das Moseltal und hallte von den Weinbergen zurück. Während sich Gerber fragte, ob denn niemand den Schuss gehört hatte, glaubte er von innen heraus zu explodieren. Sein Arm ruckte hoch, er fasste sich an die Stelle des Oberkörpers, die er als Quelle des tödlichen Schmerzes lokalisiert hatte. Seine Kleidung klebte von seinem eigenen Blut, das nun zwischen seinen verkrampften Fingern hindurchsickerte. Gerber wollte schreien, doch ein dicker Kloß in seiner Kehle hinderte ihn daran. Nur ein kehliger Laut kam über seine spröden Lippen. Nun schien sein ganzer Körper in Flammen zu stehen. Tausend winzige Nadeln bohrten sich in seinen Leib und zerstörten ihn. Der Schmerz lähmte Gerbers ganzen Körper, und er fühlte, wie seine Knie weich wurden. Leblos sackte er in sich zusammen. Das Boot geriet ins Schwanken und drohte zu kentern. Für den Bruchteil einer Sekunde hatte er die Wahl zwischen einem schmerzhaften Tod durch Verbluten oder durch Ertrinken. Im nächsten Augenblick schlug er mit dem Hinterkopf an der Kante des hölzernen Bootsrumpfes auf. Seine Knochen knackten, und er sah Lichtblitze vor den Augen, dann wurde es dunkel um ihn herum. Das Letzte, das er gesehen hatte, war der wolkenlose Abendhimmel über der Mosel. Niemand beachtete die beiden Schwäne, die sich mit einem aufgeregten Flügelschlag in den Abendhimmel erhoben.
Fast andächtig lauschte sie dem Surren der grobstolligen Reifen ihres Mountainbikes, während sie den befestigten Weg entlang des Moselufers in Richtung Zell radelte. Viel zu lange schon hatte sie auf ihren Sport verzichtet, doch an diesem lauen Sommerabend hatte Bettina Bender das Rad aus dem Schuppen ihres Hauses an der Sponheimer Straße geholt und war losgeradelt. Hinunter zum Fluss, wo es einen gut ausgebauten Weg entlang der Mosel gab.
Um diese Zeit waren die Touristen, die das Flussufer tagsüber bevölkerten, in ihren Ferienwohnungen verschwunden. Oder sie saßen in geselliger Runde in einem der Gasthöfe und Straußwirtschaften beisammen und ließen es sich bei einem edlen Tropfen aus den Steil- und Hanglagen gut gehen. So herrschte eine idyllische Stille am Fluss, und Bettina Bender atmete tief durch und genoss den lauen Sommerwind, der durch ihr Haar strich.
Nach zwei Kilometern war sie mit der Landschaft allein und fand Zeit zum Nachdenken. Die letzten Wochen und Monate waren aufregend gewesen. Sie hatte ein neues Leben begonnen. Der Job im Gemeindebüro von Enkirch war sicher nicht ihr Traumjob, und reich werden würde sie mit der Bürotätigkeit auch nicht gerade, aber die Stelle war krisensicher und sie konnte damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Ihr Traum von der eigenen Galerie, die sie bis vor kurzer Zeit in Trier geführt hatte, war geplatzt wie eine Seifenblase. Und so hatte sie sich schweren Herzens entschlossen, das Ladenlokal zu kündigen. Die Malerei würde sie fortan in ihrer Freizeit betreiben müssen. Eigentlich war es ganz gut, wie es gekommen war. Das Einzige, was ihr zum Glück noch fehlte, war ein Mann an ihrer Seite. Sie war keine zwanzig mehr, und es war höchste Zeit, dass ihr der Traumprinz, mit dem sie den Rest ihres Lebens verbringen konnte, über den Weg lief.
Mit Mitte dreißig waren die meisten Männer bereits vergeben, und der Markt schrumpfte zusehends.
Bettina kam es vor, als würde sie das Leben in Sachen Liebe nur aus der zweiten Reihe mitverfolgen, ohne aktiv daran teilzuhaben. Sie erwischte sich dabei, in Gedanken die Männer aus ihrem gesellschaftlichen Umfeld auf ihre Verfügbarkeit abzufragen. Diejenigen, die noch nicht vergeben waren, konnte sie sich beim besten Willen nicht als Traumprinzen vorstellen. Also würde sie vorerst Single bleiben. Den Mut, eines Tages doch noch ihren persönlichen Mr. Right kennenzulernen, hatte sie noch nicht verloren.
Inzwischen war sie gut vorangekommen. Nachdem sie die Ortschaften Reil und Burg passiert hatte, führte sie ihr Weg nach Pünderich. Als passionierte Mountainbikerin beherrschte sie den runden Tritt und konnte sich darüber freuen, dass sich ihr Kreislauf nach den ersten Kilometern bereits wieder normalisiert hatte. Links glänzte der Fluss im Licht der untergehenden Sonne, und die Weinberge auf dem gegenüberliegenden Ufer schienen rot zu glühen. Die üppigen Rebstöcke setzten farbig-grüne Akzente in der wildromantischen Landschaft.
An dieser Stelle führte der gut ausgebaute Weg direkt am Moselufer entlang. Der unbefestigte Rand war teils von dichten Sträuchern bewachsen, deren Zweige bis ins Wasser reichten. Der Fähranleger von Pünderich kam in Sicht. Etwas am Ufer irritierte sie. Bettina drosselte das Tempo und warf einen Blick nach links. Sie stockte, als sie ein Boot im Wasser dümpeln sah und bremste das Rad ab. Eine Person lag in verrenkter Haltung in der kleinen Nussschale, ein Arm hing über den Rumpf in den Fluss und trieb leblos auf der Wasseroberfläche.
Bettinas Atem ging rasselnd; sie musste dem Mann im Boot zu Hilfe eilen; vermutlich war er ohnmächtig geworden oder hatte einen Herzinfarkt erlitten. Die groben Reifen radierten über den Asphalt des Weges, dann stand das Mountainbike. Das kleine Ruderboot hatte sich in den Büschen am Ufer verfangen, und Bettina konnte aus der Entfernung nicht sehen, ob es dort befestigt war. Bettina sprang vom Rad und ließ es achtlos in das Gebüsch fallen. Sie bahnte sich eilig einen Weg durch das Dickicht und ignorierte den Schmerz, als ihre nackten Beine sich in den Stacheln der Brombeerbüsche verfingen. Als sie die Blätter einer Brennnessel streifte, zerdrückte sie einen Fluch auf den Lippen, dann hatte sie das Ufer erreicht.
„Oh mein Gott“, stieß sie hervor, als sie den Mann im Boot erreicht hatte. Er war groß und schlank, trug leichte Schuhe zur verblichenen Jeans. Das T-Shirt war zerfetzt, als wäre der Mann in einen Kugelhagel geraten. Sein Körper war von zahlreichen blutenden Wunden übersät. Auch das Gesicht wies unzählige rote Punkte aus, die wie die Pickel eines unter schwerer Akne leidenden Teenagers wirkten. Die Augen des Mannes standen offen und räumten die letzten Zweifel aus, dass er bereits tot war. Eine Fliege krabbelte über die blutleeren Lippen. Das Schlimmste war für Bettina jedoch, dass sie den Toten im Boot gut kannte. Bei ihm handelte es sich um Wilfried Gerber, den Ortsbürgermeister von Enkirch und somit um ihren Vorgesetzten.
Mit zitternden Fingern zog Bettina das Handy aus der Tasche ihres Shirts und wählte die Nummer des Polizeinotrufs.
ZWEI
„Urlaub?“ Günter Prangenberg blickte Bernd Kaltenbach an, als hätte der ihm in seiner Eigenschaft als Chefredakteur des Rhein Wied Express soeben das Unwort des Jahres vorgeschlagen.
Kaltenbach stand mit verschränkten Armen mitten im Raum und musterte seinen Brötchengeber sichtlich amüsiert. Das hellblaue Hemd, das sich über Prangenbergs üppigen Bauch spannte, war von Kaffeeflecken besudelt. Schon am frühen Morgen war es heiß und stickig im Büro. Prangenberg hatte den Knoten seiner Krawatte gelockert und den oberen Hemdsknopf geöffnet. Seine wachsamen Augen hatten sich zu Schlitzen verengt. Er führte den Kugelschreiber, mit dem er eben noch gespielt hatte, nachdenklich zu den Lippen, ohne seinen Reporter aus den Augen zu lassen. Stille war im Chefbüro eingekehrt.
Kaltenbach musterte seinen Vorgesetzten schweigend mit einer Mischung aus Mitleid und Wut.
„Du stellst ernsthaft einen Urlaubsantrag, Kaltenbach?“ Prangenbergs feistes Gesicht nahm eine tiefrote Farbe an, und Kaltenbach glaubte ein nervöses Zucken in seinem linken Augenwinkel zu erkennen. Sein Vorgesetzter erinnerte ihn an das hektische Vieh aus Ice Age, das ständig um seine Eichel bangte. Er fragte sich, wie das komische Geschöpf hieß.
„Du stellst dich an, als hätte ich meinen Jahresurlaub eingereicht“, murmelte Kaltenbach. „Nur ein paar Tage. Ich muss mal raus hier, und Flüge gibt es am Hahn schon für ’nen Appel und ein Ei.“ Er seufzte theatralisch. „Aber es tut gut zu wissen, dass der Laden hier ohne mich nicht läuft. Ich werde eine Gehaltserhöhung einreichen, denn wenn ich so unentbehrlich bin, dann muss sich das auch in meinem Geldbeutel bemerkbar machen.“ Kaltenbach rieb bezeichnend Daumen und Zeigefinger aneinander, und als Prangenberg mit hochrotem Kopf an einen Vulkan kurz vor dem Ausbruch erinnerte und wie ein gestrandeter Wal nach Luft schnappte, glitt Kaltenbachs Blick an Prangenberg vorbei aus dem großen Fenster im Rücken des Chefredakteurs. Von hier aus konnte man die Raiffeisenbrücke sehen. Der Rhein glitzerte im Sonnenlicht des Morgens. Erste Jogger liefen am Ufer entlang, einige Radfahrer lieferten sich mit rasanten Inlineskatern Wettrennen. Der Pegelturm ragte in einen fast wolkenlosen Himmel, und im Büro stand die Luft.
„Das Wetter ist einfach zu schön zum Arbeiten“, murmelte Kaltenbach, ohne den Blick von der Rheinpromenade abzuwenden.
„Klar“, polterte Prangenberg. „Weil die Sonne scheint, machen wir den Laden dicht und legen uns alle ins Freibad.“ Er hieb mit der flachen Hand auf den Schreibtisch und sprang von seinem Stuhl auf. Mit einem einzigen Schritt baute er sich neben Kaltenbach auf.
Der Reporter drehte den Kopf zu ihm um und sah, dass der Chefredakteur kurz vor dem Platzen stand.
Günter Prangenberg tippte sich an die Stirn. „Sag mal, geht es noch? Die Zeiten, in denen es hitzefrei gab, sind vorbei. Du bist nicht mehr in der Schule, hast du das noch nicht mitbekommen, oder hast du schon einen Sonnenstich?“
„Ein verlängertes Wochenende wird wohl drinliegen“, entgegnete Kaltenbach unbeeindruckt.
„Du willst also raus?“ Prangenberg nestelte an seinem Kragen herum. „Ich kann dir einen Kompromiss vorschlagen: Die Kollegen von der Lokalredaktion in Koblenz suchen dringend Verstärkung. Da hat die Sommergrippe zugeschlagen. Drei Leute sind ausgefallen, einer ist schon aus dem Urlaub geholt worden. Ich könnte ihnen vorschlagen, dass du ein paar Tage dort arbeitest.“
„Ich denke, ich bin hier unverzichtbar?“ Kaltenbach runzelte die Stirn.
„Die Personaldecke ist im gesamten Laden dünn – zu dünn“, wich Prangenberg aus.
Vor einigen Jahren hatte der gute alte Rhein Wied Express expandiert. So gab es eine eigene Lokalausgabe für die Rhein-Mosel-Region. Der Sitz der Redaktion befand sich in der Koblenzer Altstadt, einen Steinwurf vom Deutschen Eck entfernt.
Bernd Kaltenbach war seit der feierlichen Eröffnung des Rhein Mosel Express, wie die Ausgabe dort hieß, ein paar Mal dort gewesen. Aber er arbeitete seit vielen Jahren für das Haupthaus in Neuwied, und er hatte nicht vor, das zu ändern. „Du willst mich strafversetzen?“
„Unsinn.“ Prangenberg schüttelte den Kopf. „Ich muss zusehen, dass ich die Zeitung voll bekomme. Und das geht ohne Reporter und Redakteure nun mal nicht.“
„Schön, so etwas mal aus deinem Mund zu hören“, grinste Kaltenbach.
„Also – wann kannst du da sein?“ Prangenbergs Gesichtszüge entspannten sich ein wenig.
„In einer Stunde, wenn es sein muss.“
„Es muss, fürchte ich.“ Prangenberg kehrte zu seinem Schreibtisch zurück und griff zum Hörer. Er tippte eine Nummer ein, meldete sich und verkündete den Kollegen, dass sein Mitarbeiter in einer Stunde in Koblenz sei. Danach atmete er tief durch und blickte Kaltenbach dankbar an.
„Die Sache mit dem Kurzurlaub ist noch nicht vergessen“, schnaubte der Reporter und wandte sich ab. Während er das Büro verließ, fiel ihm der Name des hektischen Viechs ein, an den Prangenberg immer erinnerte: Scrat. So wie Scrat seiner geliebten Eichel hinterherjagte, so war der Chefredakteur des Rhein Wied Express immer auf der Jagd nach einer heißen Geschichte.
Prangenberg hat ab sofort einen neuen Spitznamen, beschloss Kaltenbach, dann ließ er seinen Chef alleine.
Gierig fraß die dunkelrote Honda CBX 750 den Asphalt der Bundesstraße 42. Bernd Kaltenbach duckte sich so tief wie möglich in den Windschatten der schweren Maschine und umklammerte den Lenker. Er schwitzte in seinem schwarzen Lederoutfit, doch nur selten verzichtete er auf die Schutzkleidung. Mit jedem Kilometer, den er auf seiner geliebten „Else“ zurücklegte, entspannte sich Kaltenbach ein wenig mehr. Jetzt wurde er schon als Springer eingesetzt, dachte er entnervt. Aber er konnte Prangenberg einfach keinen Gefallen abschlagen, und nun stand der aufbrausende Chefredakteur in seiner Schuld. Die Sache mit dem Urlaubsantrag hatte Kaltenbach nicht vergessen. Aber zunächst genoss er die Fahrt durch die Rheinebene und versuchte sich an der Landschaft zu erfreuen.
Nachdem er die Ortschaft Vallendar passiert hatte, erreichte er Urbar. Wenig später schon ragte links majestätisch der Ehrenbreitstein in die Höhe, während er rechts, am gegenüberliegenden Rheinufer gelegen, das Deutsche Eck sah. Bunt gekleidete Touristen erkundeten das Denkmal von Kaiser Wilhelm I. Er thronte auf dem massiven Sockel, der zwischen 1953 und 1990 als Mahnmal der Deutschen Einheit gedient hatte. Erst seit 1993 zierte der Kaiser wieder das Deutsche Eck und zog in den Sommermonaten täglich ganze Scharen von Touristen an. Nur die wenigsten Menschen wussten, dass es sich beim Deutschen Eck um eine künstlich angelegte Landzunge handelte, die man an der Stelle errichtet hatte, wo die Mosel in Vater Rhein mündete. Kaltenbach hielt sich rechts und gelangte über die Pfaffendorfer Brücke auf die andere Rheinseite. Von hier aus war es nur ein Katzensprung zur Altstadt, und er fand einen Parkplatz in einer schmalen Seitenstraße. Nachdem er die schwere Maschine aufgebockt hatte, zog er den Helm vom Kopf. Ein seichter Wind trug den Glockenschlag der Liebfrauenkirche an seine Ohren. Kaltenbach atmete tief durch und streckte sich, nachdem er seinen Helm im Koffer seines Motorrads verstaut hatte. Die Sonne drang nur vereinzelt durch die Kronen der Kastanien am Straßenrand.
Als eine miniberockte Blondine mit wiegenden Hüften an ihm vorbeistöckelte und ihm einen frechen Augenaufschlag schenkte, fand Kaltenbach die Vorstellung, in den nächsten Tagen in Koblenz zu arbeiten, gar nicht mehr so schlimm. Grinsend machte er sich auf den Weg zur Redaktion des Rhein Mosel Express, die im ersten Stockwerk eines sanierten Altbaus unweit des Jesuitenplatzes lag. Im Treppenhaus empfing ihn Stille und angenehme Kühle. Die erste Etage wurde von den Büroräumen der Zeitung eingenommen. Während im Treppenhaus das Flair längst vergangener Jahrhunderte herrschte, waren die Räumlichkeiten des Rhein Mosel Express modern eingerichtet. Die hohen und schmalen Fenster hatten die Kollegen freundlicherweise bereits geöffnet, und einige Tischventilatoren rotierten surrend auf den Schreibtischen und wirbelten immer wieder Papier auf, das raschelnd zu Boden segelte.
„Wir haben keinen Motorradkurier bestellt“, hörte er eine näselnde Stimme hinter sich.
Kaltenbach wandte sich auf dem Absatz seiner schweren Stiefel um und blickte in das blasse Gesicht eines schlaksigen Kollegen Anfang dreißig. Den obersten Knopf seines blütenweißen Hemdes hatte er geöffnet, auch die Ärmel waren hochgekrempelt.
„Ich bin kein Kurier, du Nase“, konterte Kaltenbach. „Ich bin euer Mann aus Neuwied.“
„Oh“, machte der Kollege ein wenig peinlich berührt. Er betrachtete Kaltenbach nachdenklich. „Dann müssen Sie Herr Kaltenbach sein.“
„Eins zu null“, nickte Bernd und reichte dem Kollegen die Hand.
„Mein Name ist Simon Dietz, ich bin Ressortleiter für …“
„Macht doch nichts“, entgegnete Kaltenbach mit seinem breitesten Grinsen und drückte fest zu, als er den lauen Händedruck seines Gegenübers spürte. Mit seinen breiten Schultern, den knapp zwei Metern Körpergröße, seinen halblangen dunklen Haaren und dem Dreitagebart war Kaltenbach rein optisch das exakte Gegenteil seines Gegenübers. Mit ein wenig Phantasie konnte Bernd sich vorstellen, dass Dietz noch bei Mutti lebte und dort kleine Brötchen backen musste. In Gedanken packte Kaltenbach den Kollegen in die Schublade Warmduscher.
Er blickte sich in dem Großraumbüro der Redaktion um. Graue Schreibtische, meist zwei gegenüber, in einer hinteren Ecke ein gläserner Tisch mit vier Stühlen, an der Wand ein Flipchart mit Notizen der letzten Redaktionskonferenz. Prangenberg hatte nicht übertrieben, denn es waren außer Kaltenbach und Dietz nur noch zwei Personen anwesend: Eine ältere Frau im adretten Kostüm mit einer Brille, die an einer Kette um den Hals hing und eine junge zierliche Frau, die so schüchtern schien, dass sie kaum von der Arbeit aufzublicken wagte. Kaltenbach schätzte das Mädchen auf Anfang zwanzig. Die langen braunen Haare hatte sie hinter dem Kopf zu einem Knoten zusammengebunden.
„Ist ja nicht gerade wegen Überfüllung geschlossen, der Laden“, stellte Kaltenbach fest.
„Deshalb unser Hilferuf an die Geschäftsleitung“, nickte Dietz. „Und wir sind sehr dankbar dafür, dass Herr Prangenberg sich bereit erklärt hat, Sie abzustellen und …“
„Ja ja, schon gut“, unterbrach Kaltenbach ihn. „Wie ich sehe, hast du die Ärmel ja schon hochgekrempelt. Dann lass uns mal loslegen, wir essen zeitig.“
Dietz war gleichermaßen pikiert und überrascht vom Tempo, das Kaltenbach an den Tag legte. Dennoch überspielte er seine Überraschung so gut es ging und führte Kaltenbach zu einem der zahlreichen verwaisten Schreibtische. „Sie können hier arbeiten.“
Kaltenbach zuckte die Schultern und setzte sich. Wenigstens befand sich sein neuer Arbeitsplatz in der Nähe eines geöffneten Fensters. Das Pfeifen von Spatzen drang ins Büro. „Was liegt denn an?“, fragte er Simon Dietz, nachdem er den Computer gestartet hatte.
Dietz blickte sich Hilfe suchend zu seiner jungen Kollegin um. „Melanie, kommst du mal?“
Das schüchterne Mädchen hob den Kopf und nickte. Sie nahm einen Ordner aus dem Ablagekorb auf ihrem Schreibtisch und erhob sich. Während sie sich Kaltenbachs neuem Schreibtisch näherte, hatte er Gelegenheit, die junge Kollegin zu betrachten. Sie war schlank und durchaus hübsch, trug ein luftiges Sommerkleid, das knapp über dem Knie endete. Im Gegenlicht der Sonne schimmerten ihre Beine durch den dünnen Stoff.
B-Körbchen, stellte Kaltenbach mit Kennerblick fest. Eine gute Handvoll. Ein hübsches Ding, fand er, wenngleich auch etwas zu jung für ihn. Dennoch registrierte er ihren neugierigen Blick.
Als sie den Schreibtisch erreicht hatte, machte Dietz die beiden miteinander bekannt. „Bernd Kaltenbach aus der Redaktion in Neuwied – das ist meine Kollegin Melanie Balmes.“
„Hallo Herr Kaltenbach.“ Sie lächelte ihn freundlich an.
Kaltenbach winkte mit einem jovialen Grinsen ab. „Bei uns sagt man unter Kollegen Du. Ich bin der Bernd.“
„Kannst Mellie zu mir sagen.“ Der lockere Umgangston, den Bernd an den Tag legte, schien ihr zu gefallen. Sie zog sich einen freien Stuhl heran, schlug die Beine übereinander und blätterte in ihren Unterlagen. „Wir haben hier eine ziemlich heiße Geschichte, die aber eine gründliche Recherche erfordert. Wenn wir falsche Fakten verbreiten, kommen wir in Teufels Küche.“
„Na, die Hölle soll doch immer schön warm sein“, erwiderte Kaltenbach. „Wer mich zum Teufel schickt, sollte den armen Kerl vor mir warnen!“ Dann wurde er ernst. „Worum geht es denn da?“
„Es gibt ein kleines Dorf an der Mosel. Alle Haushalte in diesem Dorf beziehen ihr Trinkwasser aus einem Bach, der in die Mosel mündet.“
„Wie schön“, erwiderte Kaltenbach und lehnte sich zurück. „Dann gibt es ja doch noch so etwas wie Idylle in unserem schönen Rheinland-Pfalz.“
„Leider weit gefehlt.“ Mellie schüttelte den Kopf. „Die Menschen beobachten seit einigen Tagen immer wieder tote Fische, die dort im Wasser treiben. Und nun ist die Sorge groß, dass das Wasser des Baches vergiftet sein könnte.“
„Das liegt auf der Hand. Aber so etwas lässt sich doch mit Messungen herausfinden“, erwiderte Kaltenbach.
„Allerdings. Es wurden bereits Messungen vorgenommen, und alles scheint im grünen Bereich zu liegen. Doch man traut den Ergebnissen nicht. Und eine Ursache müssen die toten Fische im Bach von Enkirch ja haben.“
Beim Namen Enkirch wurde Bernd hellhörig. Viele Erinnerungen verbanden ihn mit dem kleinen Dorf. Erinnerungen an ein verschlafenes Weindorf, die er fast schon wieder vergessen hatte. Doch dies war nicht der Augenblick, um über seine Kindheit zu sinnieren, und so konzentrierte er sich auf die Geschichte, die ihm die Kollegen vorstellten. „Gibt es denn Industrie in der Umgebung des Baches, die eventuell ihre Abwässer in den Bach leitet?“
„Industrie ist gut.“ Dietz lachte, als hätte Kaltenbach einen köstlichen Witz gemacht. Dann wurde er ernst. „Oberhalb des Dorfes liegt der Flughafen Hahn.“
„Da wollte ich sowieso mal hin, wegen der billigen Flüge.“
Dietz ging nicht auf seine Bemerkung ein. „Die Bewohner des Dorfes behaupten nun, dass die Betreibergesellschaft des Flugplatzes ihre verunreinigten Abwässer in den Ahringsbach leitet. Das wird natürlich vehement abgestritten. Die Gesellschaft droht mit Klagen wegen Rufschädigung, und nun sind die Betroffenen eingeschüchtert. Dass ein großes Unternehmen wie die Betreibergesellschaft eines Flugplatzes gute Anwälte hat, muss ich wohl nicht erwähnen.“
„Nee, musste nicht.“ Kaltenbach winkte ab. „Gibt es denn keinen Widerstand aus dem Volke mehr? Keine Bürgerinitiative, nichts?“
„Fehlanzeige.“ Melanie Balmes blätterte in ihrem Hefter und schüttelte den Kopf.
„Dann lässt das zwei Schlüsse zu: Entweder die Leute sind gekauft und bestochen, oder sie trauen sich einfach nicht, gegen eine Macht wie den Flughafen anzustinken.“ Kaltenbach holte tief Luft. „Und was ist das jetzt für eine heiße Story? Wir können über tote Fische in diesem …“
„Ahringsbach“, half Dietz.
„Ahringsbach berichten“, nahm Kaltenbach den Faden auf. „Das wäre eine reine Berichterstattung über die Fakten. Darüber wird sich niemand beschweren können, auch nicht diese findigen Rechtsverdreher der Flughafengesellschaft.“
„Wir möchten Licht ins Dunkel bringen“, erwiderte Mellie. „Wer steckt hinter dieser Geschichte? Gibt es vielleicht eine Chemiefabrik, die ihre Lkw im Bach leert oder so etwas?“
„Soll ich mich am Ahringsbach Tag und Nacht auf die Lauer legen und warten, bis ich etwas Verdächtiges beobachte?“ Kaltenbach glaubte an einen schlechten Scherz. „Prangenberg reißt mir die Eier ab, wenn er erfährt, dass ich …“ Er brach ab und murmelte eine Entschuldigung.
„Unsere Hoffnung, insofern man in einem solchen Fall von Hoffnung sprechen darf, ist, dass doch die Betreibergesellschaft hinter dieser Schweinerei steckt und wir einen großen Umweltskandal aufdecken können. Damit wäre unser Blatt ganz vorn dabei, und die Kollegen vom Trierischen Volksfreund und der Rheinzeitung würden in die Röhre gucken.“ Mellie grinste verschmitzt, und Kaltenbach sah ihr förmlich an, dass sie von einer großen Karriere als Skandalreporterin träumte.
„Das Problem ist aber der Krankenstand hier im Haus“, kam Dietz zum wesentlichen Problem der kleinen Redaktion zurück. „Man müsste vor Ort recherchieren und mit den Menschen an der Mosel sprechen. Aber wir sind jetzt schon total überlastet.“ Nun lächelte er Kaltenbach an und bekam rote Ohren. „Wir dachten, dass Sie, ich meine, dass du vielleicht an die Mosel fahren könntest, um …“
„Ich soll euch die Kohlen aus dem Feuer holen?“
„So würde ich das nicht sagen, ich …“ Dietz suchte nach den richtigen Worten und blickte Hilfe suchend zu Mellie. Sie war in den Unterlagen auf ihren Knien vertieft.
Kaltenbach überlegte. Vielleicht fand er in Enkirch tatsächlich etwas heraus. Eine Ursache musste das Fischsterben im Ahringsbach ja haben. Und er musste sich nicht mit diesen Weicheiern in der Redaktion herumärgern. Grinsend streckte er die Hand aus und ließ sich von Mellie den Ordner aushändigen. „Dann gib mal her.“
Sie hatte keine Einwände.
„Du übernimmst das also?“, fragte Dietz mit einem leichten Zögern in der Stimme. Wahrscheinlich hatte er es sich schwerer vorgestellt, den Kollegen aus Neuwied wieder loszuwerden, um seine Drecksarbeit machen zu lassen.
Kaltenbach erhob sich. „Klar. Ich fahr mal runter und seh‘ mir das an.“ Er durchquerte mit weit ausholenden Schritten die Redaktion und nickte der älteren Kollegin, die gerade telefonierte, zu.
Mellie war aufgesprungen und folgte Kaltenbach. „Warte“, rief sie. „Ich komme mit!“
Kaltenbach zögerte. „Wozu?“
„Du bist Reporter, ich Fotografin. Ich finde, wir sollten zusammen losziehen.“
Kaltenbach blieb mit der Mappe unter dem Arm stehen und blickte sie an. Dann schüttelte er den Kopf. „Nee, lass mal. Ihr seid jetzt schon unterbesetzt. Wenn ich dich mitnehmen würde, gibt das Ärger mit Prangenberg. Und das wollen wir doch nicht, oder?“
Mellie schüttelte enttäuscht den Kopf.
„Außerdem habe ich keinen Kindersitz auf der Honda. Also musst du hier warten.“ Ohne eine Antwort abzuwarten, stand Kaltenbach wieder im kühlen Treppenhaus. Er dachte kurz nach, dann entsann er sich einer alten Freundin, die er vielleicht zu Rate ziehen konnte. Doch jetzt musste er erst einmal an die Mosel fahren. Und er durfte keine Zeit verlieren.
DREI
Die Mittagssonne brannte unbarmherzig vom wolkenlosen Himmel herunter, als er das Ortseingangsschild von Enkirch passierte. Für die Fahrt von Koblenz an die Mittelmosel hatte er eine knappe Stunde benötigt. Mit dem Motorrad hatte er die gemächlich dahinschleichenden Wohnmobile der Touristen überholen und Zeit gewinnen können. Die Fahrt hatte durch viele malerische Ortschaften geführt, die auf bunt bemalten Schildern ihre Besucher „Herzlich willkommen“ hießen und zur Weinprobe einluden. Im Moseltal reihte sich ein Weindorf an das nächste, und eingebettet von Reben ragten steile Felsklüfte hinunter bis ins Tal. Ausflugsschiffe zogen auf dem Fluss ihre Bahnen, und Kaltenbach war eigentlich nicht nach Arbeiten zumute. Er drosselte das Tempo und verließ in einem schnittigen Bogen die Bundesstraße. Mit gemäßigter Geschwindigkeit drehte er zunächst eine Ehrenrunde durch das Dorf. Enge Gassen, verwinkelte Straßen, die von romantischem Fachwerk und üppigen Blumen gesäumt wurden, weckten Erinnerungen in ihm. Bernd fragte sich, wie lange er nicht mehr in Enkirch gewesen war. Es mussten fast zehn Jahre sein. Damals war sein Onkel gestorben, den sie alle nur den Sponheimer Spinner genannt hatten. Ein eigenbrötlerischer Typ, der sich als Lehrer in Traben-Trarbach seinen Lebensunterhalt verdient hatte. Mit der eingeschworenen Dorfgemeinschaft hatte er nichts am Hut gehabt, und als er tot im Ahringsbach gefunden worden war, hatte die Polizei vor einem Rätsel gestanden, denn der alte Kaltenbach war ermordet worden. Und natürlich hatten sich die Menschen im Dorf das Maul über den Mord zerrissen. Immer wieder hatte man „es musste ja mal so kommen“ hinter Kaltenbachs Rücken geraunt. Und Bernd hatte das Erbe, das ihm rechtmäßig zugestanden hatte, dankend abgelehnt. Was sollte er auch mit einem zweiten Haus? Er lebte in seinem windschiefen Fachwerkbauernhaus in Rossbach, das er sich selber saniert und eingerichtet hatte. Und nichts und niemand würde ihn von diesem Ort wegbewegen können.
Bernd verdrängte die Erinnerungen so gut es ging. Rechter Hand gab es immer noch die kleine Pizzeria, dann folgte der Getränkehandel, in dem der Sponheimer Spinner sich immer versorgt hatte. Kaltenbach passierte das Restaurant „Dampfmühle“, dann führte sein Weg ins Oberdorf. Ein verwittertes Schild auf der linken Seite verkündete, dass er sich nun im Bezirk Sponheim befand. Eine alte Frau kehrte den Bürgersteig und blickte ihm mit misstrauischem Blick nach, bis er mit seinem Motorrad hinter der nächsten Kurve verschwunden war. Nachdem Bernd seine Ehrenrunde beendet hatte, wendete er die Honda und rollte ins Unterdorf zurück. Am Ortseingang gab es das Gemeindebüro. Kaltenbach fuhr also zum Brunnenplatz und stellte die Honda ab. Nachdem er Handschuhe und Helm abgestreift hatte, blinzelte er in die Sonne. Ein wenig steif marschierte er auf das Bürogebäude zu und stellte erfreut fest, dass es nicht geschlossen war. Kaltenbach fand sich in einer Art Wartezimmer wieder. Hinter einem Empfangstresen erblickte er eine Frau in seinem Alter. Sie bearbeitete eine Tastatur und blickte konzentriert auf den dazugehörigen Monitor.
„Bin gleich bei Ihnen“, murmelte sie, ohne aufzublicken. Die Frau trug die rotblonden Haare pfiffig kurz, war durchaus hübsch und hatte ein dezentes Make-up aufgelegt, das ihre grünen Augen vorteilhaft betonte. Dass er Bettina ausgerechnet hier wiedersehen würde, hatte er nicht erwartet. Aber er gab sich Mühe, seine Überraschung zu unterdrücken.
„Ist gut.“ Bernd trat näher und beobachtete sie amüsiert. Die obersten Knöpfe ihrer karierten Bluse standen offen und gewährten ihm einen tiefen Einblick. Das, was der dünne Stoff ihrer Bluse kaum zu bändigen vermochte, kannte er bereits seit Langem. Er betrachtete sie und stellte fest, dass die irgendwie traurig wirkte. Ihr hübsches Gesicht war starr wie eine Maske, und das Make-up schaffte es kaum, die dunklen Ringe unter ihren Augen zu kaschieren. Kaltenbach spürte, wie das schlechte Gewissen in ihm aufstieg. Lag das alles noch an damals? An ihm? War sie nach all den Jahren noch nicht darüber hinweggekommen, dass er sie einfach so verlassen hatte?
Es verging eine knappe Minute, bis Bettina Bender zu ihm aufblickte. Als sie erkannte, wer vor ihr stand, wurden ihre Augen groß. Sie sprang von ihrem Stuhl auf und warf ihn dabei fast um. „Bernd?“, fragte sie. „Bist du es wirklich?“
„Es scheint so“, nickte er mit einem jungenhaften Grinsen. Die Selbstzweifel waren verfolgen. „Kannst mich ja kneifen, wenn du deinen Augen nicht traust.“
„Unsinn!“ Sie umrundete den Tresen und drückte ihn herzlich. Als sie zu ihm aufblickte, schien es Bernd, als blicke sie bis tief in seine Seele. Ihre Miene war ernst geworden. „Du blödes Arschloch“, sagte sie vorwurfsvoll. „Einfach so abzuhauen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dich zu hassen!“
So etwas hatte Kaltenbach befürchtet. Also doch, dachte er reumütig. Er war kein sentimentaler Mensch und hasste Abschiedsszenen. Deshalb hatte er Enkirch damals still und heimlich verlassen, nachdem der Mord an seinem Onkel aufgeklärt war und alle Formalitäten mitsamt einer Bestattung auf dem Friedhof des Dorfes überstanden waren. Wenn er Enkirch nach der kurzen aber stürmischen Affäre mit Bettina Bender nicht verlassen hätte, wäre er jetzt wahrscheinlich verheiratet und stolzer Familienvater. Einmal mehr wurde er sich bewusst, dass er der geborene Junggeselle war. Er liebte das Leben so wie es war: Mit viel Freiheit und der Gewissheit, niemandem Rechenschaft ablegen zu müssen, wenn er einmal später am Abend nach Hause kam. Natürlich spielten Frauen in seinem Leben eine entscheidende Rolle, doch daran, eine seiner zahlreichen Freundinnen zu heiraten, hatte er nie gedacht. Kaltenbach war ein einsamer Wolf.
„Aber du bringst es nicht übers Herz, mich zu hassen“, brach er das Schweigen, das zwischen ihnen eingekehrt war.
„Und ob. Darüber reden wir noch.“ Sie hob mahnend den Zeigefinger, und Bernd musste lachen. Er erwischte sich bei der Frage, ob sie so auch mit ihren gemeinsamen Kindern geschimpft hätte, wenn es sie denn geben würde. „Also“, sagte Bettina. „Was treibt dich an die schöne Mosel? Heimweh? Die Sehnsucht nach mir wird es nach neun Jahren ja wohl kaum gewesen sein“, fügte sie vorwurfsvoll hinzu.
Kaltenbach machte erst eine wegwischende Handbewegung und zuckte dann ein wenig hilflos die Schultern. „Ich bin beruflich hier.“
„Schreibst du noch für das Käseblättchen?“ Ironie schwang in ihrer Stimme mit. An ihrem Arbeitsplatz schlug das Telefon an. Sie blickte kurz zum Schreibtisch und ignorierte das Klingeln dann.
„Vorsichtig, der Rhein Wied Express hat in den letzten Jahren stetig expandiert“, erwiderte Bernd. „Und genau deshalb bin ich hier. Im Moment helfe ich den Kollegen in der Koblenzer Redaktion ein wenig. Und die haben mir eine irrwitzige Geschichte erzählt.“
„Schieß los.“
„Nicht hier.“ Er blickte sich um. Das Vorzimmer des Gemeindebüros schien ihm nicht der richtige Ort zu sein, um über verseuchtes Trinkwasser zu sprechen. „Ich habe Hunger.“
„Ganz der Alte“, lachte Bettina. „Immer hungrig und trotzdem kein Gramm zu viel auf den Hüften.“ Sie kniff ihn durch die Lederkluft in die Taille.
„Danke für die Blumen. Also was ist – ich lad dich zum Essen ein, dann können wir reden.“
„Und die alten Zeiten aufleben lassen?“ Ihre grünen Augen funkelten ihn an.
„Auch das, wenn du magst“, antwortete er.
Bettina warf einen Blick auf die große Wanduhr. „Du hast Glück“, sagte sie dann. „Ich habe Feierabend. Also los – führ eine enttäuschte Geliebte mal anständig aus!“
Bernd sparte sich eine Antwort. Auf Vorwürfe hatte er nun wirklich keine Lust. Hätte er geahnt, dass er Bettina Bender hier im Gemeindebüro antraf, wo er recherchieren wollte, hätte er Mellie vorgeschickt. Aber nun war es zu spät, und Kaltenbach stellte sich seinem Schicksal. Und dennoch spürte er, dass mit Bettina etwas nicht stimmte. Er beschloss, sie bei passender Gelegenheit darauf anzusprechen.
Durch die verwinkelten Gassen von Enkirch hatte sie ihn zu Renks Straußwirtschaft in der Sonnenstraße geführt. Auf dem kurzen Fußmarsch durchs Dorf hatten sie kaum geredet, und Kaltenbach hatte die Stille genossen. Schweigen war ihm augenblicklich lieber als endlose Diskussionen über eine längst vergangene Liebe. In der Sonnenstraße angekommen, kehrten sie in den „Churtrierschen Weinhof“, wie Renks Gasthof auch hieß, ein und suchten sich einen der wenigen freien Plätze im Innenhof des Weingutes. Der urig eingerichtete Schankraum war verwaist, doch Kaltenbach erinnerte sich daran, hier früher einmal mit seinen Verwandten gesessen zu haben. Doch das war lange her, und eigentlich hatte er mit der Vergangenheit seiner Familie längst abgeschlossen.
Die freundliche Kellnerin brachte ihnen die Speisekarte an den Tisch.
„Null acht fünfzehn gibt es hier nicht“, bemerkte Bettina lächelnd, als sie Kaltenbachs verwundertes Gesicht sah. „Auf Fritten und Currywurst musst du wohl verzichten.“
„Das macht gar nichts“, erwiderte Kaltenbach und strich sich bezeichnend über den Bauch.
Nachdem Bettina ihm vom selbst gemachten frischen Flammkuchen vorgeschwärmt hatte, lief ihm das Wasser im Mund zusammen. Sie bestellten zwei Portionen bei der Bedienung, eine Weinschorle für Bettina und ein Bier für Kaltenbach. Danach genossen sie das Ambiente im Innenhof des Gutes. Bernd blieben Bettinas neugierige Seitenblicke nicht verborgen. Doch er ließ sie beginnen und schwieg.
„Also gut“, machte sie schließlich den Anfang. „Der Job treibt dich also nach Enkirch? Hätte ich mir nach all den Jahren auch denken können. Die Sehnsucht nach mir wird es wohl kaum gewesen sein.“ Ihre Stimme klang verbittert.
Er grinste verkniffen, denn der Vorwurf war ihm unangenehm. „Erzähl zuerst von dir: Warum arbeitest du im Gemeindeamt?“ Er erinnerte sich daran, dass Bettina eine begnadete Malerin war. Vielleicht gelang es ihm so, sie von ihren Vorwürfen abzubringen und sie ein wenig aufzuheitern. Bettina hatte damals eine kleine Galerie in Trier geführt. „Hast du die Galerie in Trier nicht mehr?“
Sie schüttelte den Kopf. „Kunst ist wohl nicht so angesagt zur Zeit. Die Leute müssen sparen und investieren ihr knapp gewordenes Geld in wichtigere Dinge als in Bilder, die sie sich in ihre Wohnung oder ihr Haus hängen können. Wie sagt man immer so schön? Kunst kann man nicht essen, und ich konnte irgendwann nicht mehr davon leben. Also hab ich die Reißleine gezogen, bevor es zu spät war. Frau Conradi, die seit vielen Jahren im Gemeindeamt gearbeitet hatte, ging in den Ruhestand, und die Stelle wurde frei. Da habe ich zugeschlagen. Nun vermittele ich den Touristen Zimmer und Ferienwohnungen, erledige den anfallenden Bürokram und war die rechte Hand des Ortsbürgermeisters.“
Die Bedienung brachte die Getränke; sie prosteten sich zu und tranken schweigend.
Kaltenbach war nicht entgangen, dass Bettinas grüne Augen feucht schimmerten. Er hatte Bettina, seine Jugendliebe, als taffe Frau in Erinnerung gehabt. Und nun schien sie dem Verkauf ihrer Galerie nachzutrauern.
„So schlimm?“, fragte er ein wenig hilflos.
Bettina nickte stumm und kämpfte gegen die Tränen an. Eine Kellnerin trat an den Tisch und brachte das dampfende Essen. Sie wünschte ihnen freundlich einen guten Appetit und verschwand wieder.
Kaltenbach hasste Sentimentalitäten. Damit konnte er nur schwer umgehen. Und dass Bettina hier und jetzt weinte, ging ihm näher als ihm lieb war. Ihre letzten Sätze gingen ihm durch den Kopf. „Moment“, rief er dann. „Warum sagtest du, du warst die rechte Hand des Ortsbürgermeisters?“
„Er ist tot“, antwortete Bettina leise und nestelte an der Papierserviette herum. „Ermordet. Gestern hat man ihn erschossen. Und ich habe seine Leiche gefunden.“ Aus ihrem hübschen Gesicht war jede Farbe gewichen. „Er sah so schrecklich aus, wie er da im Boot gelegen hat.“
„Das musst du mir erklären“, sagte Kaltenbach, mehr, um überhaupt etwas zu sagen.
Bettina berichtete ihm vom kaltblütigen Mord an ihrem Vorgesetzten, und Bernd unterbrach sie kein einziges Mal.
„Hat die Polizei den Mörder schon gefasst?“, fragte er, nachdem sie ihre Ausführungen beendet hatte.
Wieder schüttelte sie den Kopf. „Nein“, sagte sie leise. „Es war doch erst gestern.“