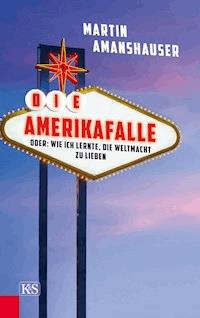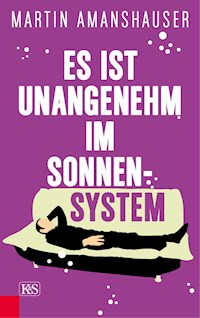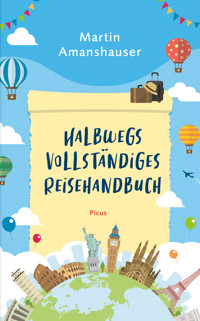
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Picus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Martin Amanshauser ist weit gereist. Im Laufe seines Lebens hat er mehrfach den Planeten umrundet und so gut wie alle Länder der Welt besucht. Wer wäre also berufener, ein Reisehandbuch zu schreiben, als er? Er erzählt von allen Aspekten des Reisens respektive Fortbewegens: von Fußgängern und Ampeln, einem spektakulären Navigations-Fail, Interrail-Erfahrungen und davon, warum Flugzeugschläfer angesehener sind als Busschläfer. Neben historischen Anekdoten übers Daheimbleiben gibt Amanshauser auch Tipps, wohin man auf keinen Fall und wohin man auf jeden Fall reisen sollte. Er berichtet von Begegnungen mit Einheimischen, von ethischem Tourismus und Folgen für das Klima, von Rollkoffern und Fortschritten der Kartographie, von einer Reisekrankheit, die gar keine war, und einer Insel, die nie existiert hat. Ein ebenso kluges wie amüsantes Brevier des Reisens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Copyright © 2025 Picus Verlag Ges.m.b.H.
Friedrich-Schmidt-Platz 4/7, 1080 Wien
Alle Rechte vorbehalten
Grafische Gestaltung: Buntspecht, Wien
Umschlagabbildung: © Barks / Shutterstock
ISBN 978-3-7117-2160-0
eISBN 978-3-7117-5538-4
Informationen über das aktuelle Programm des Picus Verlags und Veranstaltungen unter www.picus.at
Martin Amanshauser
HALBWEGS VOLLSTÄNDIGES REISEHANDBUCH
Picus Verlag Wien
INHALT
FRAGEBOGEN
MEINE VERHASSTEN GRENZEN, MEINE SUSPEKTEN REISEN
AMPEL
AUTOS
BALLON
BERGGORILLAS
BETTLER
BETTWANZEN
BHUTAN
BILLIGLINIE
BOYKOTT
BUCHUNGSZEITPUNKT
BUSCHFEUER
BUSFAHRER
BUSINESSREISENDER
BUSSCHLÄFER
CARVING
CHINA-RASSISMUS
DAHEIMBLEIBEN
DEUTSCHE GÄSTE
DIA-ABEND
DURCHFALL
EINWANDERUNGSINSEL
ELEFANTENRENTE
ENTWICKLUNGSHILFE
EU-PARLAMENT
FEMIZIDE
FLAT EARTHER
FLIP FLOP
FLIPPER
FLUGBUCHUNG
FLUGLOB
FLUGSCHAM
FRAUENREISE
FRIEDHOF
FUSSBALL
GASTFREUNDSCHAFT
GEFAHREN
GEISTERINSEL
GELÄNDE
GELD
GEPÄCK
GLOBUS
GRAFFITI
GYROCOPTER
HAIFISCH
HANDTUCHKRIEG
HEADLESS MIKE
HELMPFLICHT
HIMALAYA
HIPPIE TRAIL
HOTELZIMMER
HÜTCHENSPIELER
INFLUENCERIN
INSELURLAUB
INTERRAIL
JACHT
JAGD UND REITEN
JERSEYKALB
KAFFEESUD
KEYCARD
KLIMAKATASTROPHE
KOFFERRAUM
KOLONIALHAUS
KORALLEN
KREUZFAHRT
KUPFERZEIT
LÄCHELN
LEGUANPLAGE
LEICHEN
LEIHWAGEN
LEIHWAGEN AUSGEBUCHT
LEUCHTTURM
LICHTVERSCHMUTZUNG
LINKSVERKEHR
LOVE LOCKS
LUXUS
MAGNETSCHWEBEBAHN
MARKTGEBIET
MITTERNACHTSSONNE
MOLESKINE
NACHHALTIGKEIT
NAGELSCHERE
NAVIGATIONSSYSTEM
NOSTALGIEREISE
OSTCHARME
PLASTIK
PRIVATJET
PSEUDOWISSENSCHAFT
PSYCHO
QUALLEN
QUARANTÄNE
RASSISMUS
RÄUBER
RAUMFAHRTSIMITATION
REISEROUTE
ROLLKOFFER
RUM DOODLE
SAFARI
SANDFRASS
SCHACH
SCHWEBEBAHN
SECHSERABTEILE
SEEKRANKHEIT
SELFIE
SENFBRUDERSCHAFT
SENSOREN
SOMMERZEIT
SONNENFINSTERNIS
SOUVENIR
SPRACHEN
STRASSENHUND
TAXI BAKU
TAXI WIEN
TINY HOME
TOPONYME
TOURISMUSMINISTER
TOURISTENHASS
TRAVEL RISK MAP
TRIPADVISOR
TURBULENZEN
ÜBERBEVÖLKERUNG
UDO LINDENBERG
UNCONTACTED
VANILLE
VÉLOSOLEX
VENEDIG
VIERTE KLASSE
VULKAN
WELLNESS
WELTFRAUENTAG
WELTRAUM
WETTERAPPS
WIND
ZEITREISEN
ZUKUNFT
Die meisten Firmen können einen nicht besonders gut leiden, außer Hotels, Fluggesellschaften und Microsoft – die hassen einen bis aufs Blut.
BillBryson
FRAGEBOGEN
1)
Wer bist du, Amanshauser?
Ich gelte als Reiseschreiber.
2)
Also ein reisender Kugelschreiber?
Ein reisender Laptop.
3)
Geburtsort?
Diakonissenspital Salzburg; Gebäude abgerissen.
4)
Spitzname?
In einem Hotel schrieben sie mich »Herr Amanshase«.
5)
Länderfavoriten?
Neuseeland, Vanuatu, Peru.
6)
Interessantester Stempel im Pass?
Timor-Leste.
7)
Beste Städte?
New York, Hongkong, San Francisco.
8)
Schönste Natur?
Bhutan, Chocolate Hills auf Bohol, dazu Vulkane.
9)
Wo willst du irgendwann hin?
Moçambique, Laos, Chocolate Hills auf Bohol.
10)
Sympathischste Währung?
Alter Escudo in Portugal.
11)
Leihwagenwunsch?
Mit Schaltgetriebe.
12)
Wechselst du Reifen?
Verwirrt, verzweifelt, im Notfall.
13)
Letzte Reise?
Hab ich vergessen, ah nein, es war Bormio.
14)
Zu den Affen?
Nicht Borneo in Indonesien, sondern das lombardische Skigebiet.
15)
Beste Erfahrung mit Tieren?
Berggorillas in Ruanda, die sind so menschlich.
16)
Schlechteste Begegnung mit Tieren?
Sandflöhe in St. Kitt's and Nevis, so unmenschlich.
17)
Fallschirm, Achterbahn bzw. Bungee?
Gern, gern bzw. niemals.
18)
Komfortabelstes Verkehrsmittel, das du je benutzt hast?
Zeppelin.
19)
Unrealisierter Verkehrsmittel-Wunsch?
Draisine.
20)
Bevorzugte Fluglinie?
Singapore Airlines.
21)
Unsympathischster Flughafen?
Paris CDG.
22)
Impfungen?
Nehme alles bis auf Tollwut (High Responder, kriege Fieber).
23)
Ängste?
Hunde (seit Schäferhundbiss) und Warane (bisher kein Biss).
24)
Schwäche?
Sitzfleischmangel.
25)
Knochenbrüche unterwegs?
Kahnbeinbruch, mit Moped gegen Mauer in Hallwang.
26)
Zeltest du gern?
Nur dann, wenn selten.
27)
Berg oder Tal?
Wiese am Meer (z. B. Auckland).
28)
Einsamer Strand?
Nein, volle (Copacabana) oder schwarze Strände (Fogo, Cabo Verde).
29)
Schwimmer?
Bleibe über Wasser; schlechter Krauler.
30)
Lieblingsunterkunft?
Alte Pensionen mit großen Einzelzimmern (gelte als Schnarcher).
31)
Luxus und High End?
Privat zu teuer, ich mag aber frei stehende Badewannen mit Tierfüßen.
32)
CO2-Fußabdruck?
Ich wünsch mir eine härtere Klimapolitik – persönlich zahle ich dafür gerne mehr.
33)
Liebste Fortbewegungsart?
Zeppelin und E-Tandem als Vornsitzender.
34)
Reisegeheimtipp?
Unterhose und Socken im Handgepäck.
35)
Unheimliche Leidenschaft?
Sonnenfinsternisse.
36)
Welche Waffe dabei?
Textverarbeitungsprogramm.
37)
Warmgetränk?
Darjeeling-Flugtee.
38)
Kaltgetränk?
Rhabarberschorle (Berlin).
39)
Hassgetränk?
Red Bull (Gestank).
40)
Tristeste Reiseart?
Pauschal.
41)
Lieblingsessen?
Linguine/Pesto (Italien), Phở Đặc Biệt (Vietnam), Ceviche (Peru).
42)
Wunschmahlzeit in Todeszelle?
Seeigel-Sushi und chinesischer Algensalat.
43)
Moderegeln?
Selten Kurzhose, kein City-Rucksack, keine Flip-Flops.
44)
Reiseschuhwerk?
Halbschuhe ohne Schuhbänder.
45)
Kofferapotheke?
Antibiotika.
46)
Liebste Jahreszeit?
Herbst (zweimal verpasst).
47)
Schon Gespenster gesehen?
In der Literar-Mechana-Wohnung in Venedig.
48)
Feindbild?
Duty-free-Shops.
49)
Wieso schreibst du Reisetexte?
Damit ich im Alter was Interessantes zu lesen habe.
50)
Wo begraben werden?
Cimitero Acattolico (Rom).
MEINE VERHASSTEN GRENZEN, MEINE SUSPEKTEN REISEN
Ich bin dauernd an Grenzen. Dabei mag ich sie gar nicht. Mein Beruf erzwingt ihre Überschreitung. Ich betrete Länder und spaziere aus ihnen hinaus, lasse mir von uniformierten Walrössern und Gouvernanten Stempel in den Pass hämmern und beantworte ihre Fragen mit gelangweilter Stimme. Sie möchten immer das Gleiche wissen: »Was verdammt wollen Sie in unserem Land, wann schleichen Sie sich wieder, was machen Sie beruflich?« Ich sage »Tourismus« (unkorrekt), mein Rückflugdatum (korrekt) und erkläre, dass ich »Editor« bin (gelogen).
Was an mir »Editor«, meinetwegen Herausgeber, genau sein soll, weiß ich selbst nicht, aber ich gebe niemals preis, für eine Tageszeitung zu reisen. Den Grenzbeamten einiger Länder würde der Blutdruck die Schädeldecke sprengen, wenn ich mich als »Journalist« oder »Autor« zu erkennen gäbe. Notfalls erfinde ich so eine Art österreichisches Fanzine für Haikus, das ich herausgebe. Auflage fünftausend, Förderungen, kein Online. Ein Kunstheft, quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Wir sind unkritisch, wir schreiben nur Positives und eine Menge über Natur und Jahreszeiten.
Dass ich, der Grenzen nicht übermäßig schätzt, sie dauernd quere, hat wohl mit einer geheimen Faszination zu tun. Die Frechheit, eine Linie zu ziehen, die ein anderer nicht überqueren darf, kennt jeder von uns. Ich tat es bereits auf der Schulbank, möglichst tief im Gebiet meines Nachbarn. Wenn während der Reise meine Gedanken frei sind, sagen wir auf dem Sitz 7A, mit dem Kopf an einer der Luken aus Polycarbonat lehnend, betrachte ich die Welt unter mir. Ein Blick genügt: Die Striche, die Menschen da unten ziehen, die überflogenen Länder, sind für uns in der Höhe fiktional.
Ich liebe es, in der Wirklichkeit und ohne Pass eine Grenze zu überschreiten, nicht in der Luft, nicht an einer Grenzstation, sondern zu Fuß, auf einer Wiese, die von Walrössern und Gouvernanten nie betreten wird. Die sind ja unaufhörlich damit beschäftigt, nachzufragen, was fremde Leute in ihrem Land zu tun gedenken. Sobald ich eine wilde Grenze überquere, überkommt mich ein schwer unterdrückbares Triumphgefühl, und ich sage leise zu mir: »Na schau. Geht doch.«
An manchen Tagen wache ich um vier Uhr auf, nehme mein Gepäck, schlüpfe fünfzehn Minuten später in ein vorbestelltes Taxi und stehe bald darauf an einem Gate. Ich seufze und frage mich: Wieso jetzt? Warum schon wieder? Weshalb ich? Doch ein paar Stunden später, wenn ich den Airport der Destination verlasse, spüre ich wieder die alte, gute Neugier, die mich antreibt. (Ja, ich mache es gerne! Nein, ich brauche keine Fotografen!) Manchmal bin ich mit einer Gruppe, manchmal individuell unterwegs – immer, um Material für Reisegeschichten zu sammeln.
Das Interesse für die Rahmenbedingungen des Berufsbilds »Reisejournalist« ist hoch. Eine Frage höre ich am häufigsten: »Den Flug, das Hotel und so weiter … zahlt das die Zeitung?« Nein, antworte ich betrübt, die Zeitung zahlt nicht einmal Spesen, sondern eben die Honorare für meine Geschichten. Für die Reise kommen meist Veranstalter, Fluglinie, Tourism Board oder Hotel auf – all diejenigen, deren Daten später in der Infobox meiner Geschichte zu finden sind. Ich verursache bei denen kaum Kosten, werde ich doch mit Vorliebe außerhalb der Saison geschickt oder in der Regenzeit, niemals, wenn das Wetter perfekt oder alles ausgebucht ist.
Neben der Neugier habe ich zwei weitere Talente: Orientierung und Schreiben. An fremden Orten finde ich mich zurecht. Ich kenne meine Richtung meist ohne Stadtplan und Handy. Ich liebe U-Bahn-Systeme, spaziere aber ebenso gerne durch einen Eichenwald. Bereitwillig lasse ich mich von Listen oder Büchern anleiten. Weniger begeistern mich Reiseführer. Die meisten können mir über eine Gegend oder einen Ort weniger beibringen als Wikipedia. Ich muss eigene Dinge herausfinden und aufschreiben.
Dieses Buch soll einen Querschnitt durch die Welt der Reise geben – vieles wird Ihnen bekannt vorkommen, einiges, wie ich hoffe, auch neu. Mein Ziel ist, etwas hinzuschreiben, aus dem Leserinnen und Leser schließen können: Der Kerl war dort. Er hat etwas erlebt. Er hat mir etwas zu erzählen.
AMPEL
Darf man als Fußgänger bei Rot gehen? Niemals. Aber eigentlich doch.
Mein intensivstes Verkehrserlebnis hatte ich Ende der Neunziger in Hanoi. Autos gab es damals noch kaum. Die halbe Stadt fuhr mit Motorrollern, kleinen Motorrädern oder motorisierten Dreirädern. Beim erstmaligen Verlassen des Hotels verschüchterte mich der wilde, ungezügelte Verkehr. Wie würde ich die verdammte Straße je überqueren können? Die Einheimischen kreuzten sie indes, ohne den Kopf zu heben. Sie spazierten einfach zwischen den Fahrzeugen hinüber. Als ich beobachtete, wie ein Blinder mit Stock durch das hupende Durcheinander tappte, begriff ich: Die Motorisierten nahmen Rücksicht! Sie berechneten die Wege der Fußgänger ein, im Gegenzug hielten diese, unter Vermeidung abrupter Bewegungen, ihre Geschwindigkeit konstant. Von da an bewegte auch ich mich traumwandlerisch durch den Wunderverkehr des alten Vietnam.
Das bürgerliche Gegenstück stellt Berlin dar. Speziell am Prenzlauer Berg herrscht elterlicher Ampelterror, ausgeübt von beflissenen Jungmüttern und Jungvätern mit ihrem rosa und hellblau ausstaffierten Nachwuchs. Wagt jemand, eine Straße bei roter Fußgängerampel zu überqueren, wird er von den brav wartenden Eltern heruntergeputzt. Die lupenreine, hochmoralische Argumentation: Wer mit schlechtem Beispiel bei Rot vorangeht, produziere die Kinderleichen der Zukunft. Solche Eltern sehen in alltagstotalitärer Anmaßung sämtliche andere Passanten als Staffage ihres Aufzuchtsprojekts.
Von der Rotlicht-Stehpest ist neuerdings halb Europa angekränkelt. Auch in Wien warten alle, selbst wenn nichts kommt, so brav, als würde ein bedrohlicher Gott sie vom Überqueren bei Rot abhalten. Sollen sie. Ich habe meine Kinder anders erzogen. Ich fand, sie sollen erleben, dass es in dieser Welt Regelbrecher gibt. Das gehört zur Realität einer Stadt. Für Kinder ist selbiges verboten, und sie verstehen gut, wieso: weil ihnen noch der Überblick fehlt.
Einmal in Málaga fiel mir auf, dass alle bei Rot über die Straße gingen. Es war so befreiend. Ich erinnerte mich an den längst untergegangenen Zauber Hanois. Wir Passanten brauchen im Straßenverkehr wieder etwas mehr Selbständigkeit.
AUTOS
Wohin mit einer Milliarde? Der Parkraum als urbane Kampfzone
Paris ist Vorreiter: Eine Bürgerbefragung ergab, dass auswärtige SUVs ab einem Gewicht von eins Komma sechs Tonnen seit September 2024 die dreifache Parkgebühr zahlen. Der Automobilclub »40 millions d'automobilistes« empörte sich: »Dieser Kampf gegen SUVs ist nur ein Hintertürchen, um das Auto als Ganzes auszurotten!« Könnte stimmen. Andere Städte werden nachziehen. Was urbane Parkgebühren betrifft, so sollten wir mit der Zeit gehen und zwischen den Kraftwagen differenzieren. Der öffentliche Raum ist begrenzt, die Überlegung gewinnt an Gewicht, wie ungerecht wir ihn bisher verteilt haben.
Die Epoche der freien Fahrt für freie Bürger ist längst zu Ende, einige kapieren das nur noch nicht. Hier und dort nehmen Anrainer weiterhin Vorrechte in Anspruch. Mittlerweile mehren sich die Stimmen, die für größere, schwerere, mehr Platz verstellende Autos auch höhere Parkgebühren fordern.
Dabei war die Entwicklungsgeschichte des Automobils die bedeutsamste Erfolgsstory eines menschlichen Produkts. Inzwischen kurven mehr als eine Milliarde Personenkraftwagen auf unserem Planeten. Verkehrsunfälle kosten jährlich mehr als eine Million Menschen das Leben, darunter eine beträchtliche Anzahl von Kindern. Überhaupt wurde die Lebenswelt von Kindern, das freie Umherlaufen durch Stadt und Natur, aufgrund der neuen Gefahrenquelle stark beeinträchtigt.
Dadurch, dass Autos quasi überall parken durften, änderten sich die Stadtlandschaften dramatisch. (Das Wort »Parken« kommt aus dem Englischen – den Wagen in einem Park abstellen.) Allmählich bildeten sich allerorts Parkordnungen mit Parkzeitregeln für eine definierte Parkdauer heraus – der Beginn der Parkraumbewirtschaftung.
Der 1914 geborene britische Schriftsteller Laurie Lee beschreibt auf seiner England- und Spanienreise in den Dreißigern eine völlig andere Topografie: »Ich hatte großes Glück, damals auf Wanderschaft zu gehen, als das Land noch nicht platt gewalzt war. Viele der Landstraßen (…) folgten zärtlich der Windung eines Tales. Das alles ist noch nicht so lange her, doch könnte heute niemand mehr meinem Weg nachgehen. In der Zwischenzeit hat das Auto die Landschaft zerstückelt, der Reisende durchbraust sie auf Rinnsteinhöhe und sieht dabei weniger als ein Hund im Straßengraben.«
In der Frühzeit des Automobils wurde nach Unfällen die Frage nach Schuld und Verantwortung anders bewertet als heute. So galt die Alkoholisierung angeklagter Lenkender als strafmildernd, da diese nach damaliger Rechtsauffassung in ihrem Überblick durch die Berauschung deutlich beeinträchtigt waren.
Heute wäre eine solche Argumentation undenkbar – ebenso wie die Idee, dass die Stadtlandschaft weiterhin ganz dem Auto gehören sollte. Während Paris seine Gebühren verteuert, werden in anderen Großstädten ganze Straßenzüge autofrei gemacht. Die Windungen der alten Landstraßen, von denen Laurie Lee schrieb, sind zwar begradigt, doch in den Metropolen entsteht eine neue, alte Bewegung: die Rückeroberung des öffentlichen Raumes. Vielleicht kann sich Paris eines Tages sogar erlauben, auf Parkgebühren zu verzichten – weil niemand mehr auf die Idee kommt, mit monströsen Vehikeln durch die Stadt zu fahren.
BALLON
Laut, heiß und groß. Hoch hinauf. Und herunter mit Stil
Die Sterne scheinen noch, während sich vierzehn Fahrgäste – Platz wäre für sechzehn – um den schlaffen Sack sammeln, der bald zum Ballon aufgepumpt sein wird. Sie trinken Kaffee und Tee. Kapitän Sergej macht uns mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut, die sich auf zwei Regeln beschränken: Erstens soll man sich bei der Landung anschnallen, zweitens immer tun, was er sagt. Auf die Frage, ob er aus Russland oder der Ukraine kommt, meint Sergej, ja, ungefähr von dort, setzt aber doch hinzu, tausend Kilometer östlich von Moskau. Im Masai Mara Nationalpark fährt er seit acht Jahren Ballone, den Pilotenberuf hat er seit 1996 gelernt, »und ich lerne immer noch«.
Inzwischen wird die Hülle mit heißer Luft gefüllt – Geräusche wie aus einer ohrenbetäubenden Klospülung. Allmählich formt sich der Sack zu einem rot-gelb-orange-blau gestreiften Gebilde. Zu meiner Überraschung steigen wir Passagiere in Schubladen, vier mal vier Personen, minus zwei. In der Mitte steht Sergej wie ein Klassenlehrer und lässt mit vier Hebeln das Feuer zischen, während er gelegentlich an Schnüren zieht, um das Gerät zu manövrieren.
Die kenianische Serengeti taucht aus dem Wäldchen auf, bald erleuchtet von der Morgensonne. Unten schwartelt ein einsames Flusspferd etwas kopflos dahin – aufgescheucht von unserem Sound? Wasserböcke und Impalas nehmen es lockerer, ihre Gefahren kommen nicht aus der Luft. Sergej wechselt gern die Flughöhe. Manchmal zieht er dermaßen knapp über Sümpfen dahin, dass man Matschfrösche hüpfen sieht.
Zwischendurch herrscht wunderbare Stille. Vier weiße Vögel ziehen vorbei, ausnahmsweise will keiner ihre Namen wissen. Sergej hackelt in seiner heißen Umgebung wie in der Vorhölle, mich wundert, dass sein Kopfhaar nicht längst in Flammen steht. Erst knapp vor der Landung deutet er auf die Straße, an der er zu Boden gehen will. Bitte anschnallen! Er lässt den Riesen unter mächtigem Rumpeln in ein Feld rattern. Doch der Korb kippt nicht. Später wird er zu meiner Verblüffung seine »butterweiche Landung bei nur sechs Knoten« loben, normale Landungen, bei zehn bis elf Knoten, seien um einiges holpriger.
BERGGORILLAS
Begegnung im Nebelwald – unsere Verwandten zwischen Weisheit und Räuspern
Sechs Uhr dreißig Abfahrt, denn Berggorillas haben einen geregelten Tagesablauf. Idealerweise trifft man sie während ihrer Vormittagsruhephase. Der genaue Zeitpunkt des Zusammentreffens ist unklar, bewegen sie sich doch kontinuierlich durch das Unterholz. Im Regenwald des Volcanoes National Parks in Ruanda sind zweiundzwanzig Gorillagruppen an die Anwesenheit jener je acht Menschen gewöhnt, die fünfzehnhundert Dollar hinlegen, um sie in ihrem natürlichen Habitat eine Stunde lang zu sehen. Sie haben keine Influenza-Antikörper. Ein Veterinärteam betreut die Population, um sie, unter anderem mit Medikamente-Gaben, von Menschenkrankheiten abzuschotten.
Verhaltensvorschriften: Erstens: Kein Streicheln. Zweitens: Mund-Nasen-Schutz. »Sprechen Sie Gorillisch?«, fragt der Guide in die Runde. Alle schütteln verschämt den Kopf. Unsere Verwandten, fährt er fort, würden sich dunkel gurgelnd zu räuspern pflegen, ein Zeichen des Wohlwollens. Diese Beruhigungslaute sollen heute auch wir ausstoßen – und zwar »for safety reasons«. Während des Aufstiegs durch Matsch und durch per Machete zerhacktes Unterholz wird in der Gruppe unisono probegeräuspert.
Ein Trupp einheimischer Späher gibt über Funk bekannt: »Gorillagruppe Sabyinyo geortet!« Nach Trekking und Tracking steht unvermittelt das erste Exemplar vor uns. Der Nachwuchsaffe erhebt sich auf zwei Beine, sieht mich mit durchtriebenem Blick an (ich räuspere mich verlegen), trommelt auf seine Brust und schwingt sich in den Busch. Maskiert und flüsternd arbeiten wir uns zur Lichtung vor. Der Clanchef der Gorillas, zweiunddreißig Jahre alt, verstrahlt buddhistische Würde. Er öffnet das Maul – was für schwarze Zähne! Meine Zahnärztin würde eine sofortige Mundhygiene einfordern. Der zweitgrößte ist erst achtzehn Jahre alt, ein Typ mit Glatze und Beule, sein Gebiss allerdings perfekt. Er hebt den Arm. Chorprobenhaft stoßen wir gemeinsames Geräusper hervor. Der Glatzige räuspert zurück. Geschmeichelt? Pflichtbewusst?
Bald vergesse ich zu fotografieren. Ich beobachte, mit welcher unglaublichen Ruhe die evolutionären Kollegen Bambus knacken, schälen, vertilgen, sich gemütlich auf Zweige betten, gähnen. Uns Menschen beobachten sie aus schwarzrötlich schimmernden Augen mit mäßigem Interesse. Kein Wunder, die zahlen ja nichts für die Begegnung mit uns. Einmal wirken sie weise auf mich, ein anderes Mal total unverständig. Ich kenn das gut. Ist ja bei den meisten Familientreffen so.
BETTLER
Völkerverständigung in Vanuatu – oder Short Story über gekauften Sex und Geld
Am Aussichtspunkt über der Devil's Point Road, Efate, Vanuatu, nähert sich ein stattlicher Mann, circa siebzig bis fünfundsiebzig, etwas unsicherer Gang, weiße Locken, dunkle Haut. Seine Augen sind rot, zeigen wenig Weißes. Er heiße Antonie, woher denn ich sei? Austria. Australia? Austria. Verstehe, Austria, sehr weit weg. Woher ich nach Vanuatu geflogen bin? Von Fiji. Antonies Augen blitzen auf, die Fiji-Frauen sind super, sagt er. Sie haben – er zeigt Brüste an. Sie können gut – er stößt mit dem Zeigefinger in ein Loch, das er mit der anderen Hand bildet. Es schnalzt. Ob ich in Fiji mit einer …? Nein. Ob ich verheiratet …? Ja, lüge ich, und er? Ja, sagt Antonie, aber Vanuatu-Frauen sind … Sie sind anders, unterbreche ich ihn hastig. Und wie viel verdient ihr so in Austria?, fragt Antonie. Zwölfhundert Euro, sage ich, ich setze es niedrig an. Wenig, sagt Antonie skeptisch, ob ich Vanuatu teuer finde? Ja, sehr, sehr teuer, sage ich.
Und wo ich wohne?, fragt Antonie. Ich verschweige das Casino-Hotel, sage den Namen einer billigen Unterkunft gegenüber. Ob es in Austria Arbeitslosengeld gibt? Ja. Wie hoch? Zwölfhundert Euro. Pensionen? Ja. Alle Leute besitzen Häuser? Einige schon, längst nicht alle. Gibt es in Austria Arme? Ja. Und gibt es Bettler? Ja. Oh, ihr in Austria … habt ihr wirklich Bettler?, fragt Antonie. Ja, haben wir. Wer sind diese Bettler? Meistens Ausländer. Da hätte ich eine Idee, sagt Antonie, du machst das so: Du gehst zu einer Ausländerin, einer hübschen, jungen Ausländerin, und du schläfst mit ihr – sie möchte das bestimmt, sobald sie erfährt, wie viel du verdienst – und du gibst ihr dafür Geld. Für dich ist es wenig, für sie ist es viel, beiden ist geholfen, und du kannst sie immer wieder treffen … Aber aufpassen!, ruft er. Wieso? Dass sie dir keine Krankheit überträgt … du musst eine Hygienische nehmen, eine Saubere, verstehst du? Ja klar, ich nehme eine Saubere, sage ich, und ich muss jetzt weiter. Natürlich, verstehe ich, sagt Antonie, wie sieht es aus mit einer Contribution? Ich entgegne, ich bin nicht so der Contribution-Typ. Ich könnte mir eine in der Höhe von fünfhundert VUV vorstellen, sagt Antonie und rechnet den Betrag gleich für mich um, das wären bei euch vier Euro.
BETTWANZEN
Blutsauger im Bett – ein juckender Albtraum
Bettwanzen plagten mich im New World Hotel, Chinatown, New York. Ich dachte an Dave Goulsons Buch »A Buzz in the Meadow«, das ich auf Deutsch unter dem eher unwissenschaftlichen Titel »Wenn der Nagekäfer zweimal klopft« gelesen hatte. Dieser britische Hummelforscher und Professor an der University of Sussex, ein großartiger Wissenschaftler und Freak, erzählt von einem Mitbewohner, der im Sommer unter juckenden, wellenlinienförmigen Schwellungen litt. Man verdächtigte Moskitos, doch im Spätherbst verschlimmerte sich der Ausschlag. Allergien wurden ausgeschlossen, Ärztinnen und Ärzte waren ratlos. Der Mitbewohner tauschte die Matratze aus, stellte sein Schlafzimmer auf den Kopf – keine Verbesserung. Letztlich zog er entnervt aus.
Erst eine Renovierung beförderte hinter einem alten Holzregal Hunderte abgestreifte Insektenhüllen hervor. In den Ritzen und Fugen des Betts nahm Goulson Bewegungen wahr, beim Aufbrechen der Zargen »wuselten Dutzende bernsteinfarbener Insekten aufgeschreckt in alle Richtungen«. Selbst in den Kastenritzen und Fußbodenleisten lebten diese papierdünnen Wesen, Bettwanzen, frühmorgendliche Blutsauger mit speziellem Appetit auf Menschen. Den Juckreiz erzeugt ihr Speichel. Seit der flächendeckenden Einführung der Zentralheizung florieren sie in unseren Häusern. Da sie seit einiger Zeit Resistenzen gegen Insektizide entwickeln, sind sie heute aus Evolutionssicht erfolgreicher als je zuvor.
Goulson berichtet vom britischen Wissenschaftler Wigglesworth, der Bettwanzen köpfte und sie mit Raubwanzen verband, für den Nachweis eines Hormons zur Steuerung der Häutung. Er berichtet aber auch von Charles Darwin, der einen »Angriff« der Bettwanzen beschrieb. »Es ist äußerst widerwärtig, weiche, flügellose, ungefähr einen Zoll lange Insekten über seinen Körper kriechen zu fühlen.« Mir im New World Hotel in Chinatown half das wenig. Ich dachte an die Atombombe, und dass man Bettwanzen nicht einmal mit ihr gescheit wegkriegen konnte.
BHUTAN
Ein Reiseleiter, ein Handy und ein Plan fürs nächste Leben
Duptho Nima, dreiunddreißig, hat Pech. Immer, wenn er mit seiner Reisegruppe einen Tempel betritt, auf die Knie geht und zu beten beginnt, ruft sein Chef an. Duptho Nima greift tief in die Kängurutasche seines Gho, des traditionellen Gewands Bhutans, und würgt den Klingelton »Don't Worry, Be Happy« ab. Er wird später zurückrufen.
Nach zwei Jahren in Saarbrücken spricht er perfektes Deutsch. Beim Fremdenführer-Examen hat er mit neunundachtzig Prozent besser als die meisten Kollegen abgeschnitten. Die Touren macht er vorwiegend für einen österreichischen Veranstalter. Seine Kunden nennen ihn Nima. Seine Namen hat er, wie jeder Einheimische in diesem nachnamenlosen Himalaya-Staat, als Baby im Tempel von Mönchen erhalten. Sie haben sich bewährt. Er ist zufrieden mit ihnen.
Nima stammt aus Ostbhutan, aus der Provinz. Mit Frau und zwei kleinen Töchtern lebt er inzwischen in der Hauptstadt Thimphu. »Vor allem die Miete ist hier teuer«, seufzt er, »meine Frau verdient als Weberin dazu, auch meine Ghos macht sie.« Seine Einkünfte während der drei Monate kurzen Saison müssen ihn durchs Jahr bringen. »Manchmal reicht das Geld aus. Manchmal nicht.« Rücklagen kann er keine bilden. »In den freien Monaten bringe ich die Kinder in den Kindergarten, halte Mittagsschlaf, übe Bogenschießen – es gibt immer eine Menge zu tun!«
Nima selbst bezeichnet sich scherzend als »Apa« – als alten Mann, der man in Bhutan ab dreißig ist –, aber immerhin ist er noch kein »Meme«, erklärt er, kein Uralter, denn diesen Status erreicht man erst ab fünfundvierzig. Seinen Lebensweg sieht Nima mit buddhistischer Ruhe: »Ich arbeite noch zehn Jahre als Reiseleiter. Dann möchte ich fünf Jahre in meinem Geburtsort als Bauer leben, frisches Gemüse vor meinem Haus pflanzen, auf dem Feld arbeiten, ich kaufe eine Kuh, melke sie, trinke die frische Milch, das ist der Plan.« Nach dieser Phase möchte er sich zurückziehen vom Weltlichen. »Ich werde oft in den Tempel gehen, werde beten, Pilgerreisen unternehmen – mich eben aufs nächste Leben vorbereiten, so gut ich kann.« Als er das sagt, läutet wieder »Don't Worry, Be Happy«. Seufzend greift er in die Tasche.
BILLIGLINIE
Entschädigung? Ein Labyrinth aus Links, Ansprüchen und Abstürzen
Oft denke ich an Ryanair. Nicht nur beruflich, auch privat: Vor einigen Jahren hatte einer meiner Flüge sechs Stunden Verspätung. Ich verpasste den Anschluss und stand hilflos auf einem norditalienischen Flughafen, ohne Weiterreise-Option am gleichen Tag. Ich fuhr zum Bahnhof. Der Preis des Nachtzugs war gesalzen, immerhin kam ich nach Hause.
Laut der EU-Fluggastverordnung 261/2004 können Reisende ab einer Verspätung von mehr als drei Stunden ihre Ansprüche geltend machen. Neben dem Recht auf Ticketpreis-Rückerstattung haben sie Anspruch auf eine Ausgleichszahlung zwischen zweihundertfünfzig und sechshundert Euro. Auf Ryanairs Website informiert der Link »EU261« korrekt darüber, ein Entschädigungsformular öffnet sich. Man gibt dort all seine Daten ein, lädt allerlei Scans hoch, und es klappt. Die nehmen einen ernst! Beim allerletzten Schritt stürzt das Formular leider ab. Nach einigen erfolglosen Versuchen mit dem gleichen Resultat ergoogle ich: Viele Geschädigte machen exakt meine Erfahrung. Es sieht verdächtig nach einem absichtlich eingebauten Programmierfehler aus, mit dem Ziel der Kundenentmutigung.
Auf mein recht entschlossenes Mail antwortet Ryanair spät und unverdrossen freundlich, übersät mich jedoch mit einer Flut unbeantwortbarer Fragen und sendet massenhaft Zusatzlinks. Ich antworte ernsthaft. Ryanair gegenantwortet mit Nebelgranaten und Verwirrungserklärungen. Es geht ein paarmal hin und her, bis ich erschöpft aufgebe.
Später versuchte ich, mithilfe der Websites Fairplane und Flightright zu meinem Recht zu kommen. Seitdem informieren die beiden mich zuverlässig alle paar Monate, dass ich nichts unternehmen soll, weil sie an dem Fall dran sind. Das beruhigt ungemein.
Irgendwann las ich, dass eine Ex-Tourismusministerin schrieb, sie wolle und werde ihre »Expertise und Leidenschaft für das Wachstum der europäischen Tourismusbranche im Aufsichtsrat von Ryanair einbringen«. Toll, eine Österreicherin! Sollte ich Kontakt zu ihr aufnehmen? Die würde einem verzweifelten Landsmann doch bereitwillig helfen?
BOYKOTT
Sollen wir Ärger mit Diktatoren riskieren? Oder lieber doch nicht?
Oft werde ich gefragt, in welche Länder ich nie reisen würde. Nun, nach Nordkorea begebe ich mich garantiert nicht. Mir macht deren Geheimdienst Angst. Womöglich ergoogeln die sogar diese Zeilen, wenn ja, herzlichen Gruß, euer Führer ist dick und groß! Seit der Ermordung des US-Studenten Otto Warmbier (1994–2017), der in einem Hotel in Pjöngjang – falls überhaupt – ein Propaganda-Banner als Souvenir abmontiert hatte und danach eine Verurteilung zu fünfzehn Jahren Arbeitslager gewärtigte, die ihn letztlich das Leben kostete, habe ich mit dem mörderischen Reich des Kim Jong-un abgeschlossen.
Jemand könnte einwenden: »Geschieht Unrecht nicht überall? Da bleibt uns bald gar kein Reiseziel mehr!« Stimmt, ich etwa lebte in den rassistischen Trump-USA, fuhr in den Homosexuelle mordenden Iran, und nicht ungern bin ich in Ungarn, wo eine Abrissbirne namens Orbán die Mauern der Demokratie erschüttert – soll ich nirgends mehr hin? Nein! Bei den genannten Ländern hege ich Hoffnungen, fühl mich dort mehr oder minder wohl. Für Reisen in schurkenhaftigere Staaten wiederum spricht das durch den Tourismus finanzierte Wohlergehen der ebendort Arbeitenden. Oft hörte ich in Myanmar: »Lasst uns nicht allein!« Und seit der Verschurkenstaatung der USA in der Ära Trump II hört man ähnliche Stimmen auch von dort.
Was mich oft nachdenklich machte, waren Reisen in muslimische Länder, bei denen ich, ungetaufter Christ, in Gesprächen stets jenen muslimischen Antisemitismus erlebte, der zum Massaker des 7. Oktober 2023 führte. Soll ich fortan islamisch geprägte Länder meiden? Wieder nein! Auch daheim gibt es Belästigungen, und nicht nur von Ewiggestrigen. Beizeiten wirkt mir schon das Schweigen zu diesem Massaker verdächtig – jedoch der Schlachtruf »Free Palestine« einer europäischen »Linken«, den man wieder auf Österreichs Straßen hört, bezieht sich auf absolut keinen Freiheitskampf. Vielmehr gehört er, mit seinem Zusatz »from the river to the sea«, zu den offen artikulierten Vernichtungsfantasien. Also besser doch weg von daheim. Ich fahr, solange es noch geht, weiterhin überall hin. Außer zu Diktator Kim.
BUCHUNGSZEITPUNKT
Wann soll man früh buchen, wann pokern? Wer spielt beim Reisen besser?
Soll man eigentlich früh buchen wie in den Nullern oder möglichst spät wie in den Neunzigern? Meine Antwort enttäuscht die Leute immer: Es ist alles sehr kompliziert – geworden.
Im Prinzip wäre es von Vorteil, Bahnreisen, Flüge und Hotels möglichst früh zu buchen, speziell, wenn es sich um überlaufene Destinationen handelt. Zu manchen Daten fallen die Preise sicher nie mehr – bei Sommerangeboten oder Silvester-Städtetrips.
Bei mieser Buchungslage geben Airlines und Hotels manchmal Preisnachlässe. Sehr frühe Bucher zahlen daher manchmal mehr als jene, die sich instinktiv oder aus Faulheit zu einem späten Zeitpunkt entscheiden. Zeitlich weit entfernte Flüge neigen wiederum dazu, sich aufgrund neuer Umstände plötzlich doch in Luft aufzulösen bzw. von den Anbietern gestrichen zu werden. Im Allgemeinen sind sie zwei bis drei Monate vor Reisebeginn am günstigsten.
Leider scheint der ideale Buchungszeitpunkt der langweilige mittlere zu sein. Drei Wochen vor Reisestart beginnt die Sache heikel zu werden. Billigflüge sind voll, galoppieren nach oben oder – frustrierendste Option – haben das jüngst getan. Die stressigste Phase ist der Buchungsprozess, bei dem sich die Kosten, fast wie von Geisterhand, eigenständig nach oben lizitieren. Eine gute Idee ist, den klassischen Zwischenhändlern auszuweichen und direkt bei der Airline nachzusehen, ob sie nicht billiger anbietet. Anders stellt sich das bei der Unterkunftssuche dar: Direkt beim Hotel sind die Preise meist höher als beim Fast-Monopolisten Booking.
Die Ära der großen Restkontingente ist vorüber. Last-Minute-Angebote sind fast ausgestorben. Nur hin und wieder tauchen Ladenhüter-Pauschalreisen zu Schleuderpreisen knapp vor Reiseantritt auf. Wer sich spontan entscheiden will, hat zumindest in Europa eine glanzvollere Option. Das gute, alte Interrail-Ticket stellt preislich die Mehrzahl der Spätbucherflüge in den Schatten.
Fluglinien erfanden vor wenigen Jahren einen Kundenverärgerungstrick – die Exkludierung des Handgepäcks beim Ticketpreis. Die Handgepäckspreise reichen, völlig willkürlich, von zwanzig bis zweihundert Euro pro Strecke. Zur Eruierung dieser verdeckten Kosten muss man die Buchung versuchsweise in die Wege leiten. Kein Wunder, dass spätestens an diesem Punkt auf Kundenseite blanker Hass aufsteigt. Wozu machen die Airlines eigentlich ihre Wohlfühl-Werbung, wenn sie vor den Kunden im Netz dermaßen entlarvt, mit heruntergelassener Hose, dastehen?
BUSCHFEUER
Debattenverweigerung: Wenn die Tourismusidylle in Flammen aufgeht