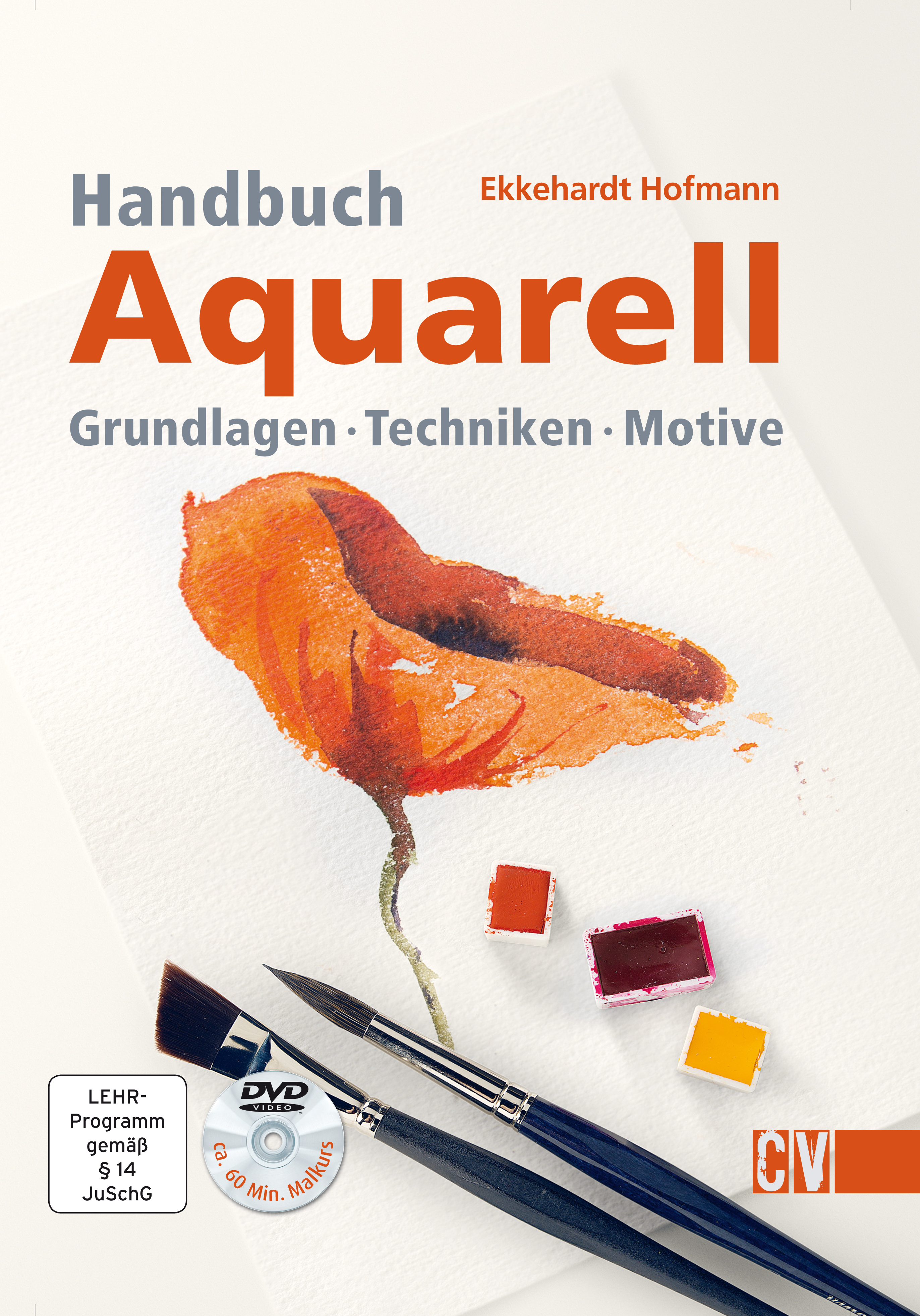
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Christophorus Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Warum malt man Nass-in-Nass? Was ist eine Lasur? Wie mische ich die Farben auf dem Papier? Solche Fragen beschäftigen sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene der Aquarellmalerei. Dieses Buch bietet dazu inklusive DVD ein umfassendes Grundlagenwissen. Hier bleiben keine Fragen offen: Die Grundbegriffe der Aquarellmalerei werden ausführlich erläutert, Werkzeuge und Materialien detailliert vorgestellt und Techniken praktisch erklärt. Anhand schöner Motive aus unterschiedlichen Motivgruppen lassen sich die einzelnen Techniken Schritt für Schritt nacharbeiten und einüben. Auf der beiliegenden DVD kann das Aquarellieren in verschiedenen Techniken zusätzlich live nachvollzogen werden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Handbuch
Aquarell
Grundlagen • Techniken • Motive
Ekkehardt Hofmann
Handbuch
Aquarell
Grundlagen • Techniken • Motive
Autor: Ekkehardt Hofmann
Bildnachweis: S. 8 oben: akg-images / Erich Lessing; S. 8 unten, S. 9: akg-images; S. 79, 154, 155, 158: Ilse und Ekkehardt Hofmann; S. 19, S. 75, S. 105, S. 159: Sylvia Heldstab; S. 81 links: © till beck – Fotolia.com; S. 81 rechts: © winterthur100 – Fotolia.com; Alle anderen: Frank Schuppelius
Layout und Litho: Achim Ferger
Lektorat und Produktmanagement: Laura Lesum
Druck und Verarbeitung: Neografia, Slowakei
ISBN 978-3-86230-307-6
Art.-Nr. EN30307
© 2015 Christophorus Verlag GmbH & Co. KG, Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
Das Werk und seine Vorlagen sind urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung oder gewerbliche Nutzung der Vorlagen und Abbildungen ist verboten und nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verlages gestattet. Dies gilt insbesondere für die Nutzung, Vervielfältigung und Speicherung in elektronischen Systemen und auf Datenträgern. Es ist deshalb nicht erlaubt, Abbildungen und Bildvorlagen dieses Buches zu scannen, in elektronischen Systemen oder auf Datenträgern zu speichern oder innerhalb dieser zu manipulieren.
Die Ratschläge in diesem Buch sind vom Autor und dem Verlag sorgfältig erwogen und geprüft, dennoch kann eine Garantie nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Besuchen Sie uns auf unserer Website: www.christophorus-verlag.de
Das Video zum Buch finden Sie auf unserer Website unter dem folgenden Link http://bit.ly/1OstMUJ.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Geschichte des Aquarells
Material und Werkzeuge
Papiere
Aquarellfarben
Pinsel
Hilfsmittel
Arbeitsplatz
Ausrüstung für das Malen im Freien
Basiswissen
Motivsuche
Skizzieren
Farbenlehre
Kontraste
Komposition
Maltechniken
Mischen
Lavieren
Lasieren
Granulieren
Nass-in-nass
Negativ aussparen / Farbe abnehmen
Abdecken
Schablonen / Sprühen
Sprenkeln
Tupfen
Effekte
Einsatz anderer Materialien
Finishen / Aquarellstifte
Experimentelle Techniken
Kolorieren und grafische Akzente
Leinwand als Untergrund
Einsatz von Airbrushfarbe
Absprengen mit Wasser
Monotypie und Abklatsch
Experimentieren
Besondere Formate
Motive
Blumen
Architektur
Landschaft
Bäume
Stillleben
Freie Komposition
Anhang
Aufbewahrung
Bildpräsentation
Ausstellung
Nachwort
Biografie Ekkehardt Hofmann
Index
Vorwort
Liebe Malfreunde,
dieses Buch ist ein Grundlagenwerk für die Aquarellmalerei und fasst die grundlegenden Fragen und Themenkomplexe zu dieser Maltechnik zusammen. Ausgangspunkt für dieses Buch waren dabei die vielen Fragen, die in Seminaren und Malvorführungen an mich herangetragen wurden. Sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen bietet dieses Buch nun eine gute Grundlage für eine intensive Beschäftigung mit der Aquarellmalerei. Neben Materialien und Grundlagenwissen werden viele Techniken vorgestellt und erläutert, ebenso Motivgruppen von Blumen bis zur Architektur.
Bei der Auseinandersetzung mit der Aquarellmalerei profitieren wir alle sehr vom Wissen und dem Erfahrungsschatz früherer Maler. Ich erachte es daher auch als unsere Aufgabe, die Maltechniken und Bildentwicklungen mit unseren heutigen Möglichkeiten und Erkenntnissen ebenfalls voranzutreiben und weiterzuentwickeln.
Ich wünsche Ihnen viel Freude und Erfolg bei Ihrer Aquarellmalerei.
Ekkehardt Hofmann
Die Geschichte des Aquarells
„Das Große Rasenstück“, Albrecht Dürer, Wasser- und Deckfarben auf Papier, auf Karton aufgezogen, 1503, 40,3 x 31,1 cm. Wien, Graphische Sammlung Albertina.
Wenn man sich mit dem Thema Aquarellmalerei beschäftigt, wird schnell offensichtlich, dass es sich dabei um eine der ältesten Techniken der Malerei handelt. Bereits in der Höhlenmalerei, aber auch im alten Ägypten kamen in Wasser gelöste Farben zum Einsatz – die Vorläufer unserer heutigen Aquarellfarben. Damals wurden Farbpigmente, die man zum Beispiel aus Holzkohle gewann, in Wasser gelöst, um damit auf Wände oder Papyrus zu malen. Auch im asiatischen Raum kam die Technik des Aquarells nicht zuletzt aufgrund der engen Verwandtschaft zur Tuschemalerei zur Anwendung.
So wie bei vielen Materialien und Techniken hat sich auch die Aquarellmalerei ständig weiter entwickelt: Man entdeckte Bindemittel, wie z. B. Eiweiß, und die Farbpigmente wurden in ihrer Qualität immer besser. Verwendete man im europäischen Raum als Trägermaterial noch Pergament, sollte die Produktion von Papier entscheidend zur Verbreitung der Aquarellmalerei beitragen. Im 13. Jahrhundert entstanden in Europa die ersten Papiermühlen, die auch die Aquarellmalerei beflügelten. Durch das Mittelalter hindurch dienten Wasserfarben überwiegend zum Kolorieren von Holzschnitten und Tuschezeichnungen. Auch in der Miniatur- und Buchmalerei entstanden mit den lasierenden Farben ornamentale und bildliche Darstellungen. Bis die Aquarellmalerei jedoch als eigenständige Kunstform galt, sollten noch einige Jahrhunderte ins Land ziehen. Zwei Künstler brachten dabei die entscheidenden Impulse: Albrecht Dürer und William Turner.
„Mondschein über dem Vierwaldstätter See vor der Kulisse des Rigi“, William Turner, Aquarell und Deckfarbe, um 1841/44, 23 x 30,7 cm. Manchester, Whitworth Art Gallery.
Der deutsche Maler und Grafiker Albrecht Dürer (1471 – 1528) war einer der bedeutendsten Maler der Renaissance nördlich der Alpen. Dürer fertigte nicht nur Holzschnitte und Zeichnungen an, sondern malte auch Aquarelle, die als Vorläufer für seine Ölgemälde dienten. Daraus resultiert noch heute vielfach die Meinung, dass das Aquarell lediglich als Vorlage für spätere Gemälde dient. In der Tat diente das Aquarell in jener Zeit überwiegend als Vorstudie oder zur Gestaltung des Hintergrunds. Aber bereits Dürer hat diese einseitige Funktion der Aquarellmalerei mit seinen eigenen Reiseimpressionen widerlegt: Auf seiner ersten Italienreise im Jahr 1494 schuf er eine Serie eigenständiger Landschaftsund Naturstudien in Aquarell. Durch die Arbeiten Dürers erfuhr die Aquarellmalerei schließlich eine Aufwertung. Dennoch blieb ihr eine Wertschätzung als eigenständige und wertvolle Kunstform versagt.
Eine breitere Anerkennung fand das Aquarell erst im England des 18. Jahrhunderts. Der englische Maler William Turner (1775 – 1851) gilt bis heute als bedeutendster Aquarellist, beherrschte er doch den Umgang mit den Farben und das Einfangen von Impressionen meisterlich. Ihm ist es gelungen, das Aquarell als eigenständige Malgattung zu etablieren, indem er seine Bildwerke mit Aquarellfarben direkt auf dem Malgrund entwickelte.
Da im Laufe des 19. Jahrhunderts einerseits das Malen in freier Natur an Beliebtheit gewann, andererseits das Angebot an Farben, Kästen und Tuben beträchtlich erweitert wurde, erlebte das Aquarell im aufkommenden Impressionismus eine Blütezeit. Ebenso wie Turner war den Impressionisten am Einfangen des atmosphärischen Augenblicks gelegen. Hier ist besonders der französische Maler Paul Cézanne (1839 – 1906) zu nennen, der mit seinem Malstil der Farbmalerei entscheidende Impulse gegeben hat. Weitere Maler werden häufig in einem Atemzug mit dem Aquarell genannt, wie etwa Emil Nolde (1867 – 1956). Der deutsche Maler war einer der bedeutendsten Aquarellisten des 20. Jahrhunderts. Die gesamte Bandbreite seiner Motive hielt er mit kräftigen Aquarellfarben fest. Jeder kennt die leuchtend starken Blumenaquarelle Noldes oder seine nass-in-nass auf stark saugendes Papier gemalten Landschaftsaquarelle. Neben Nolde sind es zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch August Macke (1887 – 1914) und Paul Klee (1879 – 1940), die beeindruckende Werke in Aquarell schaffen, ebenso wie Wassily Kandinsky (1866 – 1944), der als Wegbereiter der abstrakten Kunst die ersten ungegenständlichen Aquarelle malte.
Bis heute fasziniert die Aquarellmalerei unzählige Künstler verschiedenster Stilrichtungen. In der modernen Kunst wurden und werden Aquarelle als eigenständige Kunstwerke präsentiert. Gotthard Graubner (1930 – 2013), Oskar Koller (1925 – 2004), um nur zwei bedeutende Künstler zu nennen, griffen immer wieder zu Aquarellfarben, um damit besonders sensible, einfühlsame Bildwerke zu schaffen. Dasselbe gilt für den deutsch-amerikanischen Künstler Jerry Zeniuk (*1945), dessen Bildwerke die Eigenschaften und Wahrnehmung der Farben zum Thema haben.
„Stillleben – Äpfel auf einer Anrichte“, Paul Cézanne, Aquarell, um 1900/1906, 48 × 62 cm.
„Das helle Haus (1. Fassung)“, August Macke, Aquarell über Bleistift auf Bütten (Ingres), 1914, 25,1 × 22,1 cm.
MATERIAL UND WERKZEUGE
Die Materialauswahl für das Aquarell ist begrenzt. Darin liegt auch die Mobilität der Aquarellmalerei begründet. Ich empfehle, sich auf eine kleine Materialauswahl in bester Qualität zu beschränken. Im Folgenden lernen Sie die Grundkomponenten – Malgrund, Farben und Pinsel – kennen.
Papiere
Grundsätzlich sind fast alle Aquarellpapiere hochwertige Papiere. Der Unterschied beim Malverhalten liegt zum einen in der Mischung der Grundstoffe des Papierbreies, zum anderen im Herstellungsprozess. Für den Anfänger und zu Übungszwecken empfehlen sich Papiere, auf denen noch geringfügige Korrekturen möglich sind und die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Der Grundstoff dieser Papiere ist Holzzellulose.
Hadernpapier
Für fortgeschrittene Maler eignen sich Hadern-Papiere mit einer hohen Grammatur. Diese sind als Bogenware erhältlich, die ich bevorzugt benutze. Hadernpapier bestand früher aus echten Hadern, das heißt aus Lumpen aus Baumwolle. Diese sind heutzutage aber schwer erhältlich. Daher werden heute als Grundsubstanz sogenannte „Linters“ (die Samenhaare der Baumwollkapsel) verwendet. Daraus können Pigmente aber nur noch sehr schlecht, bzw. überhaupt nicht mehr ausgewaschen werden. Das Papier eignet sich deshalb hervorragend für eine lasierende Arbeitstechnik (siehe dazu S. 36). Wichtig bei der Papierherstellung ist ein Zusatz von Kalziumkarbonat (mindestens 4%), das die Grundlage für die Alters- und Säurebeständigkeit der Papiere darstellt.
Büttenpapier
Bei Büttenpapieren handelt es sich um Rundsiebware. Der Papierbrei befindet sich in einer Bütte und legt sich um ein Rundsieb an. Büttenpapier als Bogenware erkennt man an den etwas fransig wirkenden Rändern, die in die Präsentation eines Bildes sehr schön einbezogen werden können. Das wichtigste Argument für Büttenpapier ist das Fließverhalten. Die im flüssigen Papierbrei in Bewegung befindlichen feinsten Hadernfransen ordnen sich bei dieser Herstellungsart kreuz und quer an. Diese Anordnung bedingt im späteren Anwendungsprozess, dass die Farbe sternförmig verfließt. Je höher die Grammatur, desto weniger wellt sich das Papier beim Malprozess.
Oberflächenbeschaffenheit
Die Oberflächenbeschaffenheit des Aquarellpapiers hat einen unmittelbaren Einfluss auf das Malergebnis. Grundsätzlich ist der Papierbrei einer bestimmten Sorte von der Oberflächenstruktur unabhängig. Diese Struktur, ob Feinkorn oder Grobkorn, wird erst während des Trocken- und Pressvorgangs mit einem Prägefilz erzeugt. Meine Vorliebe gilt einer glatten Oberfläche, die man auch als satiniert bezeichnet. Hier läuft das Papier beim Herstellungsprozess durch eine Kalandermaschine. Die Rollen dieser Maschine werden erhitzt, und in Verbindung mit der Reibungswärme wird die Oberfläche ganz glatt gepresst. Deshalb findet man bei manchen dieser Papiere den Zusatz „hotpressed“. Eine ganz glatte Oberfläche wie beim satinierten Papier reflektiert das Licht optimal und bringt die Aquarellfarben zum Leuchten.
Auf den drei Beispielpapieren wurde die Farbe jeweils links mit nassem Pinsel, rechts mit trockenem Pinsel aufgetragen.
Glattes Papier ergibt ein flächiges, einheitliches Farbbild.
Bei rauem Papier wirkt sich die gröbere Oberflächenstruktur bereits auf das Erscheinungsbild der Farbe aus.
Die Struktur von extra rauem Papier bleibt bei nassem und trockenem Farbauftrag sichtbar.
Aquarellfarben
Aquarellfarben werden vorwiegend aus folgenden Bestandteilen hergestellt: Neben den Farbpigmenten dient Gummi arabicum als klassisches Bindemittel. Dazu kommt ein Netzmittel, z. B. Ochsengalle, sowie Glycerin als feuchtigkeitsbindende Substanz. Zum Verkauf werden die Farben dann fertig gegossen in Näpfchen oder Tuben angeboten. Ich persönlich bevorzuge Tubenfarben, da das Malergebnis hier mehr Farbintensität aufweist. Probieren Sie zu Anfang einfach beide Varianten aus.
Beim Kauf von Aquarellfarben sollten Sie auf die Qualität der Produkte achten. Für mich ist die Lichtbeständigkeit der Farbtöne am wichtigsten. Viele Farbhersteller kennzeichnen die Lichtbeständigkeit der angebotenen Aquarellfarben wie folgt:
höchst lichtbeständig
hoch lichtbeständig
lichtbeständig
bedingt lichtbeständig
gering lichtbeständig
Ein weiteres wichtiges Kriterium stellt die Deckkraft bzw. Lasureigenschaft eines Farbtons dar. Dabei spielen zum einen die Dicke des Farbauftrags, zum anderen verschiedene Eigenschaften des jeweiligen Farbpigments eine Rolle.
deckend
halbdeckend
halblasierend
lasierend
Für eine lasierende Maltechnik spielt die Verankerung der Aquarellfarbe auf dem Papier eine wichtige Rolle. Diese Eigenschaft wird mit dem englischen Begriff „staining“ gekennzeichnet:
schwer abwaschbar
halb abwaschbar
leicht abwaschbar
Rechts finden Sie die wichtigsten Farben im Überblick. Mit einem • gekennzeichnete Farben empfehle ich als Grundausstattung.
Die Farbe aus den Tuben drücke ich in die Näpfchen meines Aquarellfarbkastens. Damit ist das Aquarellieren unterwegs einfacher, da der Kasten weniger Raum beansprucht als ein Tubensortiment und ich so alle Farben im Überblick habe.
• Reingelb
Jaune brillant
• Indischgelb
Chinacridongold
• Lasurorange
Zinnoberrot
• Perylene maroon
Purpur-Magenta
Alizarin Karmesin
Kobaltviolett
Ultramarinviolett
Ultramarinblau
• Kobaltblau hell
• Bergblau
Ceelinblu
Türkis
Phthalogrün
Chromoxid feurig
Grünoliv
Kobaltgrün rein
Maigrün
• Gelbgrün
• Olivgrün
Perylengrün
• Indigo
Paynesgrau
Caput mortuum
• Vandyckbraun
Siena gebrannt
Goldbraun
Titanweiß
Pinsel
Künstlerpinsel sind ein Meisterwerk der Handarbeit. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Echthaar- und Kunsthaarpinseln. Echthaarpinsel haben ein größeres Wasserhaltevermögen als Kunsthaarpinsel. Dies erklärt sich aus dem Aufbau eines Naturhaars, das an der Oberfläche feinste Schüppchen hat, deshalb das Wasser sehr lange hält und langsam abgibt. Die Fasern eines Kunsthaarpinsels sind dagegen an der Oberfläche glatt, die Flüssigkeit tropft leicht ab. Im Herstellungsprozess können diese Fasern in jeder Länge erzeugt werden, so dass auch Pinsel mit einem sehr großen Durchmesser hergestellt werden können. Die industrielle Herstellung der Fasern wirkt sich auf den Rohwarenpreis aus, was auch den Preisunterschied zu Echthaarpinseln erklärt.
Es gibt bei Echthaarpinseln unterschiedliche Arten, zum Beispiel „Kolinsky“, das Schweifhaar des sibirischen Marders, oder „Fehhaar“, das weiche Haar von Eichhörnchen. Der Vorteil bei Rotmarderhaaren liegt in ihrer Struktur: Das Marderhaar hat erst nach einem Drittel seiner Länge eine wurzelähnliche Verdickung. Deshalb steckt der Pinselkörper bis zu dieser Stelle in einer Zwinge und stellt damit die Grundlage für die hervorragende Spannkraft dar. Auch Synthetikfasern gibt es in unterschiedlichen Härtegraden. Die verwendeten Pinsel sollten auf Schluss gearbeitet sein. Dabei werden zwei gleich starke, natürlich gekrümmte Borstenbündel gegeneinander gearbeitet. Dies ist die Grundlage für eine lange Formstabilität. Für die Langlebigkeit Ihrer Pinsel ist außerdem die Pflege und Reinigung entscheidend: Waschen Sie die Pinsel nach dem Malen mit Wasser aus. Verwenden Sie bei Bedarf zur Reinigung des Pinselkörpers Kernseife. Stellen Sie sie anschließend zum Trocknen mit der Pinselspitze nach oben in einen Behälter.
Die wichtigsten Pinsel im Überblick:
Echthaarpinsel
Dieser Pinsel wird für den grundlegenden Lasurauftrag verwendet. Echthaare halten die Feuchtigkeit sehr gut, so dass störende Tropfen höchst selten entstehen. Als Alternative gibt es auch Mixhaarpinsel, die Synthetikfasern und Echthaar kombinieren. Diese Pinsel sind etwas preiswerter.
Mit dem Schrägschnittpinsel können feine Linien und Blütenfasern angelegt werden. Die richtige Handhabung sehen Sie auf dieser Abbildung.
Ein weiterer Einsatzbereich für den Schrägschnittpinsel sind z. B. architektonische Ansichten und Details. Dabei sind je nach Pinselhaltung sowohl flächige als auch lineare Elemente möglich.
Tipp:
Die Strichstärke wird von der im Pinsel vorhandenen Wassermenge beeinflusst. Um ganz feine Linien zu erzielen, streifen Sie zuerst den Pinsel an der Malkastenkante ab. Nun befindet sich nur noch so viel Wasser im Pinsel, dass der Strich hauchdünn wird.





























