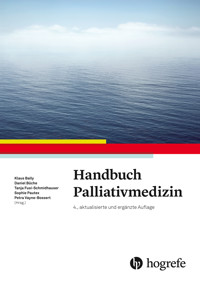
Handbuch Palliativmedizin E-Book
42,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Hohe Kompetenz und fundiertes Wissen in der PalliativmedizinDie Palliativmedizin versteht sich als integrative Disziplin, die lange vor dem Lebensende und über den Tod hinaus zum Einsatz kommt. Sie gehört in den Aufgabenbereich von Grundversorgenden und Spezialisten, von Pflegenden sowie Ärzten und ist geprägt vom Bestreben, die Lebensqualität der Patienten vorausschauend mitzugestalten, ihre Autonomie zu stärken und die Würde der Menschen in ihrer Vulnerabilität zu schützen.Die 4. Auflage des seit Jahren erfolgreichen Werkes wurde von einem neuen Herausgeberteam vollständig überarbeitet und erweitert. Folgende Aspekte werden praxisnah dargestellt:Ausführliche Erläuterung von Diagnostik und Therapie aller in der Palliativmedizin relevanten klinischen SymptomeHilfestellung bei komplexen Entscheidungsfindungen im Rahmen einer schweren KrankheitDarstellung der Bedeutung eines Palliativ-Netzwerks aus unterschiedlichen PerspektivenKonkrete Empfehlungen zur Kommunikation und Unterstützung von Betroffenen und AngehörigenAusführlicher Anhang mit hilfreichen Tipps und Service-Adressen Das Handbuch wurde ganz im Sinne der Interprofessionalität von unterschiedlichen Experten aus verschiedensten Berufsfeldern verfasst. Es soll dazu beitragen, die neuesten Erkenntnisse der Palliativmedizin in die tägliche Praxis umzusetzen sowie Fachpersonen in ihrem klinischen Alltag bei der Betreuung von Patienten und deren Angehörigen zu unterstützen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 940
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Klaus Bally, Daniel Büche, Tanja Fusi-Schmidhauser, Sophie Pautex, Petra Vayne-Bossert
(Hrsg.)
Handbuch Palliativmedizin
4., aktualisierte und ergänzte Auflage
unter Mitarbeit von
Johanna Anneser
Eva Bergsträsser
Martina-Barbara Bingisser
David Blum
Gian Domenico Borasio
Barbara Bucher
Christoph Cina
Henri Emery
Steffen Eychmüller
Michaela Forster
Jan Gärtner
Claudia Gamondi
Andreas Gerber
Heidrun Golla
Heike Gudat
Jean-Paul Janssens
Karin Jaroslawski
Steffen Kammler
Joachim Küchenhoff
Roland Kunz
Wolf Langewitz
Bénédicte Lasne Hachin
Francoise Laurent
Luisella Manzambi
Claudia Mazzocato
Marta Mazzoli
Andreas Monsch
Maya Monteverde
Hans Neuenschwander
Simon Peng-Keller
Raoul Pinter
Laetitia Probst
Florian Riese
Corina Salis Gross
Piotr Sobanski
Corinne Urech
Karine Vantieghem
Raymond Voltz
Andreas Weber
Catherine Weber
Judith Wieland
Mit Unterstützung von:
Handbuch Palliativmedizin
Klaus Bally, Daniel Büche, Tanja Fusi-Schmidhauser, Sophie Pautex, Petra Vayne-Bossert (Hrsg.)
Programmbereich Medizin
PD Dr. med. Klaus Bally (Hrsg.)
Universitäres Zentrum für Hausarztmedizin
beider Basel uniham-bb
Kantonsspital Baselland
Rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal
Dr. med. Daniel Büche, MSc (Hrsg.)
Klinik Gais AG
Gäbrisstrasse 1172
Postfach 131
CH-9056 Gais
Dr. med. Tanja Fusi-Schmidhauser, PhD (Hrsg.)
Clinica di Cure Palliative e di Supporto
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana – EOC
Via Tesserete 46
CH-6900 Lugano
Prof. Dr. med. Sophie Pautex (Hrsg.)
Hôpitaux Universitaires de Genève
Ch de la Savonnière 11
CH-1245 Collonge-Bellerive
Dr. med. Petra Vayne-Bossert (Hrsg.)
Hôpitaux Universitaires de Genève
Ch de la Savonnière 11
CH-1245 Collonge-Bellerive
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autoren bzw. den Herausgebern große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autoren bzw. Herausgeber und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Medizin
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Susanne Ristea, Lisa Maria Pilhofer
Bearbeitung: Elizabeth Dominik, Allendorf/Lumda
Herstellung: René Tschirren
Umschlagabbildung: Getty Images/James O’Neil
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Satz: punktgenau GmbH, Bühl
Format: EPUB
4. Auflage 2021
© 2021 Hogrefe Verlag, Bern
© 2015 by Verlag Hans Huber, Hogrefe AG, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-95969-6)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-75969-2)
ISBN 978-3-456-85969-9
http://doi.org/10.1024/85969-000
Nutzungsbedingungen:
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Teil I: Einführung
1 Gedanken zur PalliativmedizinHans Neuenschwander, Christoph Cina
1.1 Palliative Care: Definition und Bedeutung
1.2 Herausforderungen für den Hausarzt
1.3 Impulse durch das NFP 67
2 GebrauchsanweisungKlaus Bally, Daniel Büche, Tanja Fusi-Schmidhauser, Sophie Pautex, Petra Vayne-Bossert
3 Erkennen einer Palliativsituation – Voraussetzung für aufrichtige KommunikationPetra Vayne-Bossert, Klaus Bally
3.1 Einleitung
3.2 Instrumente zur Erfassung der Prognose/Überlebenswahrscheinlichkeit
3.3 Die Surprise-Question
3.4 Instrumente zu Erfassung von Palliativpatienten und deren Bedürfnissen
3.5 Kommunikation – Bereitschaft für ein Prognosegespräch und Wahrhaftigkeit
3.6 Der richtige Augenblick für ein Gespräch
3.7 Inhalte eines Gesprächs bei möglicher Verschlechterung des Gesundheitszustandes
Teil II: Symptome
4 AngstDaniel Büche, Joachim Küchenhoff
4.1 Einführung und Definition
4.2 Ätiologie und Epidemiologie
4.3 Pathophysiologie
4.4 Bedeutung
4.5 Beurteilung und Erfassung
4.6 Behandlung
4.7 Zusammenarbeit mit Pflegenden und anderen Fachärzten
5 Anorexie und KachexieDavid Blum, Daniel Büche
5.1 Einführung und Definition
5.2 Ätiologie und Epidemiologie
5.3 Pathophysiologie
5.4 Bedeutung und Prognose
5.5 Beurteilung und Erfassung
5.6 Behandlung
5.7 Zusammenarbeit mit Pflegenden und anderen Fachärzten
6 Asthenie – FatigueDaniel Büche, Raoul Pinter
6.1 Einführung und Definition
6.2 Ätiologie und Epidemiologie
6.3 Pathophysiologie
6.4 Bedeutung und Prognose
6.5 Beurteilung und Erfassung
6.6 Behandlung
6.7 Zusammenarbeit im interprofessionellen Team
7 AszitesDaniel Büche
7.1 Einführung und Definition
7.2 Ätiologie und Epidemiologie
7.3 Pathophysiologie
7.4 Bedeutung und Prognose
7.5 Beurteilung und Erfassung
7.6 Behandlung
8 Darmobstruktion (Ileus)Claudia Mazzocato, Daniel Büche
8.1 Einführung
8.2 Ätiologie und Epidemiologie
8.3 Pathophysiologie
8.4 Bedeutung und Prognose
8.5 Beurteilung und Erfassung
8.6 Behandlung
8.7 Kommunikation
8.8 Zusammenarbeit mit Pflegenden und anderen Fachärzten
9 DelirJan Gärtner, Daniel Büche, Karin Jaroslawski
9.1 Einführung und Definition
9.2 Ätiologie und Epidemiologie
9.3 Pathophysiologie
9.4 Bedeutung und Prognose
9.5 Beurteilung und Erfassung
9.6 Behandlung
10 DehydratationCatherine Weber, Sophie Pautex
10.1 Definition
10.2 Ätiologie
10.3 Bedeutung und Prognose
10.4 Pathophysiologie
10.5 Beurteilung und Erfassung
10.6 Behandlung
10.7 Kommunikation
11 DiarrhöJan Gärtner, Karin Jaroslawski
11.1 Einführung und Definition
11.2 Ursachen
11.3 Pathophysiologie
11.4 Beurteilung und Erfassung
11.5 Behandlung
12 DyspnoeSophie Pautex
12.1 Einführung und Definition
12.2 Ätiologie und Epidemiologie
12.3 Pathophysiologie
12.4 Bedeutung und Prognose
12.5 Beurteilung und Erfassung
12.6 Behandlung
13 HautproblemeDaniel Büche
13.1 Einleitung
13.2 Pruritus
13.3 Maligne Wunden
14 MundschleimhautproblemePetra Vayne-Bossert, Bénédicte Lasne Hachin
14.1 Einführung
14.2 Ätiologie, Epidemiologie und Pathophysiologie
14.3 Bedeutung und Folgen
14.4 Beurteilung und Erfassung
14.5 Behandlung
14.6 Zusammenfassung
15 Nausea und EmesisHeike Gudat
15.1 Einführung und Definition
15.2 Ätiologie und Epidemiologie
15.3 Pathophysiologie
15.4 Bedeutung und Prognose
15.5 Beurteilung und Erfassung
15.6 Behandlung
16 ObstipationClaudia Mazzocato
16.1 Einführung
16.2 Ätiologie
16.3 Bedeutung und Prognose
16.4 Beurteilung und Erfassung
16.5 Therapeutischer Ansatz
17 ÖdemeDaniel Büche
17.1 Einführung
17.2 Ätiologie und Epidemiologie
17.3 Pathophysiologie
17.4 Bedeutung und Prognose
17.5 Beurteilung und Erfassung
17.6 Behandlung
17.7 Zusammenarbeit
18 SchlafstörungenFlorian Riese
18.1 Einführung und Definition
18.2 Physiologie
18.3 Epidemiologie und Ätiologie
18.4 Pathophysiologie
18.5 Bedeutung und Prognose
18.6 Beurteilung und Erfassung
18.7 Behandlung
18.8 Zusammenarbeit mit Pflegenden und anderen Fachärzten
19 SchmerzenSteffen Eychmüller
19.1 Einführung
19.2 Beurteilung und Erfassung
19.3 Grundlagen der medikamentösen Schmerztherapie
19.4 Weitere medikamentöse und nicht-medikamentöse Maßnahmen der Schmerztherapie
19.5 Therapie mit Opioiden
19.6 Schmerztherapie und Sucht
19.7 Schmerzmedikamente: Übersicht
20 Sedierung bei refraktären SymptomenMarta Mazzoli
20.1 Einführung
20.2 Definition und Epidemiologie
20.3 Durchführung der palliativen Sedierung
20.4 Spezielle Situationen
20.5 Ethische Überlegungen
20.6 Kommunikation
20.7 Zusammenarbeit
21 Trauer und das Traurig-Sein aus neophänomenologischer PerspektiveWolf Langewitz, Steffen Kammler
21.1 Einführung
21.2 Begriffsklärung
21.3 Woher weiß ich, dass ich traurig bin?
21.4 Wie reagiert eine Person leiblich als trauernde Person?
21.5 Psychologische Modelle und Definitionen von Trauer
21.6 Psychiatrische Diagnostik
21.7 Eine Annäherung an den Trauerprozess aus neophänomenologischer Perspektive
21.8 Wie umgehen mit trauernden Menschen?
21.9 Zum Verhältnis eines leib-phänomenologischen und eines psychoanalytischen Zugangs
21.10 Fazit
Teil III: Spezieller Fokus auf besondere Palliativ-Care-Situationen
22 NotfallsituationenDaniel Büche
22.1 Einleitung
22.2 Rückenmarkskompression
22.3 Epileptischer Anfall, Status epilepticus
22.4 Obere Einflussstauung
22.5 Massive Blutung
23 Besonderheiten der Pharmakotherapie in der Palliative CareDaniel Büche
23.1 Einführung
23.2 Ursachen für Probleme der Pharmakotherapie in der Palliative Care
23.3 Anwendung von Arzneimitteln außerhalb der Zulassung
23.4 Mitführen von Arzneimitteln ins Ausland
23.5 Die wichtigsten Arzneimittel in der Palliative Care
23.6 Zusammenarbeit
24 End-of-Life Care oder die letzten TagePetra Vayne-Bossert
24.1 Einführung
24.2 Diagnose einer beginnenden Sterbephase
24.3 Maßnahmen bei Erkennen der Sterbephase
Teil IV: Entscheidungsfindung
25 Gesundheitliche Vorausplanung – Advance Care Planning (ACP) – PatientenverfügungenKlaus Bally, Sophie Pautex
25.1 Einführung
25.2 Vorgehen und Inhalte
25.3 Voraussetzungen zur Implementierung
25.4 Dokumentation
26 Entscheidungsfindung am LebensendeSteffen Eychmüller
26.1 Einführung
26.2 Die „5 P“ als Praxisleitfaden
26.3 „Concurrent care“ statt kurativ und palliativ
26.4 Gesundheitliche Vorausplanung – Advance Care Planning – Patientenverfügungen
26.5 Entscheidungsfindung und Ethik
26.6 Das Problem mit dem Zielkriterium Lebensqualität
26.7 Entscheidungsfindung in sechs Schritten
27 Sterbe- und Suizidwünsche bei unheilbarer KrankheitHeike Gudat, Claudia Gamondi
27.1 Einführung
27.2 Analyse und Interpretation von Sterbewünschen
27.3 Formen der Sterbehilfe
28 Umgang mit HoffnungSimon Peng-Keller
28.1 Konzeptionelle Grundlagen
28.2 Empirische Einsichten
28.3 Palliative Care als Hoffnungspraxis
Teil V: Netzwerk im interprofessionellen Team
29 Interprofessionelle ZusammenarbeitDaniel Büche
29.1 Einführung
29.2 Definition
29.3 Welches sind die Herausforderungen in der interprofessionellen Zusammenarbeit?
29.4 Bedeutung
29.5 Wo kommt interprofessionelle Zusammenarbeit in der Palliative Care zum Tragen?
30 Palliative Care in der HausarztmedizinAndreas Gerber
30.1 Einleitung
30.2 Strukturen und Organisationsroutinen
31 Die Rolle der PflegeMaya Monteverde, Luisella Manzambi
31.1 Einführung
31.2 Die Rolle der Pflegenden im spitalexternen Umfeld
31.3 Die Rolle der Pflegenden in Institutionen
31.4 Die Pflege im Palliativen Konsiliardienst – spitalintern und spitalextern
32 Seelsorgliche und gesundheitsberufliche Spiritual CareSimon Peng-Keller
32.1 Einführung
32.2 Spiritual Care als inter- und transprofessionelle Aufgabe
32.3 Schlüsselkonzepte: Spirituelle Ressourcen und Belastungen
32.4 Aufgaben von Spiritual Care in Palliative Care
33 Soziale Arbeit – Psychosoziale AspekteBarbara Bucher
33.1 Einführung
33.2 Soziale Arbeit in der Palliative Care
33.3 Psychosoziale Auswirkungen bei schwerer Erkrankung
33.4 Die Situation schwer kranker und sterbender Menschen
33.5 Gelingende interprofessionelle Zusammenarbeit – An- und Herausforderung
33.6 Trauer
34 Physiotherapie in PalliativsituationenHenri A. Emery
34.1 Einführung
34.2 Symptomlinderung
Teil VI: Netzwerk: Die Arbeitsweise
35 Austrittsplanung und die Betreuung zu HauseMaya Monteverde, Christoph Cina
35.1 Einführung
35.2 Praktisches Vorgehen
35.3 Das SENS-Modell als zentrales Element des Betreuungsplanes
35.4 Grenzen der Pflege zu Hause
35.5 Zu Hause leben bis zuletzt
36 Vernetzung und SchnittstellenmanagementAndreas Weber, Christoph Cina
36.1 Einführung
36.2 Betreuungsziele
36.3 Betreuungsteam
36.4 Controlling
37 PatientenpfadeSteffen Eychmüller
37.1 Einführung
37.2 Herausforderungen
37.3 Wege für die Zukunft
38 Selbst- und TeampflegeMichaela Forster
38.1 Einführung
38.2 Fallvignette
38.3 Lösungsansätze – Selbst- und Teampflege
Teil VII: Netzwerk in speziellen Settings und besonderen Patientengruppen
39 Palliative Care Community – regionales Netzwerk Palliative CareChristoph Cina
39.1 Einführung
39.2 Eine neue Sorgekultur und die Umsetzung im regionalen Netzwerk Palliative Care
39.3 Die Grundbedürfnisse des Menschen
39.4 Konkrete Umsetzung in der Palliative Care Community
40 Palliative Care bei Patienten mit TumorerkrankungenClaudia Mazzocato, Petra Vayne-Bossert
40.1 Einführung
40.2 Besondere Bedürfnisse von Patienten mit Tumorerkrankungen
40.3 Barrieren für einen frühzeitigen Zugang zu Palliative Care
40.4 Supportive Care und Palliative Care
40.5 Früherkennung von palliativen Situationen bei Tumorpatienten
40.6 Die Einbindung von Palliative Care in die Onkologie
41 Palliative Care bei Patienten mit neurologischen ErkrankungenGian Domenico Borasio, Heidrun Golla, Raymond Voltz, Johanna Anneser
41.1 Einleitung
41.2 Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
41.3 Schlaganfall
42 Palliative Care bei Patienten mit chronischem OrganversagenJean-Paul Janssens, Piotr Sobanski, Tanja Fusi-Schmidhauser
42.1 Einleitung
42.2 Palliative Care bei chronischen AtemwegserkrankungenJean-Paul Janssens
42.3 Palliative Care bei Patienten mit HerzinsuffizienzPiotr Sobanski
42.4 Palliative Care bei Patienten mit einer terminalen NiereninsuffizienzTanja Fusi-Schmidhauser
43 Palliativmedizin in der GeriatrieRoland Kunz
43.1 Einführung
43.2 Multimorbidität
43.3 Assessment
43.4 Beurteilung von Krankheitsverlauf und Prognose
43.5 Symptomtherapie beim multimorbiden geriatrischen Patienten
43.6 Die Angehörigen des geriatrischen Patienten
43.7 Entscheidungssituationen beim älteren Menschen
43.8 Flüssigkeits- und Nahrungszufuhr
44 Palliative Care bei KindernEva Bergsträsser, Judith Wieland
44.1 Einleitung
44.2 Lebenslimitierende Erkrankungen im Kindesalter (0–18 Jahre)
44.3 Betreuung, Behandlung und Begleitung von Kindern und deren Familien
44.4 Behandlungs- und Notfallplan
44.5 Erkennen und Behandeln von Symptomen
44.6 Gespräche über Sterben und Tod mit Kindern und deren Familien
44.7 Pflege des sterbenden/verstorbenen Kindes
45 Palliative Care bei Menschen mit BehinderungenKarine Vantieghem, Françoise Laurent, Laetitia Probst-Barroso
45.1 Einführung und Epidemiologie
45.2 Entscheidungsfindung
45.3 Diagnostisches Vorgehen
45.4 Beurteilung der Symptome
45.5 Behandlungen
45.6 Trauergefühle
45.7 Antizipation der Bedürfnisse am Lebensende
45.8 Interprofessionelle Zusammenarbeit
46 Diversitätssensitive Palliative CareKlaus Bally, Corina Salis Gross
46.1 Einleitung
46.2 Herausforderungen
46.3 Checklisten Migrationssensitive Palliative Care
Teil VIII: Kommunikation und Support für Angehörige
47 Wichtige Konzepte und daraus folgende InterventionenDaniel Büche
47.1 Unit of Care
47.2 Salutogenese
47.3 Empowerment
47.4 Krankheitsverständnis
47.5 Patienten- und Angehörigenedukation
48 Psychosoziale Aspekte bei Betroffenen und Angehörigen – Resilienz, Coping, RessourcenCorinne Urech, Martina-Barbara Bingisser
48.1 Einführung
48.2 Resilienz
48.3 Coping
48.4 Ressourcen
48.5 Zusammenfassung und Möglichkeiten zur Unterstützung der Familienangehörigen
49 SpiritualitätSimon Peng-Keller
49.1 Einführung
49.2 Die vielen Gestalten von „Spiritualität“
49.3 Spiritualität als basale Sinndimension
49.4 Spiritualität als Erfahrungsdimension
49.5 Spiritualität als Praxisdimension
Nachwort: Der persönliche Blick durch die Corona-BrilleHans Neuenschwander
Anhänge und Service
Anhang 1: ESAS (Edmonton Symptom Assessment System)Sophie Pautex
Anhang 2: Beurteilung der kognitiven Leistungsfähigkeit mit dem MMS und dem MoCAAndreas Monsch, Klaus Bally
Anhang 3: Beispiel für ein Instrument zur Protokollierung des SchmerzverlaufsRoland Kunz
Anhang 4: Schmerzerfassung bei kognitiv beeinträchtigten Menschen mit ECPARoland Kunz
Anhang 5: Medikamente in der Palliative Care und Off-Label-UseDaniel Büche
Anhang 6: Mischbarkeit diverser Medikamente für s. c. Applikation, für Infusionen oder SpritzenpumpenDaniel Büche
Anhang 7: Darf ich Medikamente teilen, zermörsern oder über (Magen)-Sonde verabreichen?Daniel Büche
Anhang 8: BetreuungsplanChristoph Cina
Anhang 9: AusbildungSteffen Eychmüller
Autorenverzeichnis
Internet-Adressen
Sachwortverzeichnis
|9|Teil I: Einführung
|11|1 Gedanken zur Palliativmedizin
Hans Neuenschwander, Christoph Cina
„Unser Leben als denkende, erlebende und handelnde Wesen ist zerbrechlich und stets gefährdet – von außen und von innen. Die Lebensform der Würde ist der Versuch, diese Gefährdung in Schach zu halten. Es gilt, unser stets gefährdetes Leben selbstbewusst zu bestehen.“
„Eine Art zu Leben.“ Pascal Mercier (Peter Bien)
1.1 Palliative Care: Definition und Bedeutung
Medizin ist primär darauf ausgerichtet, Krankheiten zu vermeiden, zu heilen und den Tod zu verhindern. Dies ist die Erwartung sowohl des Gesunden wie auch des Erkrankten. Es entspricht außerdem der Erwartung der Leistungserbringer, speziell der Ärzte1, als erfolgsgetrimmte Wiederinstandsetzer. Dementsprechend fokussieren sich Ausbildung und Forschung vorwiegend auf diese Ziele. Die Erfolge sind nicht von der Hand zu weisen; die Lebenserwartung hat in den letzten 60 Jahren ungefähr um 20 Jahre zugenommen. Das ist enorm. Ein großer Teil dieser Lebensverlängerung mag zwar nicht auf den bahnbrechenden Fortschritten der modernen Reparatur-Medizin, sondern auf der Verbesserung der Lebensumstände (Wohlstand, Ernährung, Hygiene, Gesundheitsbewusstsein und entsprechendes Verhalten, Unfallvorbeugung, usw.) beruhen. Aber dennoch: Krankheiten werden heute, vor allem in den ersten Lebensjahrzehnten, geheilt. Parallel dazu beobachten wir eine Wandlung von akuten Erkrankungen in chronische Krankheitszustände und damit verbundene verlängerte Lebenserwartung. Dadurch ist die Palliativmedizin immer aktueller geworden. Ein erheblicher Teil des wachsenden Bedarfs und der zunehmenden Bedürfnisse der Palliativmedizin können also paradoxerweise als nicht erwünschtes und vor allem nicht geplantes Nebenprodukt des Erfolgs der modernen Medizin betrachtet werden. Aldous Huxley (1894–1963) sagte es in visionärer Art schon vor über 60 Jahren so: „Die moderne Medizin hat so große Fortschritte gemacht, dass es fast keine gesunden Menschen gibt“.
Noch oft hört man den Einwand: Palliativmedizin ist nichts Neues, das haben wir immer und alle (auch) gemacht, das gehört intrinsisch zu unserem Berufsverständnis und zu unserem Rüstzeug an Haltung, Wissen und Fähigkeiten. Diese Aussage bildet sich in der täglichen Praxis immer weniger deutlich ab. Das mag verschiedene Gründe haben. Sicher spielt eine Rolle, dass vor allem in urbanen Gebieten – und andere gibt es in der Schweiz nur noch wenige – der Hausarzt auch bei weit fortgeschrittener |12|Krankheit, und vor allem bei der laufend zunehmenden Polymorbidität in fragilem Alter durch eine Gruppe, aber nicht ein Team, durch mehrere Krankheits- und Organspezialisten ersetzt wird. Dabei will jeder sicher das Beste für die Krankheit oder das Organ seiner Zuständigkeit, was sich mit dem Besten für den Patienten nicht unbedingt decken muss. Andererseits befindet sich die Grundversorgung durch neue Arbeitsmodelle (Wandel von Einzelpraxis zu Gruppenpraxen), Teilzeitarbeit und neue Professionen wie APN (Advanced Practice Nurse) in einem großen Strukturwandel. Ein zweiter Grund könnte sein, dass im Zeitalter der „Lösbarkeit aller Probleme“ Sterben aus den Optionen gefallen ist, sowohl für den Arzt wie für den Betroffenen. Ein Hauptgrund ist aber die Tatsache, dass die Palliativmedizin in den letzten 20 Jahren namhafte Fortschritte gemacht hat, welche bis auf den Tag in Vor- und Nachdiplomausbildung nicht gebührend vermittelt werden. Unter anderem diese Lücke soll das vorliegende Buch schließen helfen.
Es gibt viele Definitionsversuche von Palliativmedizin, was an sich schon heißt, dass es keinen befriedigenden gibt. Deshalb, und um ein paar Mythen auszuräumen, ist es einfacher und vielleicht auch sinnvoll, zu sagen, was mit Palliativmedizin nicht gemeint ist:
„Nicht nur am Ende“
Die Spitzenmedizin erlebt den Misserfolg ihrer Spitzenleistung manchmal als Niederlage: Sie verliert dann das Interesse. Das sollte eigentlich nicht passieren, wenn das Interesse nicht auf die Krankheit, sondern auf den Patienten und seine Bedürfnisse fokussiert wird. Dieser Gedanke gilt nicht nur für die Onkologie, sondern für eine ganze Reihe anderer Spezialitäten, welche in den letzten Jahrzehnten Durchbrüche erzielt haben (Kardiologie, Transplantationsmedizin u. a.). So beschränkt sich der Bedarf an Palliativmedizin nicht auf die Onkologie, und ebenso wenig auf die Phase des Lebensendes, sondern auf alle Gebiete, in denen akute in chronische Krankheiten umgewandelt werden. Sie befasst sich deshalb nicht mit bestimmten Krankheiten, sondern mit Menschen (und deren Bedürfnissen) in bestimmten, symptomatischen Phasen ihrer chronischen und/oder weit fortgeschrittenen Krankheit. Sie ist fächerübergreifend.
„Nicht nur Morphium“
Schmerz ist fast immer die Motivation, ein palliativmedizinisches Konsilium anzufordern. Meistens ist aber dieses Symptom nicht das wichtigste Problem. Viel häufiger besteht eine komplexe und instabile Polysymptomatik. Oft stellt es sich auch heraus, dass die Stolpersteine auch bei existenziellen oder psychosozialen und kulturellen Fragen liegen, bei Schwierigkeiten im Umgang mit nicht lösbaren Problemen, bei der Entwicklung von realistischen Erwartungen, oder in Momenten der konsensuellen Entscheidungsfindung. So wird der seelische Schmerz, welcher zerebral an gleicher Stelle verarbeitet wird wie der somatische Schmerz, unter Umständen bedeutsamer und nicht primär mit Morphium behandlungsbedürftig.
„Nicht nur Krebs“
Palliative Care steht für alle chronischen degenerativen nicht heilbaren Krankheiten zur Verfügung (neurologische, chronische Lungenkrankheiten, chronische Herzinsuffizienz und viele andere). Zunehmend wird uns die Besinnung der Integration von Palliativmedizin und Geriatrie beschäftigen. Die Herausforderungen, vor allem auch in den Entscheidungsprozessen, sind hier oft komplexer als bei Tumorleiden. Diese Entscheidungsprozesse werden im Gegensatz zu Krebserkrankungen nicht selten zeitlich hinausgeschoben oder vernachlässigt.
„Nicht nur der Arzt“
Palliativmedizin pflegt den umgreifenden multi- und interprofessionellen Ansatz. Das ist zwar auch anstrengend, aber unter dem Strich gewinnbringend. Ein ganzes Team (Arzt, Sozialarbeit, Pflege, Psychologie, Seelsorge, usw.) zieht am gleichen Strick und wenn möglich in |13|die gleiche Richtung. Deshalb gilt es ja politisch als unkorrekt, von Palliativmedizin zu reden. Der heute akzeptierte Ausdruck heißt Palliative Care (man kann ihn mögen oder nicht, aber wir sind immer noch auf der Suche nach einem besseren). Je nachdem, in welcher Dimension sich ein Leiden in einem bestimmten Moment schwerpunktmäßig äußert, wird sich der Lead im Lauf einer Lebens- und Krankengeschichte vielleicht zwischen einzelnen Berufsfachleuten verschieben.
Wir leben in einer 24-Stunden-Gesellschaft. Das Leben ist schnell geworden. Und trotzdem haben wir damit keine Zeit gewonnen. Zeit ist nicht gewinnbar, höchstens verlierbar.
In der Situation der fortgeschrittenen Krankheit, wenn man sogenannt „nichts mehr tun kann“, bietet der tiefere palliative Gedanke noch einmal, oder auch endlich, die Chance, die verbleibende Lebenszeit zu dezelerieren und ihr dadurch Qualität zu geben. Und gerade hier liegt einer der Schwerpunkte der Palliative Care: ein Erkennungssymbol für die moderne Kardiologie ist der Pace Maker, für die Orthopädie das Sulzergelenk, für die Onkologie die Chemotherapie, für die Radiotherapie der Linac. Gleichzeitig sind diese Symbole auch im Tarifsystem abgebildet. Für die Palliative Care ist ein wesentliches Erkennungsmerkmal die Zeit. Betreuen heißt doch auch, jemandem etwas geben, wovon er wenig hat, und wir wahrscheinlich mehr. Zeit also. Zeit ist teuer und schlechter fakturierbar als ein PET-Scan oder eine technisch aufwändige Therapie. Aber, wenn professionell mit entsprechendem Wissen und Fähigkeiten eingesetzt, ist Zeit sehr wirksam und relativ untoxisch. Es bleibt zu hoffen, dass diese Verzerrungen möglichst bald behoben werden und „Zeit der menschlichen Zuwendung“ als ein wertvolles Symbol im Tarifsystem abgebildet wird.
Die schwierigsten Momente in einer Patientenkarriere, für den Betroffenen und für den Arzt, eben häufig auch ein „Betroffener“, sind diejenigen, in denen eine wegweisende Entscheidung ansteht. Für den Onkologen zum Beispiel geht das irgendwann einher mit der Notwendigkeit zur Akzeptanz der Therapieresistenz der Tumorkrankheit. Als Palliativmediziner darf man von einem Onkologen selbstverständlich erwarten, dass er alle kurativen Möglichkeiten kennt und anbieten kann. Noch wichtiger ist aber, dass dieser Spezialist den natürlichen Verlauf einer Krankheit kennt, und dieses Wissen in seine Überlegungen einbezieht. Das Problem ist, dass es natürliche Verläufe fast nicht mehr gibt, sodass es zunehmend schwierig wird, sie zu (er-)kennen. Wir laufen dauernd Gefahr, anstehende Entscheidungen an „noch eine Untersuchung, noch ein Konsilium, noch ein interdisziplinäres Meeting, und noch eine Therapie“ zu delegieren, und beschneiden damit möglicherweise die Zeit des Patienten, die er noch hätte, um sich eben auf etwas anderes, oder mehr auf die Gegenwart (und vielleicht auch auf die Vergangenheit, seine Biografie) zu konzentrieren als auf eine nicht mehr realistische Zukunft. Die bald einmal uferlose Ausweitung der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten bringt zwar Fortschritt, aber gleichzeitig auch einen zunehmenden Verlust von Entscheidungsfähigkeit, Entscheidungswillen und Entscheidungskraft. Dabei lässt sich der Moment der „Therapieresistenz“ in der Onkologie noch relativ leicht identifizieren. Viel schwieriger ist dies bei anderen chronisch evolutiven Krankheiten wie der chronischen Herzinsuffizienz (CHF) oder den chronischen Lungenkrankheiten wie z. B. bei der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD). Und tatsächlich ist die Akzeptanz der Palliative Care bei Tumorleiden unter Onkologen heute recht gut etabliert. Viel Sensibilisierungsbedarf gibt es nach wie vor bei den erwähnten Krankheiten CHF und COPD. Die Integration von kurativem und palliativem Bemühen ist in diesen häufigen Situationen essenziell, und gleichzeitig anspruchsvoll.
Das heißt, dass die Palliative Care nicht nur sequenziell am allerletzten Ende an eine Pa|14|tientengeschichte angefügt und an die „Spezialisten“ delegiert werden soll, sondern dass sie die sogenannte kurative Phase kontaminieren und als Gedankengut und Haltung zum Beispiel in jede multidisziplinäre Sitzung während der ganzen Krankheitsphase einfließen möge. Es gibt heute genügend Evidenz für die Verbesserung der Lebensqualität, und vielleicht sogar auch von Lebensquantität (welche halt für viele Menschen auch ein Teil der Qualität ist) beim Einsatz von Palliative Care ab Diagnose.
Früher wurden alte Leute alt, weil sie gute genetische Voraussetzungen hatten. Die zukünftige Generation der über 80-Jährigen wird das hohe Alter erreichen, weil das Sterben an der akuten Krankheit vorher verhindert wurde. Das könnte auch heißen, dass die zukünftige Generation der alten Menschen vulnerabler, fragiler und kränker, resp. polymorbider sein wird, was für die Palliativmedizin und Palliative Care neue Herausforderungen mit sich bringen wird. Auch diese „neuen chronisch Kranken“ werden sich wünschen, an ihren Krankheiten nicht unmittelbar zu sterben, sondern dann auch trotz der Morbidität eine bestmögliche Lebensqualität zu bewahren.
Palliativmedizin als neu erwachter Anspruch wurde nach Jahren des Schattendaseins auf die Agenden der Politik (Nationale Strategie in Palliative Care 2010 – 2012 – 2015, Nationale Strategie gegen den Krebs 2014–20) der Aus- und Weiterbildungsprogramme gesetzt. Der Nationalfonds förderte die Schweizer Forschung über Palliative Care im Rahmen des NFP 67 („Lebensende“) von 2012 bis 2017. Das Forschungsprogramm wurde Ende Februar 2019 abgeschlossen. Die Resultate sind größtenteils veröffentlicht und geben der Palliativmedizin namhaften Schub (s. Kap. 1.3).
Seit 2016 gibt es in der Schweiz die Möglichkeit, einen interdisziplinären Schwerpunkttitel Palliativmedizin („IdS Palliativmedizin“) zu erwerben. Es handelt sich dabei um eine anforderungsreiche Zusatzausbildung, welche für das SWIF (Schweizerisches Institut für ärztliche Fort- und Weiterbildung) wegen seiner Interdisziplinarität eine Neuheit ist. Diese Entwicklung fördert einerseits zwar die Vertikalisierung der Spezialität, färbt aber auch auf die Qualität der allgemeinen Palliativmedizin in Verbreitung, Ausbildung und Forschung ab.
1.2 Herausforderungen für den Hausarzt
1.2.1 Rolle
Worte und Wörter sagen Vieles. Sie bestimmen Inhalte. In unseren Breitengraden wird die Figur „Hausarzt“ genannt; ein Arzt, der auch nach Hause geht, die regionalen Verhältnisse als auch den individuellen Kontext kennt, für welchen er zur Lebensqualität des Patienten beitragen soll. Auf französisch (médecin de famille) und italienisch (medico di famiglia) geht es vordergründig nicht um das Haus und Heim, sondern um das Beziehungsnetz. Idealerweise wird der Arzt diese Begriffe, respektive ihre Inhalte, bei der Interpretation seiner Rolle verschmelzen. Das gibt ihm einen unersetzbaren Mehrwert, den er in der interprofessionellen Zusammenarbeit einbringen kann und in seinem Berufsverständnis auch einbringen soll.
Das Buch ist praxisorientiert, von Fachpersonen aus der Praxis für Fachpersonen aus der Praxis konzipiert. Das vermittelte Wissen geht nicht immer in spezialistische Details, ist aber darauf ausgerichtet, dass bei seiner Anwendung unter Vermeidung gröberer Fehler nicht-komplexe klinische Probleme in Eigenregie angegangen, und dass komplexe Probleme als solche identifiziert werden können.
1.2.2 Entscheiden
Der Hausarzt ist ein Hauptadressat dieses Buchs. Er ist einer der wichtigen Entscheidungsträger. In der Palliativmedizin müssen oft Weichen gestellt werden (z. B. Hospitalisation |15|ja/nein, Ernährung oder Flüssigkeit ja/nein, Antibiotika ja/nein, Sedierung ja/nein, usw.). Wie entstehen Entscheidungen?
Am häufigsten entscheiden wir nicht, weil wir nicht wahrnehmen, dass eine Entscheidung ansteht, weil wir es vergessen, oder weil wir es hinausschieben. Nun, man kann das Nichtentscheiden auch als Entscheidung betrachten, indem wir alles dem natürlichen Verlauf überlassen. Das ist nicht per se falsch oder schlecht, es setzt aber ein entsprechendes Bewusstsein und die Kenntnis des natürlichen Verlaufs voraus, erworben aus Wissen und Erfahrung.
Wir entscheiden aus Gewohnheit („das habe ich schon immer so gemacht“). Dabei ist das Risiko einer Fehlentscheidung erheblich, wir messen uns nicht an einem Standard, außer an uns selber.
Wir entscheiden nach Evidenz. Dies wäre eigentlich das Vorgehen der „safety“. Leider gibt es aber in der Palliativmedizin wenige Daten mit hohem Evidenzniveau. So greifen wir dann auf Richtlinien oder Empfehlungen (z. B. dieses Buches) zurück, welche in der Regel vor allem Kondensate von Expertenmeinungen sind.
Bei anstehenden wichtigen Entscheidungen ist, gerade in der palliativen Situation, ein patienten- und bedürfnisorientierter Fokus angezeigt. Die Achtung der Autonomie des Betroffenen wird dabei den Entscheidungsprozess mitprägen. Allerdings geht es vor allem um die relationale Autonomie, welche das Beziehungssystem des Patienten mitberücksichtigt. Dass der Hausarzt oft auch noch Teil dieses Systems ist, kompliziert den Prozess zusätzlich. Das alles heißt, dass in zwei augenscheinlich identischen klinischen Situationen deutlich voneinander abweichende Entscheidungen vernünftig sein können.
Der Arzt, gerade der Hausarzt, sollte aufgrund seiner jahrelangen beruflichen Exposition den Umgang mit Unvorhersehbarem und Ungewissheit interiorisiert haben. Die evidenzbasierte Medizin (EBM) kann ihn von dieser einsam getragenen Bürde entlasten. Allerdings fokussieren EBM-Guidelines in der Regel auf eine bestimmte Krankheit. Vor dem Bild der Polymorbidität in palliativer Situation wird deshalb die korrekte Anwendung schwierig und nicht selten auch kontraproduktiv. Da muss die Integration von explizitem Wissen, z. B. aus Guidelines und implizitem Wissen aus inter- und intraindividueller Erfahrung zum Zuge kommen. „Evidenz“ ist zwar gut, sie könnte aber bei anstehenden Entscheidungen der Patientenorientiertheit im Wege stehen. In diesem Moment hat die Funktion des Hausarztes einen nicht ersetzbaren Mehrwert. Er kennt die betreute Person seit vielen Jahren – „ein Leben lang“ –, ist Teil seiner Biografie, und umgekehrt. Wenn er bewusst eine individualisierte Mischung zwischen „Evidenz und Eminenz (auf sich selber bezogen)“ sucht und findet, kommt der Mehrwert zum Zug, die Entscheidungen gewinnen an „Systemrelevanz“.
1.2.3 Zukünftige Herausforderung: Autonomie und Gerechtigkeit
Innerhalb der medizinisch-ethischen Grundsätze hat das Konzept der Autonomie in den letzten Jahren ein Primat eingenommen. Diese Entwicklung kann/konnte durch die Abwendung von Paternalismus und oder anderweitig begründbaren asymmetrischen Machtverhältnissen in der Entscheidungsgewalt gerechtfertigt werden. Sie wurde u. a. begünstigt durch den heute verblassenden Zeitgeist, dass alles Machbare möglich und alles Mögliche machbar sei, dass „der Himmel auch unter den Wolken grenzenlos sei“. Begünstigend wirkt auch die Forschungsfreiheit (die wir nicht missen möchten). Der Forscher fühlt sich bei seiner Arbeit und der Veröffentlichung der Resultate nicht verantwortlich für z. B. volkswirtschaftliche Konsequenzen, welche seine neuen Entdeckungen potenziell haben könnten. Und schließlich folgt der Gesundheitsmarkt (eigentlich ein Krankheitsmarkt) nicht üblichen Gesetzen von Angebot und Nachfrage mit dem Kontrollin|16|strument „Preis“, u. a., weil der Preis garantiert bleibt, auch wenn das Angebot ausufert.
Die Emanzipation des Patienten in die Richtung von Autonomie und Umsetzung der Selbstbestimmung ist eine Errungenschaft, die wir nicht mehr missen möchten. Gleichzeitig zeigt sie aber zunehmend ursprünglich nicht reflektierte Grenzen auf:
„Die Würde des Menschen besteht in der Wahl.“ (Max Frisch)
Muss dieser Satz von Max Frisch angesichts der begrenzten Ressourcen relativiert werden? Wie frei darf diese Wahl bleiben?
Wünschen kann der potenzielle Verbraucher und auch der potenzielle Leistungserbringer „alles“. Aber müssen alle verzichten, wenn es nicht für alle reicht? Oder: Sollen alle paritätisch ein wenig von den begrenzten Mitteln erhalten, oder doch umgekehrt, einige Ausgewählte genug und andere nichts?
Ursprünglich ist das Autonomieprinzip primär im Sinne eines Abwehrrechts, auf die Reaktion von sich verbreitendem therapeutischen Übereifer(acharnement thérapeutique) in den Vordergrund gerückt. Es geht dabei um den Verzicht auf vorhandene und angebotene Ressourcen. Bei diesem Teilaspekt des Autonomieanspruchs stellt sich die Frage der Verteilungsgerechtigkeit der Ressourcen nicht so sehr. Diese Konstellation finden wir vor allem im Rahmen der fortgeschrittenen Krankheit, besonders am Lebensende.
In zunehmendem Maße könnten aber angesichts von innovativen und ressourcenintensiven Therapieangeboten Anspruchsrechte quantitativ wichtiger werden. Die vorhandenen Ressourcen werden dann Bedarf und Bedürfnissen nicht mehr gerecht werden können, mit einer Ausuferung ist zu rechnen. Die alleinige Steigerung des Angebots zur Befriedigung der steigenden Nachfrage kann keine Lösung sein. Es werden sich deshalb regulierende Maßnahmen aufdrängen, welche im Widerspruch zum absoluten Autonomieprimat stehen werden. Die Frage wird sich stellen, wie Kriterien zur sinnvollen gerechten Verteilung der Ressourcen erarbeitet werden, eher gesetzlich (Gebote und Verbote), oder eher lenkend/regulierend (Leitplanken oder Leitschranken)?
Wir kommen nicht umhin, auch innerhalb des Respekts von autonomen Wünschen, sowohl auf individueller, wie auch auf kollektiver Ebene, Ziele auszuhandeln und zu formulieren. Diese Ziele müssen mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen realisierbar sein. Es wird nötig sein, von einer Kultur des „immer besser“ zu einer Kultur des „gut genug“ zu finden. Gesundheitsfachleute werden dabei eine besondere Verantwortung übernehmen müssen. So kann die persönlich eingeforderte Autonomie nur in einer sozialen Verantwortung gelebt werden.
1.3 Impulse durch das NFP 67
Der Nationalfonds förderte die Schweizer Forschung über Palliative Care im Rahmen des NFP 67 („Lebensende“) von 2012 bis 2017. Das Forschungsprogramm wurde Ende Februar 2019 abgeschlossen. Grundsätzlich machen die Resultate ein nach wie vor sehr heterogenes palliatives Betreuungsangebot in der Schweiz sichtbar. Neben wenigen Überversorgungen sind, mit großer Spannweite, Unterversorgungen am Lebensende immer noch häufig.
Die Resultate sind größtenteils veröffentlicht und geben der Palliativmedizin namhaften Schub. Sie untermauern einerseits mit Daten, „was wir schon immer vermuteten oder zu wissen glaubten“. Andererseits bringen sie auch viele neue Erkenntnisse, die hoffentlich in den klinischen Alltag und in die Gesundheitspolitik Eingang finden. Folgende Felder mit Handlungsbedarf werden identifiziert und mit „Impulsen“ im NFP-Bericht hervorgehoben:
Verbesserung von Kommunikation, Kooperation und Koordination der Versorgung. Davon sollen Schnittstellen (horizontal zwischen ambulanter und stationärer Betreuung, sowie vertikal zwischen allgemeiner |17|und spezialisierter Palliative Care) homogener verknüpft werden. Insbesondere wird der Einbezug von Angehörigen und Hausärzten hervorgehoben.
Förderung der Palliative Care in den Ausbildungscurricula aller Gesundheitsfachleute.
Durchsetzung von medizinethischen Grundsätzen, insbesondere zur Ermöglichung der gemeinsamen Entscheidungsfindung.
Verbesserung der kommunikativen Abläufe in Spitälern zur Vermeidung der Fraktionierung der Betreuung durch Spezialisierung.
Verbesserter Fokus auf die Betreuung besonders vulnerabler Personen (Kinder und Jugendliche, kognitiv Beeinträchtigte, Alloglotte, usw.).
Rechtliche und wirtschaftlich-soziale Anerkennung der „Laienarbeit“ durch Angehörige.
Erarbeiten von Transparenz in den Entscheidungsprozessen.
Datenanalyse im Hinblick auf die Revision des Erwachsenenschutzgesetzes, z. B. in Bezug auf Entscheidungsfähigkeit.
Förderung der Enttabuisierung im Umgang mit Sterben und Tod.
Fokus nicht nur auf die somatischen, sondern ebenso auf psychosoziale und spirituelle Aspekte am Lebensende.
Forschung am Lebensende anerkennen und etablieren.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Buch generell die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind, wenn von Patienten und Ärzten die Rede ist, auch weibliche Patientinnen und Ärztinnen gemeint.
Literatur
[1] Bundesamt für Gesundheit BAG: Palliative Care [Internet; abgerufen am 13. August 2020]. Verfügbar unter: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationale-gesundheitsstrategien/strategie-palliative-care.html
[2] Bundesamt für Gesundheit BAG: Plattform Palliative Care [Internet; abgerufen am 13. August 2020]. Verfügbar unter: https://www.plattform-palliativecare.ch/
[3] Bundesamt für Gesundheit BAG, Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren: Nationale Strategie gegen Krebs [Internet; abgerufen am 13. August 2020]. Verfügbar unter: https://www.nsk-krebsstrategie.ch/
[4] Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FNSNF): Lebenende, Nationales Forschungsprojekt NFP 67 [Internet; abgerufen am 13. August 2020]. Verfügbar unter: http://www.nfp67.ch/
|19|2 Gebrauchsanweisung
Klaus Bally, Daniel Büche, Tanja Fusi-Schmidhauser, Sophie Pautex, Petra Vayne-Bossert
Sie halten die 4. Auflage des Handbuchs Palliativmedizin in Ihren Händen. Für die Erstausgabe im Jahr 2000 zeichnete Hans Neuenschwander verantwortlich, ebenso für die Zweitausgabe 2005. 2015 hat abermals Hans Neuenschwander gemeinsam mit Christoph Cina das Handbuch für die 3. Auflage vollständig neu überarbeitet. In Anbetracht der aktuellen Dynamik im Fachgebiet der Palliativmedizin hat sich der Hogrefe Verlag dazu entschieden, schon im Jahr 2021 eine abermals umfassend neu bearbeitete 4. Auflage herauszugeben.
Die Herausgeber dieser 4. Ausgabe des Handbuchs Palliativmedizin sind sich bewusst, dass sie in große Fußstapfen treten. Sie bedanken sich bei Hans Neuenschwander und Christoph Cina für ihr Vertrauen, ihre anhaltende und tatkräftige Unterstützung im Rahmen der Realisierung dieser 4. Auflage und auch für ihre ganz wertvollen redaktionellen Beiträge.
Ebenso bedanken sich die Herausgeber bei Frau Susanne Ristea und Frau Lisa Maria Pilhofer vom Hogrefe Verlag für ihre kompetente Beratung und Begleitung in den vergangenen drei Jahren.
Das Buch trägt wie die 3. Auflage den Titel Handbuch Palliativmedizin. Dies bedeutet keineswegs, dass im vorliegenden Buch nur medizinische Aspekte beleuchtet werden und auf die mit dem umfassenderen Begriff der Palliative Care assoziierte Haltung nicht eingegangen wird. Es soll aber ein Buch sein, das wie schon die letzten drei Auflagen im medizinischen Umfeld im weitesten Sinn zur Anwendung gelangen wird, primär in der Grundversorgung, aber auch im spezialisierten Umfeld in Hospizen, Palliativabteilungen und natürlich auch im ambulanten Bereich der spezialisierten Palliativversorgung.
Die Herausgeber haben sich bei der Konzeption des vorliegenden Buches am in der Palliativmedizin zentralen Primat der Erhaltung und Förderung von Lebensqualität orientiert und daher das Buch in insgesamt neun Teile gegliedert:
Einführung
Symptome
besondere Situationen in der Palliative Care
Entscheidungsfindung
Netzwerk im interprofessionellen Team
die Arbeitsweise im Netzwerk
Netzwerkarbeit in speziellen Settings oder mit speziellen Patientengruppen
Kommunikation und Support für Angehörige
Anhänge und Services.
Die subjektiv empfundene Lebensqualität wird zu großen Teilen vom Gesundheitszustand beeinflusst und der Gesundheitszustand wird wiederum bestimmt durch
eine adäquate Symptomkontrolle
die bestmögliche körperliche Funktionsfähigkeit
das psychische Wohlbefinden
|20|und die Erfahrung von Lebenssinn und Erfüllung.
Daher sind in diesem Buch insgesamt 18 Kapitel der Symptomkontrolle gewidmet. Ganz bewusst wurde auf ein Kapitel mit dem Titel Psychiatrische Aspekte verzichtet, um auf die in der Palliativmedizin so wichtigen Symptome wie Angst, Delir, Schlafstörungen und Trauer vertieft einzugehen. Für jedes dieser Symptome wurde ein eigenes Kapitel neu geschrieben. In denjenigen Teil, der den besonderen Situationen in der Palliative Care gewidmet ist, wurde neben den Notfallsituationen und den Besonderheiten der Pharmakotherapie in der Palliativmedizin ein ganz neues Kapitel zur End-of-Life Care aufgenommen.
Ebenso wurde angesichts der zunehmenden Bedeutung der Gesundheitlichen Vorausplanung und der autonomen Entscheidungsfindung zusätzlich zum Kapitel über Entscheidungsfindung am Lebensende ein Kapitel zur Gesundheitlichen Vorausplanung geschrieben und in den Teil Entscheidungsfindung integriert. Ebenso wurde für diesen Abschnitt ein Kapitel über Umgang mit Hoffnung ganz neu verfasst und das ursprüngliche Kapitel über Sterbehilfe wurde deutlich erweitert und ist nun den Sterbe- und Suizidwünschen gewidmet. Auch auf den zunehmend an Bedeutung gewinnenden Freiwilligen Verzicht auf Nahrung und Flüssigkeit (FVNF) wird in diesem Kapitel eingegangen.
Für kaum eine Disziplin in der Medizin ist die Arbeit im Netzwerk so wichtig wie in der Palliativmedizin. Für jede im Bereich der Palliativmedizin tätige Fachperson gehört es zu den Grundvoraussetzungen, dass sie in der Lage ist, interprofessionell in einem Netzwerk tätig zu sein. Interprofessionalität bedeutet in diesem Kontext nicht nur die Zusammenarbeit zum Wohl des Patienten, sondern auch Respekt und Wertschätzung für die Partner aus anderen Berufsumfeldern sowie das Hinterfragen der eigenen Rolle im Netzwerk im Sinne einer Selbstreflexion. Daher sind der Arbeit im Netzwerk ganze drei übergeordnete Abschnitte im Buch gewidmet. In Anbetracht der Bedeutung der Arbeit im Netzwerk und auch der palliativen Betreuung von Menschen mit Nichttumorerkrankungen in Netzwerken wurden folgende Kapitel ganz neu geschrieben:
Palliative Care Community – regionales Netzwerk Palliative Care
Palliative Care bei Patienten mit Tumorerkrankungen
Palliative Care bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen
Palliative Care bei Patienten mit chronischem Organversagen
Palliative Care bei Menschen mit Behinderung und
Diversitätssensitive Palliative Care.
Schließlich wurde ebenfalls ganz neu ein Teil des Buches für den Bereich Kommunikation und Support für Angehörige vorgesehen. Für diesen Abschnitt wurde ein Kapitel mit dem Titel Wichtige Konzepte und daraus folgende Interventionen neu verfasst, ebenso wie ein Kapitel über Psychosoziale Aspekte bei Betroffenen – Resilienz, Ressourcen, Coping, Ressourcen sowie ein Kapitel über Spiritualität.
Ergänzt werden diese insgesamt 49 Kapitel durch mehrere Anhänge, welche die Leserschaft bei der täglichen Arbeit am Patienten unterstützen sollen.
Das vorliegende Handbuch wurde ganz im Sinn der Interprofessionalität von Fachpersonen mit ganz unterschiedlicher Ausbildung aus verschiedensten Berufsfeldern und aus allen Landesteilen der Schweiz wiederum für Menschen aus ganz unterschiedlichen Professionen ebenfalls aus der ganzen Schweiz verfasst und wird in deutscher, französischer sowie in italienischer Sprache herausgegeben. Die Mehrheit der Leser wird Autoren kennen, die an diesem Buch mitgewirkt haben. Dass Sie, liebe Leser, mit den Autoren dieses Buches in Kontakt treten, ist durchaus gewünscht und soll letztlich unseren Patienten zu Gute |21|kommen. Möge diese 4. Auflage des Handbuchs Palliativmedizin Sie in Ihrem klinischen Alltag zum Wohle der von uns gemeinsam betreuten Menschen und deren Angehörigen unterstützen und begleiten.
Bern, im Juli 2021
Klaus Bally
Daniel Büche
Tanja Fusi-Schmidhauser
Sophie Pautex
Petra Vayne-Bossert
(Hrsg.)
|23|3 Erkennen einer Palliativsituation – Voraussetzung für aufrichtige Kommunikation
Petra Vayne-Bossert, Klaus Bally
3.1 Einleitung
Bis vor wenigen Jahrzehnten wurde der Begriff der Palliativmedizin als Synonym für die Medizin am Lebensende verwendet. Erst in den letzten zehn Jahren konnte auch wissenschaftlich gezeigt werden, dass die frühe Erfassung der entsprechenden Bedürfnisse von betroffenen Menschen und deren Angehörigen mit der nachfolgenden palliativmedizinischen Unterstützung verglichen mit einer Population, die nicht in den Genuss dieser Früherfassung resp. frühen palliativmedizinischen Begleitung kommt, zu einer deutlich besseren Lebensqualität, zu einer Verringerung von Depressions- und Angstsymptomen und sogar zu einer Lebensverlängerung führt [16].
Dies hat aber noch nicht zu einem generellen Umdenken geführt. Leider werden Palliativsituationen von Gesundheitsfachpersonen immer noch viel zu spät als solche erkannt, was zur Folge hat, dass palliativmedizinisch ausgebildete Ärzte sowie Pflegende oftmals erst wenige Tage vor dem Lebensende beigezogen werden. Die empfohlenen Maßnahmen beschränken sich dann auf eine Symptomlinderung; eine eingehende psychosoziale Begleitung und Unterstützung bei wegweisenden Entscheidungen ist in diesem vergleichsweise späten Stadium oft nicht mehr realisierbar.
Je nach vorliegender Erkrankung mit der entsprechenden Prognose sollten die Bedürfnisse der betroffenen Patienten Monate bis Jahre vor ihrem Tod erfasst werden. Schon hier muss erwähnt werden, dass Instrumente, welche zur Ermittlung der Prognose resp. der Überlebenswahrscheinlichkeit geschaffen wurden, nicht in gleichem Maße geeignet sind, Menschen als Palliativpatienten zu identifizieren, um deren ganz spezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden.
3.2 Instrumente zur Erfassung der Prognose/Überlebenswahrscheinlichkeit
Um Überlebenswahrscheinlichkeiten zu bestimmen, wurden vor 20 Jahren sogenannte Prognose-Instrumente entwickelt, die in der Tabelle 3-1 einzeln beschrieben werden:
Palliative Performance Scale (PPS – aktuelle Version 2 [PPSv2])
Palliative Prognostic Index (PPI)
Palliative Prognostic Score (PaPS).
3.3 Die Surprise-Question
Wäre ich überrascht, wenn mein Patient innerhalb der kommenden 6–12 Monate versterben würde?
Seit mehr als 10 Jahren wird diese Frage eingesetzt, um unterstützt durch andere Indikatoren die Überlebensprognose eines Patienten abzuschätzen und ihn unter Umständen als Palliativpatienten zu identifizieren.
|24|Tabelle 3-1: Instrumente zur Erfassung der Prognose/Überlebenswahrscheinlichkeit.
Prognose-Instrument
Beschreibung
Besonderes
PPSv21
(Palliative Performance Scale)
Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des Karnofsky-Indexes: Neben der symptombezogenen Einschränkung der Aktivität und der Selbstversorgung werden auch der aktuelle Bewusstseinsgrad und die Nahrungs- sowie Flüssigkeitszufuhr durch den Patienten mitberücksichtigt.
Es sind keine Blutanalysen notwendig; das Instrument konnte in verschiedenen Populationen (nicht nur onkologische Patienten) getestet und validiert werden.
PPI2
(Palliative Prognostic Index)
Es handelt sich um eine Weiterentwicklung des oben beschriebenen PPS, wobei auch gewisse Symptome wie Atemnot und Delirium sowie gewisse klinische Zeichen wie das Vorliegen von Ödemen mitberücksichtigt werden.
Mit diesem Instrument können kurze Überlebenszeiten prognostiziert werden. So kann z. B. bei einer Punktzahl von > 6 eine zu erwartende Überlebenszeit von weniger als 3 Wochen mit einer Sensitivität von 80 % und einer Spezifität von 85 % vorausgesagt werden.
PaPS3 (Palliative Prognostic Score)
Dieses Instrument bedient sich zur genaueren Prognose gewisser Laborparameter.
Mit diesem Instrument können Überlebenswahrscheinlichkeit von > 30 Tagen prognostiziert werden.
1 [2]; 2 [9]; 3 [8].
Mittels eines systematischen Reviews wurde die Aussagekraft dieser Surprise-Question etwas genauer untersucht: Hierbei konnte eine große Variabilität bezüglich der Fähigkeit, Patienten in ihrem letzten Lebensjahr zu erkennen, festgestellt werden (Sensitivität: 11,6–95,6 %). Insbesondere ist diese Frage ungeeignet, um Patienten zu identifizieren, welche nicht auf Palliative Care angewiesen sein werden (Spezifizität: 13,8–98,2 %) [19].
Bei allen oben aufgeführten Prognose-Instrumenten nimmt die Qualität von Überlebensprognosen mit zunehmend verbleibender Lebenserwartung eines Patienten ab. Ärzte sind häufig zu optimistisch und überschätzen die Überlebenszeit, vor allem dann, wenn ein Patient voraussichtlich noch länger als drei Monate leben wird. Bei einer Überlebenswahrscheinlichkeit von mehr als einem Jahr entspricht das Prognostizieren durch Ärzte eher einem Ratespiel als einem wissenschaftlich erprobten Instrument (Genauigkeit schwankt von 23–78 %) [20]. Auch sind, vor allem bei älteren Menschen mit vielen Komorbiditäten, die Krankheitsverläufe sehr individuell und daher schwer vorhersagbar [1].
Da es letztlich darum geht, die palliativen Bedürfnisse von ernstlich erkrankten Menschen zu erfassen, und diese Bedürfnisse oftmals nicht in Zusammenhang stehen mit der prognostizierten Überlebenswahrscheinlichkeit, wurden in den letzten Jahren mehrere Instrumente entwickelt, welche nicht mehr alleine auf Überlebensprognosen basieren, sondern sich an den Bedürfnissen der Menschen sowie an allgemeinen und krankheitsspezifischen Indikatoren orientieren.
|25|3.4 Instrumente zu Erfassung von Palliativpatienten und deren Bedürfnissen
Am bekanntesten und als Vorreiter für solche Instrumente ist sicher der Gold-Standard-Framework zu erwähnen, welcher bereits schon seit zwanzig Jahren im angelsächsischen Sprachraum gebraucht wird und heute als „Evidence Based Best Practice“ gilt [17]. Dieses Instrument hat sich bewährt, indem es nachweislich die Früherkennung von Palliative-Care-Situationen optimiert, eine Zusammenarbeit im Netzwerk fördert, sowie ein sorgfältiges Advance Care Planning ermöglicht. Als „Trigger-Punkte“ werden in einem Flowchart drei Schritte festgehalten, wobei jeder für sich alleine geeignet ist, einen Palliativpatienten als solchen zu identifizieren und in der Folge seine entsprechenden Bedürfnisse zu erfassen sowie diesen gerecht zu werden:
1. Schritt: Beantwortung der oben erwähnten Surprise-Question.
2. Schritt: Berücksichtigung allgemeiner Indikatoren wie z. B. eine zunehmende funktionelle Einschränkung, signifikanter Gewichtsverlust (> 10 % des Körpergewichts innerhalb der letzten 6 Monate) oder aber auch der Wunsch des Patienten auf Therapieverzicht resp. Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen.
3. Schritt: Erheben von spezifischen klinischen Indikatoren der vorliegenden Organerkrankung. Dies kann beispielsweise bei chronischen Lungenerkrankungen sehr hilfreich sein und erlaubt das Erfassen von Palliativsituationen, die Ärzte spontan oftmals nicht als palliativ einschätzen würden.
Ähnliche Instrumente sind mittlerweile in verschiedenen Sprachen erhältlich. Die in der Schweiz gebräuchlichsten werden in Tabelle 3-2 dargestellt und erläutert.
Speziell zu erwähnen ist ein allerdings noch nicht validiertes Instrument mit dem Namen Pallia 10–CH. Hierbei handelt es sich um ein einfaches 10-Frage-Instrument, abgeändert von der französischen Originalfassung der Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs (SFAP), veröffentlicht im Kanton Waadt im Rahmen der kantonalen Strategie Palliative Care.
Sobald ein Palliativpatient als solcher identifiziert wurde, wird man sich Gedanken machen, was dies für die Kommunikation und für die weitere Betreuung bedeutet. Das Behandlungsziel soll nun klar auf die Lebensqualität ausgerichtet sein. Auf belastende Interventionen mit bescheidenem bis nicht vorhandenem Nutzen [14] und Spitaleinweisungen mit unklarem Behandlungsziel soll zum Wohl des Patienten verzichtet werden [3].
3.5 Kommunikation – Bereitschaft für ein Prognosegespräch und Wahrhaftigkeit
Die Art der Kommunikationin diesem Stadium der Erkrankung unterscheidet sich grundsätzlich von derjenigen, die für das Überbringen schlechter Nachrichten zur Anwendung gelangt. Es geht um Unsicherheit bzgl. des weiteren Verlaufs, das Abwägen der Prognose und insbesondere auch um das Krankheitsverständnis des betroffenen Menschen. Dabei spielt die Bereitschaft des Patienten, sich auf ein derartiges Gespräch einzulassen, eine wichtige Rolle. Entscheidend ist letztlich, dass der Patient in die Lage versetzt wird, aufgrund der erhaltenen Informationen die für ihn persönlich richtigen Entscheidungen zu treffen [7].
|26|Tabelle 3-2: Instrumente zur Erfassung von Palliativpatienten und deren Bedürfnissen.
Name
Jahr
Sprache
Setting
Anzahl Indikatoren/Parameter
Zeitbedarf
Sensitivität/Spezifität
Gold Standard Framework Prognostic Indicator Guidance (GSF-PIG)
2000
4. Aufl. (2011)
Englisch
Vor allem Grundversorgung; auch in Klinken getestet
Flussdiagramm mit 3 Kapiteln
„Surprise question“
Allgemeine Indikatoren (11 + funktionelles Assessment)
Spezifische Indikatoren nach Organsystem unterteilt (11)
N/A
1Sensitivität: 62,6 %
Spezifität: 91,9 %
Tool to identify Advanced-Terminal patients in need of palliative care within health social services (NECPAL CCOMS-ICO© TOOL)2
2011
3.1 Aufl. (2017)
Englisch
Spanisch
Portugiesisch
Grundversorgung
Flussdiagramm mit 3 Kapiteln
„Surprise question“
11 allgemeine Parameter
2 spezifische Parameter
Gemäß NECPAL ist ein Mensch dann als Palliativpatient zu betrachten, wenn die „Surprise Question“ bejaht wird und mindestens ein Parameter identifiziert werden kann.
N/A
3Sensitivität: 91,4 %
Spezifität: 32,9 %
Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICTTM)4
2014
Deutsch
Englisch
Französisch
Spanisch
Portugiesisch
Dänisch
Schwedisch
Holländisch
Japanisch
Vor allem Grundversorgung; auch in Klinken getestet
6 allgemeine Indikatoren
mehrere spezifische Indikatoren nach Organsystem unterteilt (7)
5–10 Min.
5Sensitivität: 78 %
Spezifität: 72 %
RADboud Indicators for Palliative Care Needs (RADPAC)6
2012
Englisch
Vor allem Grundversorgung; geeignet für Tumorpatienten, Patienten mit COPD und chronischer Herzinsuffizienz
Indikatoren pro Krankheit
COPD: 6 Indikatoren
CHI: 7 Indikatoren
Tumor: 8 Indikatoren
N/A
N/A
Pallia 107
2010 1. Aufl.
Französisch
Grundversorgung
10 Punkte
Palliative Care Betreuung ist bei > 3 Punkten indiziert.
N/A
N/A
N/A: Daten nicht bekannt; COPD: Chronic Obstructive Pulmonary Disease; CHI: chronische Herzinsuffizienz.
1 [12]; 2 [4]; 3 [5]; 4 [6]; 5 [10]; 6 [18]; 7 [15].
Gemäß den Medizin-ethischen Richtlinien der SAMW „Palliative Care“ [13] (angepasst an das neue Erwachsenenschutzrecht 2013)
gehört zur palliativen Behandlung und Betreuung ganz zentral der Aspekt der offenen, adäquaten und einfühlsamen Kommunikation mit dem Patienten und auf dessen Wunsch mit seinen Angehörigen.
|27|versetzt eine verständliche und wiederholte, stufenweise Aufklärung den Patienten in die Lage, realistische Erwartungen zu entwickeln und ermöglicht eine eigenständige Willensbildung und Entscheidung.
sind Empathie und Wahrhaftigkeit sowie die Bereitschaft, Möglichkeiten und Grenzen der kurativen wie der palliativen Behandlung offenzulegen, Grundvoraussetzungen dazu.
Wenn Max Frisch einmal sagte, dass man dem anderen die Wahrheit wie einen Mantel hinhalten soll, dass er hineinschlüpfen kann und nicht wie ein nasses Tuch um den Kopf schlagen soll, meinte er damit wohl auch, dass man individuelle und kulturelle Besonderheiten berücksichtigen soll (s. auch Kap. 46). Ebenfalls in den Medizin-ethischen Richtlinien der SAMW „Palliative Care“ ist daher festgehalten, dass sich manchmal ein Patient nicht realistisch mit seiner Krankheit auseinandersetzen möchte. Diese Haltung sei zu respektieren. Sie erlaube dem Kranken, Hoffnungen zu hegen, die ihm helfen können, eine schwierige Situation besser auszuhalten. Hoffnung habe einen eigenständigen Wert, welcher palliative Wirkung entfalten könne.
3.6 Der richtige Augenblick für ein Gespräch
Patienten mit lebensbedrohlichen Erkrankungen erleben eigentliche Schlüsselmomente, an denen sie grundsätzlich empfänglich sind für Gespräche über die Prognose ihrer Erkrankung. Murray et al. [11] beschreiben drei unterschiedliche Verläufe von chronischen zum Tode führenden Erkrankungen:
1. Krankheiten mit einer raschen funktionellen Verschlechterung kurz vor dem Lebensende
Diesen Verlauf beobachtet man typischerweise bei Tumorpatienten. Zu einer Einschränkung ihres psychischen Wohlbefindens kommt es bei diesen Menschen zum Zeitpunkt der Diagnosestellung, nach der Spitalentlassung im Anschluss an die erste Therapie, bei einem Fortschreiten der Erkrankung unter Behandlung und schließlich Tage bis Wochen vor dem Lebensende. Das sind diejenigen Situationen, in denen Patienten oftmals verunsichert sind und empfänglich für vertiefende Gespräche. Dann sind auch Diskussionen über den zu erwartenden Verlauf der Erkrankung mit evtl. vorwegzunehmenden Entscheidungen angezeigt. Dies gilt insbesondere auch für Stadien der Erkrankung, in denen noch ein kurativer Ansatz verfolgt wird.
2. Erkrankungen mit intermittierenden funktionellen Verschlechterungen
Es sind dies in der Regel Patienten mit chronischem Organversagen wie COPD-Patienten, Menschen mit weit fortgeschrittener Herz- oder Niereninsuffizienz oder auch mit einer Leberinsuffizienz infolge Leberschädigung bei chronischer Hepatitis oder übermäßigem Alkoholkonsum. Diese Patienten werden häufig nicht oder viel zu spät als Palliativpatienten identifiziert, weswegen im Gespräch oftmals nur Therapiemöglichkeiten besprochen werden und kaum einmal potenzielle Entscheidungen über das Unterlassen oder Erbringen von lebensverlängernden Maßnahmen. Bei diesen Menschen bietet sich insbesondere der Moment nach einer Spitalentlassung an, um Gespräche über die Prognose und sich daraus ableitende Entscheidungen zu führen.
Wichtig ist es auch in Erfahrung zu bringen, ob diese Patienten bei einer erneuten Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes nochmals hospitalisiert werden möchten.
3. Erkrankungen mit einer allmählichen oftmals sich über Jahre hinziehenden funktionellen Verschlechterung
Hierzu gehören Menschen mit einer Demenz aber auch Patienten mit einer chronisch fortschreitenden neurodegenerativen Erkrankung. Auch diese Individuen werden häufig nicht als |28|Palliativpatienten erkannt. Der entscheidende Augenblick für ein Gespräch über die Prognose der Erkrankung wird oft verpasst, weswegen Entscheidungen stellvertretend für den bei fortgeschrittener Erkrankung urteilsunfähigen Patienten gefällt werden müssen. Bei diesen Menschen gilt es, Gespräche über das weitere Vorgehen bei evtl. ungünstigem Verlauf so früh wie möglich anzusetzen.
3.7 Inhalte eines Gesprächs bei möglicher Verschlechterung des Gesundheitszustandes
Zuerst wird man sich einige Grundfragen stellen und diese mit dem Patienten ansprechen:
Was denkt der Patient; wie viel versteht er von seiner Erkrankung; was möchte er über seine Erkrankung und den zu erwartenden Verlauf wissen; was möchte er planen resp. frühzeitig entscheiden?
Welche Ziele (kurativ und/oder palliativ) sollen im Gespräch mit dem Patienten vereinbart werden; ist ein Plan B vorgesehen bei Verschlechterung der gesundheitlichen Situation?
Wer in der Familie soll wie umfassend informiert und aufgeklärt werden?
Die Erfahrung zeigt, dass Patienten oftmals gar nicht bereit sind, die Botschaft über eine Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes anzunehmen und Gespräche über die Prognose der Erkrankung zu führen. Jackson et al. [7] raten dazu, in solchen Situationen primär die Dringlichkeit zu definieren, mit der die prognostischen Überlegungen angestellt werden sollen und ein auf den individuellen Patienten zugeschnittenes Gespräch zu führen. Oftmals benötigt der Patient Zeit, um sich für solche Diskussionen zu öffnen. Dass schwer kranke Menschen gleichzeitig erfüllt sind von der Hoffnung auf eine Genesung und der Angst vor einem ungünstigen Verlauf ist eher die Regel als die Ausnahme. Hier sind insbesondere Fragen geeignet wie „Was würde es für Sie bedeuten, wenn sich ihre Hoffnung auf eine Genesung nicht erfüllen würde – haben Sie sich hierzu schon Gedanken gemacht?“
Praxistipps
Murray et al. [11] geben einige ganz konkrete Empfehlungen, wie ein solches Gespräch geführt werden könnte:
„Wenn einer meiner Patienten eine Erkrankung wie die Ihrige hat, führe ich in der Regel ein Gespräch mit ihm über die Prognose resp. die zu erwartenden Verläufe. Es ist ja erfreulich, dass die Therapie diesmal erfolgreich war; auf der anderen Seite mache ich mir Gedanken, was sein wird, wenn Ihre Krankheit eines Tages nicht mehr wirksam behandelt werden kann.“
„Möchten Sie mit mir allein darüber sprechen oder sollen wir noch jemanden aus Ihrem Familien- resp. Freundeskreis beiziehen?“
„In diesem Gespräch sollten wir erfassen, wozu Sie jetzt und in Zukunft in der Lage sein möchten; auch möchte ich mit Ihnen über Ihre aktuelle Situation sprechen, welche Informationen Sie zu Ihrer Krankheit benötigen und welche Gedanken und Sorgen Sie sich machen, wenn Sie an Ihre Zukunft denken.“
„Darf ich Sie fragen, was Ihnen bisher zu Ihrer Krankheit mitgeteilt wurde und wie ein möglicher Verlauf aussehen könnte?“
„Was ist Ihnen wichtig, im Voraus festzulegen resp. zu entscheiden?“
„Es ist mir ein Anliegen, dass Ihre Lebensqualität so gut als möglich ist; ich habe auch die Möglichkeit, zum Erreichen dieses Ziels einen Spezialisten auf dem Gebiet der Palliative Care beizuziehen.“
Im Verlauf dieses Gesprächs ist es von Bedeutung, immer wieder Pausen einzulegen, in denen der Patient sich Fragen überlegen kann und auch Emotionen wie Angst und Wut zum Ausdruck bringen kann.
|29|Derartige Gespräche sollen dazu dienen
ein Vertrauensverhältnis zwischen dem Patienten und den ihn betreuenden Gesundheitsfachpersonen zu schaffen.
eine gesundheitliche Vorausplanung einzuleiten für Situationen der erhaltenen Urteilsfähigkeit, insbesondere aber auch für Zeiten, in denen eine Urteilsfähigkeit nicht mehr gegeben ist (s. auch Kap. 25).
Behandlungsziele festzulegen.
den Patienten auf mögliche belastende Symptome hinzuweisen und Wege aufzuzeigen, wie die Symptomlast gelindert werden kann.
dem Patienten gut informierte autonome Entscheidungen zu ermöglichen.
mit dem Patienten entsprechend seinen Bedürfnissen und seiner Belastbarkeit ein Betreuungsnetzwerk zu etablieren.
die Angehörigen entsprechend dem Wunsch des Betroffenen miteinzubeziehen.
Literatur
[1] Amblàs-Novellas J, Espaulella J, Rexach L, Fontecha B, Inzitari M, Blay C, et al. Frailty, severity, progression and shared decision-making: a pragmatic framework for the challenge of clinical complexity at the end of life. Eur Geriatr Med. 2015;6:189–94. Crossref
[2] Anderson F, Downing GM, Hill J, Casorso L, Lerch N. Palliative Performance Scale (PPS): A New Tool. J Palliat Care. 1996;12(1):5–11. Crossref
[3] Detering KM, Hancock AD, Reade MC, Silvester W. The impact of advance care planning on end of life care in elderly patients: randomised controlled trial. BMJ. 2010;340:c1345. Crossref
[4] Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz M, Blay C, Amblàs J, Vila L, Costa X. [Identification of people with chronic advanced diseases and need of palliative care in sociosanitary services: elaboration of the NECPAL CCOMS-ICO© tool]. Med Clin (Barc). 2013 Mar 16;140(6):241–5.
[5] Gómez-Batiste X, Martínez-Muñoz M, Blay C, Amblàs J, Vila L, Costa X, et al. Utility of the NECPAL CCOMS-ICO© tool and the Surprise Question as screening tools for early palliative care and to predict mortality in patients with advanced chronic conditions: A cohort study. Palliat Med. 2017 Sep;31(8):754–63.
[6] Highet G, Crawford D, Murray SA, Boyd K. Development and evaluation of the Supportive and Palliative Care Indicators Tool (SPICT): a mixed-methods study. BMJ Support Palliat Care. 2014 Sep;4(3):285–90. Available from [Last accessed 23.09.2019]: https://www.spict.org.uk/Crossref
[7] Jackson VA, Jacobsen J, Greer JA, Pirl WF, Temel JS, Back AL. The cultivation of prognostic awareness through the provision of early palliative care in the ambulatory setting: a communication guide. J Palliat Med. 2013;16:894–900. Crossref
[8] Maltoni M, Nanni O, Pirovano M, Scarpi E, Indelli M, Martini C et al. Successful validation of the Palliative Prognostic Score (PaP Score) in terminally ill cancer patients. J Pain Symptom Manage. 1999;17(4):240–47. Crossref
[9] Morita T, Tsunoda J, Inoue S, Chihara S. The palliative prognostic index: a scoring system for survival prediction of terminally ill cancer patients. Support Care Cancer. 1999;7:128–33. Crossref
[10] Mudge AM, Douglas C, Sansome X, Tresillian M, Murray S, Finnigan S, et al. Risk of 12-month mortality among hospital inpatients using the surprise question and SPICT criteria: a prospective study. BMJ Support Palliat Care. 2018 Jun;8(2):213–20 Crossref
[11] Murray SA, Kendall M, Mitchell G, Moine S, Amblas Novellas G, Boyd K. Palliative care from diagnosis to death. BMJ. 2017 Feb 27;356:j878. Crossref
[12] O’Callaghan A, Laking G, Frey R, Robinson J, Gott M. Can we predict, which hospitalised patients are in their last year of life? A prospective cross-sectional study of the Gold Standards Framework Prognostic Indicator Guidance as a screening tool in the acute hospital setting. Palliat Med. 2014 May 22;14(8):1046–52.
[13] Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW). Medizin-ethische Richtlinien: Palliative Care [Internet; abgerufen am 13. August 2020]. 2006, angepasst an das Erwachsenenschutzrecht 2013. Verfügbar un|30|ter: https://www.samw.ch/de/Publikationen/Richtlinien.html
[14] Scottish Government. Chief Medival Officer’s Annual Report 2014–15. NHS Scotland. Realistic medicine [Internet; cited 2020 Aug 13]. 2014. Available from: http://www.gov.scot/Resource/0049/00492520.pdf
[15] Suc A, Vinant P, Hirsch G, Pourchet S, Kanius A, Chelbani L, Cristol N. Pallia 10. Publié par la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs. Version 1 – Juin 2010
[16] Temel JS, Greer JA, Muzikansky A, Gallagher ER, Admane S, Jackson VA et al. Early palliative care for patients with metastatic non-small-cell lung cancer. N Engl J Med. 2010;363:733–42. Crossref
[17] Thomas K. Prognostic Indicator Guidance (PIG). 4th ed. The Gold Standards Framework Centre In End of Life Care CIC; Oct 2011.
[18] Thoonsen B, Engels Y, van Rijswijk E, Verhagen S, van Weel C, Groot M, et al. Early identification of palliative care patients in general practice: development of RADboud indicators for PAlliative Care Needs (RADPAC). Br J Gen Pract. 2012 Sep;62(602):e625–31. Crossref
[19] White N, Kupeli N, Vickerstaff V, Stone P. How accurate is the „surprise question“ at identifying patients at the end of life? A systematic review and meta-analysis. BMC Medicine. 2017;15:139. Crossref
[20] White N, Reid F, Harris A, Harries P, Stone P. A Systematic Review of Predictions of Survival in Palliative Care: How Accurate Are Clinicians and Who Are the Experts? PLoS One. 2016 Aug 25;11(8):e0161407. Crossref
|31|Teil II: Symptome
|33|4 Angst
Daniel Büche, Joachim Küchenhoff
4.1 Einführung und Definition
In der Palliativsituation sollte Angst sehr breit definiert werden, um diesem Gefühl beim schwerkranken und sterbenden Menschen gerecht zu werden. Einerseits sind Angstzustände eine normale Phase im Prozess der Anpassung an die lebensbedrohliche Krankheit. Schon Freud hat zwischen Realangst und neurotischer Angst unterschieden und Angst als ein Signal verstanden, das sich auf äußere, aber auch auf innere Bedrohungen ausrichtet [3]. Daher kann Angst in der Palliativsituation sowohl realistisch als auch als Signal nützlich sein. Andererseits können Angstzustände aber auch eine psychische Störung oder ein Krankheitssymptom darstellen.
Definition
Anxiety Definition nach ICD-11
Apprehensiveness or anticipation of future danger or misfortune accompanied by a feeling of worry, distress, or somatic symptoms of tension. The focus of anticipated danger may be internal or external.
Verängstigte Patienten in Palliativsituationen können bereits vor dem Auftreten der lebensbedrohlichen Erkrankung an einer Angststörung gelitten haben. Ebenso kann Angst auch als krankheitswertiges Symptom im Rahmen einer Anpassungsstörung oder einer sekundären Angststörung auftreten.
Angst gehört über den klinischen Bereich hinaus zur Conditio humana, wie die Existenzphilosophie herausgearbeitet hat [4, 5]. Auch Psychoanalytiker [3, 6, 11] haben darauf hingewiesen, dass Angst – insbesondere die Todesangst – eine treibende Kraft in unserem Leben und unserer menschlichen Entwicklung darstellt. Dabei erkannte Yalom den Tod als eine der vier ultimativen bzw. existentiellen Gegebenheiten des Menschen.
Die vier existenziellen, ultimativen Gegebenheiten/Herausforderungen des Menschen [11]
Tod
Freiheit (Freedom)
Einsamkeit (Isolation: intra-, interpersonell, existenzial)
Sinnlosigkeit (Meaninglessness).
Riemann legte in seinem Grundlagenwerk „Grundformen der Angst, eine tiefenpsychologische Studie“ [9] dar, wie wesentlich die Angst in der Entwicklung des Menschen ist. Dabei dürften angesichts des Todes und der als unausweichlich erlebten Endlichkeit des Lebens „die Angst vor der Wandlung“ (Vergänglichkeit und Unsicherheit) und „die Angst vor der Notwendigkeit“ (Endgültigkeit und Unfreiheit) in der Palliativsituation im Vordergrund stehen.
Somit darf Angst als häufiges Thema bei Patienten in Palliativsituationen und deren Angehörigen angenommen werden.
|34|Grundformen der Angst nach [9]:
Die Angst vor der Selbsthingabe, als Ich-Verlust und Abhängigkeit erlebt.
Die Angst vor der Selbstwerdung, als Ungeborgenheit und Isolierung erlebt.
Die Angst vor der Wandlung, als Vergänglichkeit und Unsicherheit erlebt.
Die Angst vor der Notwendigkeit, als Endgültigkeit und Unfreiheit erlebt.
Fallvignette
Die 60-jährige Frau R. wurde zum dritten Mal wegen unerträglicher Schmerzen zur medikamentösen Schmerztherapie der Palliativstation zugewiesen. Die Patientin litt an einem ossär metastasierenden Mammakarzinom und gab v. a. Rückenschmerzen an. Bei jeder Hospitalisation konnten mittels Opioidwechsel von Fentanyl TTS auf parenterales Morphin eine rasche Schmerzlinderung und eine deutliche Verbesserung der Funktion (Spazieren gehen und Aktivitäten des täglichen Lebens) erreicht werden. Auf ihren Wunsch hin wurde für die Entlassung wieder auf Fentanyl TTS gewechselt, einige Tage abgewartet, ob die Analgesie auch so befriedigend bleibe und die Funktion aufrecht erhalten werden könne, was jedes Mal der Fall war. Die Rehospitalisation durch ihre Onkologin erfolgte jeweils nach sieben bis zehn Tagen wegen v. a. nächtlichen unerträglichen Schmerzen mit zunehmender Funktionseinschränkung und Selbstvernachlässigung. Auf den Umstand angesprochen, was zuhause anders sei als im Krankenhaus, konnte die Patientin zuerst keine Auskunft geben. Nach anderen Symptomen gefragt, gab Frau R. zusätzlich eine Schlafstörung an, welche auf der Station weder beobachtet noch von der Patientin angegeben wurde. Somit wurde der Schlaf thematisiert. Die Patientin erklärte, dass sie zuhause abends und nachts jeweils Todesangst habe. Sie habe Angst einzuschlafen und nie mehr zu erwachen, und niemand würde dies merken oder gar bei ihr sein. Hier im Spital sei immer jemand da, hiertrete diese Angst nicht auf. Wir thematisierten die Angst und das Sicherheitsbedürfnis und kamen überein, dass die Übersiedlung in ein Pflegeheim eine Möglichkeit sein könnte. Auch nach dem Übertritt ins Pflegeheim blieb der Schmerz gut eingestellt, die Schlafstörungen waren verschwunden und die Angst trat deutlich in den Hintergrund – jedenfalls beeinträchtigte sie die Patientin nicht mehr wesentlich.
4.2 Ätiologie und Epidemiologie
Man unterteilt die klinisch belastende Angst, die sich gemäß ICD-11 auf die Funktionen, die Befindlichkeit und Beziehungen des Patienten auswirkt, wie folgt:
Klassifizierung der Angst nach ICD-11
Angst bei:
Stressstörungen (Anpassungsstörung)
spezifische Angststörung (generalisierte Angststörung, Panikstörungen, Phobien)
Depression mit Angstsymptomen
Delir
substanzbedingte Störungen (Alkohol-, Benzodiazepin-, Cannabinoid-bedingte Angststörung u. a.)
Angstsymptome bei Demenz.
Sekundäre Angststörungen (sie treten im Rahmen von Krankheiten/Gesundheitsstörungen auf, die nicht als psychische Störung oder Verhaltensstörung klassifiziert werden) bei:
Schmerzen
Dyspnoe
Angina pectoris
Hypoxämie
metabolischen und endokrinologischen Störungen (Hypoglykämie, Hypo- oder Hyperkalzämie, Hypo-, Hyperthyreose u. a.)
Arzneimittelwirkungen (Kortikosteroide, Theophyllin, Methylphenidat u. a.)
Gehirnverletzung
|35|Harnverhaltung, Verstopfung
existenzieller Bedrohung, spiritueller Krise
widersprüchlichen ärztlichen Informationen
Beziehungsabbruch, -konflikt.
Angststörungen liegen gemäß Studien bei ca. 10 % der Patienten in Palliativsituationen vor, Angst als Symptom werden bei ca. 25–50 % der Patienten erfasst. Viele Experten sind sich jedoch einig, dass Angst deutlich unterdiagnostiziert ist.
4.3 Pathophysiologie
Häufige Auslöser der Angst sind Übergangsphasen im Leben, Krisen, Verluste, Ausweglosigkeit, wenn Vertrautes in Gefahr ist, wenn Geborgenheit und Sicherheit verloren gehen. Alle diese Faktoren spielen angesichts des Todes und im Sterben eine ganz wesentliche und zugespitzte Rolle. Somit ist es nachvollziehbar, dass Patienten in Palliativsitutationen Angst haben können.
Konkret geben Patienten in Palliativsituationen Angst vor unerträglichen Symptomen, Leiden, Abhängigkeit, Kontrollverlust, Einsamkeit, dem Unbekannten, dem Nichts/Nicht-Existieren, dem was aus den Angehörigen wird an, und sie haben Angst davor, zur Belastung zu werden.
Angst wird zur Krankheit, wenn sie:
unangemessen stark oder anhaltend wird
ohne wirkliche, reale Bedrohung auftritt
nicht mehr ausgehalten oder kontrolliert werden kann
Leiden verursacht und das Leben einschränkt
verhältnismäßig starke Reaktionen auf körperlicher und emotionaler Ebene auslöst.
4.4 Bedeutung
Angst ist prinzipiell ein Alarmzeichen





























