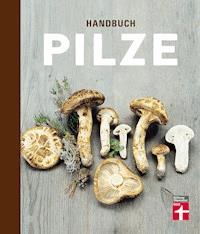
Handbuch Pilze: Speisepilze und ihre Doppelgänger - Klare Einordnung durch Tableau- und Detailfotos - Für Anfänger und Pilzsammler E-Book
Pelle Holmberg
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stiftung Warentest
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
In diesem hochwertigen Nachschlagewerk für heimische Pilze begegnet Ihnen umfangreiches Wissen über die besten Speisepilze, ihre Doppelgänger und die giftigsten Pilze. Exzellente Tableau- und Detailfotos ermöglichen eine klare Einordnung, damit kein falscher Pilz in Ihren Korb wandert. Die Speisepilze sind nach dem Schwierigkeitsgrad ihrer Erkennbarkeit in vier Gruppen eingeteilt. So macht es dieses Buch Anfängern und fortgeschrittenen Pilzsammlern leicht, Pilze zu erkennen, richtig zuzubereiten und zu genießen. Das Handbuch Pilze ist in Zusammenarbeit mit einem Fachberater Mykologie der Deutschen Gesellschaft für Mykologie entstanden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HANDBUCHPILZE
PELLE HOLMBERG & HANS MARKLUND
Begriffe und Symbole
(siehe auch S. 48–49)
SPEISEPILZE sind mit einer weißen Ziffer in einem grünen Kreis markiert, der von einem grünen (= Anfängerpilze), blauen oder roten Quadrat umgeben ist.
Speisepilz
Mit Speisepilz meinen wir eine Pilzart, die nicht aus irgendeinem Grund zur Verwendung bei der Essenszubereitung ungeeignet ist. Ein wichtiges Kriterium ist, dass der Pilz Geschmacksstoffe enthalten muss, die nach der Zubereitung als in irgendeiner Weise angenehm oder interessant erlebt werden.
Speisepilz –Anfängerpilz –, der nur mit anderen Speisepilzen verwechselt werden kann.
Speisepilz –Anfängerpilz –, der mit Pilzen verwechselt werden kann, die aus einem anderen Grund als Giftigkeit zum Verzehr ungeeignet sind.
Speisepilz, der mit schwach giftigen Pilzen verwechselt werden kann.
Speisepilz, der mit gefährlich giftigen Pilzen verwechselt werden kann.
HINWEIS: Wenn Sie einen Pilz finden, der keinem der in unserem Buch beschriebenen Speisepilze entspricht, dürfen Sie ihn nicht ohne weitere Absicherung probieren. Es besteht sehr große Gefahr, dass er zum Verzehr ungeeignet ist, denn wir haben die allermeisten Speisepilze aufgenommen, die in Nord- und Mitteleuropa wachsen. Denken Sie daran, dass es noch Tausende weitere Arten gibt, die wir hier nicht aufnehmen konnten.
Hutformen
SPEISEPILZE? sind mit einem weißen Fragezeichen in einem grünen Quadrat markiert.
Neben den Pilzarten, die wir in diesem Buch als Speisepilze vorstellen, werden in unserem Land auch noch andere Arten zum Verzehr genutzt. Das sind Pilze, die traditionell oder von bestimmten Pilzexperten als gute Speisepilze angesehen werden. Aus verschiedenen Gründen stellen wir den Wert dieser Arten als Speisepilze infrage und haben sie nicht unter die Speisepilze aufgenommen (weitere Einzelheiten auf S. 205–211).
KEIN SPEISEPILZrotesodergelbesQuadrat.
Giftpilz
Eine große Anzahl von Pilzarten enthält von den Pilzen selbst produzierte Stoffe, die wir als Pilzgifte bezeichnen. Einen Pilz, der – für den Menschen und andere Säugetiere – schädliche Mengen solcher Stoffe enthält, bezeichnen wir als Giftpilz.
Gefährlich giftige Pilze, vor allem solche, die zellschädigende Stoffe oder große Mengen auf das Nervensystem einwirkender Stoffe enthalten, sind mit einem weißen Kreuz markiert.
Pilze, die aus anderen Gründen als darin enthaltenen Pilzgiften nicht zum Verzehr geeignet sind
Der allergrößte Teil unserer Großpilze gehört in diese Gruppe. Die gesammelten Erfahrungen reichen nicht aus, um uns zu einer eventuellen Essbarkeit des Pilzes äußern zu können. Die Verwechslungskandidaten oder Doppelgänger, die wir auf diese Weise gelb markiert haben, gehören einer oder mehreren der folgenden vier Kategorien an:
1. Unzureichend erforschter Pilz
2. Unappetitlicher Pilz
3. Wertloser Pilz (in Bezug auf den Verzehr; zum Beispiel klein, dünnfleischig, zäh, geschmacklos)
4. Essbarer, aber seltener bzw. gefährdeter Pilz (HINWEIS: Zur Verbreitung der Pilzarten in Deutschland siehe auch www.pilze-deutschland.de)
Lamellenformen
INHALT
Vorwort
Einleitung
Pilzesammeln in früheren Zeiten
Was sind Pilze?
Das Reich der Pilze – das neue Reich!
Der Aufbau der Pilze
Die Lebensweise der Pilze
Grobe Einteilung der Pilze
Was ist eine Gruppe?
Was ist eine Art?
Wann und Wo?
Die Jahreszeit
Das Wetter
Wo sammelt man?
Die Ausrüstung
Das Sammeln
Grobes Vorsäubern
Speisepilze und ihre Doppelgänger
Gruppeneinteilung der Speisepilze
Erklärung der Texte und Bilder zu den Arten
Begriffe und Symbole
Artbeschreibungen
Speisepilze?
Pilze als Lebensmittel
Essbar, schmackhaft oder lecker?
Die Sortierung der Ernte
Feinsäuberung
Verarbeitung
Grundrezepte (ca. 4 Portionen)
Weitere Verwendungsvorschläge
Konservierung
Welches Getränk passt zum Pilz?
Die Inhaltsstoffe der Pilze
Sind die Pilze giftiger geworden?
Giftpilze und Pilzgifte
1. Zellschädigende Gifte
2. Auf das Nervensystem einwirkende Gifte
3. Den Magen-Darm-Trakt reizende Gifte
4. Giftwirkung zusammen mit Alkohol
5. Antigen-Antikörper-Reaktion (allergische Reaktion)
Pilzvergiftung erlitten?
Literatur
Speisepilze
Register
Impressum
Vorwort
Seit der ersten Auflage des Pilz-Handbuchs im Jahr 1996 hat sich einiges getan. Das Interesse an Pilzen hat immer mehr zugenommen. Das Pilzesammeln ist wahrscheinlich die beliebteste Freiluftaktivität, der die Menschen in Nord- und Mitteleuropa im Herbst nachgehen.
Das Interesse am Sammeln von Pilzen und ihrer Nutzung zur Essenszubereitung ist mittlerweile sehr groß. Immer mehr Experten sind der Ansicht, dass Pilze zur Kategorie der funktionellen Lebensmittel gehören – ursprünglich ein japanischer Ausdruck, der den internationalen Namen „Functional Food“ erhalten hat.
Das gesammelte Wissen über unsere Speise- und Giftpilze ist inzwischen groß, doch neue Erkenntnisse werden vermutlich auch Neubewertungen mit sich bringen. Was heute als gesund betrachtet wird, kann in einigen Jahren infrage gestellt sein, und wir, die wir Pilze und das Pilzesammeln lieben, müssen ein offenes Ohr für die neuen Tatsachen der Forscher haben. Hingegen sollten wir die Gerüchte, die im Herbst oft unter anderem in den Massenmedien auftauchen, nicht für bare Münze nehmen. Es gibt viele „Pilzexperten“, darunter auch selbst ernannte. Wie jeder weiß, halten sich Gerüchte und Tratsch hartnäckig, während Dementis es schwer haben, die Menschen zu erreichen. In den 1980er-Jahren war der Irrglaube, Pilze würden Umweltgifte aufsaugen, mehr oder weniger allgemein verbreitet. Leider lebt er zum Teil immer noch fort. Ab Seite 223 können Sie unter der Überschrift „Sind die Pilze giftiger geworden?“ mehr dazu lesen.
Wir haben uns bemüht, im Handbuch Pilze so aktuelle Angaben zu machen wie möglich, und wir hoffen, dass uns diese schwierige Aufgabe gelungen ist. Die mykologische Forschung hat in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Es werden neue Arten beschrieben und frühere Arten in mehrere neue Arten aufgeteilt. Außerdem ändern Arten und Familien ihre Namen.
Das von uns mit dem Handbuch Pilze eingeführte Symbolsystem geht von der in Bezug auf Speisepilze am häufigsten gestellten Frage aus: Kann ich diesen Speisepilz mit einem gefährlichen Pilz verwechseln? Wir haben viele positive Reaktionen auf unser Symbolsystem erhalten. Dieses Symbolsystem beruht auf langjähriger Erfahrung, sowohl unserer eigenen als auch der anderer, unter anderen der nationalen Giftinformationszentralen. Außerdem haben wir im Vorfeld dieser Ausgabe das System weiter vereinfacht und versucht, es noch pädagogischer zu gestalten.
Im Laufe der mehr als 40 Jahre, in denen wir über Pilze und ihre Nutzung informieren, haben wir Tausende von Menschen getroffen, die unser eigenes Wissen über Pilze bereichert haben. Dafür danken wir Ihnen allen, bekannter- oder unbekannterweise. Herzlichen Dank an alle Pilzberater, die an unserer Umfrage unter anderem über die Verbreitung der Pilze im Land teilgenommen haben. Danke auch an das Personal der Giftinformationszentrale in Stockholm. Unser besonderer Dank gilt Michael Krikorev, der uns mit der sich ständig verändernden Mykologie geholfen und Bilder von Lebensräumen und Arten beigesteuert hat.
Viel Spaß im Pilzwald!
So sahen die Verfasser aus, als 1996 die erste Ausgabe ihres „Pilz-Handbuchs“ erschien.
Pelle Holmberg
Hans Marklund
Oben links: Der Autor Pelle Holmberg und der Mykologe Michael Krikorev im Pilzwald. Gesellschaft von jemandem mit Kenntnissen zu haben, die man selbst nicht hat, ist von unschätzbarem Wert, wenn man sich ans Pilzesammeln macht. Oben rechts: Starkriechender Trompetenpfifferling Unten links: Birken-Rotkappe Unten rechts: Echte Pfifferlinge
Einleitung
Das Pilzesammeln ist eine der beliebten Freizeitbeschäftigungen, denen die Menschen im Herbst nachgehen. Aufgrund langjähriger Erfahrung mit Pilzkursen, Ausstellungen und Vorträgen im ganzen Land können wir sagen, dass sich in den letzten Jahren vor allem viele Jüngere zur großen Schar der Pilzsammler hinzugesellt haben. Auch wollen viele Pfifferlingssammler den Schritt vom „Ein-Pilz-Sammler“ zum „richtigen“ Pilzsammler tun.
Dieses Buch ist ein gesammeltes Ergebnis unserer Jahre als Pilzkundler und Ausbilder. Eigene Erfahrungen und Erfahrungen anderer, neue Erkenntnisse aus der Chemie, aktuelle Informationen der Giftinformationszentralen usw. sind in diesem Buch enthalten.
Für die deutsche Ausgabe wurde die Beurteilung der Pilzarten für Speisezwecke nach der „Liste der empfohlenen Speisepilze in Deutschland“ überprüft, die vom Fachausschuss für Toxikologie und Pilzverwertung der Deutschen Gesellschaft für Mykologie erstellt wurde.
Während unserer vielen Jahre als Lehrer für Pilzkunde haben wir versucht, unsere Präsentationstechnik zu verfeinern. Wir hoffen, dass unsere Methoden leicht verständlich sind und so viel Wissen über unsere besten Speisepilze, ihre Doppelgänger und die giftigsten Pilze vermitteln, wie es in einem Buch dieser Art möglich ist. Zusätzlich zu eingehenden Beschreibungen der verschiedenen Pilze in Text und Bild haben wir auch allgemeine Abschnitte aufgenommen, die für alle Pilzsammler unentbehrlich sind.
Um ein guter Pilzsammler zu werden, reicht es nicht aus, dieses oder andere Pilzbücher zu studieren (Achten Sie darauf, neue, aktualisierte Ausgaben zu lesen!), sondern versuchen Sie auch, auf Pilzausflüge mitzukommen oder einen Studienkreis oder örtlichen Pilzverein zu besuchen. Begeben Sie sich ruhig auf eigene Faust in die Natur und sammeln Sie Pilze, aber wenn Sie unsicher sind, müssen Sie sich an einen Pilzberater in Ihrer Region oder eine andere anerkannte pilzkundige Person wenden. Sie können auch eine Pilzausstellung besuchen und sich nach den Pilzen erkundigen, bei denen Sie sich unsicher sind. Bringen Sie in solchen Fällen, wenn möglich, mehrere Exemplare der betreffenden Pilze zur Ausstellung mit. Das erleichtert die Beurteilung.
Einige Arten lernt man schnell kennen, bei anderen dauert es etwas länger, bis man sich völlig sicher ist. Die Speisepilze in diesem Buch sind nach ihrem Schwierigkeitsgrad in vier Gruppen eingestuft (S. 48). Zwei Gruppen enthalten die Pilze, die wir als für Anfänger geeignete Pilze betrachten. Die meisten von ihnen lernt man relativ schnell kennen, aber bei den Arten in den zwei übrigen Gruppen muss man bisweilen viele Jahre warten, bevor man sich ihrer vollkommen sicher ist.
Natürlich ist es sehr individuell, wie schnell man neue Pilze kennenlernt. Wer fleißig unterwegs ist und sammelt, lernt in ein und demselben Herbst leicht über 30 neue Arten kennen. Für einen anderen ist es realistischer, in der gleichen Zeit nur eine einzige oder einige wenige neue Arten kennenzulernen.
Bei wiederholten Gelegenheiten den Pilz dort sehen, wo er wächst, sich die Wachstumsstelle einschärfen, erkennen, welche Bäume und anderen Pflanzen es in der Nähe gibt, junge und ältere Fruchtkörper Seite an Seite sehen – auf diese Weise lernt man einen neuen Pilz am besten kennen.
In Deutschland gibt es entsprechend der Traditionen und lokalen Kenntnisse ein unterschiedlich dichtes Netz von meist ehrenamtlich tätigen Pilzberatern und geprüften Pilzsachverständigen. Einige Städte und Landkreise haben feste Beratungsstellen. Auf der Webseite der Deutschen Gesellschaft für Mykologie www.dgfm-ev.de werden alle pilzkundlichen Vereinigungen aus Deutschland gelistet.
Beim ersten Verdacht auf eine Pilzvergiftung sollten Sie sich immer unverzüglich an den Notruf 112, eine Giftnotrufzentrale oder das nächste Krankenhaus wenden. Nehmen Sie Reste der Pilzmahlzeit auf jeden Fall mit, das kann die richtige Diagnose und Behandlung sehr erleichtern.
Pilzesammeln in früheren Zeiten
Auch wenn es nur wenige prähistorische Nachweise von Pilzen in menschlichen Siedlungen gibt, wurden in Mitteleuropa und anderswo Pilze vermutlich genauso wie Pflanzen gesammelt und genutzt. Bei der „Gletschermumie“ Ötzi, die vor etwa 5 200 Jahren in den Alpen konserviert wurde, fand man Birkenporling und Zunderschwamm. Der Birkenporling (Piptoporus betulinus) hat medizinisch relevante Wirkungen, die innerlich bei Magenbeschwerden und äußerlich zur besseren Wundheilung eingesetzt werden können. Der Zunderschwamm (Fomes fomentarius) war bis Ende des 19. Jahrhunderts das geeignetste Material zum Entfachen eines Feuers (Stichwort: „brennt wie Zunder“) und wurde erst durch die Erfindung und Verbreitung von Zündhölzern abgelöst. In mehr als 90 Prozent aller prähistorischen Siedlungen wurden Reste von Zunderschwämmen nachgewiesen. Da sich vor allem frische, fleischige Pilzfruchtkörper wie zum Beispiel Steinpilze aber nicht so lange erhalten lassen wie Pflanzenreste oder deren Samen, haben wir aus dieser Zeit kaum wissenschaftliche Belege für die Verwendung von Pilzen als Nahrungsmittel. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Sammler auch die allgegenwärtigen Pilze genutzt haben.
Die ersten europäischen Aufzeichnungen zu Pilzen stammen aus der Antike. Die griechischen Gelehrten konnten dabei auf ein umfangreiches empirisches Wissen zurückgreifen. Vor etwa 2 500 Jahren wurde schon von Pilzen in Zusammenhang mit Vergiftungen berichtet. In den Werken von Hippokrates sind Beschreibungen von Arzneien enthalten, die zur Linderung von Pilzvergiftungen eingesetzt wurden.
Von Aristoteles, der die Pilze in seine naturwissenschaftlichen Betrachtungen mit einbezog, bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts galten Pilze also rund 2 000 Jahre lang als Organismen, die aus Fäulnisprozessen spontan entstehen. Von Plinius (1. Jahrhundert n. Chr.) wurden Trüffeln als „Geschwülst der Erde“ angesehen. Pilze wurden aufgrund ihrer damals nicht erklärbaren, spontanen Erscheinungsweise von der katholischen Kirche als heidnisch erklärt. Begriffe wie Hexenbesen, Hexenbutter, Hexenring, Satanspilz und Wolfspfurz zeugen davon, dass mit Pilzen viele negative Assoziationen verbunden wurden. Ob die im 14. bis 16. Jahrhundert grassierende Tanzwut mit dem Verzehr von halluzinogenen Pilzen zusammenhängt, ist noch nicht hinreichend geklärt. Hexen und Schamanen hingegen nutz(t)en ihre bewusstseinserweiternde Wirkung mit Sicherheit. Erst Louis Pasteur räumte durch seine Keimstudien (ab 1860 n. Chr.) mit dem Mythos der spontanen Entstehung von Leben auf.
Doch auch positive Erfahrungen sind in die Namensgebung bis zur Neuzeit mit eingeflossen. Davon zeugen der Kaiserling (Amanita caesarea), der schon im 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung vom römischen Dichter Martial als „boletus“ erwähnt wird, oder der Herrenpilz (Boletus edulis). Es ist gut möglich, dass der römische Einfluss in Deutschland auch die Nutzung von Pilzen als Nahrungs- und Genussmittel begünstigt hat. In adeligen Kreisen der Renaissance wurden jedenfalls Trüffeln nicht nur aus Frankreich und Italien importiert, sondern Lizenzen zum Trüffelnsammeln in den eigenen Ländereien versteigert. Der heute so beliebte Eierschwamm (Cantharellus cibarius) war hingegen so häufig und ein preiswertes „Armeleuteessen“, dass sich bis heute der Spruch „das ist doch keinen Pfifferling wert“ gehalten hat.
Eine Doppelseite aus Brockhaus Konversationslexikon von 1891, das für den späteren Teil des 19. Jahrhunderts typische Abbildungen von Pilzen zeigt.
Im Mittelalter (500–1500 n. Chr.) waren Wissenschaft und schriftliche Aufzeichnungen der Kirche und dem Adel vorbehalten. In erster Linie wurden Übersetzungen antiker Schriften verfasst, ohne wesentliche neue Erkenntnisse hinzuzufügen. So sind pharmakologische Rezeptsammlungen in Handschriften des 8. und 9. Jahrhunderts aus dem Fränkischen Reich erhalten. Dort sind sowohl Rezepturen gegen Pilzvergiftungen als auch Pilze als Heilmittel dokumentiert. Die Handschriften von Hildegard von Bingen (1098–1179 n. Chr.) gelten als die umfassendsten mittelalterlichen Werke mit Darstellungen und medizinischen Rezepten mit Pilzen.
In mittelalterlichen Klöstern wurden Pilze als Nahrungsmittel verwendet. Das Wort Pilz leitet sich aus den Übersetzungen und dem Sprachgebrauch des antiken Begriffs „boletus“ über „bolitus“ > „boliz“ > „bülez“ > „bütz“ > „bültz“ ab. Parallel dazu wurden in Deutschland auch die Begriffe „Schwamm“, „swamb“ oder „swam“ verwendet. Im Schwedischen ist der Begriff „Svampe“ heute noch üblich. Im Bayerischen werden die Pilze „Schwammerl“ genannt.
Bei Albertus Magnus (13. Jahrhundert n. Chr.) werden ebenfalls einige essbare und giftige Pilze beschrieben, so zum Beispiel der Fliegenpilz als „tuber muscarum“ und „Fungus muscarum“. Er wurde gestückelt oder als Pilzpulver in Milch gekocht bzw. aufgelöst. Das Gebräu in einer flachen Schale lockte Fliegen an und tötete sie. Diese Methode war bis ins 20. Jahrhundert verbreitet.
Das erste bekannte, deutschsprachige Druckwerk, in dem Pilze enthalten sind, stammt von Johann von Cube (1485 n. Chr.): „New Kreütter Buch: von Underscheydt, Würckung und Namen der Kreütter so in teütschen Landen wachsen; auch der selbigen eygentlichem und wolgegründtem Gebrauch in der Artznei, zu behalten und zu fürdern Leibs Gesuntheyt fast nutz und tröstlichen, vorab gemeynem Verstand“. Mit der Renaissance und Entwicklung der Drucktechnik erschienen dann vermehrt Kräuterbücher, die von steigendem botanischem Wissen zeugen und oft Kapitel über Pilze enthalten. So schreibt Bock (1539 n. Chr.) in seiner Einleitung: „Vil und mancherlei Schweme wachsen im Teütschen Lande.“ In seinem Kräuterbuch waren zum Beispiel Brätling, Eichhase, Fliegenpilz, Morchel, Pfifferling, Wolliger Milchling, Wiesen-Champignon und Zunderschwamm enthalten. Es ist anzunehmen, dass viele essbare Arten auch auf mittelalterlichen Märkten zum Verkauf angeboten wurden. Die Bauern verdienten sich ein Zubrot, indem sie Edelpilze und Trüffeln an Adelige und Reiche verkauften. Schon in der Renaissance waren Trüffeln eine sehr begehrte Diplomatenspeise.
Carolus Clusius (1601 n. Chr.) brachte dann mit „Fungorum in Pannoniis observatorum Brevis Historia et Codex Clusii“ das erste umfassende, rein pilzkundliche Werk mit 21 essbaren und 26 schädlichen „genera“ (Geschlechter) heraus.
So wuchs das Wissen um die Pilzarten und ihre Verwendung bis hin zur Neuzeit. Eine besondere Bedeutung für die Volksernährung spielten die Pilze nachweislich während der Hungerjahre um den Ersten Weltkrieg. So wurden denn auch 1910 in Nürnberg der erste deutsche Pilzverein und 1921 die Deutsche Gesellschaft für Pilzkunde gegründet. Diese wurde dann in DGfM, Deutsche Gesellschaft für Mykologie, umbenannt und wird 2021 ihr 100-jähriges Bestehen feiern. Diese Vereine waren laut ihren Satzungen der Aufklärung der Bevölkerung und Verbreitung der Pilzkunde verpflichtet. Pilzberatungsstellen wurden in vielen deutschen Städten eingerichtet und bestehen zum Teil bis heute. So zum Beispiel in München, wo 1916 der Verein für Pilzkunde gegründet wurde und seither während der Saison wöchentlich im alten Rathaus am Marienplatz kostenlose Pilzberatungen für die Bevölkerung anbietet. Pilze wurden in den Kriegsjahren und in der Nachkriegszeit bis in die 1950er-Jahre gesammelt und in Garküchen verarbeitet, um die Bevölkerung mit Nahrung versorgen zu können. Sie wurden nicht nur als Konserven eingemacht, sondern auch getrocknet und als Beimischung in Broten verbacken. In der DDR wurde das System von Kreispilzberatern bis zur Wiedervereinigung aufrecht gehalten. Pilzesammeln war in der Bevölkerung sehr beliebt.
Das erste im Dreifarbendruck in Deutschland hergestellte Buch war der mehrbändige Pilzführer von Edmund Michael (1895 n. Chr.), aus dem ein umfassendes, sechsbändiges „Handbuch für Pilzfreunde“ von Michael-Hennig & Kreisel (1975–1988 n. Chr.) entstanden ist, das bis Ende der 1980er-Jahre mehrfach aufgelegt wurde und als populäres Standardwerk eine große Verbreitung erlangt hat.
In Westdeutschland haben Pilzberater und Pilzsachverständige auf freiwilliger, vorwiegend ehrenamtlicher Basis gearbeitet. Die Ausbildungsrichtlinien für Pilzsachverständige werden von der DGfM aufgestellt und die Prüfungen organisiert. Derzeit sind in ganz Deutschland mehr als 1000 Pilzberater und Pilzsachverständige tätig, um vorbeugend zu beraten und im Vergiftungsfall den Ärzten und Kliniken über die Giftnotrufe beratend zur Seite zu stehen.
In der „Hornberger Pilzlehrschau“ im Schwarzwald werden seit fast 50 Jahren Pilzkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene angeboten. In Westdeutschland wurden seit den 1960er-Jahren unzählige Pilzbücher unterschiedlichster Qualität veröffentlicht. Aufgrund des stetig wachsenden Wissensstands über Gift- und Speisepilze ist es ratsam, sich neben den alten, bewährten Büchern immer wieder mit aktueller Literatur zu versorgen. Ein jüngeres Beispiel ist der Grünling (Tricholoma equestre, siehe S. 122/123), der bis Anfang 2000 über Jahrhunderte ein beliebter Marktpilz war und nun seit gut zehn Jahren als potenziell tödlich giftig gilt.
Brockhaus Konversationslexikon von 1891: Illustrationstafel zu giftigen Pilzen
Das Pilzesammeln ist in Deutschland also schon sehr lange in der Bevölkerung verankert, tendenziell mehr im Süden und Osten und weniger im Norden und Westen. Die Nordischen Völker und Angelsachsen galten lange Zeit als mykophob, während die Alpenvölker und Slawen als mykophil gelten. Diese Situation hat sich durch die kriegsbedingten Völkerwanderungen und die heute notwendige Mobilität verändert. Pilze werden bei uns heutzutage mit Begeisterung von der Lüneburger Heide bis zum Bodensee gesammelt.
Was sind Pilze?
DAS REICH DER PILZE – DAS NEUE REICH!
Schon seit den Tagen des Aristoteles (300 v. Chr.) hat die Wissenschaft alles Leben auf der Erde in das Pflanzen- und das Tierreich eingeteilt. Die Pilze wurden zu den Pflanzen gezählt. Linné, der Vater der Botanik, war jedoch selbst im Zweifel, wo er sie einordnen sollte, und in seinem eigenen System findet man sie in der Klasse Vermes, das heißt Würmer, wieder. Er bekam die Pilze nicht richtig in den Griff und fand, sie seien ein „räuberisches Gesindel“.
Vor gut 100 Jahren gab es auch Biologen, die der Ansicht waren, dass die Pilze nicht zu den Pflanzen gerechnet werden dürften. Heute wissen wir so viel über Aufbau und Lebensweise der Pilze, dass ihnen wissenschaftlich eindeutig das eigene Reich der Fungi zugeordnet wird, getrennt sowohl von den Pflanzen als auch von den Tieren. Wir gehen davon aus, dass es grob gerechnet über 300 000 bekannte Pilzarten auf der Welt gibt, von denen mehr als 12 000 in Nordeuropa anzutreffen sind.
DER AUFBAU DER PILZE
Den größten Teil des Pilzes macht das Myzel aus, das aus einer großen Menge sehr dünner weißer oder farbiger Fäden, den Hyphen, besteht. Das Myzel ist der eigentliche Pilz, und hier finden bei Streu bewohnenden Pilzen Zersetzung und Nahrungsaufnahme sowie bei Mykorrhizapilzen der Nahrungsaustausch mit lebenden Bäumen und Pflanzen statt. Wir sehen dieses Myzel draußen in der Natur selten, weil es sich in der Erde, in der Streuschicht, in morschen Bäumen, unter der Rinde von Baumstümpfen oder an anderen versteckten Orten befindet.
Die Teile der Pilze, die hingegen leicht zu beobachten sind, sind die Fruchtkörper. Das ist, was wir in der Umgangssprache als Pilze bezeichnen. Sie machen nur etwa 5 Prozent des gesamten Pilzes aus, der Rest ist Myzel. Je nach der Größe der ausgewachsenen Fruchtkörper teilen wir die Pilze in Kleinpilze (Mikromyzeten) und Großpilze (Makromyzeten) ein. Zu den Letzteren – die so große Fruchtkörper haben, dass wir sie draußen in der Natur leicht sehen können – werden heute mehr als 5 000 Arten in unserem Land gezählt.
Weißes und gelbes Myzel auf der Unterseite eines morschen Baumstamms am Boden
Wenn wir Pilze sammeln, nutzen wir also deren Fruchtkörper. Das Myzel ist üblicherweise mehrjährig und erreicht meist ein Alter von mehreren Jahrzehnten. Ja, es gibt sogar Berechnungen, die das Alter bestimmter Pilzindividuen von Hallimasch-Arten mit Tausenden von Jahren angeben. Es gibt auch Fruchtkörper, die Jahrzehnte alt werden können, aber die meisten leben nur kurze Zeit, üblicherweise ungefähr eine Woche, manchmal nur einige Stunden.
Die Fruchtkörper enthalten weniger Energievorräte als die Wurzelknollen oder Samen der Pflanzen (S. 222). Ihre biologische Funktion besteht darin, die sehr kleinen Vermehrungskörper der Pilze, die Sporen, zu bilden. Der Sporen bildende Teil wird als Hymenium bezeichnet, und dieses befindet sich an der Außenseite oder im Inneren des Fruchtkörpers, zum Beispiel bei Blätterpilzen an den Lamellen und bei Röhrlingen und Porlingen in den Röhren.
Älteres Jungpilzstadium des Gemeinen Riesenschirmlings
Junges Stadium eines Streiflings
DIE LEBENSWEISE DER PILZE
Pflanzen, die den grünen Farbstoff Chlorophyll enthalten, können mithilfe des Sonnenlichts durch die Photosynthese aus dem Kohlendioxid der Luft und Wasser aus dem Boden energiereiche organische Zuckerstoffe herstellen. Pilze und Tiere benötigen auch organisches Ausgangsmaterial, zum einen für den Bau ihrer eigenen Zellen, zum anderen für die Verbrennung, die ihnen Energie für ihre unterschiedlichen Lebensprozesse liefert. Aber die Pilze können dieses Ausgangsmaterial nicht selbst herstellen, weil ihnen das für die Photosynthese erforderliche Chlorophyll fehlt. Aus diesem Grund müssen sie bereits vorhandenes organisches Material nutzen und werden je nach der von ihnen verwendeten Methode in die folgenden drei Gruppen eingeteilt:
Saprobionten (Zersetzerpilze)
Hexenring des Nelken-Schwindlings, saprotroph
Diese leben saprotroph auf verrottenden und vermodernden Organismen und sind zusammen mit den Bakterien die wichtigsten Abbauer toter organischer Materie in der Natur. Hierzu werden die meisten Pilze gerechnet, die auf Wiesen wachsen, sowie diejenigen, die auf Laub und Komposthaufen oder in der Nadelstreu unter Fichten und Kiefern wachsen. Diese Pilze pflegen wir auch als Streusaprobionten oder als Streuzersetzer zu bezeichnen. Die Streu ist die oberste Bodenschicht, die hauptsächlich aus Pflanzenteilen besteht, die noch nicht so verrottet sind, dass man ihren Ursprung nicht mehr bestimmen kann. Diese Streuzersetzer helfen also, das organische Material in einfache chemische Bausteine aufzuspalten, die von den Pilzen selbst oder beispielsweise von den grünen Pflanzen genutzt werden können und auf diese Weise wieder in den Kreislauf der Natur eingehen.
Die Pilze, die auf Baumstümpfen und toten Bäumen, Zweigen und Wurzeln leben, nennen wir Holzsaprobionten. Saprotrophe Pilze können auch von Erde, Tierdung oder toten Tieren leben. Mehrere unserer Speisepilze sind Saprobionten, zum Beispiel der Nelken-Schwindling, der Violette Rötelritterling und das Gemeine Stockschwämmchen.
Parasiten
Die Krause Glucke lebt als Wurzelparasit von Kiefern.
Diese Pilze beziehen ihre Nahrung aus lebenden Zellen. Befallene Pflanzen und Tiere werden geschädigt und können sogar an dem Parasitenbefall sterben. Mehrere Arten können sowohl als Saprobionten als auch als Parasiten leben. Nur einige wenige Speisepilze gehören zu denjenigen, die als Parasiten leben können, zum Beispiel die Krause Glucke und alle Hallimasch-Arten.
Symbionten (Mykorrhizapilze)
Rotgelber Stoppelpilz, ein Symbiont
Eine große Gruppe von Pilzen lebt in einer Gemeinschaft, einer Symbiose, mit grünen Pflanzen, insbesondere Bäumen. An den feinsten Wurzelspitzen der Pflanzen befindet sich sehr oft ein besonderes Gebilde, das als Mykorrhiza, „Pilzwurzel“, bezeichnet wird. Das Wort „Mykorrhiza“ steht sowohl für das Phänomen selbst als auch für das zusammengewachsene Gewebe, das aus Wurzelzellen der Pflanze und Pilzzellen besteht.
Mithilfe der Mykorrhiza entwickelt sich das Zusammenleben, das ein gegenseitiges Geben und Nehmen bedeutet. Der Pilz erhält Zuckerstoffe von der Pflanze. Bei Mykorrhiza bildenden Bäumen zeigen Berechnungen, dass bis zu einem Drittel des vom Baum hergestellten Zuckers an die Pilze gehen kann. Der Pilz wiederum versorgt den Baum mit Wasser und Mineralstoffen, in erster Linie Stickstoff, Phosphor und Kalium. Im Großen und Ganzen haben das gesamte Wasser und alle Mineralien, die diese Bäume durch die Wurzeln aufnehmen, zuvor die Mykorrhiza durchlaufen. Die Kontaktfläche des Baumes mit der Erde vertausendfacht sich dank des Pilzmyzels. Jeder Quadratmeter Waldboden beherbergt 100 000–500 000 Wurzelspitzen mit Mykorrhiza.
Die Mehrzahl der Großpilze, und dadurch auch die Mehrzahl der Speisepilze in unseren Wäldern, sind Mykorrhizapilze. Ihnen kommt keine oder nur eine geringe Funktion als Abbauer von organischem Material zu, aber sie haben sehr große Bedeutung für das Wohlbefinden unserer Wälder.
Wälder, die von Luftverunreinigungen betroffen sind, insbesondere Niederschlag von Stickstoff und versäuernden Stoffen, zeigen sehr schnell beunruhigende Zeichen. Die Anzahl der Mykorrhizapilze verändert sich auffallend. Auf kurze Sicht gibt es Arten, die durch die Versäuerung zunehmen, aber auf lange Sicht scheint sich die Anzahl der allermeisten zu verringern. Dies ist zum Beispiel bei Schleierlingen, Ritterlingen und Pfifferlingen der Fall. In Deutschland ist die allgemeine Stickstoffüberfrachtung der Böden aus Landwirtschaft, Industrie und Verkehr ein sehr ernst zu nehmendes Problem geworden.
Baumwurzeln, die in noch verunreinigteren Böden wachsen, haben oft keine Mykorrhiza, und deshalb ist ihr Vermögen, Wasser und Nahrung aufzunehmen, begrenzt. Die Außenzellen der Wurzelspitzen verkümmern und bilden eine Rinde. Wenn der Stickstoffgehalt im Boden steigt, verringert der Baum seine Bildung von neuen kleinen Feinwurzeln. Dadurch droht diesen Bäumen ein Mangel an anderen wichtigen Mineralstoffen.
Um herauszufinden, wie es dem Wald geht, kann man folglich die Pilzflora studieren, und am allerbesten ist es, wenn man Angaben darüber hat, wie sie früher ausgesehen hat, um Vergleiche anstellen zu können. Wenn die Mykorrhizapilze zurückgehen, weist das auf kritische Veränderungen der Bodenchemie hin.
Auch für die Pilzsammler ist es wichtig, die Lebensweisen und Lebensraumanforderungen der verschiedenen Pilze zu kennen. Wer das Aussehen sowohl der Pilze als auch ihrer Wachstumsstellen gelernt hat, findet seine Pilze leichter als derjenige, der sein Interesse allein auf das Aussehen der Pilze beschränkt hat. Bei der Vorstellung der Arten beschreiben wir die bevorzugten Wachstumsstellen der Speisepilze und geben an, mit welchen Bäumen sie gegebenenfalls in einer symbiotischen Beziehung leben.
GROBE EINTEILUNG DER PILZE
Die vorstehende Gruppeneinteilung wurde aus einem ökologischen Blickwinkel vorgenommen, aber man kann die Pilze auch nach Verwandtschaft einteilen. In den letzten Jahren sind verschiedene systematische Einteilungen vorgestellt worden, oft sehr umfassend und untereinander widersprüchlich. Ohne Anspruch darauf zu erheben, einem dieser wissenschaftlichen Systeme genau zu folgen, stellen wir hier sehr kurz gefasst die wichtigsten Gruppen vor.
Schleimpilze
Myxomycota
Gelbe Lohblüte, Beispiel für einen Schleimpilz
Dies sind primitive Organismen, die Eigenschaften sowohl von Tieren als auch von Pilzen aufweisen. Diese uneinheitliche Gruppe wird heute nicht zum Reich der Pilze gerechnet. Aber da sie einerseits früher zu den Pilzen gerechnet und oft von Mykologen studiert wurden und andererseits dank ihrer klaren Farben und eigentümlichen Formen und Verhaltensweisen oft im Herbst von Pilzsammlern beobachtet werden, nehmen wir auch diese in die Gruppenvorstellung mit auf.
Die Schleimpilze durchlaufen verschiedene Entwicklungsphasen. In einer dieser Phasen können sie wie ein amöbenähnlicher Plasmaklumpen auf dem Untergrund vorangleiten. In einer anderen bilden sie feste, Sporen bildende Einzel- oder Sammelfruchtkörper.
Zu den Schleimpilzen werden zum Beispiel der Blutmilchpilz, die Gelbe Lohblüte, der Schaumpilz und der Kelchstäubling gezählt. Es gibt keine Speisepilze in dieser Gruppe.
Algenpilze (Phykomyzeten)
Mastigomycota + Zygomycota
Die allermeisten Algenpilze sind mikroskopisch klein und gehören zu den Kleinpilzen. Sie kommen sowohl im Wasser als auch auf dem Land vor, sind einfach gebaut (ohne Septen, das heißt ohne Querwände in den Hyphen) und werden zu den niederen Pilzen gezählt. Es gibt etwa 1500 bekannte Arten von Algenpilzen, und sie leben sowohl als Saprobionten als auch als Parasiten an höheren Pflanzen und Tieren, zum Beispiel der Kartoffelkrebsverursacher Synchytrium endobioticum und verschiedene Mehltauarten. In dieser Gruppe finden sich keine Speisepilze.
Schlauchpilze
Ascomycota
Gemeiner Orangebecherling, Beispiel für einen Schlauchpilz
Pinselschimmel, Beispiel für einen Schlauchpilz
Circa ein Drittel aller bekannten Pilzarten gehört dieser systematischen Gruppe an. Die meisten gehören zu den Kleinpilzen, zum Beispiel Hefepilze, die einzellig und mikroskopisch klein sind. Weitere Beispiele sind die Pinsel- und Gießkannenschimmelarten, die zum Beispiel auf altem Brot gut sichtbare grüne oder graue Überzüge bilden. Auch viele Großpilze werden dieser Gruppe zugerechnet, zum Beispiel Morcheln, Becherlinge, Echte Trüffeln und Erdzungen.
Bei den Schlauchpilzen werden die Sporen in lang gestreckten, manchmal angeschwollenen Endzellen, den Sporensäcken (Asci, Einzahl Ascus) an den Hyphenfäden, die den Fruchtkörper aufbauen, gebildet. Bei den meisten Arten werden in jedem Schlauch acht Sporen gebildet. Bei der Ausreifung öffnet sich bei vielen Arten das äußerste Ende des Schlauchs, das bei einem Teil mit einem kleinen Deckel versehen ist. Durch die Öffnung werden die reifen Sporen aktiv ausgeschleudert und außerhalb des Fruchtkörpers verbreitet.
Zusammen mit sterilen Endzellen bilden die Schläuche den Sporen bildenden Teil, das Hymenium, das sich an unterschiedlichen Stellen des Fruchtkörpers befindet. Bei den Becherpilzen befindet sich das Hymenium zum Beispiel im Becher und bei Morcheln an der Außenseite des Hutes. Die Mehrzahl der Schlauchpilze sind Saprobionten, aber auch hier gibt es Parasiten und Symbionten. Nur einige wenige Arten rechnen wir zu den Speisepilzen, zum Beispiel ein paar der Echten Trüffeln.
Ständerpilze
Basidiomycota
Fichten-Reizker, Beispiel für einen Ständerpilz
Dunkelvioletter Schleierling, Beispiel für einen Ständerpilz
Zu dieser systematischen Gruppe wird etwa ein Drittel aller Pilze gerechnet. Auch innerhalb dieser Gruppe gibt es mikroskopische Arten, zum Beispiel Rußpilze und Rostpilze, die parasitisch auf grünen Pflanzen leben. Die meisten innerhalb der Gruppe sind jedoch Großpilze, und die Mehrzahl sind Saprobionten. Hierher gehören auch viele Mykorrhizapilze, zu denen die Mehrzahl unserer Speisepilze und Giftpilze gerechnet wird. Ständerpilze sind zum Beispiel Korallen- bzw. Keulenpilze, Stachelpilze, Pfifferlinge, Röhrlinge, Porlinge, Blätterpilze und Bauchpilze.
Bei den Ständerpilzen werden die Sporen in blasenähnlichen, oft keulenartigen Endzellen im Hymenium, den Basidien, gebildet. In jeder derartigen Basidie werden ein bis acht, meist aber vier Sporenkerne gebildet, die bei der Reifung in spitze Ausstülpungen der Zelle, die Sterigmen, wandern, von wo aus die reifen Sporen dann abknospen und den Fruchtkörper verlassen. Das Hymenium befindet sich bei den verschiedenen Pilzgruppen in unterschiedlichen Teilen des Fruchtkörpers, zum Beispiel bei den Blätterpilzen und Stachelpilzen an den Außenseiten der Lamellen bzw. Stacheln und bei den Röhrlingen und Porlingen in den Röhren.
Bauchpilze
Gasteromycota
Die Ständerpilze, die der uneinheitlichen Gruppe der Bauchpilze angehören, haben die Gemeinsamkeit, dass der Sporen bildende Teil ein spezielles Gewebe ist, die Gleba, die in den jungen Fruchtkörpern eingeschlossen ist. Die reifen Sporen werden auf unterschiedliche Weise freigesetzt, zum Beispiel durch Löcher oder Risse in der „Schale“ des Fruchtkörpers.
Den Bauchpilzen gehören rund 1 000 Arten an, die meisten in warmen und trockenen Gebieten unserer Erde. Hierher gehören Stäublinge und Boviste, unter denen es einige Speisepilze gibt. Erdsterne und Kartoffelboviste sind Beispiele für nicht essbare Bauchpilze.
Rötender Erdstern, Beispiel für einen den Bauchpilzen angehörenden Ständerpilz
WAS IST EINE GRUPPE?
Wenn wir in diesem Buch bei verschiedenen Gelegenheiten von einer Gruppe sprechen, meinen wir eine größere oder kleinere Anzahl Individuen, die auf die eine oder andere Weise zusammengehören. Wir verwenden das Wort „Gruppe“ demnach meist als volkstümliche Bezeichnung ohne wissenschaftlichen Anspruch. In wissenschaftlicher Literatur gibt es gebräuchliche Begriffe, um eine nach Rangstufen dargestellte Gattungszugehörigkeit anzugeben. Sie bilden ein umfassendes hierarchisches System, das sich stark vereinfacht auf die folgende Weise beschreiben lässt: Die eben vorgestellten Hauptgruppen, deren wissenschaftliche Bezeichnungen die Endung -mycota besitzen, bezeichnen die Stämme (Phyla; Sg.: Phylum) oder die Abteilungen. Diese werden dann in Klassen -mycetes eingeteilt, die wiederum in Ordnungen eingeteilt werden, deren Bezeichnungen mit -ales enden (zum Beispiel Agaricales). Die Ordnungen werden in Familien (Fam.) aufgeteilt, deren Bezeichnungen mit -aceae enden (zum Beispiel Agaricaceae). Die Familien werden in Gattungen eingeteilt, die keine bestimmten Endsilben haben. Beispiele für Gattungen sind Champignons, Agaricus, und Täublinge, Russula. Wenn wir noch einen Schritt weitergehen wollen, können die Gattungen in Sektionen untergliedert werden. Zuletzt haben wir dann die Arten, die manchmal in Varietäten (var.) und/oder Formen (forma) eingeteilt werden.
WAS IST EINE ART?
Der Begriff „Art“ ist schwer zu definieren – auch in Bezug auf Pilze. Meist ist mit einer Art eine Gruppe von Individuen gemeint, die im Großen und Ganzen in Aufbau, Aussehen und Lebensweise miteinander übereinstimmen und durch geschlechtliche Fortpflanzung untereinander fruchtbare Nachkommen erhalten. Jede Art hat einen zweiteiligen (binären) Namen – einen wissenschaftlichen Artnamen, der zum einen den Namen der Gattung und zum anderen das Art-Attribut beinhaltet. Nach einem wissenschaftlichen Artnamen steht manchmal in Klammern die Abkürzung „Syn.“ gefolgt von einem anderen Artnamen. Dies bedeutet, dass die Namen synonym, das heißt, gleichbedeutend sind, aber der erste verwendet werden sollte, weil er der wissenschaftlich anerkannte Name ist.
Der wissenschaftliche Artname, zum Beispiel Agaricus arvensis, ist ursprünglich von einer oder mehreren Personen (Autoren) vergeben worden, die den Pilz eingehend studiert haben. Der Autor hat den Artnamen – üblicherweise auf Griechisch oder Lateinisch – ausgehend von einem bestimmten Kriterium in Verbindung mit genau diesem Pilz konstruiert.
In älteren Pilzbüchern werden die Pilze in einer anderen Ordnung als der heute am meisten verwendeten vorgestellt. Früher folgte man dem von Elias Fries ausgearbeiteten System. Er begann mit Blätterpilzen, und danach kamen Röhrlinge, Porlinge, Stachelpilze, Korallen- bzw. Keulenpilze, Stäublinge, Echte Trüffeln und Morcheln.
In moderneren Pilzbüchern ist das System anders, im Großen und Ganzen kehrt es die Ordnung um. Wir verwenden das moderne System, das auch für den Anfänger gut geeignet ist, unter anderem deshalb, weil die meisten Anfängerpilze in diesem System an erster Stelle kommen.
Der Rote Heringstäubling, Russula xerampelina, ist ein Beispiel für eine Pilzart. Der wissenschaftliche Name der Art besteht aus dem Namen der Gattung, Russula, und dem artspezifischen Attribut, xerampelina.
WANN UND WO?
In Deutschland darf man mit Ausnahme von Nationalparks und Naturschutzgebieten in allen frei zugänglichen Gebieten Pilze sammeln. Ausnahmen davon regelt die Bundesartenschutzverordnung.
In Deutschland sind die Betretungsregeln der Wälder in jedem Bundesland anders. Dort, wo man freien Zugang hat, darf man in der Regel auch Pilze und Waldfrüchte für den Eigenbedarf (privaten Verbrauch) sammeln, sofern keine Einschränkungen oder gar Verbote bestehen.
Die grundsätzlich freie Nutzung der Natur gewährt uns Möglichkeiten, und im Gegenzug sollten wir Naturverstand zeigen, wenn wir uns im Pilzwald aufhalten. Man sollte während des Pilzesammelns darauf achten, keine Waldpflanzen und kein Jungholz zu beschädigen. Auch darf man dem Grundeigentümer keinen Schaden und keine Ungelegenheiten bereiten. Achten Sie zum Beispiel darauf, alle Abfälle aus Ihrem Essenspaket mit nach Hause zu nehmen. Die Pilze, die man nicht sammelt, sollten unberührt stehen bleiben. Losgetretene und umhergeworfene Pilze sehen für den, der später kommt, nicht schön aus. Denken Sie daran, dass man Gatter stets wieder schließen sollte, nachdem man sie zum Hindurchgehen geöffnet hat. Vielleicht gibt es Vieh, das andernfalls entweichen kann.
Für alle, die unsere Natur nutzen, sollte eine Regel gelten, die besagt: Nicht stören und nicht zerstören. Seien Sie in der Natur leise – genießen Sie die Stille ganz bewusst!
DIE JAHRESZEIT
„Gegen Ende August kommen die Pilze in besonders großen Mengen vor, und September ist ihr richtiger Hochsommer.“
Aus Svampar (Pilze) von Waldemar Bülow, 1917
„Die Pilze müssen bei klarem und trockenem Wetter eingesammelt werden.“
Aus Våra bästa Matsvampar (Unsere besten Speisepilze) von Elias Fries, 1867
Die Pilzsaison variiert von Jahr zu Jahr. Jedes Pilzjahr ist einzigartig. In Deutschland kann die Pilzsaison von Mai bis Oktober oder auch November dauern. Meist setzt im Herbst der Frost der Sammelzeit ein Ende.
Damit die Pilze Fruchtkörper entwickeln können, wird Feuchtigkeit benötigt. Ohne Regen keine Pilze! Aber auch in Jahren, in denen im Juni–Juli Trockenheit geherrscht hat, können Ende August reichlich Pilze auftauchen. Dazu werden Anfang August mehrere Regenfälle von je 20–30 Millimeter benötigt, die den Boden gut durchfeuchten, und danach Regen in regelmäßigen Abständen. Zwei bis drei Wochen nach den ersten Regenfällen fangen dann die Pilze an zu erscheinen. Danach ist eine gleichmäßige Feuchtigkeit wichtig, damit sich das Wachstum fortsetzen kann.
Zur Bildung der Fruchtkörper wird auch Wärme benötigt, aber hier variieren die Anforderungen von Art zu Art. Vermutlich wird die Fruchtkörperbildung von vielen Faktoren beeinflusst, aber man weiß noch nicht sehr viel über ihre Wirkungsweise. Wiesen-Champignons beispielsweise bilden nach trockenen, warmen Sommern und dann einsetzendem Niederschlag mehr Fruchtkörper. Alle Pfifferlingsarten hingegen benötigen längere Feuchteperioden mit gemäßigten Temperaturen.
Eine häufige Frage lautet: Wie oft kann man von einer Pilzstelle ernten? Wie schnell können neue Pilze emporschießen, nachdem man gesammelt hat? Auch hier hängt es vom Wetter ab, aber auch davon, um welchen Pilz es sich handelt. Pfifferlinge wachsen langsam und benötigen mindestens zwei und bis zu zehn Wochen. Röhrlinge wachsen schneller und können mit Abständen von wenigen Tagen geerntet werden. Bei Schopf-Tintlings- und Champignon-Gruppen kann man oft täglich weitere Ernten einsammeln.
Wer mehrere Jahre lang Pilze gesammelt hat, spürt instinktiv, wann es Zeit ist, auf Pilzsuche zu gehen, obwohl keine Saison genau einer früheren gleicht. In manchen Jahren können einige verbreitete Pilze fast vollständig fehlen. In anderen Jahren können einige ungewöhnlichere Arten ziemlich verbreitet sein.
In den folgenden Artbeschreibungen gehen wir auf die individuellen Variationen bei den verschiedenen Speisepilzen und Doppelgängern ein. Zu Beginn der Pilzsaison findet man Speisepilze meist am Waldsaum, entlang der Wege, in Laubwäldern und auf offenen Flächen. Die richtigen Nadelwaldarten erscheinen in der Regel etwas später. Wenn die Laubbäume ihre Blätter abwerfen, hören auch die meisten ihrer Mykorrhizapilze auf, Fruchtkörper zu bilden.
DAS WETTER
Das beste Pilzsammelwetter ist, wenn es bewölkt ist, aber nicht regnet. Wenn es warm und sonnig ist, werden die Pilze schneller durch Maden und Bakterien aufgezehrt. Außerdem sind die Pilze bei starkem Sonnenschein schwieriger zu entdecken, vor allem im Spätherbst, wenn die Sonne tiefer steht. Die Schatten werden schärfer, und wenn man mit der Sonne im Gesicht geht, blendet sie einen leicht. Auch das Sammeln von Pilzen bei Regen empfiehlt sich nicht. Die Pilze sind dann wässrig und schwer zu säubern.
WO SAMMELT MAN?
Es gibt viele verschiedene Arten von Pilzsammlern: Der häufigste ist der Pfifferlingssammler, der gezielt Pfifferlinge sammelt. Ein weiterer ist derjenige, der bei Waldspaziergängen nur zufällig Pilze findet. Ein dritter, nicht allzu ungewöhnlicher Pilzsammler ist derjenige, der nur so weit drinnen im Wald sucht, wie er noch den Straßenlärm vernehmen kann. Die Angst, sich zu verlaufen, ist leider für viele eine Realität, die dem Pilzesammeln Grenzen setzt. GPS ist heute eine gebräuchliche Orientierungshilfe, aber es kann trotzdem sinnvoll sein, eine Karte dabeizuhaben, und in dem Fall braucht man auch einen Kompass zur Orientierung.
Echte Urwälder (oben links) sind sehr selten geworden. Wälder, die mehrere Jahrzehnte nicht abgeholzt wurden, nennen wir Naturwälder, und sie rufen bei den meisten Menschen ein Gefühl von Urwald hervor. In diesen Wäldern kann man Pilzarten finden, die eine lange Kontinuität benötigen, um sich zu entwickeln, Arten also, die es ausschließlich in diesen Altwäldern gibt. Der Fichtenwald (oben Mitte) ist der häufigste Forstwald in unserem Land. In Fichtenwäldern mit leichter Beimischung von Kiefer und Birke finden sich viele unserer besten Speisepilze, zum Beispiel der abgebildete Semmel-Stoppelpilz, aber auch mehrere gefährliche Giftpilze. In ungedüngten Parkanlagen mit altem Baumbestand (oben rechts) gibt es sowohl leckere Speisepilze als auch gefährliche Giftpilze.
Mithilfe der Karte kann man leicht erkennen, wo sich die Pilzsuche lohnen könnte. Etwas ältere Misch- und Nadelwälder sind oft gut geeignet. Nordhänge und Gebiete entlang von Bächen und kleinen Flüssen sowie Sumpfränder können in etwas trockeneren Jahren ergiebiger sein. Im nassen Spätsommer und Herbst sind auch flechtenreiche Kiefernheiden und felsiges Gelände gute Sammelgebiete. Wiesen und Weiden haben wie Laubwälder ihre eigene Pilzpopulation mit mehreren Speisepilzen, vor allem zu Beginn der Saison.
Nach Möglichkeit meiden sollte man reine Feuchtgebiete wie Niedermoore und Moore – auch wenn es einige Arten gibt, die üblicherweise genau auf diesen Böden wachsen, zum Beispiel der Starkriechende Trompetenpfifferling, der Apfel-Täubling und einige Röhrlinge. Kahlschläge sollte man definitiv meiden, ebenso Gebiete mit sehr jungem Wald.
DIE AUSRÜSTUNG
Pilze sammelt man am besten in einem Korb, vorzugsweise einem Spankorb von der Art, wie man ihn früher auf dem Marktplatz für Obst verwendete. In einem solchen ziemlich großen und flachbodigen Korb liegen die Pilze luftig und werden nicht zerquetscht, wie es in einer (Plastik-)Tüte leicht der Fall ist. Es ist empfehlenswert, den Korb in Fächer einzuteilen, um die Ihnen gut bekannten Arten von noch nicht einwandfrei bestimmten Exemplaren zu trennen. Eine einfache Möglichkeit besteht darin, Wellpappescheiben zu schneiden, die man zwischen den Wänden des Korbes einklemmt, oder ausgespülte Milchpackungen zu verwenden. Eine Plastiktüte ist denkbar ungeeignet, um frisch gesammelte Pilze darin aufzubewahren. In der Wärme und Feuchtigkeit, die sich darin bilden, fühlen sich Bakterien, Schimmelpilze, Insektenlarven usw. wohl und steigern ihre Zersetzungstätigkeit. Unsere schönen Speisepilze werden deshalb in der Plastiktüte ziemlich schnell ruiniert.
Im nordischen Birkenwald gibt es weniger Arten, aber die Menge und Qualität der Pilze ist beeindruckend. Hier wachsen Raufüße, Täublinge, Reifpilz, Semmel-Stoppelpilz, und wenn man Glück hat, kann man auf Stellen mit Gebirgspfifferlingen treffen.
In reinen Kiefernwäldern auf Heiden und in Gebirgsgegenden kann es, vor allem in etwas feuchteren Jahren, reichlich Pilze geben. Mehrere Arten von Röhrlingen, Ritterlingen und Täublingen wachsen hier, manchmal auch Pfifferlinge und Trompetenpfifferlinge.
Buchenwälder haben eine spezielle Pilzflora mit mehreren Arten, die nur hier wachsen. Aber man findet auch sowohl die bekannten Speisepilze wie den Blassen Pfifferling, den Brätling, den Sommer-Steinpilz und Giftpilze wie den Grünen Knollenblätterpilz.
Offene Wiesen und Weiden





























