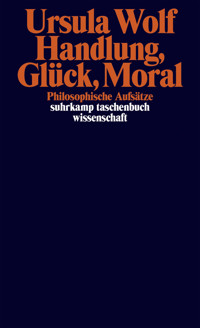
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ist Moralität notwendig für das Glück? Formuliert aus der Sicht des Individuums, das sich mit moralischen Forderungen konfrontiert sieht, verlangt diese Frage eine Erweiterung der Moraltheorie zu einer Theorie des guten Lebens. Diese setzt wiederum eine Klärung der Struktur menschlichen Handelns und Lebens voraus. In den hier vorliegenden Aufsätzen aus drei Jahrzehnten versucht die Autorin, von unterschiedlichen Problemen wie etwa der Willensschwäche und dem Zusammenhang von Tugend und Glück ausgehend, das antike Bemühen um eine solche Ethik im umfassenden Sinn wiederaufzunehmen und fortzuführen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
3Ursula Wolf
Handlung, Glück, Moral
Philosophische Aufsätze
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
5Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Vorwort
I
. Handlung
Zum Problem der Willensschwäche
Alte tote weiße Europäer. Bernard Knox über die aktuelle Bedeutung der Antike
Worin sich die Platonische und die Aristotelische Ethik unterscheiden
Reflexion und Identität. Harry Frankfurts Auffassung menschlichen Handelns
Aporien in der aristotelischen Konzeption des Beherrschten und des Schlechten
Das Wunsch-Meinungs-Modell und die Kontroverse zwischen Externalisten und Internalisten
Die Rolle des
›
thymos
‹
in Platons Handlungstheorie
II
. Glück
Über den Sinn der Aristotelischen Mesoteslehre
Kunst, Philosophie und die Frage nach dem guten Leben
Die Freundschaftskonzeption in Platons
›
Lysis
‹
Jenes Tages bleibender Umriß. Eine philosophische Lektüre von Handkes Versuchstrilogie
Zur Struktur der Frage nach dem guten Leben
Tugend und Glück. Was Platon und Aristoteles lehren
Warum sich die metaphysischen Fragen nicht beantworten, aber auch nicht überwinden lassen
III
. Moral
Moralische Dilemmata und Wertkonflikte
Übergreifender Konsens und öffentliche Vernunft
Grenzen des Individuums und Grenzen des Handelns. Überlegungen zum Klonen
Was wollen und sollen wir wissen? Probleme der Humangenetik
Die menschliche Natur und das Gute. Ein Vergleich der Positionen von Aristoteles, Thompson und Foot
Vom moralischen Sollen
Moralische Rechte ohne Würde
Textnachweise
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
7Vorwort
Der vorliegende Band macht (neben zwei Originalbeiträgen) verstreute Aufsätze aus drei Jahrzehnten neu zugänglich. Sie gliedern sich nach drei Themenbereichen, die in meinen philosophischen Überlegungen eng verknüpft sind: Handlungstheorie, Theorie des guten Lebens (Glücks) und Moraltheorie.
Mein 1984 erschienenes Buch Das Problem des moralischen Sollens endet mit der Überzeugung, dass die moralischen Phänomene nicht für sich, sondern nur eingebettet in den weiteren Kontext der Frage nach dem guten Leben zureichend bearbeitet werden können. Das erklärt meine Beschäftigung mit der antiken Ethik, die von vornherein diesen weiteren Ansatz verfolgt. Dabei interessieren mich weniger die inhaltlichen Vorschläge, die teilweise zeit- und kulturabhängig und für uns nicht immer brauchbar sind, als vielmehr die Entwicklung handlungstheoretischer Grundbegriffe und Grundstrukturen des Lebens und Handelns. Deren Ausarbeitung geht mit der Verengung der praktischen Philosophie auf Moraltheorie in der Neuzeit weitgehend verloren und wird erst nach dem linguistic turn von der analytischen Handlungstheorie wiederaufgenommen. Da diese jedoch das Handeln losgelöst und nicht wie in der Antike strukturiert durch die Suche nach dem Guten thematisiert, verlieren sich die heutigen handlungstheoretischen Debatten oft ohne nachvollziehbare Problemstellung in immer neue Spitzfindigkeiten. Hiergegen verfolge ich in den Beiträgen zur Handlungstheorie die Absicht, diese wieder in die ethische Frage zurückzuholen. Gleichzeitig steht dahinter eine theoretische Frage, die Frage, was die Aufgabe der Philosophie ist, ob sich die strukturelle Ordnung des Handelns auf den Begriff des Guten in der Philosophie direkt auswirkt oder eher im Hintergrund die Entscheidung über Methode und Inhalte steuert. (Dieser Frage ist mein skizzenhafter historisch-systematischer Versuch Die Philosophie und die Frage nach dem guten Leben (1999) gewidmet.)
Während die Entwicklung meiner Überlegungen mit der Moraltheorie begann, ist die Ordnung in diesem Band systematisch: Handlungstheoretische Fragen bilden den Anfang; es folgen Überlegungen zur Ethik im weiten Sinn bzw. zur Theorie des guten 8Lebens; schließlich werden moralphilosophische Probleme behandelt. Innerhalb der drei Teile sind die Aufsätze chronologisch angeordnet. Dabei sind der erste und der zweite Teil, die sich beide stark an der antiken Philosophie orientieren, nicht scharf trennbar. Der dritte Teil thematisiert sowohl moraltheoretische Fragen wie Probleme der angewandten Ethik, wobei ich die Tierethik bewusst auslasse, da meine Position hierzu in der Monographie Ethik der Mensch-Tier-Beziehung (2012) leicht nachzulesen ist.
Danken möchte ich Eva Gilmer und Jan-Erik Strasser für die verständnisvolle und freundliche Betreuung des Bandes; Carola Hesch für Korrekturen und die Einrichtung der bibliographischen Angaben; Ursula Baumann für hilfreiche Beratung bei der Auswahl der Texte.
Bad Dürkheim, Juni 2019
Ursula Wolf
9I. Handlung
11Zum Problem der Willensschwäche
Das Wort »Willensschwäche« ist zum einen ein Ausdruck unserer Umgangssprache, zum anderen fungiert es in der Philosophie als Übersetzung des griechischen Wortes »akrasia«. »Akrasia« kann man ungefähr mit »Unbeherrschtheit« übersetzen, und die Wörter »Willensschwäche« und »Unbeherrschtheit« sind sicher nicht völlig gleichbedeutend. Nun wurde auch in der griechischen Philosophie »akrasia« nicht genau im Sinn der damaligen Umgangssprache verwendet, sondern in einem terminologischen Sinn. Aristoteles hat dieses Wort als Terminus eingeführt für das Phänomen, daß jemand nicht tut, was er für das Beste hält, obwohl er es tun könnte. Sokrates hatte bestritten, daß es dieses Phänomen gibt, und er hat mit dieser zunächst wohl erstaunlichen und provokanten These eine Diskussion angefacht, die noch heute im Gang ist. Da es diese Diskussion ist, an der ich mich beteiligen möchte, ist das Wort »Willensschwäche« in meinem Titel so zu verstehen, daß es zunächst einfach eine Abkürzung für die genannte ausführlichere Phänomenbeschreibung ist.
Daß wir nicht tun, was wir für besser halten, auch wo wir es könnten, scheint ein so häufiges Phänomen zu sein, daß man sich fragen wird, wie Philosophen überhaupt dazu kommen konnten, sich ausgerechnet über seine Existenz zu streiten. Warum sie das tun und worüber sie dabei genauer streiten, kann uns vielleicht immer noch am besten Aristoteles erläutern, der sich ausführlich und differenziert mit der These des Sokrates auseinandersetzt.
Aristoteles wirft Sokrates zunächst vor, daß seine Behauptung den Phänomenen widerspricht (1145b27 f.), entwickelt dann jedoch eine Position, die zwischen schwächeren und stärkeren Versionen von Willensschwäche unterscheidet und die Sokratische These für die starke Version bestätigt. Ich beginne unmittelbar mit dem Beispiel, das Aristoteles in dem zentralen Text EN VII 5 erörtert.
Jemandem wird eine Süßigkeit angeboten. Er hat den Wunsch, seine Gesundheit zu erhalten, und die Meinung, daß Süßigkeiten schädlich sind, und daher kommt er in einer praktischen Überlegung, in der er fragt, was er in der Situation am besten tun sollte, zu dem Ergebnis, daß er die Süßigkeit ablehnen sollte. Damit wird 12sein konkretes Wollen in der Situation mit der Erforderlichkeit dieser Handlung des Ablehnens konfrontiert, d. h., diese Handlung müßte jetzt zu einer in der Situation gewollten werden. Nun kann es sein, daß unsere unmittelbaren oder sinnlichen Wünsche zufällig in Einklang mit dem sind, was aufgrund von Überlegung das Beste zur Erreichung bestimmter höherstufiger oder langfristiger Ziele ist. Es kann sein, daß der Handelnde kein großes Bedürfnis nach Süßigkeiten oder sogar eine Abneigung dagegen hat. Es kann aber ebensogut sein, daß überlegtes Wollen und unmittelbares Wollen sich widerstreiten. Es kann sein, daß dem Betreffenden einerseits viel an seiner Gesundheit liegt, daß er aber andererseits in der vorliegenden Situation große Lust auf die Süßigkeit hat. In solchen Situationen, in denen das Tun des Besseren sozusagen gegen innere Widerstände erfolgen müßte, erweist sich Willensstärke oder Willensschwäche: Der Willensstarke tut gegen seine unmittelbaren Antriebe das, was ihm die Überlegung als das Beste erweist, der Willensschwache folgt gegen die Überlegung seinem unmittelbaren Antrieb.
Nun ist diese Überlegung nicht irgendeine Überlegung, sondern sie ist eine Überlegung darüber, was für mich in dieser Situation zu tun das Beste ist. Nach Aristoteles sind für eine solche praktische Überlegung u. a. zwei Dinge charakteristisch: Erstens muß ich berücksichtigen, was ich in der Situation tun kann, was überhaupt in meiner Macht steht (sowohl was die äußeren Situationsbedingungen als auch was meine – physischen, technischen, intellektuellen usw. – Fähigkeiten angeht). Zweitens gehören in die praktische Überlegung nur diejenigen meiner Wünsche, die nicht bloße Wunschvorstellungen, sondern handlungsbezogene Wünsche sind, d. h. deren Realisierung ich wirklich anstrebe. Der Handelnde in dem Beispiel überlegt also nicht einfach abstrakt, was das Beste zur Erhaltung seiner Gesundheit wäre, um sich dann vielleicht zu sagen, daß es schön wäre, wenn er ein anderer Mensch wäre, der wirklich so handeln wollte oder könnte; sondern seine Überlegung geht aus von dem handlungsbezogenen Willen zur Erhaltung der Gesundheit, und d. h. von einer praktischen Einstellung, die sich in jeweiligen Situationen in geeigneten Handlungsvorsätzen manifestiert. Die praktische Überlegung fragt nach der hier und jetzt und für mich besten Handlung, gegeben meine verschiedenen handlungsbezogenen Wünsche, meine Fähigkeiten sowie die Situationsumstände, und ihr Ergebnis hat daher unmittelbar die Form eines Handlungsvorsatzes.
13Ein konkreter Handlungsvorsatz hinsichtlich einer jetzt anstehenden Handlungssituation ist aber dadurch definiert, daß er zur Ausführung kommt, wenn kein äußeres Hindernis vorliegt und der Handelnde ihn ausführen kann (1147a30 f.). Wenn daher jemand den Vorsatz, die nach seiner Überlegung beste Handlung zu tun, nicht ausführt, obwohl kein äußeres Hindernis vorliegt und obwohl er die Fähigkeit im gewöhnlichen Sinn der physischen usw. Fähigkeit besitzt, dann folgt analytisch, daß er entweder den Vorsatz nicht wirklich hat oder ihn aufgrund bestimmter innerer Bedingungen nicht ausführen kann. Wir können jetzt sehen, was das Problematische an der Beschreibung ist, daß jemand das seiner Meinung nach Beste nicht tut, obwohl er es tun könnte. Wenn die Meinung über das Beste Vorsatzcharakter hat, dann verwickeln wir uns in einen Widerspruch, wenn wir sagen, daß jemand das, was er für das in der Situation Beste hält, in dieser Situation tun könnte, es aber doch nicht tut. Ich stimme daher Sokrates und Aristoteles zu, daß es dieses Phänomen in der Tat nicht geben kann. Andererseits hatten wir, als uns die These des Sokrates auf den ersten Blick unplausibel vorkam, doch offenbar ein Phänomen im Auge, und es bleibt daher die Frage, wie dieses gesuchte Phänomen angemessen zu beschreiben wäre.
Aristoteles selbst macht dazu folgenden Vorschlag. Derjenige, der es für das in der Situation Beste hält, die Süßigkeit abzulehnen, wird in dem Augenblick, in dem er den Vorsatz faßt, von einem Verlangen nach der Süßigkeit überwältigt, das einfach hinter dem Rücken des Vorsatzes oder an dem Vorsatz vorbei Einfluß auf sein Handeln gewinnt (1147a34). Seine Handlung ist dann nur noch freiwillig in dem Sinn, daß sie nicht unter äußerem Zwang geschieht, aber sie ist nicht mehr freiwillig in dem Sinn, daß er zu diesem Zeitpunkt auch hätte anders handeln können. Dieser Verlust an Freiwilligkeit ist für Aristoteles letztlich immer ein Verlust an Wissen: in dem Moment, in dem die Begierde wirksam wird, macht sie den Handelnden sozusagen vorübergehend blind, so daß er, selbst wenn er seine Meinung über das Beste ausspricht, das nur wie ein Betrunkener oder Träumender tut, und d. h. ohne sich in diesem Moment über die Bedeutung und Handlungsrelevanz der Aussage im klaren zu sein (1147b9 ff.).[1]
14Neben diesem wohl eher seltenen, wenn auch denkbaren Fall, daß jemand, der eine Überlegung bis zum Ende durchgeführt hat, dann doch noch von einer Begierde oder einem Affekt überwältigt wird, bezeichnet Aristoteles als Willensschwäche auch das sicher häufigere Phänomen, daß jemand in der konkreten Situation unter dem Einfluß einer Begierde überhaupt nicht überlegt, sondern einfach unmittelbar handelt (1150b19 ff.).[2] Hier ist sein höherstufiger Wunsch bzw. sein allgemeines Handlungsprinzip, z. B. das Vermeiden von Dingen, die der Gesundheit schaden, in der Handlungssituation nur potentiell vorhanden, ohne in einer Überlegung aktualisiert und auf die Situation angewandt zu werden (1146b31 ff.).
Erfaßt Aristoteles auf diese Weise dasjenige Phänomen, das wir neu zu beschreiben versuchen, nachdem sich die Beschreibung, daß jemand freiwillig gegen das seiner Meinung nach Beste handelt, als widersprüchlich erwiesen hat? Solange wir noch nicht über eine neue Beschreibung verfügen, kann ich selbst dieses Phänomen vorläufig nur vage benennen. Aber es wäre jedenfalls dort zu suchen, wo jemand sich in der konkreten Situation in einem bewußten Konflikt zwischen überlegter Meinung und unmittelbarem Wollen befindet und dann dem unmittelbaren Wollen folgt. Dieses Phänomen aber kommt bei Aristoteles – wenn ich ihn richtig interpretiere – nicht vor. Es liegt ohnehin nicht vor, wo der Handelnde unter dem Einfluß der Begierde überhaupt nicht überlegt; aber es kommt bei Aristoteles auch dann nicht vor, wenn er überlegt hat, weil die Begierde, sobald sie eingreift, die Meinung über das Beste für den Moment in einen Status der Potentialität zurückversetzt, so daß ein Konflikt nicht vorhanden ist. Wie läßt sich das gesuchte Phänomen aber dann beschreiben?
Moderne Anhänger der sokratisch-aristotelischen Position versuchen es dadurch zu fassen, daß sie den von Aristoteles angenommenen Zusammenhang zwischen Wissen und Handlungsfreiheit 15auflösen. So beschreibt z. B. Hare den Willensschwachen als jemanden, der eine klare Meinung über das Bessere hat, jedoch in der Situation aufgrund einer psychischen Unfähigkeit nicht entsprechend handelt;[3] andere reden statt von psychischer Unfähigkeit von zwangsneurotischem Verhalten.[4] Was diese Begriffe bedeuten und ob man die Rede von Unfähigkeit oder Zwang hier wörtlich nehmen darf, müßte genauer geklärt werden. Zwar können wir bei Freud den Satz lesen: »[Der Zwangsneurotiker] ist vollkommen klar, teilt Ihr Urteil über seine Zwangssymptome […]. Er kann nur nicht anders«,[5] aber das ist durchaus auch in der Psychologie nicht die einhellige Meinung.[6] Man könnte es plausibler finden zu sagen, daß es für den Zwangsneurotiker nicht unmöglich, sondern nur besonders schwierig ist, anders zu handeln, d. h., man könnte an dem Zusammenhang zwischen Wissen und Handlungsfreiheit festhalten, den Aristoteles annimmt und den später mit allen Details Spinoza aufzuzeigen versucht hat. Obwohl ich selbst diese letztere Auffassung für überzeugender halte, kann ich diesen Punkt offenlassen; denn gerade dann, wenn es dem Zwangsneurotiker in einem wörtlichen Sinn unmöglich ist, anders zu handeln, kommen wir nicht zu dem gesuchten Phänomen. Die praktische Überlegung fragt nach der besten der mir möglichen Handlungen, und daher kann, wenn ich mich selbst so sehe, daß ich unter innerem Zwang stehe und nicht anders handeln kann, die betreffende Handlung nicht Inhalt meiner Meinung über das Beste sein.[7]
Das gesuchte Phänomen, daß jemand sich in einer Situation, in der er so oder anders handeln könnte, in einem bewußten Konflikt zwischen unmittelbarem Wunsch und überlegter Meinung befin16det und dann dem unmittelbaren Wunsch folgt, wird also sowohl von Aristoteles als auch von seinen modernen Anhängern übersprungen, wenn auch auf verschiedene Weise. Bei den modernen Autoren dadurch, daß sie sich auf den Spezialfall des zwangsneurotischen Handelns konzentrieren. Aber schließlich haben wir es nicht immer, wenn wir einem unmittelbaren Wunsch nachgeben, mit einer neurotischen Handlung zu tun, d. h. mit einer Manifestation von fest verankerten wiederkehrenden Verhaltensstrukturen. Wenn jemand z. B. am Abend ins Kino geht, obwohl er eigentlich noch arbeiten wollte, braucht das kein Fall von zwanghafter Arbeitsflucht zu sein, sondern kann einfach heißen, daß er gegen seinen höherstufigen Wunsch seiner Unlust nachgibt. Aristoteles andererseits verfehlt das Phänomen dadurch, daß er sich auf den Spezialfall des blinden Verlangens beschränkt, welches die Seite der Überlegung ausschaltet. Aber nicht in jedem Fall, in dem jemand einem unmittelbaren Wunsch folgt, braucht dieser ihn in dem Maß überwältigt zu haben, daß er nicht mehr weiß, was er tut.[8]
Das Phänomen, das wir suchen, muß also irgendwo zwischen dieser unteren Ebene des entweder zwanghaften oder blinden Handelns, welches kein Anders-handeln-Können impliziert, und der Ebene des Handelns nach den besten Gründen liegen. Daß jemand einem unmittelbaren Wunsch nachgibt, wo er sich in einem echten Konflikt zwischen diesem Wunsch und einer Meinung über das Beste befindet, läßt sich erst dort sinnvoll sagen, wo der Betreffende in der Situation überlegen und so oder anders handeln kann. Das aber heißt, daß die Konfliktsituation eine Wahlsituation ist, in der der Handelnde sich zwischen seinem unmittelbaren Wunsch und seinem höherstufigen Wunsch entscheidet. Wir könnten die Situation des Willensschwachen jetzt so beschreiben, daß er überlegt hat und d. h. eine Entscheidung gefunden hat, daß aber der unmittelbare Wunsch in der Situation dann doch so stark bleibt, daß er das Ergebnis der Überlegung sofort wieder in Frage stellt. Nehmen wir an, jemand hat aus seinem langfristigen Wunsch nach Erhaltung seiner Gesundheit zusammen mit bestimmten Kausalgesetzen und Tatsachen geschlossen, daß er nicht mehr rauchen sollte. Und er hat nach diesem Überlegungsschritt, der fragt, wie sich sein langfristiger Wunsch am besten realisieren läßt, in einem 17zweiten Schritt zwischen seinen verschiedenen Wünschen abgewogen und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß ihm die Erhaltung der Gesundheit wichtiger ist als das Rauchen. Wenn jetzt in der konkreten Situation sein Bedürfnis nach Zigaretten sehr stark ist, könnte er zunächst die abwägende Überlegung wiederholen. Da der Willensschwache jemand sein soll, der gegen seine überlegte Meinung handelt, müssen wir jedoch den Fall so konstruieren, daß er auch in dieser Überlegung, in der die Stärke des Verlangens als ein Faktor berücksichtigt wird, zu dem Ergebnis kommt, daß er keine Zigarette anzünden sollte, und daß er doch anders handelt. Er handelt dann freiwillig und aus einem Grund, nämlich weil er das Verlangen hat. Aber er entscheidet sich dadurch zugleich zum Handeln gegen seine besten Gründe, und diese Entscheidung kann jetzt nur noch eine bloße Entscheidung sein, weil weitere Gründe nicht mehr zur Verfügung stehen.
Auf diese Weise wird die Willensschwäche von Philosophen wie Davidson und Thalberg beschrieben,[9] die gegen Sokrates Partei ergreifen. Der Willensschwache entscheidet sich gegen das, was er für das in der Situation Beste hält, und wenn wir ihn fragen würden, warum er das tut, könnte er keine Antwort mehr geben. Er handelt frei, aber er kann seine Handlung prinzipiell nicht rechtfertigen. Nun haben wir aber schon vorhin gesehen, daß es Willensschwäche in diesem Sinn nicht geben kann, weil diese Beschreibung in einen Widerspruch führt. In der praktischen Überlegung geht es nicht um irgendein Bestes, sondern um die Frage, was hier und jetzt für mich zu tun das Beste ist, und daher hat die Antwort die Form eines Handlungsvorsatzes.[10] Da wir jetzt davon ausgehen, daß der 18Handelnde in der Situation so oder anders handeln kann, folgt aus dem Vorliegen eines Vorsatzes analytisch die Ausführung. D. h. umgekehrt: Handelt der Betreffende freiwillig gegen das, was er für besser zu halten behauptet, dann folgt analytisch, daß er es nicht wirklich für besser hält.
Oder ist das vielleicht doch nicht zwingend? Kenny meint, daß es dann nicht folgt und daß sich daher die antisokratische Position dann verteidigen läßt, wenn wir beachten, daß unsere individuellen Wünsche auf allgemeinen Wunschdispositionen beruhen.[11] Nach Kenny meinen wir mit Willensschwäche nicht, daß jemand gegen das handelt, was er in der konkreten Situation für das Beste hält, sondern nur, daß er gegen das Bessere im Sinne eines höherstufigen oder langfristigen Wunsches handelt, den er grundsätzlich höher bewertet. Daß jemand einen solchen höherstufigen Wunsch in einem handlungsrelevanten Sinn hat, impliziert nur, daß er ihn meistens in relevanten Situationen realisiert; aber wir sprechen ihm einen solchen Wunsch nicht schon dann ab, wenn er ihn in seltenen Fällen nicht realisiert. Also geraten wir hier nicht in den Widerspruch, der sich aus der Orientierung am konkreten Handlungsvorsatz ergibt.
Aber auf diese Weise kommen wir nicht zu einer Beschreibung des gesuchten Phänomens, bei dem ein Konflikt in der konkreten Situation vorliegen sollte. Denn nach dieser Beschreibung handelt der Betreffende in der konkreten Situation nicht gegen das, was er für das in der Situation Beste hält, sondern er hält es eben in dieser Situation für besser, seinem unmittelbaren Wunsch zu folgen. Daß wir seinem höherstufigen Wunsch nicht einfach die Handlungsrelevanz absprechen, wenn er das in seltenen Fällen tut, ist richtig. Aber wir würden doch in jedem solchen Fall von seinem höherstufigen Wunsch ein kleines Stück an Gewicht oder Handlungs19relevanz abziehen. Anders gesagt: er handelt dann nicht gegen den Wunsch, in allen Situationen der und der Art so und so zu handeln, sondern er hat dann eben vielmehr nur den Wunsch, in den meisten derartigen Situationen so zu handeln. Würden wir ihm einen handlungsrelevanten Wunsch für alle derartigen Situationen zuschreiben, würden wir bereits dann, wenn er in einer solchen Situation anders handelt, ebenso in einen Widerspruch geraten wie dort, wo wir sagen, daß jemand gegen einen konkreten Vorsatz handelt.
Wenn jemand sagt, daß er etwas für das Beste hält, aber doch anders handelt, können wir also in der Tat nur noch die vorhin schon erwähnte Konsequenz ziehen, daß er es nicht wirklich für das Beste hält bzw. nicht wirklich im handlungsrelevanten Sinn will. So erweist sich als die einzig mögliche Beschreibung des gesuchten Phänomens, welche nicht in Paradoxien führt und doch zugleich das Vorliegen eines echten Konflikts in der konkreten Situation erfassen kann, diejenige, die sich bei Thomas von Aquin findet: Daß jemand, der sich in einem echten Konflikt zwischen einem unmittelbaren Wollen und einer Meinung über das Beste befindet, dem unmittelbaren Wollen folgt, kann nicht heißen, daß er gegen seine überlegte Meinung bzw. seinen Vorsatz handelt, sondern es kann nur heißen, daß er diese Meinung bzw. diesen Vorsatz zunächst erwägt, aber sofort wieder aufgibt. Und bezogen auf den höherstufigen Wunsch, der in dieser Meinung enthalten ist, kann es nur heißen, daß er seine Realisierung nicht sehr fest, sondern nur auf schwächere Weise bzw. nicht für alle, sondern nur für manche Fälle intendiert.[12] Thomas bezeichnet das Phänomen auch unter dieser Beschreibung als Willensschwäche (incontinentia), aber es scheint angemessener, hier einfach von der Änderung eines Vorsatzes hinsichtlich der konkreten Situation bzw. der Änderung des Status der höherstufigen Wünsche zu reden.
Wer gegen seine Meinung über das Beste seinem unmittelbaren Wollen folgt, müßte also sehen, daß er damit in Wirklichkeit seine Meinung geändert hat und damit seine Überlegungen revidieren müßte. Für eine solche Revision bestehen zwei Möglichkeiten. Nehmen wir z. B. an, jemand habe seiner eigenen Aussage zufolge den höherstufigen Wunsch, schlank zu werden, und er halte es daher für das Beste, keine Süßigkeiten zu essen; er handelt jedoch 20nicht entsprechend. Dann wäre die erste Möglichkeit die, daß er zugibt, daß er seinem höherstufigen Wunsch keinen handlungsrelevanten Status gibt, sondern den eines bloßen Wunsches; er fände es zwar schön, schlank zu sein, aber er will die erforderlichen Verzichte doch nicht auf sich nehmen. Bloße Wünsche aber sind nicht Gegenstand der praktischen Überlegung, so daß er diesen Wunsch aus der Überlegung streichen müßte. Es braucht jedoch, zweitens, nicht der Fall zu sein, daß der höherstufige Wunsch überhaupt keinen Handlungsbezug hat. Es könnte z. B. sein, daß der Betreffende nur manchmal der Versuchung durch Süßigkeiten nachgibt, oder es könnte sein, daß er in anderen Handlungsbereichen Dinge tut, die der Realisierung seines Wunsches förderlich sind, daß er sich z. B. viel bewegt und Sport treibt. Dann muß er denjenigen Schritt in seiner Überlegung revidieren, in dem er seine verschiedenen Wünsche gegeneinander abgewogen hat. Er müßte dem Genuß von Süßigkeiten ein größeres Gewicht einräumen, als er das in seiner ursprünglichen Äußerung, die zu seinem Handeln in Widerspruch steht, getan hat.
Würde der Handelnde seine Überlegung auf eine dieser Weisen revidieren, dann käme er zu derjenigen Meinung über das in der Situation Beste, die mit seinem Handeln übereinstimmt, d. h. die die Befriedigung des unmittelbaren Wollens als das in der Situation Beste erweist. Wir können daher die thomasische Beschreibung des gesuchten Phänomens jetzt auf folgende Weise präzisieren: Es liegt dort vor, wo jemand, wenn ein unmittelbarer Wunsch das Ergebnis seiner Überlegung immer noch in Zweifel zieht, durch sein tatsächliches Verhalten seinen konkreten Vorsatz ändert bzw. den Status eines höherstufigen Wunsches abschwächt, ohne sich mit der Erforderlichkeit eines erneuten Überlegungsschritts, in dem er die Gewichtung oder den Status seiner Wünsche revidiert, zu konfrontieren.
Man könnte daher sagen, daß wir es hier letztlich mit einem kognitiven Fehler zu tun haben, wenn auch von besonderer Art, nämlich einem Fehler im Selbstverständnis. Dieser Fehler ist ein interessierter Fehler. Wir machen ihn deswegen, weil wir einerseits vor uns selbst und vor anderen jemand sein möchten, der bestimmte höherstufige Wünsche als wirkliche Handlungsabsichten hat, weil wir aber andererseits im Konfliktfall ungern auf die Befriedigung unmittelbarer Wünsche verzichten. Da wir gern beides 21zugleich hätten, reden wir so, als wäre das möglich, und versuchen zu übersehen, daß wir uns damit in einen Widerspruch verwickeln. Aber diesem Widerspruch können wir nicht entgehen. Er ergibt sich nicht aus zufälligen begrifflichen Abgrenzungen, die wir auch ändern könnten, sondern daraus, daß es an uns selbst liegt, ob wir so oder anders handeln, d. h. daraus, daß wir Handlungsfreiheit besitzen. Der Begriff der Handlungsfreiheit impliziert den Begriff des Wollens, und zwar nicht in irgendeinem Sinn von »wollen«, sondern im Sinn des handlungsrelevanten Wollens: wenn ich etwas hier und jetzt tun kann oder auch nicht und es nicht tue, dann folgt analytisch, daß ich es nicht im handlungsrelevanten Sinn will, d. h. nicht wirklich für das in dieser Situation Beste halte. Da wir selbst es sind, auf die diese Begriffe angewandt werden, sind wir mit den analytischen Notwendigkeiten, die sie implizieren, praktisch oder von innen konfrontiert. Behaupten wir, eines für das Beste zu halten, und tun gleichwohl ein anderes, dann verwickeln wir uns in einen Widerspruch, der sich nur dadurch auflösen läßt, daß wir zugeben, daß wir in Wirklichkeit nicht ganz die Menschen sind, als die wir uns gerne verstehen würden.
Glücklicherweise jedoch besitzen wir mit der Handlungsfreiheit zugleich auch eine Fähigkeit, die es uns ermöglicht, diese unerfreuliche Konsequenz zumindest in manchen Fällen zu umgehen, die Fähigkeit zur Selbsttäuschung. Mit Hilfe dieser Fähigkeit gelingt es uns, die Diskrepanz zwischen unserem wirklich handlungsrelevanten Wollen und denjenigen Wünschen, die wir uns gern als handlungsrelevante zuschreiben würden, ein Stück weit zu überbrücken bzw. die vorhin erläuterten Revisionen der Überlegung, nämlich entweder die Abschwächung des Gewichts eines höherstufigen Wunsches oder die Änderung seines Status vom handlungsrelevanten zum bloßen Wunsch, zu umgehen.
Daß wir diese Möglichkeit haben und benutzen, bestätigt meine Auffassung von Willensschwäche als widersprüchlichem Verhalten: Wenn wir nicht selbst unser Verhalten als widersprüchlich empfinden würden, bestünde kein Grund, von einer Verdeckung durch Selbsttäuschung Gebrauch zu machen. Die Untersuchung des Begriffs der Willensschwäche müßte also jetzt in eine Untersuchung des Begriffs der Selbsttäuschung übergehen. Ich kann eine solche Untersuchung hier nicht mehr wirklich durchführen, möchte aber wenigstens noch damit beginnen, indem ich die zwei wichtigsten 22Verfahren erläutere, deren sich Selbsttäuschung bedienen kann, nämlich Rationalisierung und Ausnutzung von Zeitdifferenzen.
Das Problem des sog. Willensschwachen war, daß er einerseits ein bestimmtes ideales Selbstverständnis aufrechterhalten will und andererseits nicht auf die Befriedigung unmittelbarer Wünsche verzichten will, daß aber beides zusammen oft nicht möglich ist. Die unmittelbaren Wünsche können uns jedoch zu einer Weise des Überlegens veranlassen, durch die es etwas öfter möglich wird. Unsere höherstufigen Wünsche erfordern in relevanten Situationen Handlungen, die Prinzipien oder Kausalgesetze befolgen. Wer z. B. ein guter Mensch sein will, muß nach bestimmten Moralprinzipien handeln; wer seine Gesundheit erhalten will, muß sein Handeln an den entsprechenden Kausalgesetzen orientieren. Wenn die praktische Überlegung fragt, welche Handlung in einer konkreten Situation zur Realisierung eines solchen Wunsches erforderlich ist, bewegt sie sich daher in einem gewissen Spielraum der Unbestimmtheit: Handlungsprinzipien sind Prima-facie-Prinzipien, d. h., sie sehen Ausnahmen in begründeten Fällen vor, ohne daß diese im voraus festgelegt wären. Kausalgesetze andererseits haben häufig Wahrscheinlichkeitscharakter; z. B. sind nicht für alle Menschen dieselben Dinge schädlich, und der Schwellenwert, an dem die Schädlichkeit beginnt, sowie der Zeitpunkt, zu dem der Schaden eintreten wird, lassen sich selten exakt angeben. Außerdem erfordert die Anwendung eines Prinzips oder Kausalgesetzes eine Interpretation der konkreten Handlungssituation, und Situationsinterpretationen sind nie in dem Sinn definitiv, daß wir hier nicht ebenfalls Spielräume hätten.
Durch Ausnutzung dieser Unbestimmtheitsspielräume können wir oft auch dort, wo wir in einem Konflikt zwischen einem unmittelbaren und einem höherstufigen Wollen einfach dem unmittelbaren Wunsch nachgeben, das Eingeständnis umgehen, daß wir damit das Gewicht des höherstufigen Wunsches in der Überlegung abschwächen müßten. Denn wir können, indem wir z. B. unliebsame Situationsfaktoren für irrelevant erklären oder falsch interpretieren, indem wir Wahrscheinlichkeitsgesetze für zu unsicher halten usw., die Überlegung so wenden, daß wir zu dem Ergebnis kommen, daß wir in dieser Situation eine wohlbegründete Ausnahme von der Befolgung des Prinzips oder Gesetzes machen können. Wohlbegründete Ausnahmen aber sind in den Prinzipien selbst 23vorgesehen, und daher bedeutet es keine Abschwächung des Prinzips, wenn wir sie machen. Solche Überlegungen, in denen wir unseren wirklichen Handlungsgrund, einen unmittelbaren Wunsch, durch Scheingründe verdecken, kann man als Rationalisierungen bezeichnen. Sie haben insbesondere zwei Merkmale. Erstens steht hier von vornherein fest, was das für den Handelnden Beste ist, nämlich das Handeln nach dem unmittelbaren Wunsch, und die Überlegung sucht nur nachträglich nach solchen Gründen, die die Handlung in ein möglichst gutes Licht stellen. Zweitens sind diese Gründe nicht die Gründe, aus denen der Betreffende handelt, sondern der Grund, aus dem er in Wirklichkeit handelt, ist, daß er seinen unmittelbaren Wunsch befriedigen will.
Es gibt noch eine zweite Weise der Rationalisierung, die es uns anders als die erste ermöglicht, offen unseren unmittelbaren Wünschen zu folgen, indem wir gerade eine solche Verhaltensweise zu einem bestimmten Selbstverständnis hochstilisieren. Wenn wir uns von unmittelbaren Wünschen bestimmen lassen, ohne die weiteren Folgen zu bedenken, reden wir häufig so, daß wir sagen, daß es schließlich nicht so wichtig ist, was wir tun und wie wir sind, daß im Grunde nichts daran liegt oder daß es egal ist, was man tut. Auf diese Weise brauchen wir nicht zu sagen, daß uns die unmittelbaren Wünsche als solche das Wichtigste sind, sondern können unser Verhalten als Ausdruck eines distanzierten Verhältnisses zu uns selbst und zur Welt hinstellen.
Damit möchte ich nicht sagen, daß jemand ein solches Selbstverständnis nicht aufrichtig und ohne Rationalisierungsabsichten haben kann. Das ist vielmehr ohne weiteres möglich. Daß die Selbstdistanzierung häufig nur Rationalisierungsfunktion hat, zeigt sich jedoch daran, daß viele Leute sie gerade nur in den Situationen vertreten, in denen sie sie gebrauchen können, um ihre höherstufigen Wünsche in den Status bloßer Wünsche zu verweisen, während sie sich in anderen Situationen, in denen sie unter negativen Folgen ihrer Handlungen zu leiden haben, eher ernst nehmen und bereuen, daß sie diese Folgen nicht verhindert haben.
Der Kunstgriff der Rationalisierung ist also, was ebenfalls für die zuvor genannte Form gilt, nur in Grenzen wirksam. Wir können uns seiner in der konkreten Situation bedienen, in der unmittelbares und höherstufiges Wollen konfligieren, und wir können ihn dort so verwenden, daß wir uns die Tatsache, daß wir rationalisie24ren, nicht bewußt machen. Aber wenn wir nachträglich und außerhalb dieser Situation die Folgen unseres Verhaltens nicht einfach in Kauf nehmen, sondern unsere Handlungsweise bereuen, wird uns bewußt, daß wir nicht richtig überlegt, sondern rationalisiert haben und uns in Wirklichkeit einfach von einem unmittelbaren Wunsch bestimmen ließen. Wir fassen dann häufig zu solchen späteren Zeitpunkten den Vorsatz, künftig unseren höherstufigen Wünschen nicht nur scheinbar, sondern wirklich mehr Gewicht zu verleihen bzw. sie nicht als bloße Wünsche, sondern als zu realisierende Wünsche zu behandeln. Da dieser Vorsatz außerhalb der Handlungssituation gefaßt wird und sich auf unbestimmte künftige Zeitpunkte bezieht, bietet sich uns hier eine weitere Möglichkeit der kostenlosen Identifikation mit unserem idealen Selbstverständnis. Wir können jeweils in den Zeitintervallen zwischen relevanten Konfliktsituationen unseren höherstufigen Wunsch als handlungsrelevanten ausgeben und ihn selbst für handlungsrelevant halten, auch wenn sich schon in der nächsten Konfliktsituation zeigen wird, daß wir ihm nicht wirklich einen handlungsrelevanten Status geben.
Die Rationalisierung durch Ausnutzung von Überlegungsspielräumen sowie durch Überhöhung unmittelbarer Wünsche und die Ausnutzung von Zeitdifferenzen zwischen Vorsatz und Handlung ermöglichen es uns also in manchen Fällen, daß wir uns in der Handlungssituation oder für eine gewisse Zeitspanne mit einem höherstufigen Wunsch identifizieren können, ohne entsprechend zu handeln. Aber die Rationalisierung verliert ihre Wirkung, wo wir nachträglich mit negativen Handlungsfolgen konfrontiert sind, und die Benutzung von Zeitdifferenzen verliert ihre Wirkung, sobald die nächste relevante Situation auftritt, in der sich der Vorsatz zeigen müßte. Nun ist das natürlich etwas, was wir wissen. Wir wissen, daß wir uns gerne dieser Kunstgriffe bedienen, und wir wissen auch, daß sie sich nachträglich immer wieder als wirkungslos erweisen. Da wir es wissen, sind diese Kunstgriffe nur im Modus von Selbsttäuschung sinnvoll. Denn dieses Wissen ist ja ein zusätzlicher Faktor, den wir in der praktischen Überlegung in Rechnung stellen müßten, womit aber die Kunstgriffe von vornherein als solche entlarvt und damit wirkungslos wären. Damit sie wenigstens partiell und zeitweise wirksam sein können, müssen sie mit Selbsttäuschung verbunden sein. D. h., ihre Wirksamkeit setzt voraus, daß 25wir dieses zusätzliche Wissen über unsere Neigung zu Überlegungsmanipulationen und über deren nur partielle und vorübergehende Wirksamkeit beiseite schieben oder vergessen können.
Ich möchte an diesem Punkt, an dem die Aufklärung des Phänomens der Selbsttäuschung erst richtig beginnen müßte, enden. Aber wir können immerhin sehen, welches die Funktion dieses Phänomens ist. Es kommt gerade dadurch zustande, daß es Willensschwäche in dem Sinn, daß jemand etwas für das Beste hält und es nicht tut, nicht geben kann, weil diese Beschreibung widersprüchlich ist. Dieser Widerspruch, in den uns unsere Handlungsfreiheit verwickelt, ist in der Selbsttäuschung in versteckter Form vorhanden, die uns ermöglicht, uns mit höherstufigen Wünschen zu identifizieren und im Konfliktfall doch möglichst oft nach unmittelbaren Wünschen zu handeln. Aber auch in der Selbsttäuschung können wir den Widerspruch nur verschieben und nicht beseitigen. Er kommt immer wieder zum Vorschein, weil die Kunstgriffe, mit denen wir ihn verdecken, nur partiell und zeitweise wirksam sind.
26Alte tote weiße Europäer
Bernard Knox über die aktuelle Bedeutung der Antike
Das Interesse an den alten Sprachen geht immer weiter zurück. Vielleicht hängt es mit 1968 zusammen. Die kritische Hinterfragung überkommener Vorstellungen hat auch die Ideale des Bildungsbürgertums mit ihrem geschönten Vorbild der Griechen zum Einsturz gebracht. Das Griechische und das Lateinische werden zu Lerninhalten wie anderes, und da sie uns eher fern sind, gibt es wenig Motive, sie zu wählen. Daß das nicht notwendig so ist, zeigt die Rolle, die das klassische Bildungsideal nach wie vor in England spielt. Vielleicht hat die stärker empirische und pragmatische Mentalität der Engländer weniger idealisiert, so daß die Antike von vornherein nicht zu einem hohen Vorbild wurde, das bei kritischer Betrachtung um so tiefer stürzen mußte.
Aufschlußreich ist der amerikanische Bildungskrieg. Der Angriff auf die alten Sprachen entspringt dort nicht einer Kritik an unglaubwürdigen Idealisierungen. Vielmehr ist es ein moralischer Angriff, der aus dem feministischen und dem postmodernen Lager kommt. Der Vorwurf lautet: Als selbstverständliches Bildungsgut sind die alten Sprachen zugleich eine Diskriminierung der Frauen und Mißachtung anderer Kulturen. Denn die Alten, deren Schriften wir lesen, waren Männer, sie waren weiß, und sie waren Europäer: eine Subspezies der Menschheit, die »Dead White European Males«, wird bevorzugt. Das verstößt gegen die Prinzipien der Gleichheit und Gerechtigkeit.
Auch wenn diese Auseinandersetzung in Europa wenig virulent ist, sind die Argumente der angegriffenen Seite für uns doch aufschlußreich. Der englische Gräzist Bernard Knox sagt in seiner Essaysammlung »The Oldest Dead White European Males and Other Reflections on the Classics« (New York und London 1993):
Der Primat der Griechen im Kanon der westlichen Literatur ist weder ein Zufall noch das Ergebnis einer von oben auferlegten Verordnung. Er geht schlicht und einfach auf den inneren Wert des Materials zurück, auf seine Originalität und Brillanz. Was das multikulturelle Curriculum betrifft, das Ideal der heutigen radikalen Akademiker, so gibt es sicher keine guten 27Gründe gegen den Versuch, neuen Stoff aufzunehmen, der den Studierenden eine umfassendere Sicht vermittelt. Aber dieser neue Stoff wird sich mit dem alten messen müssen, und wenn er sich nicht auf demselben hohen Niveau bewegt, wird er früher oder später von den Studierenden selbst mit Geringschätzung zurückgewiesen werden. Nur ein totalitäres Regime kann das Studium zweitrangiger Texte oder überlebter Philosophien auf Dauer durchsetzen. Solange die ganz und gar griechische Vorstellung vom Wettkampf freies Spiel hat, muß man sich keine Sorge über die künftige Stellung der Griechen im Lehrplan machen. Selbst wenn sie hier und dort vorübergehend ausrangiert werden, werden sie sich ihren Platz zurückerobern. Sie haben die Probe der Zeit bestanden, länger als zweitausend Jahre, und sie sind ein Element unseres Charakters, unserer Natur geworden.
Diese Verteidigung der klassischen Bildung schätzt ihren Gegenstand realistisch ein. Bernard Knox setzt sich in dem Titel-Essay seines Buches kritisch mit den alten Griechen auseinander, und eine solche kritische Tendenz ist in der gesamten neueren angelsächsischen Literatur verbreitet. Knox verteidigt nicht die politische und gesellschaftliche Rechtlosigkeit der Frau in der Antike, weist aber auf die große Bedeutung der Frauenrollen in Tragödie und in Literatur hin. Er zeigt, daß der Verzicht auf eine Idealisierung der Antike ihre Bedeutung nicht schmälert. Vielmehr wird dadurch ein Dialog möglich, in dem sich erweist, daß die Griechen zwar nicht immer recht behalten, aber standhalten.
Nun haben auch Shakespeare und andere den Zeittest bestanden: Steht dies alles also auf einer Ebene mit den Griechen, oder haben sie darüber hinaus ein Gewicht? Knox antwortet, die humanistische Bildung sei eine Erziehung zur Demokratie. Die Sophisten haben eine intellektuelle Revolution angefacht und bildeten ihre Schüler darin aus, skeptische Fragen zu stellen, die keine definitive Antwort erlauben, sondern subversive Kraft entfalten und die Freiheit des Redens und Denkens offenhalten.
Knox zeigt damit allerdings nicht mehr, als daß eine Beschäftigung mit der Antike eine Möglichkeit bleibt, zu einer demokratischen Einstellung zu gelangen. Der Verweis auf die politische Verfassung der Griechen ist im übrigen ein zweischneidiges Argument. Denn auf die Griechen berufen sich auch diejenigen, die der liberalen Demokratie gegenüber kritisch eingestellt sind. Der von MacIntyre und anderen propagierte Rückgang auf die politische Gemeinschaft antiker Art, der unter dem Schlagwort »Kommu28nitarismus« verhandelt wird, ist inzwischen auch hierzulande zur Kenntnis genommen worden.
Dem Liberalismus, der nur formale Bedingungen vorgibt, nach denen die Personen ihren Vorstellungen gemäß leben können, werfen die Kommunitaristen vor, er sei unfähig, Bindung an das Gemeinwesen und Erfahrung von Lebenssinn zu erzeugen. Sie verweisen auf die Polis, in der das individuelle Leben wesentlich in das Gedeihen der Gemeinschaft integriert war. Daß die Demokratie im Athen der klassischen Zeit eine Quelle für starke Gemeinschaftsvorstellungen ebenso wie für Ideale freien Redens und Denkens ist, ist richtig, aber damit ist es noch nicht selbstverständlich, daß sie die beste Quelle für eine Erziehung zur Demokratie ist.
Ein stärkeres Argument enthält die Bemerkung von Knox, daß die Griechen ein Element unseres Charakters geworden seien. Das heißt nämlich, daß wir uns selbst nur verstehen können, wenn uns die antiken Hintergründe unserer Denk- und Handlungsweisen bekannt sind. Der englische Philosoph Bernard Williams vertritt in seinem Buch »Shame and Necessity« (Berkeley, Los Angeles, Oxford 1993) die noch stärkere These, daß die klassischen Vorstellungen nicht nur als ein wichtiger Teil unseres Selbstverständnisses präsent bleiben müssen, sondern daß sie noch heute in vieler Hinsicht die bessere und richtigere Sicht der Dinge enthalten.
Auch Williams, der inzwischen in Kalifornien lehrt, setzt sich in seinem Buch mit den Angriffen auf die Kategorie der »Dead White European Males« auseinander:
Es ist unzureichend anzunehmen, daß die griechische Vergangenheit interessant sein muß, nur weil sie »unsere« ist. Wir brauchen einen Grund, nicht so sehr um zu sagen, daß das historische Studium der Griechen in einer besonderen Beziehung dazu steht, wie die modernen Gesellschaften sich selbst verstehen können – denn so viel ist offenkundig –, sondern um zu sagen, daß diese Dimension des Selbstverständnisses wichtig ist. Ich denke, daß es einen solchen Grund gibt […]. Die grundlegenden ethischen Vorstellungen der Griechen waren in mancher Hinsicht von den unsrigen verschieden, in manch anderer aber folgen wir ganz ähnlichen Auffassungen wie die Griechen, ohne daß wir uns jedoch über das Ausmaß im klaren sind.
Die griechischen Begriffe des Handelns, der Verantwortung, der Scham und der Freiheit sind, so zeigt Williams in seinem Buch, 29in unserem Selbstverständnis nach wie vor zentral, und ihm zufolge könnten wir ein klareres und sinnvolleres Selbstverständnis gewinnen, wenn wir uns auf sie besinnen und von den aus jüdisch-christlichem Gedankengut stammenden Zutaten, etwa dem metaphysischen Willensbegriff, absehen würden. Die griechischen Vorstellungen enthalten Sichtweisen, die bis heute nicht ausgeschöpft sind. Cornelius Castoriadis hat dies so ausgedrückt, daß die Vorstellungen der Griechen weder ein Ideal noch ein beliebiger Teil von uns seien, sondern der Keim unserer Denk- und Handlungsweisen. Dadurch besäßen sie immer noch produktive Kraft (»The Greek Polis and the Creation of Democracy«, New School Graduate Faculty Philosophy Journal, Bd. 9, 1983).
Auch Castoriadis vergleicht die griechische und die jüdisch-christliche Weltsicht und ihre säkularen Nachfolger, indem er die Verschiedenheit der Antworten auf die kantischen Fragen hervorhebt: »Über die ersten beiden Fragen ›Was kann ich wissen?‹ und ›Was soll ich tun?‹ beginnt in Griechenland eine endlose Debatte, und es gibt keine ›griechische Antwort‹ auf sie. Doch auf die dritte Frage ›Was darf ich hoffen?‹ gibt es eine endgültige und klare griechische Antwort, und sie lautet entschieden: Nichts. Offensichtlich ist es die richtige Antwort.«
30Worin sich die Platonische und die Aristotelische Ethik unterscheiden
Die folgenden Andeutungen enthalten keinen fertigen Aufsatz, sondern nur einige Vermutungen, die ausgearbeitet und genauer belegt werden müßten. Sie artikulieren vorläufig nur die Unzufriedenheit mit der derzeitigen Interpretationssituation. Die Mehrzahl derjenigen Forscher, die sich mit der Ethik des Aristoteles befassen, verzichtet auf einen Vergleich mit Platon oder verwendet darauf nur wenige Zeilen. Eine der originellsten neueren Publikationen über die Nikomachische Ethik, C. D. C. Reeves Buch Practices of Reason,[1] erwähnt den Namen Platons nicht einmal, was um so befremdlicher ist, als Reeve der ethischen Methodenproblematik breiten Raum beimißt, für die Platon Bahnbrechendes geleistet hat. Gerade in der Methodenproblematik, die mir für den Vergleich zentral scheint, wird das Neuartige gewöhnlich Aristoteles zugeschrieben. Platon, so die Standardinterpretation, fordert in der Ethik exaktes Wissen, während Aristoteles als erster auf die schwächere Genauigkeit der Ethik und zugleich auf ihre methodische Eigenständigkeit verweist, was selten geprüft und hinterfragt wird.[2] Diese Auffassung des neuen Beitrags von Aristoteles scheint mir falsch zu sein. Worin bestehen aber dann die Unterschiede zwischen der Ethik Platons und derjenigen des Aristoteles, und wenn es nicht der Beitrag zur Methodenfrage ist, welches sind dann die Fragen, in denen Aristoteles Neues in die ethische Theorie einbringt?
Es fällt auf, daß bei der Erörterung der aristotelischen ethischen Methode nirgendwo erwähnt wird, daß Platon in den frühen Dialogen eine ganz neuartige Methode für ethische Probleme entwickelt hat, den Elenchos, den er in diesen Dialogen unermüdlich vor- und durchführt, während Aristoteles nur wenige methodische 31Bemerkungen macht und sich auf diese Errungenschaft Platons in den ethischen Schriften nicht explizit bezieht. Ist mit der Erfindung des neuen praktischen Verfahrens des Elenchos die Standardthese der Aristotelesforscher vereinbar, Platon glaube an ein Wissenschaftsmodell der Ethik? Weiterhin: Was wird aus Platons Elenchos bei Aristoteles, oder durch was wird er abgelöst, und geht vielleicht dadurch, daß Aristoteles das Methodenproblem mit geringerer Schärfe behandelt, sogar gegenüber Platons Neuerung etwas verloren? Schließlich: Wenn Aristoteles in der Ethik Neues leistet, liegt es dann vielleicht auf einer ganz anderen Ebene, und hat sein mangelndes Interesse an Platons methodischer Neuerung vielleicht gerade mit solchen andersartigen Unterschieden zu tun?
Es ist in der Tat befremdlich, daß die Aristotelesdeutung sich gegen einen stilisierten Platon abhebt und den wichtigen Beginn einer ethischen Methodenreflexion in Platons Frühdialogen ignoriert. Zwar ist die Interpretation der Platonischen Intention strittig, und es gibt in der Tat auch Platonforscher, die der Meinung sind, Platon operiere mit einem Modell, wonach die Ethik eine Techne oder Wissenschaft sei und deren Erkenntnischarakter aufweise. Andere aber haben mit ebenso guten Gründen das Gegenteil zu zeigen versucht,[3] das sich skizzenhaft so darstellen läßt: Platon sucht gegen den sophistischen Angriff auf feste Werte, gegen den damaligen Relativismus und Machtegoismus nach einem verläßlichen ethischen Fundament. Ein solches wäre gegeben, wenn es ein gegenüber jedem sprach- bzw. vernunftbegabten Menschen demonstrierbares praktisches Wissen gäbe. Das einzige Modell von strengem Wissen, das Platon vorfindet, ist das der Wissenschaft, der Episteme, und ähnlich auch das der Techne. Deren Wissenscharakter verdankt sich, wie Platon nicht müde wird herauszustellen, dem Umstand, daß sie einen klar umgrenzten Gegenstandsbereich hat, der durch Gesetzmäßigkeiten bestimmt und auf diese Weise faßbar und definierbar ist. Wie Platon nicht weniger oft betont, ist das Problematische im praktischen Bereich aber gerade, daß wir nicht eine Erkenntnis dieses oder jenes Gegenstandsbereichs suchen. Vielmehr stellen wir hier gerade diejenigen Fragen, die jede Episteme und Techne unbeantwortet lassen muß, nämlich wozu wir diese Er32rungenschaften im individuellen Leben und in der Politik verwenden wollen, was das gute individuelle und gemeinsame Leben im ganzen ist. Diese Frage hat keinen umgrenzten Gegenstand mehr, sondern bezieht sich auf alles. In diesem Punkt gibt Platon den Sophisten recht, die beansprucht hatten, über jedes beliebige Thema argumentieren zu können. Die Sophisten hatten damit aber auch jeden strengen Wissensanspruch zurückgenommen, während Platon nach neuen Wegen sucht, ihn aufrechtzuerhalten. Wenn die inhaltliche Verankerung fehlt, bleibt als Alternative offenbar nur, die Begründetheit aus der methodischen Strenge zu gewinnen, aus den Gesetzen der Rede und Argumentation.
Was Platon statt dessen von vielen Aristotelesforschern unterstellt wird, daß er nämlich Definitionen von Wertbegriffen, der Idee des Guten oder der Besonnenheit usw. zugrunde lege und aus ihnen ethisches Wissen herleite, ist jedenfalls in den uns vorliegenden Texten nicht zu finden.[4] In den Frühdialogen ist eines der Leitmotive das sokratische Nichtwissen, die Einsicht des Sokrates, daß er als Mensch kein definitives und endgültiges Wissen vom Guten (Leben) habe und haben könne. Auch in den mittleren Schriften, in denen die Ideen und die Idee des Guten erwähnt werden, bleibt die Einsicht in die Begrenztheit der menschlichen Erkenntnissituation. Nirgends wird eine endgültige Definition einer Wertidee gegeben, und im Phaidon wird explizit für die praktischen Fragen die »zweitbeste Fahrt« empfohlen, die Zuwendung zu den Logoi, der Ersatz also des wissenschaftlichen Erkennens der Gesetze und Ursachen durch die Orientierung an der methodischen Ordnung der Rede, durch das Prüfen des Richtigen, also den Vollzug des Elenchos, der prüfenden Überlegung.[5]
Trotzdem bleibt in gewissem Sinn hinter diesem Methodenersatz ein inhaltlicher Bezug. Das letztlich und vollkommen Gute, bei dem wir nicht mehr weiterfragen können, warum wir es wollen, ist die Eudaimonia. Nicht im Sinn des alltäglich erreichbaren beschränkten menschlichen Glücks, sondern im Sinn des vollkommenen und vollständigen Glücks. Dieses Zielen auf das vollkommen Gute ergibt sich für Platon aus der Struktur des menschlichen Strebens und Existierens. Der Mensch ist für Platon wesentlich ein 33bedürftiges und abhängiges Wesen. Ein vollkommen Gutes aber, das diese Bedingungen des Lebens aufhebt, ist in der Wirklichkeit, wie sie ist, nicht nur nicht erreichbar; wir können es auch nicht konkret denken oder wissen. Andererseits müssen wir es als existent unterstellen, weil sonst das Streben nach dem vollkommen guten Leben ins Leere läuft und keinen Zielpunkt hat. Das führt zu der Merkwürdigkeit, daß das Praktizieren des Elenchos für Platon mit dem guten Leben zusammenzufallen scheint. Merkwürdig für uns ist das zunächst darum, weil sich schwer nachvollziehen läßt, wie das Praktizieren einer Methode die praktische Glücksintention auch in ihren gewöhnlichen subjektiven Aspekten aufnehmen kann.[6] Ein Aspekt der Erklärung ist, daß das beständige Praktizieren Dauer und Einheit der Person herstellt. Zum Glück im normalen Verständnis gehört aber auch, daß man sein Leben als glücklich erlebt, Lustgefühle usw. hat. Nun behauptet Platon zwar im 9. Buch der Politeia, daß der gute Mensch sich in der Tat an der Lebensweise der stetigen ethischen Überlegung freuen wird. Doch wird die Rolle dieses Lustaspekts nicht wirklich klar, und das Bedürfnismodell des Menschen hat zur Folge, daß diese Lust ohnehin immer gemischt mit Unlust ist, weil der Mangelzustand bis zu seiner vollständigen Beseitigung immer mitläuft, auch wenn er kleiner wird.
Gehen wir nun zu Aristoteles, zunächst zu der bekannten These, jeder Bereich habe seine eigentümlichen Genauigkeitsansprüche und in der Ethik sei es nicht sinnvoll, dieselbe Genauigkeit zu verlangen wie in der Mathematik. Das klingt so, als würde Aristoteles der Ethik wie jeder Episteme und Techne einen umgrenzten Gegenstand zuschreiben, dem ihre Gesetzmäßigkeiten und Bestimmungen zu entnehmen sind, nur daß diese Gesetzmäßigkeiten schwächer und weniger notwendig sind als etwa die der Mathematik. Auf welche Art ethischer Aussagen bezieht sich Aristoteles hier? Sicher nicht auf seine ethischen Grundprämissen wie die Lehre vom menschlichen Ergon, wonach der Mensch wesentlich die Funktion hat, seine spezifischen Fähigkeiten, nämlich die Fähigkeiten zu einem vernunftgeleiteten Leben, zu betätigen. Auch nicht auf begriffliche und allgemein wertende Aussagen wie zum Beispiel Aussagen darüber, was Lust ist und ob die Lust etwas 34Gutes ist, ob es Willensschwäche gibt, ob also jemand absichtlich etwas Schlechtes tun kann usw. Solche grundlegenden ethischen Aussagen sind für Aristoteles keine Aussagen mit bloßem Wahrscheinlichkeitscharakter, die nur meistens gelten, sondern sie beanspruchen allgemeine Richtigkeit. Für derartige Fragen, wie sie ähnlich in Platons ethischen Dialogen Thema sind, ist die klassische Stelle, an der Aristoteles sein Vorgehen beschreibt, das Ende des einleitenden Teils des 7. Buchs der Nikomachischen Ethik, in dem die Willensschwäche behandelt wird.[7] Das Vorgehen besteht in der dialektischen Prüfung der vorhandenen Meinungen, die oft richtige Aspekte enthalten, aber zusammengenommen in Widersprüche und Schwierigkeiten führen, so daß sie im Zusammenhang erörtert werden müssen, um die Schwierigkeiten nach Möglichkeit zu lösen und zu einer konsistenten Menge von Sätzen zu gelangen. Es liegt auf der Hand, daß dies ziemlich genau dem entspricht, was Platon in den frühen Dialogen ständig vorführt, der Methode des Elenchos, und Aristoteles selbst charakterisiert in der Topik die Verfahren der Dialektik und des Elenchos auf genau diese Weise.
Daß das selten beachtet wird, hat zwei Gründe. Erstens praktiziert Platon seine Methode bloß und redet nicht explizit darüber, so daß hier nicht methodische Aussagen beider Philosophen zum Vergleich zur Verfügung stehen. Zweitens praktiziert Platon den Elenchos in den Frühdialogen nicht ernsthaft, um konsistente Aussagen über ethische Grundprobleme zu erreichen. Die Frühdialoge sind so inszeniert, daß sie die Gesprächspartner des Sokrates als für ethische Einsicht ungeeignete Charaktere (wo diese erwachsene Redner und Sophisten sind) oder als für selbständiges ethisches Denken noch nicht genügend gefestigte Charaktere (wo sie gutwillige junge Männer sind) vorführen. Das erfordert gerade, den Elenchos so einzusetzen, daß die Partner in Verwirrung, Widersprüche und am Ende in die Aporie geführt werden. Obwohl Platon geschickt genug ist, gleichzeitig auf der übergeordneten Ebene des Lesers die methodischen Möglichkeiten des Elenchos deutlich zu machen, wird dieser also auf der vordergründigen Ebene des Dialogs nicht zu seinem eigentlichen Zweck, dem Gewinn allgemeiner ethischer Aussagen, sondern zur Entlarvung von Personen eingesetzt.
35Entsprechend schief ist es, wenn behauptet wird, Platon suche nach einem ethischen Wissen, durch das die Menschen zugleich praktisch besser werden, während Aristoteles nur die ethische Praxis von seinesgleichen aufklären wolle, da er der Jugend und ungebildeten Charakteren die Möglichkeit ethischer Einsicht abspreche.[8] Platon ist (dies ist eines der ständigen impliziten Beweisziele der Frühdialoge) ganz wie Aristoteles der Meinung, daß zur ethischen Einsicht nur fähig ist, wer bereits im Charakter gut ist, und Aristoteles ist ganz wie Platon der Meinung, daß allgemeine ethische Einsichten durch die Methode der logisch-begrifflichen Durcharbeitung eines hinreichend großen Feldes alltäglicher Phänomene und früherer philosophischer Meinungen nach Auflösung von Aporien gewonnen werden.[9] Dafür ist, wie wir bei Aristoteles sehen, der Dialog überflüssig, es kann ein einzelner Überlegender so vorgehen. Und dafür fehlt uns von Platon eine Vorführung, sei es auch eine dialogische, weil es keinen platonischen Dialog mit einem Partner gibt, der bereits den nötigen ethisch guten Charakter besitzt.
Die in einem echten Elenchos gewonnenen grundlegenden und allgemeinen ethischen Aussagen sind zwar nicht notwendig wie mathematische Aussagen, aber sie sind sicher nicht diejenigen, denen Aristoteles schwächere Exaktheit und bloße Wahrscheinlichkeit zuschreibt. Sie sind methodisch streng gewonnen, wenn auch nicht durch Gesetzmäßigkeiten eines Gegenstandsbereichs, sondern durch Gesetze der Rede und Argumentation. Schwächer sind sie in dem einen Punkt, daß der Logos über das Gute ein offenes Ende hat (was daran liegt, daß er inhaltlich offen, auf das nicht gegenständlich faßbare Ganze des Praktischen bezogen ist) und daher im Prinzip jedes Ergebnis revidierbar ist.
Die aristotelische Lehre von der geringeren Genauigkeit der Ethik bezieht sich nicht auf die bisher betrachteten allgemeinen ethischen Aussagen, sondern auf Ratschläge des guten Lebens oder Handelns für konkrete Personen in konkreten Situationen. Platon hingegen hält solche Ratschläge, folgen wir den Sokrates beigelegten Meinungen in den Dialogen, nicht nur für ungenau, sondern 36für nicht möglich. So erfahren wir im Hippias Maior (291d 9 ff.), es sei nicht möglich, eine wirkliche Lebensweise gut zu nennen, weil sie immer in manchen Hinsichten oder für manche Menschen auch schlecht sei. Die naheliegende Vorstellung, es sei ein gutes Leben, in Reichtum, Gesundheit und Ehre möglichst lange zu leben und im Kreis der Kinder alt zu werden, passe etwa nicht für eine Person wie Achill, der ein kurzes Leben hohen Ruhms vorgezogen hat. Aristoteles würde wohl gerade auf ethische Aussagen dieses inhaltlichen Typs, die Platon ganz auszuschließen scheint, seine These von der Ungenauigkeit und bloßen Wahrscheinlichkeit der ethischen Methode beziehen und sagen, der Ratschlag gelte generell, für die meisten Menschen, aber Achill sei eine Ausnahme.
Für Platon besteht in der Tat kaum Grund, sich auf solche ungenauen inhaltlichen ethischen Aussagen festzulegen. Denn wenn das gute Leben wegen der prinzipiellen Bedürftigkeit des Menschen nur ersatzweise oder auf zweitem Weg, nur formal durch das stetige Überlegen erreichbar ist, dann ist konkret richtig einfach, was jeweils die Überlegung als richtig erweist, und die Inhalte des Strebens spielen dann nicht selbst eine Rolle.
Hingegen hat Aristoteles einen solchen Grund in der Hinsicht, in der er sich tatsächlich von Platon unterscheidet. Dieser Aspekt der Theorie ist nicht die Methode, sondern das Menschenbild, und der Punkt, an dem der Unterschied am deutlichsten zum Vorschein kommt, ist der von Aristoteles neu entdeckte Begriff der Lust als Freude an einer Tätigkeit. Zwar sieht auch Aristoteles, daß der Mensch ein bedürftiges Wesen ist und im Bereich der Sinnlichkeit nur mit Unlust gemischte Lust empfindet. Doch macht er demgegenüber eine andere Erfahrung von Lust geltend, die nicht aus einem Mangel hervorgeht, sondern Bestandteil unserer Selbstentfaltung, der Betätigung unserer menschlichen Fähigkeiten ist. Am Sehen, Betrachten, Denken usw. können wir uns freuen, ohne daß diese Tätigkeiten aus einem Mangelzustand hervorgingen. Und ebenso freuen können wir uns an der Ausübung der Tugenden, der guten Charakterhaltungen, wenn wir die geeignete Gewöhnung haben und unser Streben und Fühlen in Einklang mit dem ethisch Richtigen ist.
Das vernunftgemäße Leben, das auch Aristoteles empfiehlt, ist daher nicht einfach formal. Es enthält verschiedene Tätigkeiten, 37die in sich Freude machen und daher wünschenswerte Inhalte sind. Aristoteles arbeitet zwei solcher inhaltlichen Glücksmöglichkeiten aus, einmal das theoretische Leben des Philosophen, sodann das politische Leben der Ausübung der ethischen Tugend. Während Platon aufgrund seiner einheitlichen formalen Konzeption des guten Lebens an die Einheit von Philosophie und Politik glaubt (und in Sizilien mit diesem Glauben scheitert), finden wir bei Aristoteles eine klare Trennung der philosophischen und der politischen Lebensform.
Aus dem zweiten Vorschlag, dem des politisch-ethischen Lebens, ergibt sich auch, warum Aristoteles anders als Platon, für den die Norm der Übereinstimmung der Affekte im ganzen mit der Vernunft genügt, eine detaillierte Ausarbeitung der verschiedenen Charaktertugenden braucht und ungenaue konkrete Aussagen über Forderungen der Tugenden macht. Die Ungenauigkeit dieser Aussagen ist keine neue methodische Entdeckung, denn auch Platon würde, wenn ihn solche inhaltlichen Aussagen interessieren würden, kaum bezweifeln, daß sie nicht methodisch streng zu sichern sind wie die abstrakten ethischen Aussagen, von denen oben die Rede war. Es ist vielmehr eine Folge davon, daß Aristoteles, gestützt auf seinen neuen Lustbegriff, realisierbare inhaltliche Glücksmöglichkeiten für das menschliche Leben artikuliert, während Platon die Sicht der Unerfüllbarkeit des wirklichen Glücksstrebens mit einer formalen Lebensform der überlegenden Suche nach dem Guten verbindet.
Obwohl ich das jetzt skizzierte Bild des Unterschiedes für zutreffend halte, ist es sicher etwas überzeichnet. Dies gilt in beide Richtungen. Auch Platon rettet etwas vom wirklichen Glücksstreben in seine formale Lebenskonzeption. Denn die Idee des Guten, die hinter dieser steht, hat etwas mit Einheit und Harmonie zu tun, und sofern wir diese innerhalb unserer Seelenkräfte erreichen, kann sie eine subjektive Glückserfahrung bedeuten, auch wenn diese Einheit offenbar immer wieder neu hergestellt werden muß. Umgekehrt behält auch die aristotelische Konzeption, insbesondere wenn wir sie innerhalb der gesamten Philosophie des Aristoteles betrachten, eine metaphysische Dimension. Die Freude an der theoretischen Tätigkeit ist für Menschen, die Bedürfnisse haben, nur mit Unterbrechungen möglich, und die Freude am ethischen Tätigsein ist nicht vollständig frei von Unlust; unter widrigen äu38ßeren Umständen empfindet selbst der ethisch beste Mensch neben der Freude über die Richtigkeit seines Tuns doch zugleich Leid, Trauer, Schmerz. Die von Aristoteles ausgezeichnete erste dieser Lebensweisen wird so genaugenommen erst dadurch zu einer des dauernden und vollkommenen Glücks, daß sie die Lebensweise des Gottes ist, des Unbewegten Bewegers, der ohne Materie und daher in ununterbrochener Tätigkeit ist.
Zu korrigieren bzw. zu ergänzen ist das Bisherige aber auch noch in einem weiteren Punkt. Daß Platon sich im Bereich des Praktischen nicht für inhaltliche Aussagen interessiert, ist nur teilweise richtig. Wie schon erwähnt, ist Platon ebenso wie Aristoteles der Meinung, daß die meisten Menschen (noch) nicht zur ethischen Reflexion, zum Elenchos, fähig sind. Diese müssen auf bestimmte Weise behandelt werden, nämlich als Objekte einer pädagogischen Techne. Auf dieser vorgelagerten Ebene würden Platon und Aristoteles gleichermaßen annehmen, daß eine Techne im gewöhnlichen Sinn möglich ist, daß diejenigen, die das Gute kennen, die anderen Menschen im Charakter so eingewöhnen können, daß diese in der Lage sind, auf Gründe und Überlegungen zu hören. Die Inhalte einer solchen Psychagogik oder Pädagogik formuliert Platon insbesondere in der Politeia und den Nomoi.





























