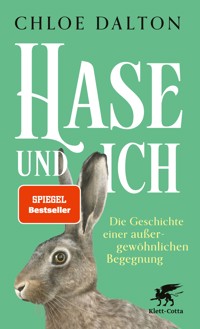
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
»Diese Begegnung beschert uns jetzt ein Buch, das zum Schönsten gehört, was seit Langem über das Verhältnis von Mensch und Tier geschrieben wurde.« Alexander Cammann, Die ZEIT Stellen Sie sich vor, Sie könnten ein Hasenbaby halten und mit der Flasche füttern. Es lebte unter Ihrem Dach, räkelte sich nachts auf dem Boden Ihres Schlafzimmers. Nach über zwei Jahren eilt es immer noch vom Feld herbei, wenn Sie es rufen. Genau das ist Chloe Dalton passiert. »Hase und ich« erzählt diese wahre, herzerwärmende Geschichte einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen einer Frau und einem Feldhasen. Während des Corona-Lockdowns zieht sich die vielbeschäftigte Chloe aufs Land zurück. In der Nähe ihres Hauses findet sie eines Tages einen verwaisten Junghasen – allein und nicht größer als ihre Handfläche. Sie nimmt ihn zu sich, versorgt ihn und beschließt nach anfänglichem Zögern, den Hasen aufzuziehen und seine Rückkehr in die Wildnis vorzubereiten: Doch »Hase«, wie ihn Chloe nennt, bleibt bei ihr – zu seinen eigenen Bedingungen. Er ist nicht zahm, lässt sich nicht streicheln und liebt seinen Freiraum. Wir werden Zeugen eines unwahrscheinlichen Bandes von Vertrauen, geschildert mit einer einnehmenden Stille, Gefühl und Respekt vor einem wilden Geschöpf der Natur. Mehr als ein Memoir ist diese Geschichte ein lebensphilosophisches Meisterwerk, das über das Miteinander von Mensch und Tier nachdenkt, eingebettet in eine wunderschöne, nahezu poetische Sprache. »Mit lyrischer Zärtlichkeit geschrieben ... ein wunderschönes Buch.« Angelina Jolie »Ein umwerfendes Buch. Es regt zum Nachdenken darüber an, wie wir die natürliche Welt um uns herum so oft ausblenden. Chloe Dalton verbindet ... die Leser mit der Wildnis, die wir Menschen einst so gut kannten.« Matt Haig »Dies ist eine große und wichtige Geschichte für unsere Zeit.« Michael Morpurgo »Ein Liebesbrief an die Natur.« The Times »Daltons klare, umsichtig geschriebene Prosa [sorgt …] für ein wenig Trost in einer Welt, die sich nun in einem noch hektischeren Zustand befindet.« The New York Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Chloe Dalton
Hase und ich
Die Geschichte einer außergewöhnlichen Begegnung
Übersetzt aus dem Englischen von Claudia Amor
Klett-Cotta
Impressum
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Raising Hare. The heart-warming true story of an unlikely friendship« bei Canongate Books Ltd, 14 High Street, Edinburgh, EH1 1TE.
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstr. 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2024 by Chloe Dalton
Für die deutsche Ausgabe
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle deutschsprachigen Rechte sowie die Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler unter Verwendung einer Abbildung von © Denise Nestor
Illustrationen: © Denise Nestor
Handlettering: © Christina Max, christinamax.de
Karte: © Jamie Whyte
Lektorat: Sabrina Keim
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-96638-1
E-Book ISBN 978-3-608-12398-2
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Prolog
Erster Teil
1.
Ein Winterkind
2.
Erste Bande
3.
Vier Wochen alt: kleiner Hase
4.
Hase ohne Namen
5.
Mai-Tage: die Hasen-Hexe
6.
Unabhängigkeit
7.
Vier Monate alt: Aktionsräume
8.
August: Hochsommersorgen
Zweiter Teil
9.
Klein war gestern
10.
Ultimativer Vertrauensbeweis
11.
Zwei Jahre alt: Staunen
12.
Häschen
13.
Ein Schlag aus heiterem Himmel
14.
Blutige Ernte
15.
Geheime Wege
Auswahlbibliographie
Abdruckgenehmigung
Danksagung
Für meine Familie, Freundinnen und Freunde
Manch ein Hase läuft schneller undist kräftiger als die anderen, so ist’s auchbeim Menschen und jedem anderen Tier.
Edward von Norwich, The Master of Game
Aus Schatten und Sonneist unser Leben gemacht.Doch bedenke, wie klein der Schattenund wie groß die Sonne lacht.
Spruch auf einer Sonnenuhr
Prolog
Der Januar war eisig kalt. Die Temperatur fiel etliche Male unter Null. Im neuen Jahr kam der erste Schnee, danach schneite es fast pausenlos weiter, bis Mitte Februar ein kurzes Tauwetter die Schneeglöckchen freilegte, die bereits ihre Spitzen durch das durchnässte Gras schoben. Wenige Tage später lagen sie unter einer frischen Schneedecke. Die Bäume standen weißgefroren unter einem Mantel aus verwehten Flocken, vereiste Spinnennetze hingen in den Hecken wie erstarrte Fadenspiele. Ein einsamer Falke hockte auf dem Gartenzaun, geisterhaft im dämmrigen Licht. Hagere Füchse durchstreiften das Gelände, schlichen, vom Hunger angetrieben, wagemutig über Stock und Stein. Ein Häufchen blutverklebte Daunen war alles, was von einer üppigen Waldtaube übriggeblieben war, ein Anblick, als hätte jemand einen Sack Federn ausgeleert. Fasane querten konsterniert die Felder, mit vorsichtigem Schritt auf dem eisigen Terrain, die Schwanzfedern schwer unter einer Kruste aus Schnee. Ihre makellosen Fußspuren führten wie Richtungspfeile in die Ferne – Hier entlang, immer hier entlang –, bis sie irgendwann verschwanden.
In diesen Wochen der Eiseskälte sprang eine Häsin in den Feldern umher, ihre Bewegungen verlangsamt durch das neue Leben, das in ihr heranwuchs. Während die tief stehende Wintersonne sich schwerfällig über den Horizont schob, drückte sie sich fest an die Erde und nutzte jedes Versteck, das ihr vor dem rauen Wind und dem gierigen Blick der Raubtiere Schutz bot. Nachts scharrte sie mit den Vorderpfoten im Schnee, um zwischen den Stoppeln des Getreidefeldes ein paar Grashalme auszugraben, oder kaute an der trockenen Rinde von Heckensträuchern – armselige Nahrungsquellen, um der Kälte zu trotzen und ihren ungeborenen Nachwuchs durch die zweiundvierzig Tage und Nächte der Tragezeit zu bringen.
Eines Nachts im Februar baute die Häsin am Feldrand, unter einem Schopf aus langem, überhängendem Gras, ein Nest. Im Mondlicht gebar sie geräuschlos ein Hasenjunges, das so dunkel war wie die Nacht selbst und nur auf der Stirn eine sternförmige, weiße Zeichnung trug. Erst leckte die Mutter das Junge sauber, dann ließ sie es trinken, während sie es mit ihrem Körper so lange stützte, bis es gelernt hatte, auf eigenen Beinen zu stehen. Danach stupste sie es besorgt fort von dem Ort seiner Geburt, hinein in ein neues Versteck in einem dichten Büschel aus abgestorbenem Gras – ein kuscheliges Zelt für das Hasenkind.
Kaum hatte sie das Junge zu ihrer Zufriedenheit getarnt, entfernte sich die Hasenmutter auf demselben Weg, auf dem sie gekommen war und verwischte dabei mit den Spitzen ihrer Vorderläufe sämtliche Spuren. Eile war geboten, denn am Horizont brach schon die Morgendämmerung an. Dabei bewegte sich die Häsin mit eleganten, federnden Schritten, als wollte sie vermeiden, auch nur einen Halm zu knicken. Sobald sie fertig war, sprang sie mit einem Stoß ihrer kräftigen Hinterläufe davon und ließ ihren Nachwuchs weit hinter sich. Ohne einen Bau, in dem sie ihr Junges hätte verstecken können, war es am klügsten, es allein zu lassen, Räuber bis zum Einbruch der Nacht abzulenken und erst im Schutz der Dunkelheit wieder zu ihm zurückzukehren.
In den darauffolgenden Stunden hatte der Winter ein Einsehen und lockerte seinen gnadenlosen Griff. Der Schnee schmolz und in dem sumpfigen Gelände begann es zu gurgeln. Erleichtert wagten sich nun auch die Menschen wieder ins Freie. Das winzige Hasenjunge mit dem sternförmigen Mal auf der Stirn kauerte in seinem gräsernen Nest und drückte sich immer fester an den Boden, während es aufmerksam den herannahenden Stimmen lauschte, die der Wind zu ihm herübertrug. Doch noch etwas näherte sich: die donnernden Pfoten, der keuchende Atem und der moschusartige Geruch eines Hundes, der mit einem furchterregenden, triumphierenden Gebell, das die Luft erzittern ließ, querfeldein auf das Versteck des Hasenjungen zuhetzte.
Erster Teil
1.
Ein Winterkind
In Sibirien benennt man Hasen nach dem Zeitpunkt ihrer Geburt: nastovik (im März geboren, wenn der Schnee eine Harschkruste hat), letnik (im Sommer geboren), listopadnik (im Herbst geboren, wenn die Blätter von den Bäumen fallen).
A. A. Cherkassov, Notes of an East Siberian Hunter, 1865
Ich stand an der Hintertür meines Hauses und machte mich für einen langen Spaziergang bereit, als ich Hundegebell und kurz darauf die Rufe eines Mannes vernahm. Ich zwängte eilig die Füße in meine Stiefel und lief über den Kiesweg hinüber zu der hölzernen Gartentür, um zu sehen, woher der Lärm kam. Hunde hatten hier in der Nähe eigentlich nichts verloren. Die alte Scheune, in der ich lebte, stand mutterseelenallein inmitten von weitem Ackerland, das von Bächen und Hecken unterteilt und hier und da mit kleinen Waldstücken durchsetzt war. Aus meiner Kindheit kannte ich noch diese Geschichten von Wilderern, die Schlösser kappten, gewaltsam Gatter aufbrachen oder mit ihren Autos in die Felder und Wälder der Bauern fuhren, um Wild und Kaninchen zu schießen oder ihre Hunde auf Feldhasen zu hetzen. Die weit weniger drastische Alternative war, dass ein Hund seinem Besitzer ausgerissen war – die umliegenden Wege waren beliebte Spazierstrecken –, weil er einem Kaninchen nachgejagt hatte oder einfach nur magisch von der offenen Landschaft angezogen wurde, dabei jedoch nichtsahnend Schafe zerstreute oder nistende Vögel aufschreckte. Ein besonders übermütiger Hund war im vergangenen Jahr einmal über die Mauer in meinen Garten gesprungen, wo er, noch keuchend von der Jagd, innehielt und fröhlich mit dem Schwanz durch die Luft peitschte, ehe er sich mit einem Satz wieder davonmachte. Solche Episoden ereigneten sich jedoch nur sehr selten, daher war ich neugierig, was da draußen los war.
Ich lehnte an der Gartentür und suchte das Feld ab, das sich in sanftem Anstieg bis zum Horizont erstreckte und dahinter, für meine Augen unsichtbar, wieder abfiel. Der Himmel war stahlgrau. Ich ließ den Blick über die langen Heckenreihen schweifen, über die weiten Flächen aus kahlen Getreidestoppeln mit letzten Flecken liegengebliebenen Schnees, bis hin zu den finsteren Umrissen des nächsten Waldstücks. Keine Spur mehr von einem freilaufenden Hund. Der Wind strich mit eisiger Klinge über meine Wangen und riss den weißen Rauch meines Atems mit sich fort. Ich tastete in den Taschen nach meinen Handschuhen, schlug den Mantel fester um mich und begann meinen Spaziergang.
Der Weg, den ich einschlug, war ein kurzer, unbefestigter Pfad, der an einem Getreidefeld entlangführte und in eine schmale, beiderseits mit hohen Hecken aus dichtem Brombeer- und Schneebeergestrüpp flankierte Landstraße mündete. Der Feldweg hingegen bestand aus zwei kompakten, ungepflasterten Spuren, die fest genug waren, um darauf zu fahren, jedoch jede Menge Schlaglöcher und Pfützen aufwiesen. Geistesabwesend erklomm ich den höchsten Punkt und war eben im Begriff, das sanfte Gefälle zur Landstraße hinunterzugehen, als ich von einer winzigen Kreatur, die mir vom grasbewachsenen Mittelstreifen des Pfades entgegenblickte, aus meinen Gedanken gerissen wurde. Ich blieb wie angewurzelt stehen. Ein Hasenjunges. Daran hatte ich keinen Zweifel, obwohl ich noch nie zuvor einen Feldhasen aus der Nähe gesehen hatte.
Das Tier, nicht größer als meine Hand breit, lag bäuchlings und mit offenen Augen da, die kurzen, seidigen Ohren fest an den Rücken gepresst. Es hatte dunkelbraunes, dichtes Strubbelfell, das entlang der Wirbelsäule leichte Wellen warf. Die helleren Deckhaare und der Hasenbart standen etwas länger vom Körper der kleinen Gestalt ab, sodass Rumpf und Schnauze wie eine Korona aus Licht in der kraftlosen Sonne leuchteten. Doch auf der kahlen Erde und im trockenen Gras – dort, wo das schwache Licht nicht hinfiel – war kaum erkennbar, wo sein Fell endete und der Boden begann. Wäre da nicht das hastige Heben und Senken seines Brustkorbs gewesen, hätte ich das Hasenjunge wohl für einen Stein gehalten, so perfekt fügte es sich in die leblose Winterlandschaft ein. Die mit beinfarbenem Fell umrandeten Vorderpfoten hatte es leicht übereinandergeschlagen, wie um es sich gemütlich zu machen. Rund um die tiefschwarzen Augen trug es einen dichten, unregelmäßigen Ring aus cremefarbenem Fell und hoch auf der Stirn einen auffälligen weißen Fleck, der hervorstach wie ein Spritzer Farbe. Als ich in Sichtweite kam, schreckte das Hasenjunge nicht auf, sondern fixierte den Boden, ohne eine Regung.
Die klaffenden Mäuler von Kaninchenbauten am Fuße von Bäumen oder Böschungen und die vorbeihuschenden Wattebausch-Schwänzchen ihrer Bewohner waren gängige Bilder meiner Kindheit. Feldhasen hingegen waren selten und so scheu, dass man sie immer nur aus der Ferne sah, ständig auf der Flucht. Ein Hasenjunges aus nächster Nähe zu sehen, vor allem eines, das einfach so da lag, ohne jeden Schutz, kam mir daher überaus seltsam vor. Die wahrscheinlichste Erklärung war, dass der Hund, den ich vorhin gehört hatte, es gejagt oder geschnappt und wieder fallengelassen hatte, sodass es nun verirrt mitten auf dem Weg kauerte.
Ich überlegte, welche Möglichkeiten ich hatte. Entweder ich ließ das Hasenjunge, wo es war und hoffte, dass es einen sicheren Unterschlupf finden und von der Mutter geholt werden würde, bevor ein Raubtier es aufspürte oder es unter die Räder eines vorbeifahrenden Autos geriet, oder ich hob es auf und bettete es ins hohe Gras, mit dem Risiko, dass seine Mutter es entweder nicht mehr finden würde, weil es vielleicht zu weit von seinem ursprünglichen Versteck fortgetragen worden war, oder dass sie es nicht mehr annahm.
Als Kind war es für mich das Allerschönste, wenn im Frühling die Lämmer auf die Welt kamen und ich meine Freizeit auf einem nahegelegenen Bauernhof verbringen durfte. Dort sah ich, wie Mutterschafe ihre Jungen unter den vielen Lämmern, die auf einer Weide standen, allein durch den Geruch erkennen konnten. Jedes andere Lamm, das sich einer Mutter zu nähern wagte, oder versuchte, ihre Milch zu trinken, wurde unsanft fortgeschubst. Ich erinnerte mich noch gut daran, wie der Bauer einmal ein Mutterschaf, deren eigenes Lamm gestorben war, davon überzeugte, das Waisenkind einer anderen Mutter zu säugen, indem er es in das abgezogene Fell ihres toten Lämmchens wickelte. Denn nur wenn das mutterlose Lamm annähernd so roch wie das Lamm, das sie verloren hatte, war die Pflegemutter bereit, das Lämmchen aufzuziehen. Wenn ich also meinen fremden Geruch auf das Hasenjunge übertrug, indem ich es aufhob – selbst um es nur wenige Meter fortzutragen –, brachte ich es vor lauter Fürsorge vielleicht um.
Ich hielt es für ausgeschlossen, dass das wehrlose Tier zu meinen Füßen allein überleben könnte, zumal in einer Umgebung, in der es vor Gefahren nur so wimmelte, wo es Füchse gab und Falken, die ich oft dabei beobachtete, wie sie über der Erde kreisten, plötzlich die Flügel einklappten und sich wie Steine auf ihre Beute hinabstürzten. Solch tödlichen Jägern, egal ob sie am Boden oder über die Luft angriffen, war das Hasenjunge völlig schutzlos ausgeliefert. Dennoch wusste ich, dass ein Eingreifen des Menschen mehr Schaden anrichten konnte als Gutes bewirken, daher beschloss ich, der Natur ihren Lauf zu lassen. Ich beließ den kleinen Hasen dort, wo ich ihn gefunden hatte, in der Hoffnung, dass er, sobald ich fort war, ins hohe Gras huschen und bald wieder mit seiner Mutter vereint sein würde. Ich zählte noch schnell die Zaunpfähle, damit ich die Stelle später wiederfände, und setzte meinen Weg fort.
Als ich auf dem Rückweg vier Stunden darauf wieder vorbeikam, hatte ich den Hasen fast vergessen. Doch da saß er immer noch, mitten auf dem Weg, genau so, wie ich ihn zurückgelassen hatte. Er verfügte über keinerlei Deckung, Bussarde kreisten am Himmel über ihm und klagten wie verlorene Seelen. Ich zögerte, schließlich würde es noch einige Stunden hell sein. Besonders seltsam kam es mir vor, dass die Mutter noch nicht gekommen war, um ihr Junges zu holen. Das hätte sie doch, so dachte ich zumindest, längst tun müssen. Ich erwog auch, dass der Hund das Häschen möglicherweise verletzt haben könnte oder die Mutter getötet worden war. So oder so war klar: Die Gefahr, dass es überfahren, angegriffen oder gefressen würde, stieg mit jeder Minute, die es hier schutzlos auf dem Weg liegen blieb.
Immer noch unsicher, was ich tun sollte, beschloss ich letztendlich aus dem Bauch heraus, das Hasenjunge bis zum Einbruch der Nacht mit nach Hause zu nehmen, um es dann an die Stelle zurückzubringen, wo ich es gefunden hatte. Um es nicht mit den Händen anzufassen, rupfte ich einige Büschel abgestorbenes Gras vom Wegrand. Ich hockte mich zu dem Tier auf den Boden, wobei ich fast damit rechnete, dass es nun jede Sekunde flüchten würde, doch es machte keinen Mucks. Also nahm ich es mit je einer Hand an der Seite hoch und hob es, eingewickelt in das Gras, an meine Brust. So trug ich es die paar Hundert Meter zurück zum Haus und durch die Hintertür ins Innere.
Dort setzte ich das Hasenjunge behutsam auf der Arbeitsfläche ab, damit ich es auf Verletzungen untersuchen konnte. Ich nahm ein unbenutztes gelbes Staubtuch und schlug den Hasen darin ein, um sein Fell auch weiterhin nicht direkt zu berühren. Ich war erleichtert, als ich keine Spur einer Blutung oder einer Wunde entdeckte. Das Tier stemmte sich auf zitternden Vorderpfoten hoch, die nicht einmal halb so lang waren wie mein kleiner Finger und so dünn wie Bleistifte, und saß dann wackelig auf seinem Hinterteil, blinzelte und blähte die Nasenlöcher, wie um die seltsame Umgebung in sich aufzunehmen. Hier im Haus, wo jeder Gegenstand für den menschlichen Gebrauch gemacht war, wirkte der Hase sogar noch winziger als draußen auf dem Spazierweg. Dennoch schien er keine Angst zu haben und machte keine Anstalten, vor mir wegzulaufen. Sein Mund war eine kaum erkennbare schwarze Linie auf der Unterseite des runden, kleinen Kopfes, die an beiden Seiten ein wenig nach unten zeigte, als wäre das Leben für ihn jetzt schon eine milde Enttäuschung. Seine ebenholzschwarzen Augen trugen noch den milchig-lila Schleier vieler Neugeborener. Der Hase hatte kurze, steif abstehende Tasthaare, in spitzem Winkel gebeugte Hinterläufe und Hinterpfoten, die beinahe so lang waren wie der gesamte restliche Körper.
Ich rief einen Naturschützer aus der Gegend an, der früher Wildhüter gewesen war, um ihm alles zu erzählen und seinen Rat einzuholen. Mit meiner Idee, den kleinen Hasen ins Feld zurückzubringen, hatte er schnell aufgeräumt. Denn er meinte, dass die Mutter das Junge, wenn sie es denn wiederfände, sicher verstoßen würde, weil es, trotz all meiner Vorsichtsmaßnahmen, nun nach Mensch roch. Außerdem habe er in all den Jahrzehnten der Arbeit in der freien Natur noch nie gehört, dass jemand ein Hasenbaby erfolgreich aufgezogen hätte. »Sie müssen sich leider mit dem Gedanken abfinden, dass es wahrscheinlich verhungern wird, oder durch den Stress stirbt«, sagte er mitfühlend, aber ohne Umschweife. »Ich kenne Leute, die Dachse oder Füchse großgezogen haben, aber einen Feldhasen kann man nicht domestizieren.«
Ich war beschämt und durcheinander. Ich hatte ja gar nicht vorgehabt, den Hasen zu zähmen, ich wollte ihm nur einen sicheren Unterschlupf bieten, doch wie es aussah, hatte ich die Situation völlig falsch eingeschätzt. Ich hatte ein junges Tier aus seiner natürlichen Umgebung gerissen – vielleicht grundlos – ohne zu überlegen, ob und wie ich mich überhaupt darum kümmern konnte. Die Folge war, dass es nun wahrscheinlich sterben würde. Bei dem Gedanken wurde mir ganz schwer ums Herz.
Ich war mit meinen drei Geschwistern im Ausland aufgewachsen, da die Arbeit meine Eltern nach Übersee geführt hatte. In den Ferien fuhren wir heim nach England, um die Familie zu besuchen, und ich verbrachte die Sommer meiner Kindheit in unserem Haus auf dem Land. Meine Mutter hatte ein erstaunliches Gespür für Tiere, und ich erinnere mich noch gut daran, wie sie zu meiner großen Freude eine ganze Reihe von Igeln, Baby-Dohlen und einmal sogar einen Grünfink, den wir aus dem Schnabel einer Krähe gerettet hatten, gesund pflegte. Ich liebte diese Ferientage, doch nach meiner Schulzeit und dem Studium richtete sich mein Blick nach London und in die weite Welt.
In den Jahren, die folgten, rückte das Landleben in immer größere Entfernung. Der Puls meines Lebens schlug in der Stadt, wo mich die Welt der Politik und der Auslandsdiplomatie in ihren Bann zog. In meinem Job als Politikberaterin entwickelte ich Ideen und Strategien für öffentliche Personen, unterstützte sie dabei, ihre Gedanken in Worte zu fassen und stand in Krisensituationen neben ihnen in der Einsatzzentrale, gemeinsam mit einem eng vertrauten Stab aus ebenso hochmotivierten Menschen. Antoine de Saint-Exupéry, der Autor des Kleinen Prinzen, schrieb einmal: »Kameradschaft entsteht nur, wenn man an einem gemeinsamen Seil demselben Gipfel entgegenklettert«, womit er sehr treffend die Zielstrebigkeit beschrieb, die mich und meine Kollegen antrieb. Wenn es irgendwann zu einem Staatsstreich oder einer Revolution käme und alle anderen bereits geflohen wären, so scherzten wir manchmal, wären wir wohl die Letzten, die im Bunker unseres Vorgesetzten im Kugelhagel untergingen.
Wenn es in meinem Leben eine Sucht gab, dann die nach diesem Adrenalinschub, wenn es eine schwierige Situation oder eine Krise zu bewältigen gab. Und ich war süchtig nach Reisen, zu denen ich oft innerhalb weniger Stunden aufbrechen musste. Verbindliche Verabredungen, die mir die Flexibilität nahmen, einfach meine Tasche zu schnappen und loszufahren, versuchte ich zu umgehen. Was ich dadurch an Urlauben und Familienfeiern verpasste, machte ich nach meinem Empfinden mit unwiederbringlichen Abenteuern und dem Besuch von Teilen der Welt wieder wett, die ich ansonsten niemals gesehen hätte: Bamako, Bagdad, Kabul, Algier, Damaskus, Ulaanbaatar, Tallinn, Sarajevo oder Siem Reap. Am Wochenende und an Feiertagen zu arbeiten war für mich irgendwann ganz normal. Unter diesen Bedingungen ein Haustier zu halten, wäre grausam gewesen, und ich war auch gar nicht darauf eingestellt. Ich beschäftigte mich mit internationalen Krisen, die Menschen betrafen, und auf Tiere nur selten Rücksicht nahmen. Meine Zeit verbrachte ich in Büros, Konferenzräumen und an Flughäfen, außerdem würde ich mich nicht als besonders praktisch veranlagte Person bezeichnen. Das letzte Tier, um das ich mich gekümmert hatte, war eine weiße Maus namens Napoleon gewesen, die ich mit acht Jahren bekam und die ein böses Ende nahm, als unsere Hauskatze eines Tages, während ich in der Schule war, den Käfig umstieß und die Tür aufbekam. Was danach passierte, kann man sich denken.
Als mich die Fliehkraft der Pandemie aus meinem bisherigen Lebensmittelpunkt zurück aufs Land schleuderte und dort festnagelte, war ich innerlich zerrissen: Einerseits war ich mir über meine glückliche Lage im Klaren, andererseits empfand ich immense Rastlosigkeit und tiefe Zukunftsangst. Das veränderte Tempo machte mir sehr zu schaffen. Eine befreundete Kollegin hatte mich aufs Land begleitet, als das Büro dichtmachte. Rigoros behielten wir beide unseren Arbeitsrhythmus bei und planten unentwegt unsere Rückkehr in die City. Ein Babyhase hätte in keinem der Szenarios, die wir gemeinsam diskutierten oder die ich für mich anpeilte, einen Platz gefunden. Noch wenige Tage zuvor war ich allein spazieren gegangen und hatte mich unterwegs auf einen Stein an einem Bach gesetzt, der nicht größer als ein Rinnsal war. Die Stiefel steckten im klebrigen Schlamm, und die leblosen Bäume über mir hätten kaum trostloser sein können als die Gedanken in meinem Kopf, die sich allesamt darum drehten, wie es möglich war, dass sich mein Leben zu einem ebenso traurigen Dahintröpfeln verlangsamt hatte wie dieser Bach. Und nun stand ich unversehens über ein wildes Lebewesen gebeugt, das ich irgendwie füttern und am Leben erhalten musste.
Das Hasenjunge wartete geduldig, nichtsahnend, was mir durch den Kopf ging. Meine Freundin, die die ganze Szene mitverfolgte, fasste meine Zweifel in Worte: »Versteh mich nicht falsch, aber ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist«, begann sie. »Was willst du damit machen, wenn du zurück nach London gehst? Wäre es nicht besser, ihn jemand anderem zu geben? Jemandem, der sich mit Tieren auskennt?« Daran hatte ich auch schon gedacht, doch noch während sie sprach, regte sich meine Dickköpfigkeit. Ich kriege das schon hin.
Ich rief meine Schwester an, die einen kleinen Bauernhof besaß, und erzählte ihr die ganze Geschichte. Wie in aller Welt sollte ich ein wildes, vielleicht einen Tag altes Hasenbaby füttern? Sie räumte ein, über Feldhasen rein gar nichts zu wissen, ging aber davon aus, dass das Hasenjunge vermutlich laktosefreien Milchersatz brauchen würde, wie man ihn auch zur Flaschenaufzucht kleiner Kätzchen verwendete. Sie bot an, mir gleich am nächsten Morgen welchen zu besorgen. In der Zwischenzeit wollte sie mir etwas von dem Präparat vorbeibringen, das sie für die Flaschenfütterung von Lämmern verwendete. Sie setzte sich sogleich ins Auto und brachte mir einen riesigen, ziemlich schlammigen und zerbeulten Eimer mit Deckel, in dem sich Trockenmilch befand, und einen Kanister Desinfektionsmittel.
Mit gespielter Selbstsicherheit hob ich den Deckel von dem Eimer und prüfte das darin aufgehäufte gelbe Pulver, das nach meinem Ermessen für eine ganze Schafherde reichen musste. Als ersten Schritt musste ich die richtige Dosierung von Milch und Wasser ausrechnen, die ich für ein Wesen, das nur den Bruchteil des allerkleinsten Lammes wog, benötigen würde. Dazu musste ich das Hasenjunge erst wiegen. Es zeigte keine Spur von Angst, als ich es aufhob und in der Schale meiner Küchenwaage absetzte. Eingewickelt in sein Tuch wog der Hase einhundert Gramm – weniger als ein Apfel.
Ich verrührte das Pulver mit Wasser und füllte das Gemisch in eine kleine Kosmetikflasche mit Pipette und Verschluss, die ich zuvor auseinandergenommen und mehrmals gewaschen, desinfiziert und sorgfältig auf Rückstände untersucht hatte, wissend, wie ungeeignet sie eigentlich war. Danach stellte ich sie einige Minuten lang in eine Tasse mit kochendem Wasser, drückte ein paar Tropfen des Inhalts auf die Innenseite meines Handgelenks, um die Temperatur zu prüfen, hob anschließend das Hasenjunge hoch und hielt es vorsichtig an meine Brust. Es war warm und weich und beinahe gewichtslos, so klein, dass es problemlos in die Mulde meiner Hand passte. Durch den Stoff konnte ich die Form seiner Pfoten spüren.
Ich drehte den kleinen Hasen ein wenig zu mir nach oben, damit ich die winzige Öffnung seines Mundes leichter finden konnte, dann schob ich die Pipette hinein und drückte ein paar Tropfen Milch heraus. Der Hase schluckte und blinzelte. Der Großteil der Flüssigkeit sammelte sich jedoch erst unter seinem Kinn und lief dann weiter in sein Fell und in das Staubtuch. Hatte er einen ordentlichen Schluck getrunken? Ich war nicht sicher. Ich wiederholte den Vorgang, bis der Hase die Augen zumachte und in meiner Hand eindöste.
Ich trug ihn durch den Flur in das Zimmer, das ich als Büro benutzte und setzte ihn dort auf dem Teppich ab, damit ich mich an den Schreibtisch setzen und nach Informationen über die Aufzucht von Feldhasen suchen konnte. Wie sich herausstellte, gab es online unendlich viele gute Tipps zum Thema Kaninchen, aber so gut wie gar nichts über Feldhasen, von allgemeinen Tierprofilen einmal abgesehen. Sich selbst überlassen tapste der kleine Hase inzwischen auf dem Boden umher. Jedes Mal, wenn er versuchte, sich aus einer waagerechten Position aufzurichten, rutschten seine Hinterbeine seitlich weg und er landete auf dem Bauch. Er taumelte in seiner Ecke des Zimmers umher, kippte oft dramatisch zur Seite und fiel gelegentlich auf die Nase.
In meiner Angst, er könnte bereits krank sein (man hatte mich schließlich gewarnt), rief ich meine Schwester an und schlug vor, sie solle sich doch bitte um den kleinen Hasen kümmern. Ich hatte einfach kein Vertrauen in meine Fähigkeiten und mir graute vor der Vorstellung, für seinen Tod verantwortlich zu sein. Im Gegensatz zu mir hatte meine Schwester den Großteil ihres Lebens auf dem Land verbracht. Die Ausbildung als Intensivkrankenschwester und ihr von Haus aus robuster Charakter hatten sie so widerstandsfähig gemacht, dass weder Mensch noch Tier sie aus der Bahn werfen konnten. So rettete sie einem verunfallten Biker mit der gleichen Souveränität das Leben wie sie einem Mutterschaf half, ihr Lamm auf die Welt zu bringen. Für unsere gesamte Familie ist sie bis heute die erste Anlaufstelle bei medizinischen Notfällen. Ich hingegen bin zimperlich, wenn ich Blut sehe und kann weder mit Krankheiten oder anderen Widrigkeiten des Lebens gut umgehen. Ich bevorzuge es – oder hoffe zumindest darauf –, sämtliche leidvollen Erfahrungen auf Abstand zu halten.
»Ich bin nicht die Richtige dafür«, erklärte ich ihr. »Ich weiß nicht, was ich tue. Ich werde es noch aus Versehen umbringen!« Ihre Antwort bestand daraus, all die Tiere aufzuzählen, die bereits unter ihrem Dach lebten – zwei Katzen, zwei Hütehunde, ein Welpe, mehrere frisch geschlüpfte Perlhühner, einige elternlose Lämmer und zwei Pfauenküken – und die Kakophonie an Tiergeräuschen zu beschreiben, die diese erzeugten. Ihr Haus sei demnach eine gänzlich ungeeignete Umgebung für einen Babyhasen. Ich verstummte. »Du machst das schon«, munterte sie mich noch auf, ehe sie auflegte.
Als der Abend langsam dämmerte, durchforstete ich sämtliche Schränke auf der Suche nach einer geeigneten Schuhschachtel, die dem Hasen als Übergangswohnung dienen konnte, anschließend ging ich noch einmal nach draußen, um mehr Gras vom Wegrand zu sammeln, weil ich annahm, dass es ihm als Einstreu am vertrautesten sein musste. Das Gras, das ich bis zu diesem Zeitpunkt kaum wahrgenommen hatte, stand hüfthoch. Die langen Halme, die im Sommer getrocknet waren, bogen sich unter dem Gewicht der gefiederten Samenstände und neigten sich in die dominante Windrichtung wie eine im Herabstürzen erstarrte Welle. Ich schnitt einen Armvoll ab, trocknete das Gras zu Hause am Feuer und legte schließlich den Boden und die Seitenwände der Schuhschachtel damit aus, bevor ich den Hasen in sein improvisiertes Nest setzte. Oben ließ ich die Schachtel offen und legte als Deckelersatz nur ein Büschel langer Grashalme darauf, dann stellte ich sie auf die beheizten Bodenfliesen im hinteren Teil des Hauses. Ich beugte mich hinunter und sah dem Hasen noch ein Weilchen zu, um sicherzugehen, dass er nicht hungrig oder durstig war, fror oder Angst hatte. Doch er saß ruhig da, die Pfoten nach vorne ausgestreckt und die Ohren eng zu beiden Seiten der Wirbelsäule angelegt. Seine dunklen Augen verrieten keine Regung. Ich wünschte mir inständig, dass er überleben würde, knipste das Licht aus und ging zu Bett.
Während ich die Treppe hinaufging, musste ich an den Hahn denken, der einmal bei uns zu Hause lebte, als ich noch ein Kind war: Er hieß Charlie, war wild, dickköpfig und ein geselliger Kerl. Als er krank wurde, brachten meine Eltern mich und meine Geschwister fort, damit wir sein Ende nicht mit ansehen mussten. Doch als niemand hinsah, schlich ich auf Zehenspitzen durch den Flur zu ihm zurück, weil ich dachte, ihm helfen zu können. Ich erschrak jedoch, als er mit trüb werdenden Augen entkräftet auf den dünnen, schuppigen Beinchen wankte, mit dem Schnabel verzweifelt nach Luft schnappte und seinen letzten Atemzug tat. Der stolze, zänkische Vogel, den ich so geliebt hatte, war tot und ich erahnte zum ersten Mal die Existenz eines Mysteriums, das mein kindlicher Geist noch nicht in der Lage war, zu fassen. Nun befürchtete ich, am nächsten Morgen den schlaffen, leblosen Körper des kleinen Hasen vorzufinden und haderte erneut mit meiner Entscheidung, ihn mitgenommen zu haben. Ich fragte mich, ob seine Mutter wohl draußen im Feld nach ihm suchte, die Brust schwer vor Muttermilch, und schlief mit sorgenvollem Herzen ein.
2.
Erste Bande
Alle sind sie wild; der Hase in den Feuchtwiesen, der Hase auf dem Kleehügel und der Hase droben in den kalten Bergen, wild wie der Ruf des Kiebitzes und der wehmütige, einsame Flug des Reihers.
Ian Niall, The Poacher’s Handbook, 1950
Im frühen Morgenlicht eilte ich mit einem mulmigen Gefühl im Bauch die Treppe hinunter und stellte fest, dass sich der kleine Hase im Gras ein Nest gebaut hatte, kaum größer als er selbst. Als ich mich neben ihn setzte, reckte er seine winzigen Ohren in die Höhe, als wäre er nun bereit für die Welt.
Meine Schwester hatte mir wie versprochen schon einen Behälter Milchpulver für Kätzchen besorgt, zusammen mit einer 50-ml-Flasche, die sich laut Packungsbeschreibung für »Kätzchen, Hundewelpen, Kaninchen und Igel« eignete. Wie ich feststellen musste, stand da kein Wort von Hasen.
Ich wusch mir die Hände, sterilisierte die Flasche und bereitete alles vor, um den Hasen ein zweites Mal zu füttern. Ich hatte bereits das schwarze T-Shirt übergezogen, das ich am Tag zuvor getragen hatte, in der Hoffnung, dass es vertraut roch, und hielt den Hasen locker in dasselbe Staubtuch gewickelt. Mein Herz schlug höher, als er etwa einen Teelöffel voll Milch zu sich nahm. Entgegen meinen Erwartungen war er am Leben, und er trank seine Milch. Später saß ich still da, wie gebannt von der kleinen, warmen Kreatur auf meinem Schoß. Es war ein ruhiger, geräuschloser Morgen, und ein kleiner Hase schmiegte sich an meinen Bauch.
Mein Haus ist eine niedrige, aus Stein gemauerte Scheune, die in einer Senke zwischen drei aneinandergrenzenden Feldern steht. Das Land ringsum, das von verschiedenen Familien bewirtschaftet wird, ist dicht bestellt mit Weizen und anderem Getreide, mit Ausnahme eines Waldes unmittelbar hinter dem Haus. Von diesem Wald und einigen alleinstehenden Eichen abgesehen, die in weit entfernten Hecken stehen, gibt es hier nur wenige Bäume, unter denen man Schutz suchen könnte. Das Land ist offen, aber keineswegs flach. Es hebt und senkt sich, mit sanften Hügeln, Buckeln, steilen Böschungen, gut getarnten Gräben und sumpfigen Wiesenstücken. Der Himmel hängt tief und der Wind bläst kräftig. Überall fließt unterirdisch Wasser und tritt in prustenden, gurgelnden Bächen zutage, die sich durch ein Band aus niedrigen Holunder-, Weiden- und Birkenzweigen schlängeln, eilig im Winter und gemächlich im Sommer.
Aus der Vogelperspektive ist die alte Scheune kaum zu erkennen, wie sie dort inmitten dieser Patchworkdecke aus dunklen Wäldern, stillen Feldern und Wegen liegt, mit ihren Mauern aus grobgehauenen, grauen Steinen, die aus einem Steinbruch in der Nähe stammen oder auf den umliegenden Feldern gesammelt wurden. Auf Landkarten aus dem 18. Jahrhundert ist sie bereits verzeichnet, sie könnte aber auch noch älter sein. Nichts an ihrer Bauweise oder ihrer ursprünglichen Nutzung ist von nennenswerter Bedeutung: Sie wurde für die Separierung und Inspektion von Schafherden gebraucht, für die Lagerung des handgeschnittenen Heus für die Winterfütterung und als Unterschlupf für kranke Lämmer. Zu diesen Zwecken wurde ein dreiseitiges, niedriges Gebäude errichtet, das ungefähr die Form eines Hufeisens hatte und von einer Mauer umschlossen war, wodurch ein verschließbarer Schafpferch entstand, in den man die Tiere treiben konnte.
Als ich das heruntergekommene Haus kaufte, begriff ich es als eine Art Zukunftsprojekt, auf das ich bei Bedarf zurückgreifen konnte, denn so interessant und spannend mein Job auch war, so unbeständig und anfällig zeigte er sich im Falle von politischen Richtungswechseln. Als ich das Haus übernahm, war es eine Ruine: Es stand voller Brennnesseln, überall lagen herabgestürzte Balken und mittendurch pfiff der Wind, der ohne Unterlass durch dieses einst von einem Eiszeitgletscher ausgeschabte Tal peitscht. Um die Scheune bewohnbar zu machen, mussten die eingestürzten Wände neu aufgebaut, isoliert und verfugt werden, neue Dachbalken und Verstrebungen angebracht und das gesamte Dach neu gedeckt werden. Nach mehreren Jahren ist auf diese Weise ein einstöckiges Haus entstanden, das nur auf einer Seite – in der Mansarde unter dem Dach, wo früher das Heu aufbewahrt wurde – ein kleines Schlafzimmer beherbergt, von dem man talaufwärts dem Wind entgegenblickt. Nach Abschluss der Bauarbeiten kam ich meist nur für wenige Tage am Stück hierher, schließlich musste ich stets in der Nähe meiner Arbeit in der Stadt bleiben.
Direkt vor dem Haus, wo sich früher der Schafpferch befand, liegt ein kleiner, von der alten Steinmauer abgegrenzter, innerer Garten. Dahinter verläuft rundum ein wieder nutzbar gemachter Wiesenstreifen, der heute den Hauptgarten darstellt und von der Umgebung durch eine Mischung aus Trockenmauer, Lattenzaun und Kaninchengitter abgetrennt ist. Entlang führt eine Hecke, die als Windfang dient.
Nachdem der kleine Hase die Nacht überlebt hatte, musste ich ihm nun ein Zuhause schaffen, das dauerhafter war als der Platz am Hinterausgang. Ich brachte ihn in ein leerstehendes Schlafzimmer ganz hinten in der Scheune, wo er weitgehend ungestört war. Der Raum hatte einen Ausgang, der in den inneren Garten führte, so konnte ich ihn bedenkenlos ins Freie lassen. Ich schnitt ein Loch in eine Seite der Schuhschachtel, damit der Hase ein- und ausgehen konnte, wie es ihm beliebte.
In der Zwischenzeit hatte ich eine Website gefunden, die sich mit dem Schutz von Feldhasen befasste und Ratschläge zur Aufzucht der Tiere gab. Dort las ich zum Beispiel, dass ein Feldhasenjunges in der freien Natur nur einmal am Tag von der Mutter gesäugt wird. Ich hingegen solle ihm dreimal am Tag zu trinken geben, um die Chancen zu erhöhen, dass es genug Milch zu sich nahm, auch wenn das möglicherweise nicht von Anfang an klappte. Feldhasen werden mit je zwei gebogenen Nagezähnen im Ober- und Unterkiefer geboren, die ganz vorne im Maul liegen. Die Zähne stoßen in der Mitte zusammen und bilden eine unüberwindbare Barriere, wenn der Hase das Gebiss geschlossen hält. Hat das Hasenjunge Angst, presst es den Kiefer fest zu und verweigert das Trinken, selbst wenn das für ihn bedeuten würde, zu verhungern. Daher solle man die Flasche beim Füttern am unteren Mundwinkel positionieren und alles daransetzen, das Junge nicht zu erschrecken, zumal die häufigste Todesursache bei Feldhasen in Gefangenschaft Stress durch Lärm oder zu häufige Störungen sei. Doch auch das andere Extrem, nämlich dass der Hase an der Milch erstickt oder zu viel davon schluckt und eine Aspirationspneumonie entwickelt, sei eine Gefahr, die es zu beachten gelte. Nach etwa acht Wochen, wenn der Hase entwöhnt sei und feste Nahrung zu sich nehmen könne, solle er wieder in die freie Natur entlassen werden. Bis dahin sei es für ihn lebensnotwendig, in einer möglichst ruhigen Umgebung zu leben, außerdem solle ihn außer mir niemand sonst berühren.
Ich horchte hinaus in die Natur. Es war so still, dass man hören konnte, wie der Wind verspielt über die Ebene sauste und mit einem Brausen in den Wald hineinfuhr; so still, dass man die Rufe einzelner Vögel erkennen konnte, sobald der Wind abflaute. Es war eine Klanglandschaft aus Himmel, Wald und Erde, nicht jenes künstliche Lärmen und Poltern einer menschlichen Behausung. Und so beschloss ich, von nun an viel achtsamer zu sein, wenn ich mit Töpfen klapperte, Wasserhähne aufrauschen ließ oder die Stimme erhob, und darauf Rücksicht zu nehmen, wie laut diese Geräusche wohl für den kleinen Hasen klingen mussten.
Meist war das Hasenjunge mucksmäuschenstill. Doch als es ein paar Tage alt war, begann es, einen zarten, kaum hörbaren Laut von sich zu geben, wenn es in meiner Nähe war oder das Zimmer erforschte: tschip-tschip





























