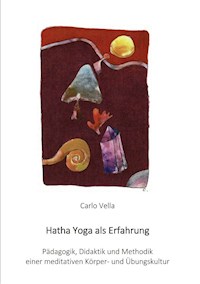
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Hatha-Yoga als Erfahrung
Das E-Book Hatha Yoga als Erfahrung wird angeboten von tredition und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Yoga, Erfahrung, Vella, Hatha, Meditativen, Übungskultur, Pädagogik, Didaktik, Methodik, Körper
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Carlo Vella
Hatha Yoga als Erfahrung
Pädagogik, Didaktik und Methodik einer meditativen Körper- und Übungskultur
Was ist der Sinn unseres Lebens?
Diese zentrale Frage weht durch die Seiten dieses vorliegenden Buches. Und eine wesentliche Antwort – neben vielen andern – heisst: mehr Achtsamkeit und über die daraus wachsende erhöhte Bewusstheit, uns, dem Mitmenschen, der Welt gegenüber. Ein Weg der Verinnerlichung ist angezeigt.
Doch dieser Weg ist nicht einfach zu gehen. Wir leben mitten in einer Welt der rastlosen Aktivitäten, der Reiz- und Informationsüberflutung, der Verunsicherung durch viele globalisierende Tendenzen. Die veräusserlichenden Tendenzen sind gross. Unsere Integrität ist gefährdet. Eine existenziell bedeutsame Frage kann in uns wach werden: Wer bin ich eigentlich?
Hatha Yoga als Erfahrung- zentrales Anliegen dieses Buches – versucht über eine meditative Körper- und Übungskultur einen gangbaren Weg der Verinnerlichung aufzuzeigen. Der Autor schildert aufgrund seiner langjährigen, persönlichen hathayogischen Praxis und seiner Lehrerfahrung einen Übungsweg, der nachhaltige Wirkungen hervorbringen kann. Er wendet sich in seinen Ausführungen vorwiegend an Yogalehrende, dies im Wissen, dass nur über einen qualitativ differenzierten, didaktisch und methodisch wohlgestatteten Unterricht entwicklungsstarke Impulse hervorgehen können. Dabei spielen gezielte Verinnerlichungsimpulse eine entscheidende Rolle. Diese lassen innere Wahrnehmungsorte beim Üben zu Lernorten werden. Es formen sich dabei geistige Qualtäten aus, wie Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Konzentration und Selbstwahrnehmung. Hatha Yoga kann auf diese Weise sein eigentliches Potenzial entfalten.
Vom Lehrenden gehen die entscheidenden Impulse aus. Setzt sie der Lernende um, übt er regelmässig 20-30 Minuten in einer täglichen Auszeit in seinem hathayogischen Lerngärtchen, werden nachhaltige Wirkungen nicht ausbleiben. Er findet zurück zu sich selbst.
Hinweise zum Umschlagbild
Im Bild «Evolution» wird eine dynamische Entwicklung angedeutet – eine Entfaltung von mineralischen zu pflanzlichen, tierischen, menschlichen und mystisch-religiösen Sphären. In den hathayogischen Stellungen spiegelt sich dieses evolutionäre Werden in eindrücklicher Weise: Berg – Baum – Kobra – Tänzer – Sphinx… Diese Tatsache bringt die tiefe Verflochtenheit hathayogischer Stellungen mit unseren menschlich-existenziellen Quellen zum Ausdruck. Wir werden an das uralte Netzwerk des Lebens erinnert. Unsere Verbundenheit mit allem kann dadurch neue Impulse erfahren.
© 2021 Carlo Vella
Illustriert von: Carlo Vella
Satz & Layout: Aimen Mokdad
ISBN Softcover: 978-3-347-49721-4
ISBN Hardcover: 978-3-347-59449-4
ISBN E-Book: 978-3-347-59450-0
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig.
Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Lob der Fülle
Fülle ist Ausdruck von Vielfalt, Reichtum und einem unermesslichen Potential. All das finden wir in uns. All das sind wir selbst.
Unser Universum ist Ausdruck einer kaum fassbaren, unermesslichen Fülle. Milliarden von Sternen – alles Sonnen – erzählen von diesem Reichtum. Fülle zeigt sich in den unzählbaren Schöpfungen der Evolution. Fülle offenbart sich in der Natur und in all ihren vielfältigen Erscheinungen. Fülle liegt als unermessliches Potential in den raum- und zeitlosen, spirituell-seelischen Bereichen, im Potenzial des universellen Bewusstseins.
Wir Menschen selbst sind evolutionäre Wunder der Fülle. Wir spiegeln in uns das ganze Universum und die Entfaltung allen Seins. In uns schlummern alle Kräfte der galaktischen Entwicklung. In unserem Körper, in unseren Zellen und Genen lebt das gesamte irdische Erfahrungspotenzial kollektiver und individueller Natur aus der Urzeit bis heute. Wir spiegeln in uns alle Stufen der Entfaltung des Lebens. Wir verkörpern diese unfassbare Fülle – wir sind diese Fülle.
Wenn es einen Bereich gibt, der diesen Facettenreichtum zum Klingen bringen kann, ist es die Praxis des Hatha Yoga als meditative Körperkultur. Alles, was wir sind und in uns als Reichtum lebt, kann im Rahmen dieses hathayogischen Erfahrungs- und Lernfeldes geweckt, erlebt und erfahren werden. Die hathayogischen Übungen, ein Übungsangebot ganz eigener Prägung, bewegen und beleben unseren Körper, unsere Systeme und unsere Organe. Die meditative Übungspraxis bringt uns auch mit anderen Aspekten unserer Verkörperung in Berührung. Bereiche unserer Psyche, Gedanken- und Gefühlswelt werden uns bewusst gemacht. Lebenswichtige Themen rücken in unseren Fokus. Existentiell bedeutsame Kompetenzen werden kultiviert. Prozesse kommen in Gang. Entwicklungen geschehen. Sternstunden sind möglich. Wir finden Kontakt zu unserer wahren Wirklichkeit, zu unseren vielschichtigen inneren Welten und können zur tiefen Erkenntnis gelangen, dass wir von seelisch-spirituellen, non-dualen, alles durchwebenden, alles erhaltenden Energiefeldern getragen sind.
Die hier vorliegende Pädagogik, Didaktik und Methodik einer meditativen Körper- und Übungskultur zeigt Möglichkeiten auf, wie die Erfahrung der Fülle über eine kreative, anregende und vielfältige Unterrichtsgestaltung möglich wird. Der Körper steht dabei nicht im Zentrum. Er ist jedoch das entscheidende Medium, über das wir übend, erfahrend und lernend einen neuen Zugang zu unseren geistigen und seelischen Lebensbereichen finden können. Vieles werden wir erkennen. Doch letztlich werden wir uns selbst immer ein Geheimnis bleiben.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1. Yogaunterricht – ein Lern- und Erfahrungsfeld ganz besonderer Art
2. Überreicher Schatz an Übungen
3. Hatha Yoga als existentiell bedeutsames, kompetenzorientiertes Lern- und Erfahrungsfeld
4. Hatha Yoga als entwicklungs- und prozessorientiertes Lern- und Erfahrungsfeld
5. Unterrichtliches Geschehen im Rahmen einer aussergewöhlichen Lernkultur
6. Verinnerlichung als hathayogisches Prinzip
7. Lob des Körpers – ein Manifest
8. Verkörperung als Verheissung erleben
9. Praktische Übungsbeispiele
Übung 1: Knie- und Hüftgelenkübung
Übung 2: Die Kleine Brücke – klein, aber fein
Übung 3: Die Sphinx – einfache, leichte Rückbeuge aus der Bauchlage
Übung 4: Vorbeuge aus dem Stand
Übung 5: Heldinnen-Helden-Stellung
Übung 6: Der Baum
Übung 7: Rotation im Sitzen
Übung 8: Atem- und Atemachtsamkeitsbereiche
Übung 9: Salutogenetisch-meditative Übung
Übung 10: Schlussmeditation “still werden – still sein”
10. Yoga und Alltag
Schlussbemerkungen
Danksagung
Anhang
Leitbild für Yogalehrende
Unterrichtskomplex “Hatha Yoga”
Gestaltung von Yogalektionen
Literaturverzeichnis
Vorwort
In dieser Publikation möchte ich Möglichkeiten aufzeigen, um im gegenwärtigen komplexen Umfeld die eigene Integrität wahren zu können. Im Zentrum steht dabei "Hatha Yoga als Erfahrung". Darin zeichnet sich ein grundlegendes Konzept ab: Verinnerlichung als Überlebenspraxis.
Die meisten Menschen werden im Verlauf ihres Lebens mit Situationen konfrontiert, die sehr belastend sein können: mit Lebensumbrüchen, körperlichen Beschwerden, ausserordentlichen Beanspruchungen im Berufs- und Beziehungsfeld. Auch ich blieb von solchen Ereignissen nicht verschont. Eine langjährige Migräne zwang mich, geeignete therapeutische Hilfen in Anspruch zu nehmen. Eine Midlife-Crisis führte mich dazu, meine bisherige Lebensweise zu hinterfragen und nach einer modifizierten Lebensgestaltung zu suchen. Dies war angesichts des Lebensumfeldes, in das ich eingewoben war, nicht einfach. Als nun Achtzigjähriger habe ich die gewaltigen Umwälzungen entscheidender Phasen des 20. und 21. Jahrhunderts eindrücklich miterlebt. Technisierung, Digitalisierung und Globalisierung sind nicht spurlos an mir vorbeigezogen. Im Gegenteil, ich fühlte mich dabei oft verunsichert, dem rasanten Wandel nicht gewachsen und den vielen fremdbestimmenden und einnehmenden Faktoren ausgeliefert. Dieses Ausgeliefert-Sein verstärkte in mir den Wunsch – inmitten dieses hektischen, reizüberfluteten und veräusserlichenden Umfeldes – nach einem Ort des inneren Rückzugs und der Stille zu suchen. Ich fand diese rettende Insel in der Praxis des Hatha Yoga. In der geschützten Übungszone und meditativen Oase konnte ich gegenüber der Wucht der Medien, dem atemraubenden Rhythmus des Alltags und der zunehmenden Polarisierung in vielen Bereichen der Gesellschaft und Politik wohltuende Distanz gewinnen. Dabei entwickelte sich im Verlauf der Übungsjahre eine ganz speziell akzentuierte hathayogische Praxis, der ich die Bezeichnung «Hatha Yoga als Erfahrung» gab. Es ist eine Übungsweise, die in ihrer Grundtendenz einer betonten Verinnerlichungsspur folgt und ganz bewusst eine innere Entwicklung anstrebt. Das Konzept dieser Unterrichtspraxis ist nicht neu. Es hat lediglich aufgrund meiner Erfahrungen eine spezifisch persönliche Ausformung erhalten. Dabei spielten die vielfältigsten Impulsbereiche eine Rolle. Zentral war meine jahrzehntelange Lehrtätigkeit auf allen Stufen im Bereich des Fremdsprachenunterrichts und als Dozent für Fremdsprachendidaktik. Stark beeinflusst und geformt haben mich die ersten Yogakontakte im Umfeld des bekannten Yogalehrers Selvarajan Yesudian in Zürich, meine ersten Yogalehrerinnen und -lehrer ganz unterschiedlicher Richtungen und meine Yogalehrerausbildung, die ich genau im Zeitpunkt meiner beruflichen Pensionierung abschloss. Eine grosse Bereicherung bildete das anschliessende Engagement als Yogalehrer mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen wie Strafgefangene, Menschen mit einer Hörbeeinträchtigung, Blinde und ältere Menschen.
Die Publikation richtet sich an Yogalehrende, die in ähnlicher Weise wie ich Lebens- und Übungserfahrungen machen durften und ihr unterrichtliches Wissen vertiefen möchten. Sie alle wissen, dass es keine Rezepte gibt und dass sie in ganz eigener Weise teilnehmerbezogen ihre hathayogische Vision umzusetzen versuchen.
Einleitung
In der vorliegenden Publikation versuche ich auf zentrale Fragen der Gestaltung eines zeitgemässen Yogaunterrichts angemessene Antworten zu geben. Dabei wird dem Aspekt der Fülle – in welcher Form auch immer – eine ganz besondere Beachtung geschenkt werden. Bei der hier beschriebenen hathayogischen Praxis liegt der Fokus akzentuiert auf Erfahrungen aus erster Hand. Neben dem Erleben der körperlichen Wirkungen beim Yoga Üben nimmt das Kultivieren und Entwickeln existenziell bedeutsamer Kompetenzen einen bedeutsamen Platz ein. Gemeint sind z. B. das Wahrnehmungsvermögen, Körper- und Atembewusstsein, Konzentration und Achtsamkeit. Die Kompetenzentwicklung basiert auf einer ganz spezifischen Übungsweise, welche der Verinnerlichung einen hohen Stellenwert einräumt. Das so gestaltete Unterrichtsgeschehen weist daher eine eher sanfte, langsame und meditative Prägung auf. Entsprechend gestalten sich die Übungsanleitungen. In diese werden neben den üblichen Anleitungselementen ganz bewusst vermehrt verinnerlichende Impulse eingewoben. Der Aufbau der Publikation spiegelt in einem gewissen Sinne meine Interessen und mein Engagement aus meiner früheren Lehrtätigkeit. Es war mir als Lehrender schon immer ein ganz wichtiges Anliegen, meinen Unterricht durch geeignete Massnahmen zu optimieren und wirksamer zu gestalten. So habe ich die fremdsprachdidaktische Konstellation sinngemäss in die Bereiche des Yogaunterrichts übertragen, Akzente neu gesetzt und den yogaunterrichtlichen Gegebenheiten angepasst.
Die Ausführungen zeigen daher folgende Aufbaustruktur: Darstellung der Vielfalt und Verflechtung aller im hathayogischen Unterrichtsfeld bedeutsamen Aspekte, spezifische Ziele und Inhalte des Yogaunterrichts und das kompetenz- und entwicklungsorientierte Lernkonzept einer erfahrungsbezogenen Yogapraxis. Der Reichtum hathayogischer Übungen wird anhand von Beispielen anschaulich aufgezeigt. Dabei wird eindrücklich darauf hingewiesen, dass Yogaübungen in sich das Potenzial von Lernmedien tragen. Wir lernen, die Übungen auszuführen, doch gleichzeitig kultivieren wir dabei auch Übungsqualitäten wie z. B. Achtsamkeit, Hingabe und Selbstvergessenheit. Wir lassen die Übungen zu uns sprechen. Sie berühren und formen uns. Diesem Aspekt sind die Ausführungen zum Prozesshaften im yogischen Lernbereich gewidmet. Es wird anschaulich am Phänomen des «Kuchenbackens» und an einem einfachen Übungsbeispiel dargestellt. Ein begrenzter geschichtlicher Exkurs erläutert, wie sich der Yoga-Modus mit dem Hatha-Yoga-Modus verflochten hat und sich daraus auch eine meditativ akzentuierte hathayogische Körper- und Übungskultur ableiten lässt. Um unserem Körper und unserer Verkörperung die ihnen gebührende Referenz zu erweisen, sind diesen Bereichen eigene Kapitel gewidmet. Bei allen didaktisch -methodischen Exkursen wird darauf hingewiesen, dass die Lernenden immer in ihrer Ganzheit angesprochen werden sollen. Körper, Psyche und die seelisch-spirituellen Seins-Aspekte bilden eine unzertrennliche Einheit. Der personenzentrierte Ansatz zeigt sich daher als tragendes Leitmotiv in allen unterrichtlichen Belangen. Das zentrale Kapitel9. veranschaulicht anhand praktischer Übungsbeispiele, wie die Prinzipien eines verinnerlichenden Yogaunterrichts umgesetzt werden können. Von besonderer Bedeutung sind die Ausführungen in Bezug auf das «hathayogische Lerngärtchen» und die Thematik «Yoga und Alltag». Hier wird deutlich, wie entscheidend für unser Leben ein regelmässiger, täglicher Rückzug in die Stille und Ruhe sein kann.
Am Ende jedes Kapitels finden sich unter der Rubrik «Persönliches» Ereignisse und Erfahrungen aus meinem Leben, meiner eigenen Yogapraxis und als Yogalehrer. Dem schliesst sich eine kurze Zusammenfassung des Kapitelinhalts an. Dabei wird immer auch die spezifische Funktion der Yogalehrenden in Bezug auf den im Kapitel beschriebenen Unterrichtsaspekt differenziert aufgezeigt. Zu erwähnen bleiben die Illustrationen. Ich habe auf farbige, perfekte Bilder bewusst verzichtet. Dafür habe ich versucht, mit eigenen Punktbildern die Publikation zu bereichern. Mit dieser Darstellungsweise will ich einen wichtigen Grundzug des vorliegenden Konzeptes untermalen: Die Form ist weniger bedeutsam als der Inhalt. Alles Seiende wird von spezifischen Energiefeldern getragen. Es sind diese Energiefelder, die uns auch yogaübend berühren und verwandeln können. Eine weitere Bereicherung stellen die da und dort eingeflochtenen, meditativen Texteingaben dar. Sie sind ein Geschenk meiner verinnerlichenden Bemühungen. Sie beinhalten erstaunlich tiefgründige, an mich gerichtete Aussagen aus dem kollektiven, weisen Hintergrund, mit dem wir alle verbunden sind. Ich bin überzeugt, dass in einer meditativen Körper- und Übungskultur, wie sie «Hatha Yoga als Erfahrung» aufzeigt, viele wertvolle Entwicklungsmöglichkeiten schlummern. Ohne Hatha Yoga als generellen Hoffnungsträger betrachten zu wollen, erkenne ich darin viele Vorteile. Ich habe neben vielen heilsamen körperlichen Wirkungen vor allem auch entscheidende innere Entwicklungen erfahren dürfen. Eine differenzierte und achtsame Selbstwahrnehmung bildete die Grundlage, dass sich meine Beziehung zur Welt und den Menschen gegenüber spürbar zum Positiven wandelte.
1 Yogaunterricht – ein Lern- und Erfahrungsfeld ganz besonderer Art
Kapitelinhalt:
• die primäre Bedeutung der personalen Ebene: Yogalernende - Yogalehrende
• die personalen und didaktischen Aspekte des Yogaunterrichts
• die gegenseitige Verflechtung der einzelnen Faktoren
Yogaunterricht im Spannungsfeld personaler und didaktischmethodischer Gegebenheiten
Jedes Unterrichtsgeschehen – auch Yogaunterricht – erweist sich als ein reichhaltiges, vielfältiges Interaktionsfeld. Die wesentlichen Schwerpunkte jedes unterrichtlichen Geschehens sind personaler und didaktisch-methodischer Natur. Die einzelnen Faktoren spielen bei der Planung, beim Aufbau, der Durchführung und Auswertung des Yogaunterrichts eine entscheidende Rolle. Jeder Faktor hat dabei seine spezifische Bedeutung und steht mit jedem anderen Faktor des Unterrichtsfeldes in Interdependenz (siehe Abb. 1). Die Verflechtungen sind dynamischer Natur. Die einzelnen Faktoren bestimmen, beeinflussen und befruchten sich wechselseitig. Der harmonische Einbezug all dieser komplementären Faktoren des gesamten Bezugsfeldes führt zu einer optimalen Gestaltung des Yogaunterrichts.
Das wohl entscheidende Stichwort inmitten aller einwirkenden Unterrichtskomponenten ist in der didaktischmethodischen Ebene unter den Unterrichtsprinzipien zu finden: Teilnehmerorientierung. Yogalehrende gestalten ihren Unterricht differenziert in Bezug auf die am unterrichtlichen Geschehen Beteiligten. Yogaunterricht ist für die Beteiligten da und nicht umgekehrt!
Erste Priorität hat daher immer die personale Ebene: die Lernenden und die Lehrenden. Pädagogische und psychologische Gegebenheiten stehen dabei im Vordergrund. Die Beachtung der Prinzipien der Erwachsenenbildung und eine liebevolle zwischenmenschliche Kommunikation wirken sich auf die Lernatmosphäre in entscheidender Weise aus. Didaktisch-methodische Aspekte sind eng mit der personalen Ebene verbunden, dieser jedoch untergeordnet. Auf diesen Grundlagen aufbauend, ist die Chance gross, dass die Lernenden den Yogaunterricht als ein fruchtbares Lern- und Erfahrungsfeld erleben.
Zentraler yogaunterrichtlicher Fokus: der Mensch als ganzheitliches Wesen
Der Kern der yogaunterrichtlichen Anliegen berührt den Menschen in der Ganzheit seines Wesens. Darin unterscheidet sich der Yogaunterricht von jedem anderen Unterricht. Daher ist die Beziehungsebene im Yogaunterricht von ganz besonderer Bedeutung. Eine Unterrichtsatmosphäre, die von Wohlwollen, Offenheit und Vertrauen getragen wird, bildet einen dafür angemessenen Resonanzraum. Alle unterrichtlichen Akzentsetzungen und Dispositionen ruhen dementsprechend auf einem betont personenzentrierten Ansatz. Inhaltliche, didaktische und methodische Elemente finden auf der Basis dieses menschlich- harmonischen Umfeldes ihren sinnvollen Platz. Das „Was“ reitet auf den heiter-positiven und motivierenden Wellen des „Wie“. Um diesem personalen Bereich das notwendige Gewicht zu geben, sollen dazu noch einige zusätzliche, erhellende Angaben folgen.
Yogalernende
Die uns Lehrenden im Yogaunterricht anvertrauten Menschen sind in ihrer Individualität einmalig. Sie haben ihre spezifischen Stärken und Schwächen, Begabungen und Veranlagungen. Geprägt durch eine einzigartige Lebensbiographie und unter dem Einfluss spezifischer Lernerfahrungen wird jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer im Unterricht seine eigenen Erfahrungen machen, einen eigenen Lernweg beschreiten und damit auch einen sehr persönlichen Yogaweg gehen. Dieser Tatsache müssen wir Yogalehrende uns stets bewusst bleiben. Gewisse Gegebenheiten bei den Lernenden sind dabei von besonderer Bedeutung. Die Teilnehmenden bringen unterschiedliche körperliche Voraussetzungen mit. Einzelne haben vielleicht einschränkende Beschwerden (z. B. Rücken- und Atemprobleme). Es zeigen sich auch im Bereich der psychischen Bereiche (Mentales, Emotionales) grosse Unterschiede (z. B. im Leistungs- und Perfektionsverhalten, in der Konzentrationsfähigkeit, im Bereich der Selbstwahrnehmungskompetenzen, im Umgang mit dem «inneren» Kritiker). Negative Erfahrungen in früheren Lernsituationen können Nachwehen verursachen und resignative Muster wachwerden lassen (Das lerne ich doch nie!). Auch ist der Tatsache Rechnung zu tragen, dass in Bezug auf den Unterricht sehr unterschiedliche Erwartungen gestellt werden. Der Erwartungsradius ist von enormer Breite. Er reicht vom körperlichen „Fit- und Schlank-Werden“, «Yoga als Wohlfühlevent» bis zu Bemühungen, etwas für die eigene innere Entwicklung zu tun. Dazwischen liegt ein breites Feld vielfältig anderer Wünsche. Yoga bietet eine breite Projektionsfläche, auf der eine Fülle an Vorstellungen Platz findet. Für uns sind jedoch jene Erwartungen von Bedeutung, die sich an uns als Yogalehrende richten, an uns Menschen in unterrichtsgestaltender Funktion. Und da ist es wichtig, sich immer wieder Folgendes zu vergegenwärtigen: Wir befinden uns weitgehend im Bereich der Erwachsenenbildung. Wir unterrichten vorwiegend Frauen und – hoffentlich - vermehrt auch Männer. Erwachsene Yogalernende erwarten in erster Linie einen kompetent konzipierten, erfahrungsbezogenen Unterricht, differenziert den Teilnehmenden angepasst mit präzis angeleiteten Übungen. Sie erwarten von uns Einfühlungsvermögen, Ausgeglichenheit und spürbares Engagement. Sie freuen sich, wenn wir ihnen mit Interesse begegnen und uns Mühe geben, sie zu motivieren, bzw. ihre Motivationen zu wecken. Aber sie schätzen es auch, wenn man ihnen vertrauensvoll Freiräume gestattet und sie in ihrer Selbsttätigkeit und Selbstverantwortung unterstützt. Manipulierenden und indoktrinierenden Tendenzen stehen sie verständlicherweise eher negativ gegenüber. Es gilt, unterrichtliche Dispositionen zu treffen, welche dazu führen, dass die Lernenden in ihrer Art das eigene, individuelle Potenzial optimal entfalten können. Entwicklung vollzieht sich in ihnen. Letztlich sind die Lernenden im Yogaunterricht «Sich-selbst-Lehrende». Eine differenzierte, teilnehmerbezogene Gestaltung des Yogaunterrichts bedingt daher, dass Yogalehrende über umfassende Informationen bezüglich der Voraussetzungen und Erwartungen der Lernenden verfügen (persönliche Gespräche, Gesundheitsfragebogen).
Eigenheiten des Gruppenunterrichts
Eine Gruppe ist im Normalfall immer ein komplexer Verband und hat eine heterogene Struktur. Gemeinsame Interessen können jedoch dazu führen, dass Unterschiede in der Gruppe weniger stark in Erscheinung treten. Dies ist in einer Yoga-Lerngruppe bis zu einem gewissen Grad der Fall. In der Praxis des Hatha Yoga als Erfahrung ist die zentrale unterrichtliche Akzentsetzung auf den Verinnerlichungsprozess ausgerichtet. Tendenziell bestimmen Konzentration, Stille und Friedlichkeit das Gruppenklima. Wesentliche Anliegen des Übungsgeschehens bilden die Entspannung, die Befreiung von inneren Irritationen und das Bei-Sich-Ankommen. Die mündlich-sprachliche Ebene im Verlauf des Unterrichtsgeschehens wird ganz von den bestimmenden, doch eher zurückhaltenden Anweisungen der Lehrenden geprägt. Gruppenatmosphärisch ist eine Tendenz in Richtung Harmonie und Übereinstimmung zu erkennen. In der yogischen Übungsgemeinschaft wird oft spürbar, dass das Ganze, dh. die Ausstrahlung der Yogalerngruppe, viel mehr ist als die Summe des Potenzials der in ihrer individuellen Art Übenden. Diese intensive und intime Gruppenatmosphäre ist wohl für alle Yogalehrenden und - lernenden eine sehr eindrückliche Erfahrung.
Yogalehrende
Die unterrichtlichen Akzentsetzungen werden jedoch nicht nur von den Voraussetzungen, Bedürfnissen und Erwartungen der Teilnehmenden her bestimmt. Yogalehrende haben naturgemäss durch ihre Persönlichkeit und ihre (Yoga)-Vorstellungen einen prägenden Einfluss auf die Art und Weise der Unterrichtsgestaltung. Dabei können jedoch auch andere Faktoren mitbestimmend sein, z. B. ein Unterricht im Rahmen spezifischer Hatha Yoga-Richtungen, die bestimmten Traditionslinien verpflichtet sind oder von ganz speziellen Akzentsetzungen geprägt werden. Auch das in diesem Buch dargestellte «Hatha Yoga als Erfahrung» zeigt ganz spezifische konzeptionelle Gegebenheiten. Daneben ergeben sich auch in Bezug auf gewisse Zielgruppen klare unterrichtliche Forderungen, die es zu beachten gilt, z. B. bei Yogakursen für Jugendliche, für Frauen, für Männer, für Schwangere, für ältere Menschen, usw. In solchen Gruppen liegen bis zu einem gewissen Grad spezifische Gemeinsamkeiten vor, die zu berücksichtigen sind und die Unterrichtsgestaltung mitbeeinflussen. Auch Frühmorgen-, Mittags- oder Abendkurse haben ihre eigenen Gegebenheiten. Und ganz gewiss wird man in Anfängerkursen, in mittleren und fortgeschrittenen Stufen spezielle personale und didaktische Akzente zu setzen haben. Doch auch in mehr oder weniger ausgewogenen Gruppen wird immer eine gewisse Heterogenität ein zu beachtender Strukturfaktor bleiben. Zusätzliche Anforderungen an uns Lehrende können durch hohe Teilnehmerfluktuationen in den Kursen und durch häufige Neueintritte in einen laufenden Kurs gestellt werden. Von uns Yogalehrenden wird daher eine hohe Flexibilität gefordert. Der unterrichtlichen Heterogenität haben wir mit einer ausserordentlichen Anpassungsfähigkeit, einer Diversifizierung des Angebotes und einer dynamischen didaktisch-methodischen Gestaltung des Unterrichts zu antworten.
Das personal-didaktische Interdependenzfeld des Yogaunterrichts
Abbildung 1: Personal- didaktisches Interdependenzfeld des Yogaunterrichts
Die einzelnen personalen, didaktisch-methodischen Aspekte werden im Allgemeinen nicht bewusst und streng geplant miteinander verknüpft. Unterrichtserfahrung, Improvisationsgabe und Intuition erlauben es Yogalehrenden, spontan situationsadäquate, ausgewogene, unterrichtliche Lösungen zu finden.
Zur Illustration der gegenseitigen Abhängigkeit der einzelnen Faktoren des personalen und didaktischen Feldes folgen einige erhellende Erläuterungen. Dadurch soll sichtbar gemacht werden, wie dicht die Verflechtungen sind und von welch hoher Dynamik das hathayogische Unterrichtsfeld geprägt ist. Ein steter, sehr enger Bezug zur personalen Unterrichtskomponente ist nicht zu übersehen.
Räumliches: Teilnehmerbezug / Hilfsmittel / Lektionsgestaltung / Übungsauswahl
Infolge mangelhafter Regulierung der Raumtemperatur trifft die Yogaklasse auf einen eher kalten Unterrichtsraum, an der Grenze des Erträglichen. Primär sind (sofern möglich) heizungstechnische Vorkehrungen zu treffen. Decken und wärmere Kleidung können Abhilfe schaffen. Die geplante, eher sanft-ruhige Lektion muss modifiziert werden. Vermehrt werden nicht vorgesehene, dynamische und kreislaufanregende Übungen eingeflochten. (vom Autor selbst erlebte Unterrichtskonstellation!)
Ziele: Teilnehmerbezug / Bezug zum Yogakurstyp / Übungsauswahl / Methode: angemessener Anleitungsmodus / spezielle Zielsetzungen: Kompetenzschulung
Ist das Unterrichtskonzept z. B. von einer grundsätzlich langsamen, meditativen Zielsetzung geprägt, tangiert dies unmittelbar die Übungsauswahl, deren Ausführung, den Ablaufrhythmus und die Umsetzung gewisser Unterrichtsprinzipien (z. B. im Yogaunterricht für ältere Menschen: schrittweises Vorgehen, sanfter Ablaufrhythmus, eingeflochtene spannungslösende Übungen und erholsame Pausen). Aufmerksames und sorgfältiges Üben werden dabei durch die Anleitung mit differenzierten Verinnerlichungsimpulsen unterstützt. Achtsamkeit und Sorgsamkeit als "Ziele" bzw. wichtige Übungsqualitäten können sich so allmählich zu tief verankerten Kompetenzen ausformen.
Methode / Unterrichtsprinzipien: Teilnehmerbezug / Umstellung des Aufbaus der Lektion / Inhalte: Übungsangebot anpassen/ Vorgehen: Freiräume gestatten, individuelle Betreuung
In heterogenen Klassen, bei einer stark fluktuierenden Präsenz der Teilnehmer oder bei häufigen Neueintritten in einen laufenden Yogakurs sind Yogalehrende stark gefordert. Vieles bleibt offen. Die vorgesehene Planung muss variiert werden. Unterrichtsprinzipien können nicht starr eingehalten werden. Auf einzelne Teilnehmer muss vermehrt eingegangen werden. Doch auch auf das Gros der Klasse muss gebührend Rücksicht genommen werden. Der Klasse werden in kurzen Phasen Freiräume des Übens gestatten, um etwas Zeit für die Betreuung von Spezialfällen zu gewinnen.
(In diesem Zusammenhang habe ich mit extremen Unterrichtssituationen einige Erfahrungen, z. B. im Yogaunterricht mit Teilnehmern im Strafvollzug. Da neben einer starken Teilnehmerfluktuation und einer internationalen Zusammensetzung der Gruppe die Übungsanleitungen mehrsprachig erfolgen mussten, geriet ich öfters in einen spürbaren personal-didaktischen Spagat.)
Inhalte/ Übungen: Teilnehmerbezug/ Unterrichtsprinzipien/ methodisches Vorgehen/ Beobachtung / Art der Korrektur
Eine neue Stellung soll eingeführt werden. Der Lehrende verfügt über das notwendige Wissen und besitzt Erfahrungen bezüglich der neuen Stellung (Details der Stellung, die zu beachten sind; biomechanische Gegebenheiten; Kontraindikationen; notwendige Vorübungen; Ausgleichsmöglichkeiten; beschwerdeschonende Varianten). Die Fragen, die sich beim Einführen stellen, sind weitgehend methodischer Natur: Worauf kann aufgebaut werden? Wie das Prinzip „vom Einfachen zum Komplexen“ umsetzen? Wie anleiten? Was vorzeigen? Worauf hinweisen? Was in erster Linie beobachten? Wie und wann allfällige Korrekturen anbringen? In welcher Art korrigieren? Was ist bei vertiefenden Wiederholungen zu berücksichtigen?
Hilfsmittel: Teilnehmerbezug / Rücksichtnahme auf die spezielle körperliche Situation einzelner Teilnehmer / Übungsauswahl / Methode: spezieller Anleitungsmodus
Die spezifische Beschwerdepalette in einer Yogaklasse wird achtsam im Auge behalten. Daher werden beschwerdeschonende Varianten vorgesehen und Hilfsmittel (z. B. Stühle, Decken, Kissen) vorgängig bei den betreffenden Lernenden bereitgelegt, dies um unnötige Zusatzbewegungen und Unruhe während der Lektion zu vermeiden. Hilfsmittel können z. B. im strukturell-körperlichen Bereich wirksame Funktionen übernehmen und die Übungsausführung schonend erleichtern.
Personaler Bereich / Yogalehrender: Methode / Art der Anleitung / Beobachtung und Korrektur (persönliche Erfahrung)
Eine geringfügige Verletzung am Unterarm verunmöglichte mir das Vorzeigen der Stellungen und das Anleiten mit gleichzeitigem Mitmachen. Daher erfolgte der Ablauf der gesamten Yogalektion nur über die mündliche Anleitung. Dies gab mir jedoch eine ausgezeichnete Gelegenheit, vermehrt das übende Geschehen in der Klasse genauer zu beobachten und - falls nötig - sanfte Korrekturen anzubringen.
In Ergänzung zu den in der Einleitung zum Buch erwähnten inhaltlichen Aspekten und den im personaldidaktischen Interdependenzfeld aufgezeigten relevanten Eckdaten soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass viele der bis anhin nur begrenzt erwähnten didaktisch-methodischen Bereiche in den folgenden Kapiteln dieser Publikation noch ausführlich behandelt werden. Es wird dabei die ausserordentliche Fülle der hathayogischen Übungspalette (Inhalte) aufgezeigt. In ihr liegt ein hohes, vielfältiges Wirkungspotential. Der kompetenz- und prozessorientierte Grundzug yogaunterrichtlicher Bemühungen wird hervorgehoben (Zielsetzungen, Verfahren, Übungsweisen). In den Zielsetzungen sind die Stärkung des Körpers, die Förderung der Beweglichkeit und die Entfaltung einer umfassenden Vitalität von zentraler Bedeutung. Doch von ebensolcher Relevanz ist die Pflege innerer Qualitäten. Hatha Yoga als Erfahrung versucht in Bezug auf diese letztgenannten Zielsetzungen einen möglichen Weg aufzuzeigen. Einer betont verinnerlichenden Unterrichtsspur folgend, können wirksam innere Kompetenzen wie Konzentration, Achtsamkeit und Bewusstheit entfaltet werden. Ein neues Verständnis zum eigenen Körper und zur persönlichen Verkörperung kann wachsen. Der zentrale Fokus liegt betont auf einer ganzheitlichen Entwicklung unseres Wesens.
Persönliches
In meinem hauptberuflichen Arbeitsbereich als Sprach- und Didaktiklehrer standen oft neue Sprachlehrmethoden und deren prägende Prinzipien und instrumentalen Gegebenheiten im Zentrum meiner Arbeit (audiovisuelle und -linguale Methoden, Einsatz multimedialer Lehrwerke, technisierter Unterricht im Sprachlabor und durch Computer programmierter Unterricht). Dabei wurde bedeutsamen personalen Aspekten oft nicht die notwendige Achtsamkeit geschenkt (den Lerngewohnheiten und hirnphysiologischen Aspekten, der Motivation und Konzentrationsfähigkeit). Oft waren die Lernenden Versuchskaninchen für didaktisch-methodische Experimente. Wie es den Lernenden im Rahmen dieser neuen Lernkonzepte zumute war, wurde selten hinterfragt. Erst aufgrund vieler Negativerfahrungen und Lernmisserfolge schwand auch bei mir allmählich der Glaube an diese methodisch-technischen Hoffnungsträger. Damit verbunden wuchs in mir die Gewissheit: Nicht das Didaktisch-Methodisch-Technische und enge Lehrvorstellungen sollten im Zentrum des Sprachunterrichtsgeschehens stehen, sondern die Lernenden mit ihren konkreten Voraussetzungen, der individuellen Lernkapazität und ureigenen Ressourcen.
Das Abrücken von einem stark instrumentalen und leicht manipulativ gestalteten Sprachunterricht führte zunächst einmal zu mehr Ruhe. Auch meine ursprüngliche Rolle als Pädagoge konnte ich wieder vermehrt wahrnehmen. Empathie, Verständnis und Humor leuchteten wieder auf. Didaktisch und methodisch sehr einfach gestaltete Lektionen, in denen jedoch die Lernenden einen hohen Stellenwert einnahmen, zeigten erstaunliche Wirkungen: Die Lernresultate waren spürbar besser, die Unterrichtsstunden hatten einen ganz neuen Klang. Sie waren geprägt von Heiterkeit, von Lachen, von Offenheit und hoher Lernbereitschaft.
Dies war für mich – als ehemaliger Methodengläubiger – eine tiefe, umwerfende Erfahrung. Ich war glücklich, den richtigen Pfad wenigstens in den letzten zehn Jahren meiner Sprachlehrertätigkeit gefunden zu haben – zu einem Unterricht mit "menschlichem Gesicht".
Zusammenfassung
Unterricht ist ein komplexes Geschehen. Viele Faktoren spielen mit ein. Dabei lassen sich zwei zentrale Komponenten unterscheiden: eine Sach- und eine Personal- bzw. Beziehungsebene. Auf der Sachebene sind vorwiegend inhaltliche und didaktisch-methodische Aspekte wegweisend. Die personale Ebene wird von pädagogisch-psychologischen Akzenten getragen. Yogaunterricht umfasst wie jeder andere Gruppenunterricht diese beiden Bereiche. Der entscheidende Unterschied zu anderen Unterrichtskonzepten liegt jedoch in Folgendem: Im Yogaunterricht geht es primär nicht um Wissen und Fertigkeiten. Es geht um die Teilnehmenden selbst. Es geht um die Menschen in ihrer Ganzheit, um ihre Integrität und umfassende Gesundheit. Diese berührt demnach nicht nur die körperliche Ebene. Es geht auch um ein Heilwerden der Psyche und um Berührungspunkte zu seelisch-spirituellen Energiefeldern. Es geht um Entwicklung und Transformation und dies über Erfahrungen in der hathayogischen Praxis. Yogalehrende sind daher in einem besonderen Mass gefordert. Sie übernehmen für die ihnen anvertrauten Menschen eine ganz spezifische Verantwortung und Funktion. Sie sind in erster Linie Gestaltende von Lern- und Erfahrungsräumen. Die Bemühungen um einen harmonischen Miteinbezug aller am Unterricht beteiligten relevanten Faktoren nimmt daher einen zentralen Platz ein. Der Schwerpunkt liegt jedoch nicht im didaktisch-methodischen Feld, sondern im Menschlich-Atmosphärischen. Das integrierte Zusammenspiel aller personalen und didaktischen Faktoren ist von hoher Dynamik und lebendiger Gegenwärtigkeit. Es ist ein Geschehen, das immer im Jetzt stattfindet und immer im Augenblick seine Erfüllung findet. Dies ist der geeignete Rahmen für prägende Erfahrungen. Was bei Yogalernenden innerhalb dieser Möglichkeiten geschehen kann, muss jedoch weitgehend ihnen selbst überlassen werden. Alle Yogalernenden erleben den Übungsprozess in ganz individueller Art. Yogalehrende sollten sich dieser Tatsache immer bewusst bleiben. So gesehen unterrichten Yogalehrende nicht im eigentlichen Sinne. Die Yogalernenden "unterrichten" letztlich sich selbst. Dies geschieht über ein engagiertes, übendes Engagement und über die Impulse, die ihnen im Rahmen des Gruppenunterrichts – allenfalls auch in ihrer individuellen Praxis zuhause – aus dem Yogaerfahrungsraum zufliessen. Es sind letztlich diese Impulse, die innere Entwicklungen und Veränderungen des eigenen Wesens auslösen.
2 Überreicher Schatz an Übungen
Kapitelinhalt:
• Überblick über das vielfältige Angebot hathayogischer Übungen
• zentrale Funktionen hathayogischer Übungen in ihren positiven gesundheitlichen Wirkungen und ihrem Potential als Lern- und Erfahrungsfelder
• hathayogische Übungen in ihrer bedeutsamen Brückenfunktion für innere Entwicklungen
Übersicht über die hathayogischen Übungen
Die nachfolgende Übersicht stellt nur einen begrenzten Teil der hathayogischen Übungsformen dar. Doch schimmert bereits in diesem knappen Überblick die hohe Vielfalt an Übungsmöglichkeiten durch. Nimmt man bei den Asanas, es sollen über 200 sein, noch die leichteren, schwierigeren und beschwerdeschonenden Varianten dazu, ergibt sich eine unermessliche Fülle an Übungsangeboten. Dabei darf nicht vergessen gehen, dass sich jede einzelne Übung durch ein ganz spezifisches, energetisches Potenzial auszeichnet. Yogalehrende können auf diesen Grundlagen aufbauend einen feingliedrigen Unterricht gestalten, der sich als äusserst wirksames Erfahrungs- und Lernfeld erweist. Die Lernenden werden darin ganz persönlich angesprochen und berührt. Sie können durch ihr übendes Engagement und über das Wirkungspotenzial des «überreichen Schatzes an Übungen» ihren eigenen «inneren Schatz» entdecken.
Ankommensübungen
Ankommensübungen haben ihren Platz ganz zu Beginn einer Yogastunde. Sie bilden gleichsam eine punktuell bedeutsame Brücke vom Alltag in die Yogastunde. Der Einstieg in das "alternative Lerngärtchen Yoga" soll bewusst erfahren werden: in der Yogastunde ankommen, bei sich selber ankommen, sich beruhigen, sich entspannen, offen sein für mögliche neue Erfahrungen …
Neben geeigneter Musik können auch ganz spezifische Übungen diese Anfangsphase unterstützen (z. B. eine einfache Atemachtsamkeitsübung, eine kleine Körperreise, den Auflagepunkten des Körpers auf der Matte nachspüren).
Abbildung 2: Ankommensübung
Aufwärmübungen
Aufwärmübungen haben ihren Platz in der ersten Phase einer Yogalektion. Sie dienen dazu, den Körper zu "wecken", ihn beweglich zu machen, den Energiefluss anzuregen und für die nachfolgenden Übungen optimal vorzubereiten. Im Rahmen der Aufwärmübungen haben auch einfachere dynamische Übungen Platz.
Abbildung 3a: Beispiel einer einfachen Aufwärm-Übungsserie
Abbildung 3b: Beispiel einer komplexeren, dynamischen Aufwärm-Übungsserie
Vorbereitende Übungen
Vorbereitende Übungen haben ganz spezielle Funktionen. Falls die Yogalektion eine spezifische Thematik hat (z. B. Öffnung des Brustraumes, Mobilität im Hüftbereich) oder gar eine einzelne, schwierige und wenig erprobte Stellung im Zentrum steht (z. B. Bogen oder Tänzerhaltung), sollten gezielte vorbereitende Übungen eingeplant werden. Durch diese Übungen wird die nachfolgende Ausführung der anvisierten Stellungen erleichtert. Dies ist vor allem bei stark heterogenen Klassen bedeutsam.
Abbildung 4: Vorbereitende Übungen
Asanas
Asanas bilden die entscheidenden Kernelemente des hathayogischen Übungsbereiches. Sie zeigen sich in vielerlei Varianten. Zudem sind bei vielen Stellungen dynamische und statische Ausführungsweisen möglich.
Abbildung 5: Asana – Varianten (Brücke)
Ergänzende Hinweise zu den Asanas
Die klassischen Yogastellungen weisen grundlegende körperliche Haltungen auf (z. B. stehende, sitzende, liegende Haltungen) und wesentliche Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule (z. B. Vorbeugen, Seitenbeugen, Rückbeugen). Aus der Kombination dieser Möglichkeiten entfaltet sich ein vielfältiges Übungsangebot. Die Stellungsdifferenzierungen erlauben es, vielfältigen Funktionen zu genügen und ein hochdifferenziertes, teilnehmerbezogenes Übungsfeld zu gestalten.
Abbildung 6a: Asana: Körperhaltungen und Bewegungsrichtungen der Wirbelsäule
Abbildung 6b: Der Körper im Energiefeld der Haltungen und Bewegungsrichtungen
Dynamische Übungssabfolgen: Vinyasas
Dynamische Yogastile gewinnen mehr und mehr an Bedeutung. Charakteristisch sind dabei sinnvoll kombinierte Stellungsabfolgen, in denen Bewegung und Atmung eng verflochten sind. Wichtig bleibt dabei die korrekte Ausrichtung der Stellungen. Leichtigkeit, Harmonie, Koordination und Dynamik prägen die Ausführung. Die spezielle atmosphärische Qualität dieser Yogapraxis erinnert an den Fluss und die Beweglichkeit des Wassers. Die volle Hingabe an den Bewegungsrhythmus kann dazu führen, dass sich der Übende selbstvergessen in einem "Flow" aufgehoben fühlt – eine meditative Erfahrung ganz eigener Art.
Klassische, fixe, dynamische Übungsreihen
Damit sind mehr oder weniger fixe Stellungsabfolgen gemeint, wie etwa der Sonnengruss in unterschiedlichen Varianten. In neuerer Zeit werden vermehrt auch kürzere, einfachere, dynamische Übungsfolgen gestaltet, die in der Vorbereitungsphase einer Yogalektion spezifische Funktionen übernehmen.
Abbildung 7: Sonnengruss
Abbildung 8: Dynamische Übungsabfolge (Zielgruppe: Senioren)
Diese dynamische Übungsabfolge ist für ältere Menschen gedacht. Jede Stellung kann auch etwas isoliert von der folgenden Stellung geübt werden mit kurzem Zwischenhalt in der Ruheposition (siehe Ausgangshaltung der Reihe). Der Atem wird sinngemäss begleitend und unterstützend integriert. Die Ausführung ist sanft fliessend, betont langsam und sehr achtsam. Höchste innere Präsenz durchzieht den ganzen Ablauf. Die Übungsweise ist von einer spürbar meditativen Atmosphäre geprägt.
Atemübungen: Pranayamas
Atemübungen, Atemtechnik und Atemführung spielen im Rahmen der hathayogischen Übungspalette eine ganz zentrale Rolle. Dabei geht es um eine bewusste und genaue Ausführung des Atemgeschehens: "Einatmen-Ausatmen-Atemanhalten", wie etwa bei der Wechselatmung Nadi Sodhana. Atemrhythmus, -volumen und -achtsamkeit können dabei spürbar verbessert werden. Traditionelle yogische Atemübungen verlangen eine präzise Ausführung und sollten daher nur von einer erfahrenen Lehrperson angeleitet werden. Neben diesen gezielten Atemübungen hat die angemessene Integration des Atems in den verschiedenen Übungsformen eine hohe Bedeutung, z. B. die Atemführung bei Beugungen, Rotationen, Dehnungen, beim Halten einer Stellung oder etwa beim Einsatz der Ujjayi-Atmung. Die unterschiedlichen Aufgaben der Atmung werden auf diese Weise bewusst erfahren (begleitende, stützende, zentrierende Funktionen).
Abbildung 9: Der integrierte Atem in der Seitenbeuge, dynamische Ausführung
Bewegung und Atem sind ein inniges Paar. Doch behält jeder Bereich klar seine jeweilige Funktion. Der Körper kann dem Atem Raum schenken. Der Atem kann Bewegungen auslösen, begleiten und unterstützen. Die einfache Seitenbeuge ist ein anschauliches Beispiel dafür. Einatmend werden die Arme gestreckt über die Seiten nach oben in die Vertikale geführt. Die Bewegung wird mit sanfter Streckung beendet. Erst mit beginnender Ausatmung gleitet der Körper sanft in die Seitenbeuge. Die Seitenbeuge löst sich mit einer Einatmung auf. Ausatmend gleiten die Arme von oben nach unten in die Ausgangslage zurück. Es folgen einige Zwischenatmungen. Dann wird in gleicher Weise die Gegenseite geübt.
Bandhas
Bandhas (Verschluss, Fessel) sind muskuläre und energetische Körperzonen-Verschluss-Techniken. Anvisiert werden dabei die Ausrichtung und die Transformation der Körperenergien. Bei der Ausführung sind folgende Aspekte wichtig: die Atemführung, das Atemanhalten, die Spannung und Entspannung. Richtig ausgeführt – auch in Kombination mit Stellungen – sind Bandhas äusserst wirkungsvoll. Voraussetzungen für eine heilsame Ausführung dieser Verschlusstechniken sind das gute Beherrschen der Atemtechniken und eine spannungsfreie, hohe Beweglichkeit im körperlichen Bereich.
Bandhas müssen genau und detailliert erlernt werden, um die erwünschten Wirkungen zu erreichen. Es werden drei grundlegende Verschlüsse unterschieden:
- Jalandhara-Bandha (Hals- und Kehlkopfzone)
- Uddiyana-Bandha (Zwerchfell- und Beckenbodenbereiche)
- Mula-Bandha (Nabel- und Beckenbodenzone)
Mudras
Der Sanskritausdruck Mudra (Zeichen, Geste, Sigel) hat einen sehr breiten Bedeutungsradius. Im engeren Sinne werden darunter fixe Hand-, Finger-, Kopf- und Körperhaltungen verstanden, z. B. Jnana-Mudra (Geste des Wissens), Yoni-Mudra (Verschluss der Sinnespforten), Yoga-Mudra (spezifische Vorbeuge im Sitzen), Agocari-Mudra (Konzentration der Augen auf die Nasenspitze). Im Hatha Yoga werden vor allem Hand-Mudras als zentrierende, den Energiefluss unterstützende Gesten in der Meditationspraxis eingesetzt. Vereinzelt werden auch Asanas mit Zentrierungstechniken und Mudras verbunden, wie etwa in der Stellung Viparita-Karani-Mudra (Schulterstand mit intensiver Lenkung des Energieflusses). Es versteht sich von selbst, dass Mudras eine sehr präzise Ausführung verlangen, sollen sich die ihnen zugeschriebenen Wirkungen entfalten können.
Zentrierende Hand- und Fingerstellung: Die Daumen berühren sanft das Brust-bein. Die Augen sind geöffnet. Der Blick ist in den Hand-Finger-Kelch gerichtet. Sanft ein- und ausatmen und versuchen, 3-5 Minuten die Konzentration zu wahren und ganz bei sich zu bleiben.
Abbildung 10: Herz-Mudra (Lotos-Mudra)
Reinigungsübungen: Shatkarmas
Unter den Shatkarmas werden sechs Körperreinigungstechniken verstanden:
- Neti (Nasenspülung)
- Trataka (Augen-Fixationsübung)
- Dhauti (Reinigung der Speiseröhre und des Magens)
- Basti (Darmreinigung)
- Nauli (bauchmuskelstärkende und verdauungsfördernde Übung)
- Kapalabhati (Lungenkräftigungsübung)
Von diesen – an sich sehr wirkungsvollen und wohltuenden Übungen – wird Neti in unseren Breitengraden wohl am häufigsten angewendet. Alle diese Reinigungsübungen sollten unter Anleitung einer erfahrenen Lehrperson eingeübt und durchgeführt werden.
Entspannungsübungen
Yogisches Üben, das einer meditativen Körperkultur verpflichtet ist, hat grundlegend einen entspannenden Charakter. In einer Zeit, die von Reizüberflutung, Hektik und Leistungsbestreben geprägt ist, haben daher zusätzliche, gezielte Entspannungsübungen einen hohen Stellenwert. Sie entspannen den Körper und beruhigen die Psyche. Meist werden Entspannungsübungen in Shavasana (Totenstellung) ausgeführt. Unterschiedliche Verfahren sind möglich. In entspannenden Übungen spielen Körper- und Atemachtsamkeit eine zentrale Rolle. Auch die Fähigkeit, sich gezielt auf einzelne Körperregionen konzentrieren und dem Impuls "Loslassen" folgen zu können, ist bedeutsam. Eine intensive Entspannungsübung stellt "Yoga Nidra" dar. Andere bekannte Entspannungstechniken, die Impulse aus dem Yoga übernommen haben, sind etwa die "Progressive Körperentspannung" nach Edmund Jacobson und der sogenannte "Body Scan" nach Jon Ka-bat-Zinn.
Position: In Rückenlage. Die Arme und Beine sind bequem ausgebreitet. Die Augen sind geschlossen. Die Haltung signalisiert Offenheit und Hingabe. Die Rhythmisierung der Atmung ist von zentraler Bedeutung. Einatmend liegt der Fokus der Aufmerksamkeit immer in der Bauchregion. Ausatmend richtet sich die Achtsamkeit in alle Körperregionen (gezielt nacheinander in die Beine, die Arme, den Bauch- und Brustraum, den Schultergürtel, den Kopf und ganz sachte auch ins Gesicht, speziell in die Augenzone). In der Vorstellung lässt man den Atemstrom wie einen sanften Wasserstrom in die Körperbereiche "ausfliessen". Loslassen ist angesagt.
Abbildung 11: Entspannungsübung (Seestern-Meditation)
Achtsamkeitsübungen
Mit Achtsamkeitsübungen (siehe auch Wahrnehmungsübungen) sind alle Übungsformen gemeint, die in irgendeiner Form der Schulung der Konzentration, der Achtsamkeit, dem "Bei-sich-sein-Können", dem "inneren Tastsinn" und dem Spürsinn dienen. Dies gilt grundlegend für alle Yogaübungen, da die achtsame Ausführung ein zentrales Element in der Yogapraxis darstellt und nur diese Art des Übens zu tieferen Erfahrungen und Erkenntnissen führt. Bei Achtsamkeitsübungen spielen Verinnerlichungsimpulse seitens der Yogalehrenden eine wichtige Rolle. Im körperlichen Bereich kann der Fokus speziell auf die Wirkungen einer Übung gelegt werden: «Spürt nach, wo sich bei Euch durch die Übung etwas verändert hat.» Im Atem- bereich kann dem Fluss der Atmung nachgegangen werden: «Spürt nach, wie Euer Atem fliesst und welche Atemräume aktiviert werden.»
Abbildung 12: Wirkungen von Übungen
Der Atemrhythmus richtet sich grundsätzlich nach den Angaben in Abbildung 9. In der Endposition dieser einfachen Seitenbeuge kann der Atem in einer unterstützenden und stellungsfördernden Funktion integriert werden. Nach dem Erreichen des ungefähren Grenzbereiches der Seitenbeuge über eine Ausatmung stellt man sanft auf eine Flankenatmung um. Leicht betont wird in den Flankenbereich der gedehnten Seite eingeatmet. Auf diese Weise kann die Seitendehnung in feiner Art gefördert und gehalten werden. Diese Atemtechnik wendet man 2-3 Mal an. In den dazwischen liegenden Ausatemphasen entspannt sich der Körper etwas, gleitet aber kaum zurück. Zum Schluss wird der gestreckte Arm einatmend über oben in die Ausgangslage zurückgeführt. Der Oberkörper ist aufgerichtet. Die Arme hangen locker seitlich nach unten. Eine erste Nachspürphase schliesst sich an: Wie fühlt sich die gedehnte Körperseite an? Und die Gegenseite? Eine zweite Nachspürphase kann am Schluss der Übung erfolgen: Wie fühlt sich der Körper an? Brust- und Flankenraum? Schultergürtel? Schultergelenke?
Visualisierungsübungen
Die Fähigkeit zu visualisieren ist eine grosse Gabe. Nicht alle Menschen können sich spontan Farben, Formen, Symbole oder Bilder vorstellen. Am besten gelingt dies wohl mit bekannten Gegenständen, mit uns bekannten Personen oder eindrücklich erfahrenen Orten der Umwelt. In der Yogapraxis kann die Visualisierungstechnik in folgenden Bereichen unterstützend eingesetzt werden:
• Eine einzuübende Stellung wird – bevor sie ausgeführt wird – mental vorausgenommen, d. h. man stellt sich die beabsichtigte Haltung (in die Haltung hineingehen, in der Haltung sein, aus der Haltung herausgehen) innerlich ganz genau vor. Dieses "Vorausfühlen" kann eine gute Voraussetzung für die nachfolgende Ausführung darstellen, da durch gezielte Vorstellungsbilder innere positiv wirkende Dispositionen ausgelöst werden können.
• Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dass man vor der Ausführung die Endstellung in einer bildlichen Darstellung eine Weile lang betrachtet und sich meditierend in sie einfühlt (ein Kleinbild der betreffenden Stellung steht allen Übenden zur Verfügung).
• Im Sinne einer vertiefenden Nachbearbeitung wird nach der Auflösung der Stellung das gesamte Ausführungsgeschehen innerlich nachvollzogen.
• In einer ähnlichen Weise können auch die mehr symbolträchtigen Elemente einer Stellung verstärkend miteinbezogen werden: z. B. "Baumstellung": sich die Verankerung in der Erde mittels Wurzeln vorstellen, den Körper als Stamm wahrnehmen, die Arme und den Kopf als Äste und Krone visualisieren und sich in der Endstellung mit dem persönlichen Lieblingsbaum verbinden.
Abbildung 13: "Ich bin auch ein Baum"
Wie ein Baum habe ich meine Wurzeln, meine ernährenden Quellen, wachse auf und entfalte mich. Meine Jahrringe sind meine Geburtstage. Sie erzählen von den Erfahrungen im vergangenen Jahresablauf. Meine Äste sind Ausdruck meiner Verwirklichungsmöglichkeiten im Leben, ja Blüten und Früchte kann ich tragen …
Und wie der Baum seine Jahreszeiten erlebt, erfahre ich selbst die verschiedenen Lebensphasen meines Lebens.
Salutogenetisch-meditative Übungen
Auf der Basis des Leitsatzes der Salutogenese "Was kann ich selber für meine (umfassende) Gesundheit tun?" können spezielle Übungen gestaltet werden, welche gezielt auf bestimmte Organe (z. B. Magen) oder Körpersysteme (z. B. Verdauungssystem) gerichtet sind. Es geht dabei um eine achtsame Konzentration in Richtung eines Körperfunktionsbereiches. Die Übungsqualität weist ganz spezifische Akzentsetzungen auf: ein achtsames und liebevolles Einfühlen in ein Organ, in ein Körpersystem, begleitet von einem tiefen Wohlwollen und einem inneren Lächeln. Auch der Atem kann "streichelnd" miteinbezogen werden. Es gilt die Annahme, dass z. B. das betreffende Organ diese Zuwendung spürt und sich in seinen Funktionen unterstützt fühlt (siehe dazu auch 4.4.2. Praxisbeispiel "Mein Verdauungssystem" und die detaillierten Ausführungen zur salutogenetischen Übung 9 in Kapitel9.).
Thema: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst
FC@Abbildung 14: Salutogenetische Übung (Herzübung)
Wie immer man diese Aussage aus der Bibel versteht, eine Interpretation könnte die folgende sein: Schau zuerst zu dir selbst. Du kannst dir und den andern am besten dienen, wenn du in erster Linie dir selbst Sorge trägst und darauf achtest, dass es dir gut geht. Und genau in dieser Weise realisiert unser Herzdiese biblische Aussage, eindrücklich und umfassend:
1. Über die Herzkranzgefässe nährt und stärkt es zuerst sich selbst, die eigene, ganz speziell gestaltete Muskulatur.
2. So gestärkt, kann das Herz seine wichtigen Funktionen ausüben. Es schickt das sauerstoff- und nährstoffreiche Blut zu allen Zellen und führt allfällige Abbaustoffe zurück, um sie sinnvoll zu entsorgen (Kohlendioxyd, Schlacken).
Die Herzübung unterstützt diesen Vorgang ganz bewusst. Im Verlauf der Übung wenden wir uns dem Herzen und dessen Funktionen liebevoll zu (inneres Lächeln). 1) Die Hände liegen übereinandergelegt auf dem Brustbein. Einatmend sammeln wir konzentriert die Nährstoffe und den Sauerstoff von den Lungen kommend im Herzraum. 2) Ausatmend lassen wir diese Nährkräfte in den Körper und in alle Körperregionen fliessen. 3) Dies führen wir 8-10 Mal in heiterer, wertschätzender Weise aus. Am Schluss verabschieden wir uns dankend von unserem Herzen, im Wissen um seine unermüdliche, grandiose Leistung: 60 000 bis 80 000 Herzschläge pro Tag! Danke, mein Herz!
Übungen mit Lauten und Tönen
Neben den traditionellen Mantras besteht auch die Möglichkeit der Verwendung einfacher Töne und Laute z. B. bei der Ausführung dynamischer Übungen oder bei Vorbeugen im üblichen Ausatmungsrhythmus. Es besteht keine Lautvorgabe. Die Übenden gestalten jene Laute, die sich spontan ergeben.
Selvarajan Yesudian – der bekannte verstorbene Yogalehrer – hat empfohlen, anstelle der klassischen Mantras die uns geläufigeren Vokale a-e-i-o-u zu verwenden, diese allerdings im Rahmen einer angemessenen, ruhigen Sitzhaltung. Das Nachspüren erhält dabei eine ganz besondere Bedeutung. Es gilt gezielt nachzuempfinden, in welcher Körperzone sich beim Intonieren der einzelnen Laute eine spürbare Resonanz ergibt.
Es bestehen zwei grundlegende Arten der Ausführung:
a) die Ausführung mit vorgegebenen Lauten wie z. B. "a-e-i-o-u"
b) die Ausführung mit freier, individueller Laut-führung wie z. B. "mm"
Im nebenstehenden Beispiel erfolgt im Heben der Arme eine etwas intensivere Einatmung, damit für den in der Ausatmung zu formenden Laut genügend Atemluft zur Verfügung steht. Die Artikulation sollte nicht allzu laut sein und der Laut kann etwas in die Länge gezogen werden. Mit Vorteil wiederholt man die Übung 5-7 Mal. Anschliessend gleitet man in eine Ruhe- und Entspannungshaltung und spürt den Wirkungen der innerlich wirkenden Töne nach. Diese können je nach ihrer Qualität unterschiedliche Resonanzen im Körper wachrufen. Wo ist im Körper eine Reaktion zu erkennen? In welchen Körperregionen finden die Laute und Töne einen spürbaren Nachhall?
Abbildung 15a: Yogaübung mit Lauten
Mantras
Mantras sind Laut- und Wortkombinationen. Sie kommen – gesprochen oder gesungen – in vielen Kulturbereichen vor. Aus dem indisch-hinduistischen Kulturraum sind uns z. B. die in der Sanskritsprache gestalteten Mantras Om, Om Namah Shivaya, Om Mani Padme Hum bekannt. Die rhythmische Wiederholung und der klangliche Reichtum erwecken in uns hohe Resonanz. Grundlage dazu bilden Schwingungsmuster, auf die wir unmittelbar ansprechen. Durch die achtsame Anwendung dieser "Vokalwerkzeuge", kann sich der Yogaübende entspannen und beruhigen. Dabei sollten Aussprache, Betonung und Rhythmus der Sanskrit-Mantras möglichst korrekt ausgeführt werden. Neben der entspannenden Funktion erzeugen Mantras in ihrer sich wiederholenden Intensität zusätzlich heilsame und harmonisierende Wirkungen mit hoher Nachhaltigkeit. Mantras können uns mit der uns innewohnenden non-dualen Wirklichkeit in Verbindung bringen.
Abbildung 15b: Om
Om ist d a s Mantra des Hinduismus. Es wird als Manifestation des Absoluten gesehen, das in allem zu finden ist. In der Auflösung in die drei Laute A-U-M zeigt sich ein weiterer Bedeutungs-inhalt. Die drei Laute stehen für die Gottheiten Vishnu, Shiva und Brahma: Erhalter – Zerstörer – Erschaffer – die drei göttlichen Kräfte. Diesen Bereichen werden auch unterschiedliche Bewusstseinsformen zugeordnet (Wach-, Traum- und Tiefschlafzustand).
Übungen mit Bildern
Bilder – Yantras aus tantrischer und Mandalas aus buddhistischer Tradition – können als Konzentrationsund Meditationshilfen in der Yogapraxis eingesetzt werden. Yantras sind abstrakte Bildgestaltungen mit geometrischen Elementen (Kreise, Dreiecke, Quadrate) wie das bekannte Sri-Yantra. Mandalas weisen oft auch konkrete Bildelemente auf (Gottheiten, Naturerscheinungen). Beide Bildtypen sind in gewisser Weise Spiegelbilder des Mikro- und Makrokosmos. Das konzentrierte Betrachten der Bilder (nur Schauen, keine Gedanken, kein Kommentar) kann dazu führen, dass Bildelemente, Bildstrukturen, Formen und Farben mit ihrem Potential direkt auf uns einwirken und gewisse Impulse auslösen, z. B. die Aktivierung geistig-seelischer Prozesse, die Harmonisierung der rechten und linken Gehirnhemisphäre. In diesem Sinne stellen diese visuellen Medien "Wirkbilder" dar. Der eigentliche Wirkungseffekt geht vom jeweils spezifischen Energiefeld der visuellen Darstellung aus.
In der gegenwärtigen Yogaszene ist der Einsatz solcher Bildtypen eher begrenzt. Andere Bildtypen können jedoch in einer differenzierten Meditationspraxis Anwendung finden (Meditationsübungen mit dem Buddha-Bild, mit Landschafts- und Pflanzenbildern).
Abbildung 16a: Buddha
Ich blicke in das Antlitz Buddhas.
Nur schauen – kein Kommentar.
Und es kann sein, dass sein Lächeln auf mich überspringt und mein Herz ganz erfüllt.
Ein Yantra ist ein magisches Diagramm, ein Instrument der Verinnerlichung. Es ist eine Kombination geometrischer Zeichen voll symbolhafter Bezüge: quadratische Formen symbolisieren die Erde, Kreise die Innenwelt, ineinandergreifende Dreiecke stehen für das weibliche und männliche Prinzip, Lotusblüten für die spirituelle Entfaltung und der Punkt in der Mitte für das Ewige und Göttliche.
Abbildung 16b: Sri Yantra
Das kontemplative Betrachten eines Yantra hat zentrierende Wirkungen. Es führt zu innerer Sammlung und Ausrichtung des Bewusstseins. Als Wirkbild kann die energetische Gestalt eines Yantra durch seine Formen, Strukturen und Kombinationen Einfluss auf unsere Hirnhemisphären ausüben, dies z. B. im Sinne einer spezifischen Aktivierung oder Harmonisierung.
In meiner persönlichen Praxis arbeite ich oft mit zeitgemässen Yantras, da ich das Glück habe, dass meine Frau solche Wirkbilder meditativ empfangen und gestalten kann. Diese Bilder sind farbig, was deren Wirkung spürbar erhöht. Sie haben keinen ersichtlichen Symbolgehalt. Sie erfüllen ihren Zweck allein durch ihr Wirken.
Wahrnehmungsübungen
Die Schulung der Wahrnehmung geschieht immer dann, wenn z. B. der Fokus auf einen bestimmten Körperbereich oder auf das Atemgeschehen gelegt wird. Dabei verblassen Gedanken und die aufmerksam gerichtete Konzentration führt zu einer intimen Beziehung zum Körper, zu einem Körperbereich und zum Atem. Eine Gewissheit kann wach werden: Ich bin dieser Körper. Ich bin diese Atmung. Im Rahmen der Wahrnehmungsschulung kann der Körper z. B. auch nach Spannungen "abgesucht" werden oder man spürt den Wirkungen einer Übung nach.
Spezifische Sinnes-Wahrnehmungsübungen stellen einen Teilbereich der Achtsamkeitsübungen dar. Im Speziellen sind damit Übungen gemeint, die unsere fünf Sinne betreffen. In einem stark visuell geprägten Umfeld ist es von hoher Bedeutung, auch den anderen Sinnen die notwendige Beachtung zu schenken. Die Wahrnehmung in Richtung des Hörens, Riechens, Schmeckens und des Tastsinns kann mit ganz unterschiedlichen Übungen differenziert geschult werden. Beispiele sind etwa:
• blind Gegenstände abtasten und nach ihrer Form, Oberflächenbeschaffenheit, der materiellen Konsistenz zu forschen (Tastsinn)
• blind die Quelle von Düften ermitteln z. B. Kräuter, Duftstoffe (Geruchssinn)
Kontemplative Übungen
Kontemplative Übungen und Meditationen haben nicht nur in östlichen Kulturen eine lange Tradition. Es finden sich auch im Christentum viele kontemplative und meditative Übungsformen. Kontemplation und Meditation sind nicht immer klar voneinander zu unterscheiden. Man könnte Kontemplation allenfalls dahingehend von eigentlicher Meditation unterscheiden, als bei dieser Übungsform meist intensiv über einen bestimmten Inhalt nachgesinnt wird (über ein Wort, einen Satz, einen Text). Es geht dabei nicht um intellektuelle Gedankengänge oder gar um spitzfindige Reflexion. Das Betrachten und Sinnen bleibt offen für ein ganzheitliches, unvoreingenommenes Erfassen und Neuentdecken der primär gegebenen Inhalte. Hauptquelle allfälliger Erfahrungen und Erkenntnisse sind assoziative Sinnerfassung, die Intuition und reines Gewahrsein. Konzentration, Achtsamkeit und völlige Ruhe der Psyche sind begleitende Wesensmerkmale dieser Übungsweise.
Meditationen
Yoga ist – im eigentlichen Sinne – Meditation. Gemäss Definition in den Yoga Sutras von Patanjali (indischer Yogaphilosoph, 2./3.Jh. n.Chr.) ist Yoga das "zur Ruhe kommen der Geistestätigkeiten" d. h. aller psychischen Regungen. Yoga als Zustand meint also eine ganz bestimmte Seinsweise ausserhalb unserer gewohnten dualen Lebenskonstellationen. Es ist der mystische Aspekt der yogischen Vision. Es geht dabei um Erfahrungen, welche uns im Zustand des Hier und Jetzt in unmittelbarer Verbindung mit der spirituell-seelischen Ebene zufliessen können. Es ist anzunehmen, dass diese Impulse zu positiven, verhaltensverändernden Wirkungen führen. Im Hatha Yoga, in allen Übungen der hathayogischen Übungspalette, schwingt dieses Element des Yoga mit. Es ist wie eine atmosphärische Begleitmelodie, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Yogapraxis im Rahmen einer meditativen Körper- und Übungskultur zieht.
Neben dieser grundlegenden Konstellation können ganz spezielle Meditationsübungen in der Vielschichtigkeit ihrer Wirkungen das Übungsangebot anreichern, z. B. Bild-, Klang-, Chakra-Meditationen, meditative Atempraxis, bewusstheitsfördernde Meditationsformen, wie etwa die Vipassana-Meditation. Auch GehMeditationen tragen in sich eine starke transformierende Kraft. Das langsame, bewusste Schreiten, bei dem auf die feinsten Bewegungen geachtet und der Atem achtsam miteinbezogen wird, führt zu ganz neuen, tiefen Erfahrungen. Meditative Übungen stellen einen wesentlichen Mosaikstein unterrichtlicher Konstellationen dar, um existenziell bedeutsame Kompetenzen zu schulen. Es sind Gelegenheiten, ruhig, entspannt und still zu werden. Allfällige Bewegungen der Psyche (Gedanken, Stimmungen, Gefühle) können mit einer gewissen Distanz und ohne Bewertung beobachtet, erkannt und sinnvoll integriert werden. In der meditativen Hingabe an eine "offene, weite Mitte" kann sich eine nicht beschreibbare Seinserfahrung entfalten. Solche Erfahrungen tragen in sich ein hohes veränderndes Potenzial. Die Impulse für allfällige Veränderungen kommen aus einer tiefen, weisen Quelle, die uns das schenkt, was für uns richtig ist. Eine Veränderung, welche aus solchen Impulsen heraus geschieht, hat oft ganz praktische, heilsame Folgen: Die Wahrnehmung kann differenzierter werden, die Bewusstheit sich erhöhen. Solche Entwicklungen führen zu neuen, tief verankerten, alternativ lebensgestalterischen Möglichkeiten.
Drei-Sphären-Meditation
Eine angenehme Meditationshaltung einnehmen, über Körper- und Atemachtsamkeit still und konzentriert werden und sich für die Übung hingebungsvoll öffnen.
1. "Ich bin ein Erdenkind"
Aus der Erde komme ich – aus Erde bin ich – die Erde trägt mich – den Kontaktstellen des Körpers mit der Unterlage nachspüren – sich mit der Erde verbinden – Wurzeln schlagen – und der Erdanziehung vertrauend sich mehr und mehr am Ort niederlassen in der Gewissheit, dass ich hier zuhause bin.
Ruhe, Verankerung und Stabilität breiten sich aus.
2. "Ich bin ein Sternenkind"
Alles, was die Erde ausmacht, stammt aus dem Kosmos. Auf ihrer weiten Reise durch den Kosmos hat sie all den Erdenreichtum eingefangen. Daher bin auch ich mit dem Kosmos verbunden. Ich bestehe aus "Sternenstaub". Im Bewusstsein dieser Tatsache, verbinde ich mich in alle Richtungen mit der Weite des Kosmos. Nach oben und unten, nach vorne und hinten, seitlich weit nach rechts und weit nach links – mit der Gewissheit, dass ich in kosmische Dimensionen eingebettet bin.
Weite, Tiefe und Verbundenheit breiten sich aus.
3. "Ich bin mit allem verbunden"
In mir, in meinem Herzen, vereinigen sich die beiden Sphären und werden eins – Erdenkind – Sternenkind. Ich bin geborgen auf der Erde und zugleich verbunden mit dem Universum, der Unendlichkeit, dem Ewigen. Alles wird durch dieselbe Energie belebt und getragen. Ich bin eine ganz spezifische Ausformung dieser kosmischen Energie.
Geborgenheit, Heiterkeit und Fülle breiten sich in mir aus.
In Stille und Harmonie verweile ich voller Zuversicht, dass mir das geschenkt wird, was für mich am besten
Abbildung 17: Drei-Sphären-Meditation (Beispiel einer geführten Meditation, in Anlehnung an die „Drei Mitten des Menschen“ von Karlfried Graf Dürckheim)
Seinsebenen, Übungsformen und Übungswirkungen
Das breitgefächerte hathayogische Übungsangebot trägt in sich ein unerschöpfliches Wirkungspotenzial. Je nach Übungsauswahl und Akzentsetzungen in der Übungsweise werden bei den Übenden die unterschiedlichsten Existenzebenen angesprochen. Die Wirkungsbereiche können dabei mehr im KörperlichEnergetischen oder mehr im Psychischen liegen. Auch Berührungspunkte mit seelisch-spirituellen SeinsBereichen sind möglich. Die nachfolgende Übersicht versucht dies aufzuzeigen. Es ist jedoch davon auszugehen, dass in einer meditativ geprägten hathayogischen Praxis die Übenden jeweils immer in ihrer existenziellen Ganzheit berührt werden.
Abbildung 18: Seinsebenen, Übungsformen und Übungswirkungen
Brückenfunktion hathayogischer Übungen
Wie erwähnt, sind die hathayogischen Übungswirkungen äusserst vielfältiger Natur. Auf der körperlichen Ebene wirken viele Übungen kräftigend, bewegungsfördernd und vitalisierend. In psychischen Existenzbereichen (Gedanken- und Gefühlszone) zeigen gewisse Übungen entspannende, stresslösende und harmonisierende Wirkungen. Das Wechselspiel "Ich-und-meine-Yogaübung" wird an Intensität gewinnen, je mehr wir uns selbstvergessen dem Übungsprozess hingeben und uns vom jeweiligen spezifischen Energiefeld einer Übung berühren lassen. Das Sich-Einlassen in die Quellkräfte hathayogischer Übungen hat zur Folge, dass in uns Resonanzen ausgelöst werden. In ihnen werden Impulse wach, die innere Entwicklungen beleben können. Es geht dabei vor allem um die Entfaltung unseres Wahrnehmungsvermögens, unseres Empfindungs- und Spürsinns. Dabei sind auch existenziell bedeutsame innere Qualitäten miteinbezogen: achtsames Gewahrwerden, Aufmerksamkeit und Bewusstheit. Diese Seins-Qualitäten bilden die Grundlage, um völlig neue Sichtweisen und Erkenntnisse zu gewinnen. Dadurch kann unser Leben eine veränderte Ausrichtung erfahren.
Doch dies ist nicht alles! Die hathayogischen Übungen halten noch zusätzliche Geschenke für uns bereit. "Sternstunden" sind möglich. Damit sind Bewusstseins-Zustände gemeint, die uns in die Erfahrung des "Hier und Jetzt" führen können, in eine tief erlebte Gegenwärtigkeit. Es sind existenzielle Augenblicke, die sich jeder Beschreibung entziehen. Doch es sind Erfahrungen, die in uns die Gewissheit verankern, dass es in uns – und von uns nicht getrennt, auch ausserhalb von uns etwas gibt, das weit über unsere einschränkenden Vorstellungen und unser konditioniertes Denken und Fühlen hinausgeht. In "Sternstunden" erleben wir die friedlich-wohltuende Atmosphäre des Nicht-Polaren, des Raum- und Zeitlosen. Wir kommen in Kontakt mit den Vibrationen einer allesumfassenden Kommunikation. Sie ist die Quelle aller Veränderungen. Daraus fliessen uns heilende Impulse zu. Hier begegnen wir dem Wesenskern hathayogischer Übungsarbeit, dem mystischen Aspekt. Aus all diesen Darlegungen wird eindeutig klar: Hathayogische Übungen sind potenzielle "Entwicklungshelfer". In dieser Hinsicht haben sie viel Gemeinsames mit den Enzymen in unserem Körper. Sie initiieren, beeinflussen und steuern innere Prozesse in der ganzen Tiefe unserer Existenz.
Yogaübungen haben Brückenfunktion. Sie erschöpfen sich nicht in sich selbst, nicht in einer perfekten Ausführung oder gar in einer ästhetisch reinen Form. Sie sind Mittel zum Zweck. Sie zielen auf Veränderung und Entwicklung. Sie bilden Brücken zu tiefen Ebenen unserer Lebendigkeit und unserer Existenz.
Die gegenwärtige Yogaszene in den westlichen Ländern zeigt ein zwiespältiges Bild. Im Vordergrund stehen wohl eher Yogakurskonzepte mit stark körperbetonten Zielsetzungen. Die Annahme mag in diesem Zusammenhang erlaubt sein, dass sich die allgemeine Leistungsbezogenheit und der Körperkult als prägende Erscheinungen unserer Zeit stark auf die Yogakursgestaltung auswirken.
Dies betrifft vor allem auch Yogakurse, die sich im Umfeld der Fitness- und Wellnessindustrie befinden. Halten wir noch einmal fest: Hatha Yoga ist nur Yoga, wenn die Übungen eindeutig Brückenfunktion haben. Sie weisen über die blosse Übung hinaus. Sie erschliessen den Lernenden neue Erfahrungsfelder. Sie dienen der Entfaltung geistiger Fähigkeiten. Sie setzen eine psycho-spirituelle Entwicklung in Gang und führen zu mehr Bewusstheit. Mehr Bewusstheit, das ist der springende Punkt! Diese bildet die Basis für tiefgreifende Veränderungen in unserer Existenz. Die Entwicklung führt dabei in eine ganz bestimmte Richtung: weg von der Polarität mit all ihren eingrenzenden Seins- und Handlungsweisen, hinein in ein neues Bewusstsein ganzheitlicher Prägung.
Persönliches
Als ich vor über 40 Jahren mit Hatha Yoga in Kontakt kam, stürzte ich mich voller Leidenschaft und Ehrgeiz auf die angebotenen Übungen. Aus der hathayogischen Übungspalette wählte ich vor allem die schwierigsten Asanas und Pranayamas aus, wie etwa Dhanurasana (Bogen), Sirshasana (Kopfstand), Viparita Karani Mudra (eine Schulterstandvariante mit Bandha), Kapalabhati (wörtlich: "scheinender Schädel", eine intensive Nasen-Ausatemtechnik), Bhastrika (Blasebalg-Atemtechnik). Von verschiedenen Zen-Seminaren angeregt, übte ich begeistert langandauernde Meditationssequenzen. Weder bei den Stellungsabfolgen noch beim langen Sitzen achtete ich auf mögliche Kontraindikationen. Das "Machen-Können" in einem gewissen Wettbewerb mit mir selbst, ein gewisses Leistungsstreben und eine starke Perfektionstendenz prägten meine frühe Yogapraxis. Der eigentliche Hintergrund yogischer Bemühungen blieb mir jedoch weitgehend verborgen. Eine wesentliche Veränderung in meinem Leben konnte ich nicht feststellen, ausser dass nach einigen Jahren des Übens "meine" Migräne allmählich verschwand und ich im körperlichen Bereich das Gefühl hatte, eine sehr hohe Beweglichkeit entfaltet zu haben. Ich werde in Kapitel 3. im Abschnitt "Persönliches" auf das Thema "Migräne" zurückkommen. Ein nennenswerter Wandel in der Übungsweise und im tieferen Verständnis setzte erst spät ein. Mit der Ausbildung zum Yogalehrer – in der Übergangsphase zu meiner Pensionierung – begann ich mich intensiver mit dem Komplex "Yoga" auseinander zu setzen. Vor allem wurde mir der Aspekt der geistigen Schulung über die Yogapraxis mehr und mehr bewusst. Anatomie- und Physiologiekenntnisse weiteten meinen Horizont aus in Richtung eines anatomisch richtigen Übens. Auch mein früh einsetzendes Unterrichten von Yoga mit Kursen für Strafgefangene, Blinde, Hörgeschädigte, Senioren und Seniorinnen begann zusehends meine persönliche Übungsweise zu beeinflussen. Ich übte einfachere Yogastellungen, wählte die Übungen vermehrt nach meinem momentanen Befinden aus, achtete auf die Integration von sanften Übergängen und ausgleichenden Übungen und bezog die Atmung sehr bewusst im begleitenden und unterstützenden Sinne in meine Übungsweise mit ein. Meditationen gestaltete ich für mich in der Form von kürzeren, intensiven Übungssequenzen voller Wachsamkeit und innerer Präsenz. Ehrgeiz und Leistungsstreben fielen vollends von mir ab. Ich "machte" nicht mehr eine Übung, ich liess mich vielmehr von den Übungen "tragen und leiten". Die Übungshektik, die meine ursprüngliche Yogapraxis prägte, verblasste und machte einer Atmosphäre Platz, die sich friedlich, freudvoll und entspannend anfühlte.
Zusammenfassung
Hatha Yoga verfügt über einen immensen Schatz an Übungen, der laufend angereichert wird. Jede einzelne Übung besitzt ihr ganz spezifisches Potenzial. Dieses ist geeignet, die Übenden in unterschiedlicher Weise zu berühren. Alle Facetten der Lernenden werden durch die Übungen differenziert angesprochen: Skelett und Muskeln, Organe und Systeme, geistige Kräfte und immer auch teilbewusste und unbewusste Innenbereiche. Unter dem Blickwinkel, dass über eine geeignete Übungsweise wichtige Fähigkeiten wie Konzentration und Achtsamkeit gefördert werden können, hat die Art und Weise der Umsetzung dieser Übungen eine hohe Bedeutung. Im Rahmen eines Hatha Yoga Konzeptes, in welchem die Kompetenzschulung eine akzentuierte Berücksichtigung erfährt, entpuppt sich das hathayogische Übungsangebot als ein wirksames Werkzeug, das innere Entwicklungen auslösen und unterstützen kann. Dies ist mit der in diesem Kapitel erwähnten sogenannten "Brückenfunktion" gemeint. Damit Yogaübungen in ihren jeweiligen Funktionen fruchtbar zur Geltung kommen können, müssen Yogalehrende als authentische Hatha Yoga Sachverständige





























