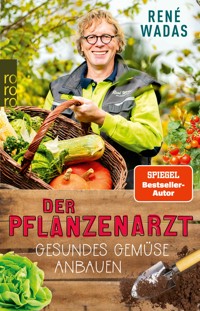9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Erste Hilfe für alle Hobbygärtner! Gartencenter und Zeitschriften versprechen viel, doch im Gemüsebeet, Schrebergarten oder auf dem Balkon blüht und gedeiht längst nicht immer alles so, wie man es sich wünscht. Hier kommt Pflanzenarzt René Wadas ins Spiel: Schädlinge, Ungeziefer und Pflanzenkrankheiten sind sein Spezialgebiet. Mit seiner mobilen Pflanzenapotheke und viel Einfühlungsvermögen kann der Pflanzendoktor fast allen grünen Patienten helfen, seien es kränkelnde Rosen, Bonsais, Rasen oder Bäume. Und das in den meisten Fällen ganz ohne Chemie! In seinem Buch erzählt er von seinen spannendsten Fällen und gibt hilfreiche Tipps, mit denen alle Hobbygärtner selbst dafür sorgen können, dass ihre Schützlinge gesund bleiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 279
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
René Wadas
Hausbesuch vom Pflanzenarzt
Tipps und Tricks für Garten und Balkon
Über dieses Buch
Erste Hilfe für alle Hobbygärtner!
Gartencenter und Zeitschriften versprechen viel, doch im Gemüsebeet, Schrebergarten oder auf dem Balkon blüht und gedeiht längst nicht immer alles so, wie man es sich wünscht. Hier kommt Pflanzenarzt René Wadas ins Spiel: Schädlinge, Ungeziefer und Pflanzenkrankheiten sind sein Spezialgebiet. Mit seiner mobilen Pflanzenapotheke und viel Einfühlungsvermögen kann der Pflanzendoktor fast allen grünen Patienten helfen, seien es kränkelnde Rosen, Bonsais, Rasen oder Bäume. Und das in den meisten Fällen ganz ohne Chemie! In seinem Buch erzählt er von seinen spannendsten Fällen und gibt hilfreiche Tipps, mit denen alle Hobbygärtner selbst dafür sorgen können, dass ihre Schützlinge gesund bleiben.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, April 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Redaktion Regina Carstensen und Ulrike Gallwitz
Umschlaggestaltung ZERO Media GmbH, München
Umschlagabbildung Andreas Brunke
ISBN 978-3-644-40356-7
Hinweis: Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Meinen Wegbegleitern, die nicht mehr auf der Blütenseite der Pflanzen wandeln, sondern auf der Wurzelseite
Ein klarer Fall für den Pflanzenarzt!
Erwarten Sie jetzt bloß nicht ein ultimatives Handbuch, das Ihnen dabei hilft, jedem Erdfloh, jeder Schnecke oder jeder schwarzen, grünen oder bleichen Laus in Ihrem Garten oder in der Wohnung auf Ihren Zimmerpflanzen den Garaus zu machen. Dafür gibt es dicke Fachbücher, die alles akribisch auflisten, diesen Ehrgeiz habe ich nicht. Stattdessen verfolge ich ein vielleicht nicht ganz übliches Ziel: Ich möchte Ihnen Lust auf den Garten machen, auf Grün überhaupt, und das ganz ohne Stress. Viele Gartenliebhaber betrachten ihren Garten mit verbissenem Blick, werden unruhig, wenn eine Rasenkante nicht akkurat geschnitten ist, wenn es in den Blumenbeeten die geringsten Erdbewegungen gibt, weil sich ein Käfer dem Rittersporn oder dem geliebten Ginster nähert. Fraßschäden! Der Gedanke daran bringt so manchen zum Schwitzen, noch bevor überhaupt etwas passiert ist. Und welkt einmal ein Salatblatt im Gemüsebeet, ist die ganz große Krise vorprogrammiert, eine Katastrophe schlechthin, nicht einmal das abendliche Grillen kann dann ablenken. Stress gibt es genug im Leben, es wäre gut, wenn man ihn an der Gartenpforte zurücklassen würde.
Ein Garten, der Freude macht, ist einer, bei dem man auch mal alle fünfe gerade sein lassen kann, in dem man sich mit Nachbarn austauscht, Tipps bekommt, herumexperimentiert und sich von dem inspirieren lässt, was man selbst in der Natur beobachtet. Die persönlichen Erfahrungen sind die wichtigsten, so war es jedenfalls bei mir gewesen, als ich mich dazu entschloss, nicht nur Gärtnermeister, sondern auch Pflanzenarzt zu werden. Humanmediziner sind ständig auf der Suche nach neuen Medikamenten, nach neuen Impfstoffen, um Patienten besser heilen zu können, versuchen, die menschliche Natur immer genauer zu verstehen, das verborgene Leben in uns. Aber auch Pflanzen und Insekten, die gemeinhin als Schädlinge bezeichnet werden, haben ein geheimes Leben, das wir uns nur durch Betrachtungen und Überlegungen erschließen können.
Pinselkäfer (Trichius fasciatus)
Ich bin kein Mensch der Planung, ich kann sicher für Sie eine Art Leitfaden spinnen, aber am Ende entsteht alles aus dem Tun heraus. Wenn ich einen Garten plane, sind nachher nicht immer die Pflanzen dabei, an die man einmal gedacht hat. Suche ich nämlich auf dem Großmarkt Pflanzen aus, sind jedes Mal welche darunter, die mir zurufen: «Ich möchte mit! Ich gehöre genau dahin, wo du hingehst.» Und seltsamerweise gedeihen diese Pflanzen allesamt prächtig. Ähnlich kann es Ihnen passieren.
Jeder Garten blüht auf seine Weise, nie nach Lehrbuch. Inzwischen denke ich, dass ich die Pflanzen verstehe und weiß, wer mit wem zusammen sein möchte und wer nicht. Nur ein Garten, in dem alle Pflanzen gut miteinander auskommen, ist gewappnet vor den Angriffen diverser Übeltäter. Pflanzen rufen mir nicht nur zu, sie kommunizieren auch mit mir – mit Ihnen. Die lästigen Plagegeister sind Signale, die Sie deuten können. Können Sie das nachvollziehen, ist Ihnen der grüne Daumen garantiert. Und auch wenn ich Ihnen von meinen Erfahrungen erzähle, so heißt das noch lange nicht, dass meine Erkenntnisse auf Ihren Garten oder Ihre Zimmerpflanzen übertragbar sind. Bei Ihnen kann alles ganz anders sein. Ich gebe Ihnen nur Anregungen, um eigene Erfahrungen zu sammeln.
Ja, da haben Sie jetzt den Salat. Statt permanent Tipps zu bekommen, nehme ich Sie mit auf eine ungewöhnliche Reise zu meinen Hausbesuchen, nicht ohne meine grüne Arzttasche, meine mobile Pflanzenapotheke. Ich erzähle Ihnen, wie großartig meine Patienten sind, die Pflanzen und die sogenannten Schädlinge, wie sie faszinierende Nachbarschaften und Feindschaften pflegen, wie klug und intelligent sie sind, wie sie hören und riechen, wie sich Pflanzen selber helfen können. So komme ich ohne chemische Keule aus, setze stattdessen auf eine große Portion Einfühlungsvermögen.
Sicher denken Sie jetzt: Wie verrückt ist der denn? Aber wenn man sich viele Jahre damit auseinandersetzt, was die häufigsten Probleme im Garten, auf dem Balkon, der Terrasse oder im Wohnzimmer auf der Fensterbank sind, erkennt man, dass diese meist nicht tierischen Ursprungs sind, sondern dass es sich um physiologische Schäden handelt. Die Schäden entstehen, weil man die Pflanze falsch behandelt. Eine Pflanze kann mit Schädlingen umgehen, mit Pilzkrankheiten, aber eine Pflanze kommt nicht mit zu wenig Licht zurecht, mit zu kleinen Töpfen, kommt nicht ohne Dünger aus, verträgt nicht zu viel Wasser und erst recht keinen falschen Standort. In den meisten Fällen hat nicht die Pflanze etwas, etwa eine Krankheit, wie vermutet wird, sondern es ist der Mensch, der ihr Probleme bereitet.
Jetzt kann ich Sie nur noch auffordern: Chillen Sie in Ihrem Garten! Legen Sie sich in die Hängematte oder mähen Sie Ihren Rasen. Gartenglück kann so oder so aussehen, jeder kann in diesem grünen Raum tun und lassen, wie es ihm beliebt. Nur eines darf nie fehlen, der Respekt vor der Natur und ihren genialen Errungenschaften im Laufe der Evolution.
Unser Mäusefänger beim Mittagsschlaf
Und denken Sie daran: Pflanzen lassen sich nicht hetzen, sie haben ihren eigenen Rhythmus – und diesem passe ich mich an. In der Winterzeit, wenn die Tage kürzer werden, befinden sich die Pflanzen im Winterschlaf (wie auch der eine oder andere Gärtner). Kommt dann das Frühjahr und die Pflanzen erwachen, werden auch die Gärtner wach und es kribbelt in den Fingern, die Motivation steigt ins Unermessliche. Wie schnell sinkt dann die Laune, wenn es einfach nicht wärmer wird oder es nicht aufhören will zu regnen. Bei meinen Hausbesuchen folge ich dem Kalender und damit den Jahreszeiten. Und folgen Sie nun mir, damit Ihre Schützlinge künftig gesund bleiben.
Kapitel 1Wenn der Elefantenfuß nicht mehr will
Nachwuchs im Hühnerstall bei uns im Garten. Aus den Eiern einer unserer Hennen haben sich die Küken unter großen Mühen, aber mit viel Willen von ihrer schützenden Hülle befreit. Großes Gegacker. Noch reicht der Hühnerstall auf unserem Grundstück aus, überlege ich, während ich die flaumigen gelben Bälle betrachte. Im Suppentopf werdet ihr kaum landen, keiner von uns wird euch schlachten. Glück gehabt, ihr Kleinen!
Von den Haushühnern wandert mein Blick zu den Beeten mit dem Spargel. Aus der Entfernung sieht alles gut aus, das Grün fängt an, üppig zu wuchern. Über viele Jahre hinweg haben ein Freund und ich Spargelpflanzen gezüchtet, grün und weiß, die auf jedem Boden wachsen und leicht zu pflegen sind. Man kann sie sogar auf einem Hochbeet anpflanzen, wenn man seinen Rücken beim Spargelstechen schonen will. Nach dem dritten Jahr kann man ernten. Eine Sensation für alle, die ihren Gemüsegarten lieben und nicht nur Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, Salat, Zucchini, Bohnen oder Erbsen ernten wollen.
In meiner Tasche habe ich ein weißes Blatt Papier, das halte ich unter das Laub einer Spargelpflanze, um festzustellen, ob die Spargellaus (Brachycorynella asparagi) ihr Unwesen treibt. Das Vieh ist graugrün, mit einer mehligen grauen Wachsschicht überzogen und mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen, ungefähr 1,2 bis 1,7 Millimeter ist sie nur groß. Sie hat die unangenehme Eigenschaft, aus der Pflanze die Nährstoffe zu saugen, aber nicht nur das, sie scheidet bei ihrem flegelhaften Tun auch noch eine giftige Substanz aus, die der Spargel überhaupt nicht goutiert. Er reagiert sogar recht heftig auf das Gebaren der Spargellaus, zumal wenn sie nicht vereinzelt auftritt, sondern in Massen über die Pflanze herfällt. Das Laub bleibt dann klein, die Triebe verkrüppeln. Und ein solcher Anblick schmerzt.
Die ersten geflügelten Stammmütter der Spargellaus gehen Ende März, Anfang April auf Tour, abhängig von der Wetterlage, je wärmer, umso besser. Junge Spargelstände sind ihr anvisiertes Ziel, insbesondere haben sie den unteren Bereich der Pflanze im Blickfeld. Bleibt es länger warm, bilden sie die berüchtigten Kolonien und wollen dem Spargel den Garaus machen.
Ich nehme einige Spargeltriebe und klopfe sie auf dem weißen Blatt Papier aus. Eingehend untersuche ich mein Ergebnis – nichts zu erkennen, was nach einem graugrünen Mehlklumpen aussieht. Damit das auch so bleibt, werde ich nächste Woche wieder kontrollieren. Zwar ist dieser Frühling nicht gerade trocken, und hohe Temperaturen sind auch nicht angesagt, aber das kann sich wöchentlich ändern. Faustregel für alle Blattläuse: Je trockener Frühling und Sommer sind, umso stärker befallen die Läuse die Pflanzen. Feuchte Witterung mögen die ungefähr 850 Blattlausarten, die in Mitteleuropa leben (weltweit sind insgesamt 3000 Arten bekannt), nicht, da verkrümeln sie sich schnellstens.
Sollten sie sich aber doch mal eingeschlichen haben, gibt es ein gutes und bewährtes Mittel, um den Kolonisten zu verstehen zu geben, dass sie unerwünscht sind: Natur-Pyrethrum. Ohne das könnte ich meinen Beruf als Pflanzenarzt auf naturheilkundlicher Basis kaum ausüben. Es ist ein Nervengift, das schon die Römer kannten, sie vertrieben damit die Läuse auf ihrem Kopf und die Flöhe am Körper sowie im Bett, im Flohhalsband von Hunden ist es auch heute noch enthalten. Gewonnen wird es aus Chrysanthemen, die das Kontaktgift einst für sich entwickelt haben, um Schädlinge davon abzuhalten, sich auf ihren hübschen Blüten heimisch zu fühlen. Ganz schön schlau, was sie sich da haben einfallen lassen, um ihre eigene Evolution voranzutreiben. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist Pyrethrum in gereinigter Form als Pflanzenschutzmittel zugelassen und darf in der ökologischen Landwirtschaft angewendet werden.
Gerade schütte ich den kleinen Kontrollhaufen vom Papier aufs Beet zurück, als mein Handy klingelt. Ich schaue aufs Display, die Nummer ist mir unbekannt, eine Festnetznummer, der Anruf kommt eindeutig nicht aus Niedersachsen, in diesem Bundesland kenne ich mich gut aus. Börßum, wo ich wohne, liegt nicht weit von Braunschweig im nördlichen Harzvorland, leicht hügelig, wunderschön.
«Hallo?», sage ich.
«Ach, Herr Wadas, gut, dass ich Sie erreiche. Ich bin so traurig.»
Der Stimme nach ist die Anruferin um die sechzig, aber schon so manches Mal habe ich mich bei meinen Einschätzungen getäuscht, nach oben und nach unten hin.
«Sie sollten nicht traurig sein», sage ich vorsichtig, denn ich weiß ja nicht, was sie zu dieser Bemerkung veranlasst hat.
Ich höre ein unterdrücktes Weinen, dann: «Sie wohnen ja so weit weg, und das mit dem Vorbeikommen gestaltet sich sicher schwierig für Sie, aber Sie müssen sich ins Auto setzen, am besten noch heute, ich habe ein ganz großes Problem.»
Sachlich frage ich nach, es könnte ja auch sein, dass die Frau sich verwählt oder meinen Beruf missverstanden hat: «Geht es dabei um eine Pflanze?»
«Ja. Um die wertvollste Pflanze, die ich besitze. Sie müssen kommen, so rasch wie möglich.» Nun bricht die Anruferin in Tränen aus. Ich kenne das, für manche Menschen sind Pflanzen so wichtig wie ein Haustier oder sogar wie die eigenen Kinder. Hin und wieder werden diese sogar mehr geliebt als Vier- oder Zweibeiner.
«Beruhigen Sie sich», sage ich. «Das bekommen wir sicher schon hin.» Optimismus kann manchmal für den ersten Moment die beste Medizin sein. «Worum geht es denn überhaupt?»
«Um einen Elefantenfuß. Er scheint einzugehen, er bekommt braune Blätter, aber er darf nicht eingehen. Ich habe ihn von meiner Tochter. Es ist das Wichtigste, was ich noch von ihr übrig habe. Sie ist nicht mehr am Leben.»
Ich muss schlucken. Bei einer solch traurigen Geschichte ist es nur zu verständlich, dass die Anruferin derart aufgewühlt ist. Aber eigentlich ist ein Elefantenfuß (Beaucarnea recurvata) eine recht anspruchslose Zimmerpflanze, die auch nur selten umgetopft werden muss, weil sie so langsam wächst. Der Name «Elefantenfuß» passt, denn nach unten hin wird der Stamm breiter, und die Rinde erinnert an die Haut eines Dickhäuters.
«Wo wohnen Sie denn?», will ich nun wissen.
«In Rheinland-Pfalz, das ist für Sie wirklich ein weiter Weg, ich weiß. Aber ich bezahle Ihnen alles, auch ein Hotel, Hauptsache, Sie schauen sich den Elefantenfuß an.»
«Gibt es nicht eine gute Gärtnerei in Ihrer Nähe? Es sind einige Kilometer, die ich zu fahren hätte, und ich möchte Ihnen nicht so viele Kosten verursachen.»
«Ich habe mehrere Gärtnereien aufgesucht, aber niemand hat mir helfen können, es war zum Verzweifeln. Und dann habe ich Sie im Internet gefunden. Bitte, Sie sind meine letzte Hoffnung. Ich wohne auch in einer Gegend, wo es wunderbaren Wein gibt.»
Wenn das mal kein Grund ist, einen kleinen Ausflug zu machen. Nachdem mir Frau Krüger ihre Adresse mitgeteilt hat, gebe ich ihr das Versprechen, mich gleich auf den Weg zu machen. Ich freue mich auf eine landschaftliche Abwechslung, das Harzvorland habe ich jeden Tag vor Augen, nicht aber das sonnenverwöhnte Mittelgebirge mit den hübschen Flusstälern von Rhein, Nahe, Mosel, Ahr und Lahn. Und da gerade keine wichtigen Termine anliegen und man als Pflanzenarzt immer auch auf Notfälle eingestellt ist – und dies scheint einer zu sein –, packe ich ein paar Sachen für eine mögliche Übernachtung zusammen, greife zu meiner «Arzttasche», die aus Leder und nicht braun ist wie jene, die Humanmediziner in Vorzeiten bei ihren Hausbesuchen benutzt haben, sondern grün mit einem weißen Kreuz. Zum Schluss verabschiede ich mich von meiner Frau Silvia, der ich die Situation kurz erkläre. Sie kennt meine Einsätze, wünscht mir, dass ich den Elefantenfuß retten kann.
«Es wird heute spät, ich will möglichst nicht dort übernachten», rufe ich ihr noch zu, die oben auf den Treppen unseres Hauses steht. Rund 400 Kilometer liegen vor mir; wenn es keine großen Staus gibt, rechne ich aus, kann ich gegen Mitternacht vielleicht wieder zu Hause sein. Die Kinder, die in der Schule sind, werden schon schlafen.
Und dann bin ich weg.
Es ist ein warmer Frühlingstag, überall blühen gelb die Rapsfelder, sie scheinen alles zu geben, um die letzte Farbe aus sich herauszuholen. Der Himmel ist selbstverständlich blau, oben schwirren ein paar kleine Wolken herum, die sich aber immer wieder auflösen. Sie haben aufgegeben, sich zusammenzuballen, haben nach einigen Anstrengungen bemerkt, dass sie keine Kraft dazu haben. Irgendwann wird ihre Zeit schon kommen, wo sie der Sonne jeden Durchgang verbauen und dann triumphieren können: Wir sind schneller da, als ihr Menschen es euch heute vorstellen könnt. Vielleicht schon morgen.
Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wieder in der Stadt zu leben, dabei bin ich in Berlin groß geworden, mittendrin, in Kreuzberg, an einer vierspurigen Straße mit viel Asphalt und Beton drum herum. Abends ist man mit dem Geräusch von Autos eingeschlafen und morgens mit ihm aufgewacht. Der Vorteil unserer Wohnung war jedoch, dass unsere Straße nahe der Hasenheide lag, eines riesigen Parks in Neukölln an der Grenze zu Kreuzberg, in dem Friedrich Ludwig Jahn, besser bekannt als Turnvater Jahn, seinen ersten Turnplatz eröffnete. Gut siebzig Jahre später kam es auf dem fünfzig Hektar großen Gelände zu einem Duell zwischen einem Offizier und einem Richter, da der Offizier eine Liebesbeziehung zu der Ehefrau des Richters unterhielt. Theodor Fontane griff dieses Drama in seinem Roman Effi Briest auf, bei ihm hieß der Offizier jedoch Baron Geert von Innstetten, der in Wirklichkeit den Namen Armand Léon Baron von Ardenne trug.
Meine Eltern erklärten den Park, aus welchen Gründen auch immer, für gefährlich, er sei «verrucht», hieß es, zu umgehen wie eine verruchte Eckkneipe, in die man auch nicht hineingehen durfte. Als Kind war es mir nicht erlaubt, den Park allein zu durchqueren, immer musste ich an der Straße entlanggehen, den Weg außen herum nehmen. Die elterlichen Mahnungen, so eindringlich sie auch waren, wurden aber ignoriert, man setzte sich über sie hinweg, unbekümmert nutzten wir das riesige Areal, um die wildesten Abenteuer zu erleben, ganz ohne dass uns etwas Schreckliches geschah. (Wenn meine Tochter heute das tun würde, was ich damals in Berlin angestellt habe, ich würde verrückt werden …)
Hatten der Park, sein Rasen, seine Beete und seine Bäume auf mich abgefärbt? Die Liebe zum Grünen bei einem Großstadtkind? Oder war es die Klassenfahrt von Berlin nach Lengeleben in Niedersachsen, nicht weit von meinem heutigen Wohnort entfernt, mit einer Jugendherberge mitten in der Wildnis und umgeben von der Ruine eines Wasserschlosses? Wir Schüler streiften durch Lichtungen und Wälder mit unseren Schnitzmessern, und hatte ich es nicht schon in der Hasenheide gespürt, wurde ich nun gewahr, dass Natur etwas ganz Tolles ist. Meine Klassenlehrerin meinte zu mir: «Du machst später mal was im Grünen.» Ich hatte ihre Feststellung nicht ernst genommen. Als Junge wollte ich immer Arzt werden, ich fand Heilen ungemein spannend, aber da ich kein Gymnasium besuchte, schien es fast unmöglich zu sein, diesen Beruf einmal ergreifen zu können. Eine meiner Lehrerinnen schenkte mir dafür ein Buch: Die Wiese lebt. Streifzüge durch die Natur. Ich weiß nicht mehr, welche Lehrerin genau es mir überreicht hatte, aber diejenige kannte mich offensichtlich besser als ich mich selbst.
Schließlich verließen meine Mutter und mein Stiefvater Berlin und zogen nach Börßum, da bestand und besteht der Ort noch immer mehr oder weniger aus einer einzigen langen Straße, ähnlich lang wie die in Berlin-Kreuzberg, nur zweispurig. Und die meisten Gebäude waren nicht grau und hatten mehrere Stockwerke mit vielen Mietern, die man nicht kannte, sondern es standen dort Einzelhäuser, oft noch altes Fachwerk, in denen einzelne Familien lebten, die man nach und nach mit Namen grüßte. Ich ging in dieser Gemeinde zur Schule, und als ich die beendet hatte, meinte mein Stiefvater:
«Du musst was Anständiges lernen.»
«Und was ist was Anständiges?», fragte ich.
«Klempner. Gas, Wasser, die Leute haben ständig Probleme damit. Klempner braucht man immer.»
Und wie man so ist als gut erzogener Junge, begann ich eine Lehre als Klempner, zwei Dörfer weiter. Das Gute an meiner Ausbildung war, dass der Ein-Mann-Betrieb kurz vor der Pleite stand. Mein Stiefvater hatte also nicht ganz recht mit seiner Prognose gehabt. Vielleicht rief auch niemand den Mann zu sich, weil es bessere Handwerker in der Gegend gab, das konnte ich damals aber noch nicht richtig einschätzen. Mich kümmerten die spärlichen Aufträge wenig, denn weil es kaum etwas zu tun gab, ließ mich mein Lehrherr, ein knorriger Typ, so knarzend wie die Stiegen in den Fachwerkhäusern, die Gartenarbeit machen – der Betrieb war in seinem Wohnhaus untergebracht. Rasen mähen, Hecken und Sträucher zurückschneiden, Beete umgraben und Verblühtes entfernen. Das hatte mir so viel Spaß gemacht, dass ich meiner Mutter und meinem Stiefvater nach der Pleite des Klempners vor dem Ende meiner Ausbildung zu verstehen gab: «Ich werde nicht Klempner, sondern Gärtner.» Und so fing ich in der Gartenstadt Wolfenbüttel eine Gärtnerlehre an.
Was fand ich es spannend, als ich zum ersten Mal die Giftspritze in die Hand gedrückt bekam. Musste ich dazu erst in den Schutzanzug steigen, dann hinein in die Gummistiefel, musste ich zum Schluss noch die Schutzmaske aufsetzen, manchmal sogar in Verbindung mit einem externen Beatmungsgerät, so fand ich das verdammt cool. Ich sah in dieser Montur superspacig aus, wobei ich mir nie Gedanken darüber machte, was man denn da versprühte und ob das überhaupt auf Dauer gut für Mensch und Natur war. Wir Lehrlinge hatten nur zu lernen, richtig mit Pflanzenschutzmitteln umzugehen. Über ihre Zusammensetzung machten wir uns wenig Gedanken, wir dachten, dass wir es einzig beim Versprühen nicht unmittelbar einatmen sollten. Das war’s dann auch.
Einmal musste ich in den Gewächshäusern ein besonders giftiges Zeug ausbringen, und mein damaliger Ausbilder kontrollierte aufs genaueste, dass Schutzanzug und Schutzmaske perfekt verschlossen waren und nichts eindringen konnte. Anschließend zog ich, ziemlich schwitzend, denn es war Sommer, mit meiner Giftspritze los, von Gewächshaus zu Gewächshaus. Irgendwann hatte ich das Gefühl, dass jemand in meiner Nähe stand. Schweißüberströmt drehte ich mich um und konnte kaum fassen, was ich da in meinem eingegrenzten Sichtfenster erblickte: Mein Ausbilder hatte nach mir schauen wollen, doch er steckte nicht in seinem Tarnoutfit, sondern trug Badelatschen, kurze Hosen und ein T-Shirt. Wer weiß, wie lange er mir schon zugesehen hatte? Da habe ich gedacht: Das kann es auch irgendwie nicht sein. Wenn der hier ohne Schutzanzug herumlatscht, kann das alles gar nicht so schlimm sein.
Er war ein harter Ausbilder, der genau darauf achtete, dass wir alles richtig machten. Erst dann war er zufrieden, wenn nicht jeder Lehrling einmal in der Woche vor Wut auf ihn heulte. Aber wir lernten viel bei ihm und in dem städtischen Betrieb, heute würde man in einer normalen Gärtnerei nicht mehr so viel Wissenswertes erfahren. Uns wurde noch beigebracht, wie man Begonien aussät. Ein Gramm Begoniensaat ergibt ungefähr 50000 Pflanzen. Und nun versuchen Sie mal, ein Gramm Begoniensaat auszusäen. Die Saat wurde mit Quarzsand gemischt, dann weiter und weiter gestreckt, bis wir das Gemisch in Kästen aussäen durften. Erde wurde nicht gekauft, sondern selbst hergestellt, dazu sammelten wir Unmengen von Laub, das in den Frühbeeten gelagert wurde und darin dann verrottete, wobei wir aufpassen mussten, dass der Laubberg nie zu trocken wurde. Denn unter solchen Bedingungen konnten die Bakterien, die dafür sorgten, dass die Blätter nach und nach zu guter Lauberde wurden, nicht arbeiten.
Von Anfang an war mir klar, dass ich in meinem selbstgewählten Beruf nie viel Geld verdienen würde, Gärtner sind Idealisten. Das spürte ich auch, als ich noch während meiner Ausbildung in eine sogenannte Meister-WG zog. Alles, was der Gartenbau hergibt, war da vertreten und eben alles in Meisterqualität: Gärtnermeister, Floristmeisterinnen. Für mich waren diese Menschen Vorbild und Ansporn. Sie brachten mich etwa dazu, dass ich Unmengen von botanischen Namen büffelte, einschließlich der lateinischen Bezeichnungen. Und bei den gemeinsamen Mahlzeiten schnappte ich eine Menge an grünem Wissen auf.
Eines Tages, ich hatte gerade meine eigene Meisterprüfung abgelegt, das war im Jahr 1997, fing ich dann doch an, den Umgang mit der Natur und den Pflanzen zu hinterfragen. Nach und nach entwickelte ich ein anderes Bewusstsein. Ich dachte, es müsse auch anders gehen, und es geht auch anders.
Pflanzen sind Lebewesen und haben schon vor uns Menschen existiert, beträchtliche Millionen von Jahren haben sie uns voraus. Viele sehen Pflanzen als etwas Selbstverständliches an, denn sie begegnen uns ja jeden Tag, selbst in urbanen Zentren stehen irgendwelche Blumenkübel herum; ein Stadtpark oder ein Spielplatz, umgeben von Bäumen, Sträuchern und Rabatten, ist meist auch nicht weit entfernt. Doch das trifft nicht auf alle Menschen zu, für manche sind Pflanzen etwas ganz Besonderes, etwas Außergewöhnliches. Pflanzen sind für sie Freunde, mit denen sich wichtige Erinnerungen verbinden und damit auch Emotionen. Diese Pflanzenliebhaber leiden, wenn ihren grünen Lieblingen etwas fehlt, sie leiden genauso wie andere, wenn deren Kanarienvogel matt auf der Stange hängt und nicht mehr singt oder wenn jemand aus der Familie die Grippe bekommt. Und so wie Menschen und Tiere erkranken können, können es auch Pflanzen. Ein Arzt für uns Menschen ist schnell gefunden, aber wo finde ich Hilfe bei einer Pflanze? Und wie gehe ich mit ihr um? Mit der Chemiekeule, das hatte ich damals begriffen, war es so eine Sache, und meine war es inzwischen überhaupt nicht mehr. Dennoch gab es vor gut zwanzig Jahren kaum eine Alternative, es war schwer, die richtige Hilfe zu finden. So schrieb ich mir auf die Fahne: «Das ist deine Aufgabe, du musst nach etwas suchen, was Pflanzen heilt und dennoch ökologisch ist.» Vielleicht war es aber auch der liebe Gott gewesen, der gemeint hatte: «Du wirst jetzt Sprecher für die Pflanzen, ich stelle dich mal auf deren Seite, das ist in Zukunft dein Ding.»
Pflanzenarzt wurde ich nicht durch Beschluss, indem ich sagte: «Ab morgen bin ich Pflanzenarzt», sondern es hat sich über Jahre entwickelt. Ich musste eine Menge lernen, nicht so sehr theoretisch, eher durch Beobachten und Ausprobieren, indem ich ständig mit Pflanzen arbeitete. Und auch falsche Entscheidungen traf. Niemand ist so verständnisvoll wie eine Pflanze. Sie können mit ihr alles tun, Sie können jeden Fehler an ihr begehen, der nur vorstellbar ist. Dennoch: Die Pflanze wird jedes Mal zeigen, dass Sie einen Fehler begangen haben. Es gibt immer eine Reaktion. Wenn Sie einen Apfelbaum schneiden und das falsch anpacken, zeigt er im nächsten Jahr genau, was Sie nicht richtig gemacht haben. Schneidet man zu viel ab, wird er im nächsten Jahr stark austreiben mit unzähligen Wassertrieben. Bei einem zu strengen Rückschnitt möchte er nachlegen, weil ihm so viel genommen wurde. Schneidet man die falschen Triebe ab, die Fruchttriebe, gibt es keine Blüten und somit keine Äpfel. So sagt mir der Baum, was ich falsch gemacht habe. Im eigenen Garten ist Learning by Doing möglich.
Baumschnitt – so sollte es nicht sein
Sehr viel habe ich mit Dünger ausprobiert, um die Abwehrkräfte der Pflanzen zu stärken. Entwickelte sich eine Pflanze unter einem bestimmten Dünger hervorragend, wusste ich, dass ich nichts verkehrt gemacht hatte. All diese Dinge merkt man sich, baut das eigene Wissen aus, indem man immer wieder neu kombiniert. Und da eine Pflanze nicht in zwei Tagen wächst, braucht man Zeit und Geduld. Wer ein Pflanzenarzt werden möchte, sollte nicht davon leben müssen, zumindest in den ersten Jahren kann man damit nicht viel Geld verdienen. Wie soll man das auch berechnen, wenn man mal kurz einen Tipp gibt? Man muss schon einen gewissen Spaß daran haben. Auch die Bestätigung wiegt viel auf, wenn die Leute hinterher anrufen und mir mitteilen, dass sie glücklich sind, weil ich ihnen hatte helfen können. Das geht runter wie Butter.
Ich hätte mich auch anders nennen können, aber bei der Bezeichnung «Pflanzenarzt» versteht jeder, was gemeint ist. Nein, das stimmt nicht ganz, denn manche rufen mich auch heute noch an und fragen: «Herr Wadas, ich habe so ein Ziehen im Knie. Was kann ich da machen?» Oder: «Mir ist seit einigen Tagen speiübel, mir geht es gar nicht gut, was können Sie mir da an Mittelchen empfehlen?» Anfangs war ich irritiert gewesen, bis ich begriff, was gemeint war. Ich klärte dann jedes Mal auf: «Sie haben da etwas missverstanden. Ich bin kein Arzt, der Menschen pflanzlich oder homöopathisch behandelt, sondern ein Arzt, der Pflanzen wieder gesund macht.» Aha.
Ohne einen Stau bin ich durchgekommen, habe Nordrhein-Westfalen und Hessen gestreift, nun bin ich in der Nähe von Koblenz und der Mosel. Ein leichter Wind weht, die Weinberge sehen noch kahl aus. Ich muss an die Schädlinge denken, die die Winzer zum Zittern bringen und immer eine Herausforderung sind: Milben, Wespen, Reblaus, Rebzikaden, Mehltaupilze, Dickmaulrüssler und ganz besonders Traubenwickler. Traubenwickler, eine Schmetterlingsart, sind eine Plage, besonders die Larven der zweiten Generation sind gefürchtet. Sie fressen gern und viel, aber das ist nicht das größte Problem. Bei ihrem großen Fressen werden die verletzten Beeren von einem Grauschimmel überfallen, verfaulen dann, ohne dass sie je reif werden. Um weniger Chemie einzusetzen, versuchen Winzer es mit einer «Verwirrmethode», um auf natürliche Weise eine Massenentwicklung von Traubenwicklern zu verhindern. Dabei werden Ampullen mit weiblichen Sexualhormonen in regelmäßigen Abständen im Weinberg ausgehängt. Auf diese Weise entstehen Pheromonwolken, die verhindern, dass Männchen gezielt Weibchen zur Begattung aufsuchen.
Ich muss schmunzeln, denn bei Pheromonfallen fällt mir mein Freund Jürgen Heinz ein. Vor einigen Jahren wurde ich in einen Kleingartenverein eingeladen, ein älterer Herr hatte mich bestellt, er war der erste Vorsitzende des Vereins und auch überregional tätig, ein ganz hohes Tier also, was das Kleingartenmetier betraf, und natürlich wusste er alles. Und das wollte er mir gegenüber demonstrieren. Aber nicht nur er hatte aus diesem Grund ein großes Interesse daran, dass ich zu ihm in sein Kleingartenreich kam, sondern auch alle seine Kleingartenfreunde und Kleingartennachbarn. Sie hatten zusammengelegt, um mich für einen Besuch zu bezahlen. Ich war dem älteren Herrn ein Dorn im Auge. «Wie kann der bloß in meinem Revier wildern?», stand unübersehbar in seinem Gesicht geschrieben.
Bevor ich die anderen Kleingärtner traf, fing Jürgen Heinz mich ab und führte mich durch die Kleingartenanlage. Er war sicher an die siebzig, ungemein rüstig, mit seinen grauen Augen musterte er mich von oben bis unten, der Scheitel seiner weißen Haare schien bewusst gerade gezogen zu sein, die Bügelfalten seiner Hose waren perfekt, hier stand einer vor mir, der den Ton angeben wollte.
«Ich zeige Ihnen mal, was ich alles bislang gemacht und veranlasst habe», sagte er laut und deutlich, als hätte er jemanden vor sich, der sich weigerte, ein Hörgerät zu tragen. Das kam unter seinen Kleingartenfreunden sicher öfter mal vor.
Ich sollte natürlich alles wunderbar finden, das war mir sofort klar. Als Erstes wies er auf jene Pheromonfallen, die männliche Falter anlocken sollen. Zu ihnen gehörten in diesem Kleingarten zum Beispiel der Apfel- und der Pflaumenwickler, beide werden im Obstbau und Hausgarten als Schädling angesehen. Stolz erzählte mir Herr Heinz, bei der letzten Versammlung hätte er alle Kleingartenbesitzer davon überzeugen können, solche Fallen in ihren Obstbäumen aufzuhängen.
Apfel mit Apfelwickler (Cydia pomonella)
Ich sah mir das an, und in jedem Apfel- und in jedem Pflaumenbaum hing dann tatsächlich so eine Falle. Das war aber falsch, eine Maßnahme, die das Gegenteil bewirken konnte. Doch wie erklärte ich ihm das, ohne ihn zu kränken? Schließlich sagte ich: «Stellen Sie sich doch mal vor, ich bin ein Apfelwickler. Ich bin so ein Männchen und fliege hier an diesen Bäumen vorbei. Wenn keine Fallen drin sind, rieche ich da mal ein Weibchen, dort mal eines, und irgendwann fliege ich irgendwo in einen Baum hinein und befruchte ein Weibchen. Danach bin ich auch schon wieder weg. Und nun sehen Sie sich das hier an, Herr Heinz. Hier fliege ich an den Bäumen vorbei, und in jedem Baum hängt eine Pheromonfalle. Da werde ich als männlicher Wickler komplett verrückt, denke, wow, hier riecht ja alles so super nach Weibchen. Und was mache ich? Ich rufe meine Kumpels an, und die kommen flugs vorbei, eine solche Gelegenheit wollen sie sich nicht entgehen lassen. Eine Sexorgie bleibt nicht aus. Denn einige meiner Spezis sind ziemlich helle, die bleiben nicht an der Falle kleben, die nehmen sich noch ein reales Weibchen, das im Baum ist, und befruchten es mit aller Lust und Laune. Bei einem solch wüsten Treiben merkt man als Obstbaumbesitzer im Endeffekt keinen Unterschied. Ob mit oder ohne Falle, die Wickler vermehren sich rapide.»
«Mmh.» Jürgen Heinz blickte mich konsterniert an, eine kleine Windbö strich durch seine Frisur, einzelne Haare zitterten. Der Scheitel interessierte ihn nicht mehr, ihm war anzusehen, dass er das Problem genauestens überdachte. Nach einer Weile sagte er: «Sie meinen, die Fallen müssen weg vom Baum? Und dann auch nicht so viele?»
Mein Gegenüber war selbst auf die Lösung gekommen, er hatte zudem offenbar nicht das Gefühl, ich hätte ihn womöglich belehrt. Als Pflanzenarzt belehrend zu wirken, wäre der größte Fehler. Feingefühl ist angebracht – wie gehe ich mit den Pflanzenliebhabern so um, dass ich sie auf meine Seite bekomme? Den schwierigsten Personen versuche ich klarzumachen, dass alles ihre Idee ist und nicht meine. Das praktiziere ich auch zu Hause im Umgang mit meiner Frau, da muss ich ganz diplomatisch vorgehen, wenn ich etwas verändern möchte. Im Nachhinein ist sie dann felsenfest davon überzeugt, dass es ihr Einfall gewesen war.
«Am besten ist es, die Fallen zwei, drei Meter vom Baum entfernt aufzuhängen. Ich will die Wickler ja vom Baum weg- und nicht hineinlocken.»
Jürgen Heinz strich sich mit seiner kräftigen Hand, die von Altersflecken überzogen war und sicher schon manchen Garten umgegraben hatte, durch das weiße Haar, das noch sehr dicht war. Der Scheitel war jetzt vollends im Eimer. «Ja, ja, recht haben Sie. Das kann ich nicht anders sagen. Und wie viele Fallen sollen wir aufhängen?»
«Es reicht, wenn sie in der Nähe jedes zweiten Baums angebracht werden.»
Seitdem sind Jürgen Heinz und ich beste Freunde. Immer wenn er nicht genau weiß, wie er mit einer Sache umgehen soll, ruft er mich an.
Nun nähere ich mich Koblenz, fast habe ich das Ziel meiner SOS-Reise erreicht.
Kapitel 2Heikle Familienangelegenheiten – oder die Sache mit dem grünen Daumen
Ich klingle, am Türschild steht «Krüger», ich müsste richtig sein. Ich befinde mich vor einem hübschen Haus mit Sprossenfenstern, im Vorgarten blüht es in allen Farben. Frau Krüger öffnet sofort die Tür, als hätte sie mich in diesem Moment erwartet. Ihr Alter hatte ich gut getroffen, sie wirkt zierlich, doch ich kann mir vorstellen, dass sie auch schon mal zwei Kleidergrößen mehr gehabt hat. Die rötlich blonden Haare, mit Sicherheit gefärbt, sind kinnlang geschnitten, sie trägt weiße Hosen und eine Bluse mit einem feinen geometrischen Muster, dazu eine Perlenkette.