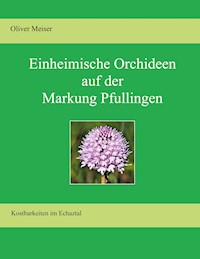Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Das west-transdanubische Dorf Hegykö liegt am Südufer des Neusiedler Sees in einer Region, die - da Grenzregion zwischen Ungarn und Österreich - sowohl landschaftlich als auch kulturell viel zu bieten hat. Der Autor, der mit dem Ort und seiner Umgebung seit langem vertraut ist, gibt Einblick in Landschaft, Natur, Geschichte und viele andere Besonderheiten. Zahlreiche Fotos und Tabellen etc. verdeutlichen die einzelnen Themen. Ein interessantes Buch für alle, die sich mit dem Neusiedler See beschäftigen und ihre Ferien in dem schönen Dorf mit seinem bekannten Thermalbad verbringen wollen. Empfehlenswert auch für Bürger von Buchholz im Westerwald, die sich intensiver auf einen Besuch in ihrer Partnergemeinde vorbereiten möchten!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HEGYKŐ
Inhalt
Vorwort des Autors
Der Naturraum - ein gesegneter Landstrich
1.1 Im Herzen Europas: Hegykő und der Neusiedler See
1.2 Angenehmes Klima mit reichlich Sonnenschein
1.3. Auf dem Boden der Tatsachen: aus Geologie und Erdgeschichte
1.4. Heilsames Wasser - die Thermalbäder
1.5. Reiche Lebewelt - von Tieren und Pflanzen
1.6. Grenzenloser Schutz - der Nationalpark Neusiedler See
Wechselvoll: die Geschichte
2.1. Die Anfänge
2.2. Kupferzeit (ab ca. 5500 v.Chr.)
2.3. Bronzezeit (ab ca. 2200 v. Chr.)
2.4. Eisenzeit und Kelten (ab ca. 800 v. Chr.)
2.5. Römerzeit (ab 15 v. Chr. bzw. 9 n. Chr.)
2.6. Hunnen, Langobarden und Awaren (ab 433 n.Chr.)
2.7. Die ungarische Landnahme (ab 895 / 896)
2.8. Hegykő ab dem hohen Mittelalter
2.9. Von der Zeit der Türkengefahr bis ins 18. Jahrhundert
2.10. Hegykő nach den Urbarialordnungen von 1767 und 1804
2.11. Ab 1849 / 49
2.12. Hegykő im Ersten Weltkrieg
2.13. Zwischenkriegszeit und Horthy-Ära
2.14. Hegykő im Zweiten Weltkrieg
2.15. Nach 1945
2.16. Grenze, Eiserner Vorhang und Grenzöffnung
2.17. Neuere Entwicklungen an der Grenze
2.18. Deutschsprachige Siedler der Region
Einige Erkundungen im Ort
3.1. St. Michael – ein Besuch der Dorfkirche
3.2. Bildsäulen, Denkmäler und Wegekreuze: ein Spaziergang
3.3. Echt Spitze! – Das Hegykőer Spitzenhaus
Leben früher und heute - aus Alltag und Festtag
4.1. Aus der Fischerei
4.2. Die Schilfernte
4.3. Weiteres aus Landwirtschaft und bäuerlichem Leben
4.3.1. Lebensmittel – ihr Transport und ihre Aufbewahrung
4.3.2. Wasser
4.3.3. Über den Marktgang
4.3.4. Über die Viehzucht
4.3.5. Brot und Brotbacken
4.3.6. Textilherstellung, Bekleidung und Tracht
4.4. Erziehung und Bildung
4.5. Volksbräuche
4.5.1. Rund ums Kirchenjahr
4.5.2. Das Pilgern nach Mariazell
4.5.3. Hochzeit
4.5.4. Tod und Begräbnis
4.5.5. Nationale Gedenktage und andere Feierlichkeiten, Kultur
Bekannte(s) aus Hegykő
5.1. Géza-Bolla und sein Chor
5.2. Károly Eperjes – von Hegykő auf Bühne und Kinoleinwand
5.3. Geboren in Hegykő – verwandt mit Europa
5.4. Ein Tropfen Pálinka – Tradition und Genuß am Ortsrand
5.5. Gesundes aus Feld und Garten
5.5.1. Gemüse…
5.5.2. …und Obst
Sagen vom Neusiedler See
6.1. Die Entstehung des Neusiedler Sees
6.2. Vom Hany Istók, dem Waasen-Steffel
6.3. Der Fluch der Nixe
6.4. Das verlorene Diplom
Anhang
Gemeindesteckbrief Hegykő:
Vereine in Hegykő
Temperaturen und Niederschläge in der Region
Wetterbeobachtungen 2021
Eine Übersicht über Fische der Region Neusiedler See
Zeittafel mit Ortschronik von Hegykő und Umgebung
Schreibweisen des Ortsnamens Hegykő
Einige Flurnamen auf der Markung Hegykő
Straßennamen von Hegykő
Einwohnerzahlen von Hegykő
Schülerzahlen der Schule von Hegykő
Ordnung muß sein! Sowohl in der Schule…
Glossar spezieller ungarischer Begriffe
Übersetzung der im Text erwähnten Ortsnamen
Leben in Hegykő und Ferien in der Region
Übersichtskarte
Quellenverzeichnis / weiterführende Literatur und Links:
Hinweise zu im Text verwendeten Abkürzungen
Danksagung
Über den Autor
Steppensee
Sommer
Blick, verloren dort im Blau,
Schwalben schwirren, froh ihr Pfeifen,
wogend-goldne Ährenfelder,
morgenmüder Moorgeruch.
Mittagshitze, Staub die Wege,
roter Mohn am Rande glüht,
Weiden spiegeln sich im Wasser,
Wald in sattem Grün ertränkt.
Nachts des Schilfes süßes Flüstern
in den flauen, lauen Lüften
und im Gras der Grillen Grüße
unterm stillen Sternenzelt.
Oliver Meiser (2003)
Steppensee
Winter
Blick, verloren dort im Schilf,
Gräben, schweigend, schwarz das Wasser,
Sonne stirbt in Nebelschleiern,
glänzend-fette Ackerschollen.
Weiden, kahl, im Wintertraum,
Kähne außer ihrer Zeit,
hinter langen Horizonten
Hornsignal der Raaberbahn.
Weite, ausgefahrne Wege,
Himmel öffnet sich bescheiden,
See und bronzefarbne Weite,
weiß ein Kirchlein in der Fern’.
Oliver Meiser (2000)
Vorwort des Autors
Liebe Ferien- und Ausflugsgäste, österreichische Nachbarn, Bürger der Partnergemeinde Buchholz, Ungarndeutsche und ungarische Freunde der deutschen Sprache!
Das 1766 Einwohner (Stand 2021) zählende westungarische Straßendorf Hegykő ist - mit seinem bekannten Thermalbad und in einer reizvollen Landschaft gelegen - ein beliebtes Urlaubs- und Wochenendausflugsziel; einer der freundlichsten Orte auf der ungarischen Seite des Neusiedler Sees.
Manche Feriengäste verbringen dabei sogar mehrere Wochen lang und schon zum wiederholten Male die schönste Zeit ihres Jahres in dieser Gemeinde, sei es, um die Heilkräfte des Thermalwassers auf sich wirken zu lassen oder mit dem Fahrrad die Natur rund um den Neusiedler See zu genießen. Viele begeistern sich auch für die Kunst- und Kulturschätze der Region, die bereits seit langer Zeit besiedelt ist, aber auch in der jüngeren europäischen Geschichte eine wichtige Rolle spielte.
Seit einigen Jahren ziehen kulturelle Events wie das Tízforrás-Festival Besucher an, welche die bunte Mischung aus traditioneller, moderner und klassischer Musik schätzen. Mit dem Spitzen-Museum, dem Csipkeház, hat Hegykő seit 2015 einen weiteren, interessanten Anlaufpunkt, der in- und ausländische Besucher begeistert.
Auch für international bekannte Veranstaltungen wie die Haydn-Festspiele von Fertőd und Eisenstadt, die Seefestspiele von Mörbisch, die Veranstaltungen in den Steinbrüchen von Fertőrákos und St. Margarethen oder die Liszt-Festspiele von Raiding ist Hegykő ein günstiges Standquartier.
Das nahegelegene Sopron hingegen ist eine der schönsten und besterhaltenen mittelalterlichen Städte Ungarns und kann mit einer Reihe von interessanten Museen aufwarten.
Für Tagesausflüge locken nahegelegene Hauptstädte wie Budapest, Wien und Bratislava oder ein Ausflug zu den östlichsten Gipfeln der Alpen wie etwa dem 2076 m hohen Schneeberg, der an klaren Tagen auch von Hegykő aus zu sehen ist.
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wuchs Europa allmählich wieder zusammen. Alte Wunden verheilten und 2004 wurde auch der damals von vielen lang ersehnte Beitritt Ungarns zur Europäischen Union verwirklicht. Doch das Zusammenwachsen Europas beginnt unten an der Basis: bei jedem Einzelnen selbst und mit seiner Bereitschaft, sich dem Nachbarn zu öffnen!
Die leider in den letzten Jahren wieder aufgekommenen nationalistischen Tendenzen in Teilen Europas zeigen aber mahnend, daß man sich auf dem bisher Erreichten nicht ausruhen darf, sondern daß das gute Miteinander weiterhin gepflegt und immer wieder neu erarbeitet werden muß. Der Zweite Weltkrieg und die Teilung Europas geraten bei manchen bereits in Vergessenheit und vielen ist gar nicht bewußt, was das vereinigte Europa als einmaliges Friedensprojekt eigentlich bedeutet. Der Krieg in der Ukraine hat uns hoffentlich geweckt!
Auch die Corona-Pandemie hat jetzt gezeigt, wie verletzlich die Errungenschaften des europäischen Gemeinsamen sind, wenn es etwa plötzlich wieder Menschen erschwert wird, zu ihrem Arbeitsplatz jenseits der Grenze zu pendeln; wenn Dienstleister von ihren Kunden und Ferienorte von ihren langjährigen Gästen abgeschnitten werden. Über Sinn und Unsinn der jeweils von den einzelnen Staaten und deren Regionen durchgeführten Corona-Maßnahmen mag man streiten, und wir werden es diesseits wie jenseits der Grenze sicher noch Jahre nach dem Ende der Tragödie tun.
Es bleibt nur stark zu hoffen, daß die bis März 2020 gewohnte Bewegungsfreiheit, die gerade in unserer Grenzregion so wichtig ist, so schnell wie möglich wieder vollständig und ohne jegliche Hindernisse dauerhaft hergestellt wird.
Steht man auf den Anhöhen am südwestlichen Rand des Dorfes, stellt man fest, daß Hegykő in den letzten 15 Jahren flächenmäßig um ein gutes Drittel gewachsen ist. Zum historischen Kern und „alten Dorf“ kam inzwischen eine große Fläche an Einfamilienhäusern dazu. Alteingesessene Bürger oder deren Kinder aus dem Ort haben neu gebaut und Menschen aus Sopron haben sich mit den im Vergleich zur Stadt günstigeren Grundstückspreisen und der höheren Umweltqualität den Traum vom Eigenheim verwirklicht.
Hegykő und der Neusiedler See – eine vielfältige Region
Tuschezeichnung von Aglája Viktória Meiser (2021)
Aber auch aus anderen Teilen des Landes sind Neubürger zugezogen und nutzen die grenznahe Lage des Dorfes, um in Westungarn oder Österreich mehr Geld zu verdienen als z.B. in ihrer Heimat im Osten des Landes. Desweiteren sorgt die inzwischen von Győr bis Sopron gebaute neue Autobahn M 85, die auch bald bis Eisenstadt führen wird, dafür, daß etwa inländische Touristen schneller unsere Region erreichen. Sie wird aber nach ihrer kompletten Fertigstellung, da Sopron verkehrsmäßig immer mehr ein Nadelöhr geworden ist, auch die Verbindung nach Eisenstadt und zum Großraum Wien erleichtern.
Während viele Ungarn zum Arbeiten und Einkaufen ins nahe Österreich fahren, haben im Gegenzug in den letzten Jahren viele Österreicher, Deutsche, aber auch aus anderen Ländern zugezogene Menschen in Hegykő und Umgebung Immobilien erworben und eine neue Heimat gefunden, sei es, daß sie ganzjährig hier wohnen oder zumindest einen Teil des Jahres hier verbringen. Einige nach dem Aufstand 1956 geflohene Ungarn sind - angereichert um die Erfahrungen der „weiten Welt“ - nach 1989 wieder in ihre alte Heimat zurückgekehrt.
Seit 2001 verbindet Hegykő auch eine Partnerschaft mit dem deutschen Buchholz im Westerwald (Landkreis Neuwied). Trotz einer Entfernung von 764 Kilometern (Luftlinie) finden Begegnungen statt, so daß sich dadurch der Kreis der Fremden, die mehr über unser Dorf wissen möchten, noch erweitert hat.
Das Erscheinen der „Hegykő Helytörténete“ („Ortgeschichte von Hegykő“) des damaligen Bürgermeisters János Völgyi und von Ibolya Szemes im Sommer 2001 hat mich damals zunächst auf die Idee gebracht, dieses Buches eins zu eins einfach ins Deutsche zu übersetzen. Doch schon bald ist im Laufe der Jahre durch Studium vieler anderer Quellen und Hinzufügen neuer Themen und Aktualisierungen dann ein neues und anderes Buch entstanden.
Nachdem im August 2021 mit der Hegykő történelme (Geschichte von Hegykő), herausgegeben von Bürgermeister István Szigethi, nach zwanzig Jahren nun erneut ein Buch in ungarischer Sprache über Hegykő erschienen ist, hatte ich unerwartet noch einmal eine weitere ergiebige Quelle zur Verfügung. Beide Bücher lieferten viel Interessantes, erforderten aber auch enormen übersetzerischen Aufwand.
Aufgrund der Corona-Pandemie über ein unerwartetes Mehr an Freizeit verfügend, habe ich seit 2020 die ganze Situation zum Anlaß genommen, das lange Zeit zu drei Vierteln unvollendet herumliegende Projekt wieder in die Hand zu nehmen und nun endlich zum Abschluß zu bringen. Neue Publikationsmöglichkeiten wie Books on Demand ermöglichen zudem nun auch die Herausgabe von Büchern, die früher aufgrund ihrer regionalen Thematik oder ihres kleinen Leserkreises nur unter finanziellen Verlusten hätten herausgebracht werden können.
So konnte mit dem hier vorliegenden Buch nun endlich auch ein Werk in deutscher Sprache erscheinen. Während das neue ungarischsprachige – wie der Titel ja besagt - sich fast ausschließlich und sehr detailliert mit der Geschichte befaßt, geht dieses hier auch auf naturkundliche Themen ein und schaut an verschiedensten Stellen auch öfter über den Dorfrand hinaus. Es ist vor allem für die deutschsprachigen Gäste von Hegykő, sowie die nahen österreichischen Nachbarn und Nationalpark-Partner gedacht, doch auch einige Ungarn mit entsprechenden Deutschkenntnissen, so hoffe ich, mögen das Buch vielleicht mit Interesse lesen.
Mein Wunsch ist vor allem der, daß sich durch mein Buch vielleicht auch einige Touristen einmal eingehender mit Hegykő und seiner Umgebung beschäftigen. Auffällig ist nämlich, daß viele der in normalen Zeiten zahlreichen Gäste aus dem Bereich um Campingplatz, Thermalbad und den danebenliegenden Restaurants so gut wie nie hinauskommen. Im übrigen Ort sind diese Leute jedenfalls fast nie zu sehen. Vielleicht animiert sie die Lektüre dieses Buches in ihrem Liegestuhl ja, sich einmal aus diesem zu erheben, sich aus ihrer Komfortzone hinauszubegeben und wahrzunehmen, wo sie überhaupt sind.
Mein Bemühen, mehr Wissen über Hegykő zugänglich zu machen und so noch mehr Menschen aus nah und fern dafür zu begeistern, ist gleichzeitig ein kleines Dankeschön an diesen Ort, der auch meiner Familie hier viele schöne Tage gegeben hat.
Von den natürlichen bis hin zu den Volksbräuchen seiner Bewohner faßt dieses Heimatbuch allerlei Wissenswertes über Hegykő und seine interessante Umgebung zusammen. Etliches davon erschloß sich bisher ja leider nur jenen Interessierten, die der ungarischen Sprache mächtig sind.
Ein Lektorat habe ich mir bei diesem Buch erspart – zum einen aus eigenen Kostengründen und zum anderen, um es somit wiederum auch Ihnen möglichst günstig anbieten zu können. Ich hoffe, daß mir bei der Korrekturarbeit nicht zu viele Fehler entgangen sind und bitte, wo etwa doch welche auftauchen sollten, um entsprechende Nachsicht.
Ebenfalls aus preislichen Gründen konnte ich Ihnen in diesem Buch leider auch keine Farbfotos anbieten, was mich etwas schmerzt, zumal ich selber ein begeisterter Fotograf bin und über viele Bilder vom Ort und seiner Umgebung verfüge. Eine Ausgabe mit farbigen Abbildungen und dem dafür notwendigen Papier hätte für Sie dann entweder zwischen dreißig und vierzig Euro kosten müssen oder aber sie hätte die Notwendigkeit von Werbung oder Sponsoren bedeutet, was sehr schnell ungewollte Kompromisse und unerwünschte Abhängigkeiten mit sich bringt.
Da viele Menschen pandemiebedingt und durch die starken Preissteigerungen der letzten Zeit immer weniger im Geldbeutel haben, wollte ich nun auch ein Buch anbieten, das dennoch für möglichst viele leistbar ist und hoffe, mit dieser Ausgabe eine befriedigende Lösung gefunden zu haben, die auch etwa Wochenend-Ausflugsgäste zum „einfach Mitnehmen“ oder „eben mal bestellen oder runterladen“ bewegt.
Um auch andere aktuelle Diskussionen aufzugreifen, möchte ich - auch wenn im Text der Einfachheit halber auf das Gendern verzichtet wurde - an dieser Stelle dennoch ausdrücklich darauf hinweisen, daß ich mit diesem Buch alle Interessierten unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Religion etc. anspreche. Gerade auch, weil in den letzten zwanzig Jahren sehr unterschiedliche Menschen nach Hegykő gezogen sind oder hier Urlaub machen, sei es aus dem Ausland oder auch aus anderen Teilen Ungarns. Das weitere Gedeihen der Region, sowie der Natur- und Umweltschutzgedanke des Nationalparks setzt für eine erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben, vor denen wir stehen, unbedingt ein freigeistiges und harmonisches Miteinander voraus, das sich mit jeglichen auf –ismus endenden Tendenzen nur schwer oder gar nicht verträgt.
In diesem Sinne grüße ich alle, die dieses Buch in der Hand halten, ganz herzlich und lade Sie ein, Hegykő überhaupt oder noch besser kennenzulernen!
der Autor, im Frühling 2022
1. Der Naturraum - ein gesegneter Landstrich
Der Naturraum, in dem Hegykő liegt, hat eine ganze Reihe von Gunstfaktoren aufzuweisen. Dazu zählen das angenehme Klima mit viel Sonnenschein, gute Böden für die Landwirtschaft, eine vorteilhafte Geologie, die das Vorhandensein von Thermalwasser gewährt, sowie eine reiche Flora und Fauna, deren Schutz durch den Nationalpark Fertő-Hanság / Neusiedler See garantiert wird.
1.1 Im Herzen Europas: Hegykő und der Neusiedler See
Hegykő, ein Dorf im westlichsten Ungarn und am Rande der Kleinen Ungarischen Tiefebene (ung. Kisalföld) gelegen, befindet sich am Südufer des in diesem Teil sehr verschilften Neusiedler Sees, der in diesem Bereich auch Silbersee (ung. Ezüst Tó) genannt wird. Die Gemeinde Hegykő liegt im Komitat Győr – Moson - Sopron auf 120 Metern Höhe über dem Meeresspiegel. Die Gemarkungsfläche beträgt 26,87 km2. Sie grenzt an folgende Nachbargemeinden: im Westen an Fertőhomok, im Südwesten an Pinnye, im Süden an Nagylózs, im äußersten Südosten an Röjtökmuszáj, im Osten an Fertőszentmiklós und Fertőszéplak, sowie im Norden an das Dörfchen Sarród. Die Gemarkungsfläche umfaßt neben dem Siedlungsgebiet von Hegykő Schilfgebiete des Neusiedler Sees, Brach- und Weideland, Ackerflächen, sowie – im Süden und Südosten – einige Gebiete mit Laubwald.
In der Vergangenheit wie heute hat der See das Leben der Dorfbewohner stark geprägt. Wenn auch seit dem für Ungarn so schicksalhaften Vertrag von Trianon am 4. Juni 1920 zu zwei Staaten gehörend, ist und bleibt der See ungeachtet aller politischen Verhältnisse ein einheitlicher, geographischer Raum, der vor allem durch die Einflüsse und Wechselwirkungen der nahen Alpen und der ungarischen Tieflandgebiete so interessant ist.
Das „alte Dorf“ von Hegykő, Tuschezeichnung von Aglája Viktória Meiser (2021)
Unterschiedliche Klimazonen, sowie tier- und pflanzengeographische Gebiete treffen hier aufeinander und mischen alpine Erscheinungen mit pannonischen Elementen.
Mit – je nach Wasserstand – 309 bis 320 km2 Fläche, einer Nord-Süd-Ausdehnung von 36 km, einer Breite von 6-14 km und 170 km Uferlinie ist der Neusiedler See nach dem Genfer See und dem Bodensee der drittgrößte See Mitteleuropas, sowie der westlichste einer langen Kette von Steppenseen, die sich von China über Mittelasien bis nach Europa zieht. Durch die Ziehung der neuen Staatsgrenzen nach dem Ersten Weltkrieg ist nur noch ein Viertel des Sees auf ungarischem Territorium verblieben.
Der mittlere Wasserspiegel des Neusiedler Sees liegt bei 115,5 mNN und damit noch 20 m niedriger als das Niveau der Donau bei Bratislava. Die mittlere Wassertiefe des Sees beträgt 1,1 m und nur die tiefsten Stellen erreichen 1,80 m.
Größe und Tiefe des Sees haben sich im Laufe der Geschichte immer wieder verändert. Das reichte von kompletter Austrocknung bis zu höheren Wasserständen als jenem von heute. Es heißt, daß der See seit seiner Entstehung vor 13.000 Jahren bis zu vierhundert Mal ausgetrocknet war.
Hinweise auf Austrocknung oder Wassertiefstand geben Berichte des Kreuzfahrerheers unter Gottfried von Bouillon (1060-1100), der auf dem ersten Kreuzzug im Jahr 1096 den See offenbar ohne Probleme überquerte. Wassermangel herrschte aber auch 1324, dann 1543, 1740 (Austrocknung), 1773, 1811 (Austrocknung) und zuletzt in den Jahren 1865-1871 (mit kompletter Austrocknung v.a. 1868). Nach Austrocknungen überlegte man häufig, das Land gewinnbringend zu nutzen, befand aber nach eingehenderen Studien wie 1866, daß u.a. aufgrund hohen Salzgehaltes der Boden für die Landwirtschaft nicht in Frage käme (vgl. Geschnatter 3/1998).
Was die Wasserhochstände anbelangt, so muß ein erster Rekordpegelstand im Jahr 1074 erreicht worden sein, zu der Zeit, da der ungarische König Salomon (1053-1087) einen Sieg über die Bissener (Petschenegen) errang (vgl. u.a. Geschnatter 1/1999).
Aus einer Schenkungsurkunde, die der ungarische König Imre / Emmerich 1199 für einen Grafen namens Lőrincz ausstellte, geht hervor, daß offenbar zwischen Balf und Fertőrákos damals noch drei weitere Siedlungen lagen, die später wohl durch gestiegenen Wasserspiegel untergegangen sind.
1230 soll der See fünf Dörfer überflutet haben. Bei Sarród lag ein Ort namens Urkony, der verschwunden ist. Auch ein Ort namens Bánfalva, der vor 1318 noch Vitézfölde hieß, taucht später nicht mehr auf. 1501 muß der See seine größte Ausdehnung gehabt haben, die in ähnlichem Ausmaße wohl auch 1677 wieder erreicht wurde. Auch 1741/42, 1797-1801, 1838, ab 1877 (1879 erreichte er den Dorfrand von Hegykő), 1886, in den 1920er Jahren und 1941 war der Wasserstand sehr hoch.
Veränderte seine Form häufig: der Neusiedler. Lazarus-Karte von 1528
1768-69 erreichte der Neusiedler See, wie berichtet wird, sogar die Größe des Plattensees (dieser hat derzeit eine Fläche von 594 m2). Auch 1786 lag die Größe des Sees bei 500 km2 - vielleicht eine Folge des Klimawandels durch eine gewaltige vulkanische Eruption an der Laki-Spalte in Island 1783.
Alte Karten (s.o.) zeigen die unterschiedlichen Formen und Ausdehnungen des Gewässers. Je nach Zustand wurde es See (lat. „lacus“), Sumpf (lat. „stagnum“) oder der sogar Fluß (lat. „fluvius“; vgl. Kiss 2010) genannt. Auf manchen Karten wie jener vom Königreich Ungarn des niederländischen Kartographen und Kupferstechers Joan Blaeu (1596-1673) aus dem Jahre 1664 tauchen die lateinische (Lacus Peiso), ungarische (Fertő) und deutsche Bezeichnung gemeinsam auf: „Peisofewrtew – Newsidlersee“.
Was die schwankenden Wasserstände betrifft, schreibt der ungarische Erzähler Maurus (Mór) Jókai von Ásva (1825-1904) in seinem 1877 erschienenen Werk „Die namenlose Burg“:
„Solch ein eigentümliches Spiel spielte der Neusiedler See oft mit den Vorbeiziehenden. Er ließ seinen Grund trocken. Doch dann kam es ihm auf einmal wieder anders in den Sinn. Erneut nannte er sich See, gewann seine einstige Würde zurück und Felder wie Höfe verschwanden unter dem Spiegel seiner grünen Wellen“
Seit 1901 soll der See zwei Drittel seiner damaligen Wassermenge verloren haben.
Seit Fertigstellung des von 1892 bis 1909 gebauten Einser-Kanals (ung. Hanság-Főcsatorna) kann der Wasserstand durch die österreichisch-ungarische Gewässerkommision geregelt werden. Das Wasser des Einser-Kanals fließt über die Rabnitz (ung. Répce bzw. Rábca) zur Donau ab. Dennoch kann der Wasserspiegel des Sees von Jahr zu Jahr um einige Dezimeter schwanken.
Bei starkem Sturm – etwa zweimal im Jahr werden über 10 Beaufort erreicht - kann der Wasserstand gar zur selben Zeit an verschiedenen Orten unterschiedlich sein (sog. Schiefstellung des Wasserspiegels), wie etwa am 29. März 1888 geschehen, als zwischen Fertőboz und Neusiedl 81 cm Differenz zu verzeichnen waren. Ein Herbststurm im Oktober 1926 legte gar 80 km2 Seefläche trokken!
Als echter Steppensee verdunstet der See mehr Wasser als er durch Niederschläge und Zuflüsse erhält. Alle anderthalb Jahre tauscht sich das Wasser komplett aus. Das Einzugsgebiet des Neusiedler Sees beträgt 1.116 km2. Zu 80 % erhält der See sein Wasser aus Niederschlägen und nur zu 20 % aus Oberflächenwasser. Einzige größere, nennenswerte Zuflüsse sind auf österreichischer Seite die Wulka (ung. Vulka), die bei Donnerskirchen in den See mündet, sowie auf ungarischer Seite der Rák Patak (Krebsbach) bei Fertőrákos, das mit deutschem Namen nach diesem auch Kroisbach heißt.
Aufgrund seiner Flachheit ist der See stark in Verlandung begriffen. Der Schilfgürtel ist an einigen Stellen – so etwa bei Donnerskirchen - bis zu 5 km breit.
Neusiedler See
von Mihály Mentes
(1891-1960)
I.
Ein riesiger, glatter Spiegel,
sich ins bläuliche neigend, milchweiß.
Innen gestaltet sein Lächeln
die Sonne, sowie sie morgens auf ihren Weg geht.
Doch hat er sehr viele Flecken in sich.
Man sagt, es seien Röhrichte,
doch schlimme, große Buben
haben dort den Lack abgekratzt.
Die Sonne glaubt vielleicht,
daß sein Gesicht fleckig ist, verschrammt,
und daß er in den Wolkendecken
einen dichten, großen Schleier sucht.
Eine große, schmutzig-gelbe Decke
schlägt Schatten auf dem Spiegel
und sieht nicht in ihn hinein. So liegt er
unleidig hinter den Bergen.
II.
Doch es geht der Mond auf… Die gelbe, häßliche
Decke lupft er schnell.
Sein blasses Gesicht badet er in des
Silberspiegels weichem Schimmer.
Er ist sehr eitel. Er sieht nicht
die häßlichen, rostigen Flecken.
Schön ist der Spiegel, denn er macht
ihm schmeichelnde, törichte Komplimente.
Und obwohl sein Licht zum Morgen hin schwindet,
glänzt er doch vor Freude.
Und eitel lacht
der riesige Silberspiegel zurück.
aus: Ungarisches Gebet (Magyar Imádság), 1927
(Übersetzung ins Deutsche: O.Meiser)
Etwa 55 % des gesamten Sees sind verschilft; im ungarischen Teil sind es sogar 86 %. In letzterem hat man außer bei Fertőrákos kaum noch Zugang zu größeren, freien Wasserflächen. Schätzungen gehen davon aus, daß diese ohne weiteren Eingriff des Menschen in spätestens hundert Jahren verschwunden sein werden. Die starke Röhrichtbildung begann offenbar jedoch erst im 20. Jahrhundert als Folge der Wasserstandsregulierungen durch den Einserkanal ab 1909. Davor führten Trockenperioden eher zum Rückgang des Schilfes, sowie in manchen Uferbereichen auch die Haltung von Steppenrindern (Graurindern), die durch ihren Tritt das Aufkommen von neuem Schilf begrenzen und daher zu diesem Zweck in den letzten Jahrzehnten wieder dafür gehalten wurden. 1950 wurden im ungarischen Bereich des Sees Haupt- und Querkanäle (auf der österreichischen Seite Schluichten genannt) angelegt, die man 2014-15 erneut ausgebaggert hat.
Der mittlere Salzgehalt des Neusiedler Sees beträgt 1.200 mg/l und stammt aus ehemaligen Meeressedimenten am Grunde des Sees.
1.2 Angenehmes Klima mit reichlich Sonnenschein
„Und Gottes lauer Hauch schwebt drüber hin
und wärmt und reift und macht die Pulse schlagen,
wie nie ein Puls auf kalten Steppen schlägt…“
So äußerte sich der Wiener Dramatiker Franz Grillparzer (1791-1872) zum pannonischen Klima.
Im westlichen Ungarn macht sich, wie übrigens auch schon im Wiener Becken und Teilen des Burgenlands, sehr stark der kontinentale Klimaeinfluß bemerkbar. Kennzeichnend für diese Kontinentalität sind lange, heiße und trockene Sommer und kürzere, schneearme, aber zum Teil dennoch sehr kalte Winter. Die Vegetationsperiode kann im Seebereich über 250 Tage betragen. Die Jahresmitteltemperatur liegt im langjährigen Mittel bei 10°C und entspricht damit den wärmsten Orten in Deutschland. Für das Jahr 2021 hat der Autor (siehe Klimadiagramm) gar 11,2°C gemessen. Die Übergangsjahreszeiten sind meist weniger stark ausgeprägt als in weiter westlich oder nördlich liegenden Teilen Mitteleuropas. So kann nach einem Frühling von oft nicht einmal vier Wochen Dauer bereits schon die Sommerhitze Einzug halten, während der sommerliche Charakter oft bis spät ins Jahr anhält, um dann abrupt - ja manchmal sogar von einer Stunde auf die andere! - von der Winterkälte abgelöst zu werden. Dies geschieht häufig jedoch, ohne mit einem Ende der sonnigen Witterung einherzugehen.
Die Region Neusiedler See ist zwar, was ihren österreichischen Teil betrifft, das wärmste Gebiet Österreichs. Die ungarischen Teile gehören jedoch - verglichen mit anderen Gebieten Ungarns - eher zu den kühleren und Sopron am Fuße des Ödenburger Gebirges daneben auch zu den regenreicheren Gebieten.
Die Mitteltemperaturen des wärmsten Monats Juli liegen bei 20 °C, während sie sich im Januar, dem kältesten Monat, um – 1°C bewegen. Für das Jahr 2021 betrugen sie in Hegykő 22°C und 1,7°C.
ein Unwetter zieht hinter Hegykő auf. Foto: O. Meiser (2020)
Spätfröste treten durch den See, der seine Wärme über Nacht abgibt, kaum auf, was günstig für das Blaufränkischland, d.h. den Weinbau auf beiden Seiten der Grenze ist, aber auch dem Gemüsebau entgegenkommt. Komplett frostfrei sind 190-195 Tage.
Im Sommer steigt das Quecksilber häufiger als etwa in Deutschland über die 30°C-Marke und vereinzelt können – wie in den heißen und trockenen Sommern 2015, 2018 und 2019 - Höchstwerte bis 40°C erreicht werden. Durchschnittlich liegt an 60 Tagen das Tagesmittel bei über 25°C. 2021 gab es gar 80 Tage dieser Qualität.
Das Wasser des Neusiedler Sees - im Jahresmittel mit einer Temperatur von 11°C - erwärmt sich aufgrund seiner geringen Tiefe recht schnell und sorgt daher schon früh im Jahr für ausgedehnten Badespaß. Im Hochsommer hat das flache Wasser durchschnittlich 22-23°C; in der oberflächennahen Schicht bzw. im Uferbereich aber auch bis zu 30°C. Insgesamt kann im Laufe des Jahres die Wassertemperatur zwischen 2 und 30° schwanken.
zunehmend wird Trockenheit in der Region ein Problem. Foto O. Meiser (2020)
Die winterliche Eisdecke kann sich in strengeren Wintern bis zu 100 Tage lang halten. Häufig setzt zu Jahresbeginn bei Hochdruckwetterlage eine längere Frostperiode ein, die für dickes Eis und - Windstille vorausgesetzt - hervorragende Schlittschuhbahnen sorgt. Im Januar 2017 fuhren gar Radler über den See. Doch die Eisdecken können aufgrund von Strömungen und Quellen auch tückisch sein, wie 1270 Ottokar II. Přemysl (1232-78, ab 1253 König von Böhmen) schmerzlich erfahren mußte, als er den Ungarn über den zugefrorenen See Infanterie und Reiter entgegenschicken wollte und durch das Einbrechen der Soldaten herbe Verluste erlitt!
Schneesturm in Hegykő in der Szt. Mihály u. Foto: O. Meiser (2017)
Schlimm für die im Wasser lebenden Tiere ist es, wenn der flache See bis auf den Grund durchfriert, wie es z.B. in den Jahren 1721, 1892 und 1929 geschah.
Ist der See gefroren, so kann der Einzug des Erstfrühlings um einige Tage verzögert werden, weil beim Auftauen des Eises Wärme gebunden wird.
Im Vergleich zu vielen westlicher in Europa gelegenen Meßstationen fällt in Hegykő weniger Niederschlag. Insgesamt läßt sich feststellen, daß es 2-3 niederschlagsreichere Perioden im Jahr gibt. Im langjährigen Mittel fallen in der Region knapp 640 mm oder l/m2. Nach den Angaben einzelner Meßstationen (siehe auch Tabellen im Anhang) hatte von 1971-2005 Fertőrákos 550 mm, Fertőújlak 570 mm und Fertőboz 590 mm Jahresniederschlag. Von 1891-1930 waren im Seewinkel in Apetlon 593 mm und in Andau 612 mm zu verzeichnen. Die in Hegykő vom Autor gemessenen 604 mm für 2021 liegen so gesehen im Bereich des Normalen, wenn auch die Verteilung - je nach Interessenslage - vielleicht ungünstig war.
Hochwassermarken der Ikva in Sopron Foto: O. Meiser (2022)
Während der Vegetationsperiode fallen 340-360 mm.
In sehr trockenen Jahren hingegen können auch insgesamt weniger als 400 mm verzeichnet werden. So wurden z.B. 1932 in Apetlon nur 346 mm gemessen.
Die höchsten Niederschläge des Jahres gibt es im Juni, was jedoch nichts über deren Verteilung aussagt: Einige, starke Gewitterregen machen die Menge aus, wobei es nach der Auskunft alter Dorfbewohner heißt, daß von Südosten heranziehende Unwetter sehr gefährlich und verheerend sein sollen. Starkregenereignisse kommen vor, doch können sie aufgrund der Flachheit des Geländes und des Fehlens größerer Fließgewässer nicht so große Schäden verursachen – anders als entlang der Ikva, wo etwa im nahen Sopron alte Wasserstandsmarken verheerende Überschwemmungen bezeugen (siehe Foto).
Oft kann man aber auch beobachten, daß sich der Himmel zwar - in unheilschwangerer Stimmung und als ob die Welt unterginge - gewitterschwarz zusammenbraut, ohne daß dabei ein einziger Tropfen Regen fällt. Häufig sind diese Erscheinungen dann nur die Ausläufer von schweren Unwettern, die noch jenseits der Staatsgrenze im Burgenland oder in Niederösterreich niedergehen. Immer wieder fällt auch auf, daß ab Hidegség nach Westen in Richtung Sopron Regen fällt, während es in Hegykő trocken bleibt. Ursache dafür sind wahrscheinlich die dort liegenden, wenn auch kleineren Erhebungen, die bereits Luftströmungen umlenken können.
An klaren Wintertagen scheint Hegykő direkt vor dem Schneeberg zu liegen. Foto: O. Meiser (2021)
Großräumig fällt bei Westwetterlage der Niederschlag im Stau entlang der Alpen mit abnehmender Menge in Richtung Osten. Bis die Wolken das hiesige Gebiet erreichen, ist die größte Menge an Niederschlag bereits gefallen.
Eine häufige Wetterscheide ist dabei auch der Wienerwald, östlich dessen es dann trockener bleibt. Oft liegt die Seeregion direkt im Wetterschatten der Ostalpen. Dies ist besonders schön bei guter Fernsicht zu beobachten, wenn man erkennen kann, wie die letzten großen Erhebungen, so vor allem der 2076 m hohe Schneeberg, regelrecht den Himmel über dem Neusiedler See freihalten, während es in Wien und im nördlichen Burgenland, sowie südlich entlang einer Linie zum Komitat Vas hin bedeckt bleibt.
Im Sommerhalbjahr gibt es immer wieder Trockenperioden von mehreren Wochen Dauer, die durchaus, wie in den vergangenen zwanzig Jahren mehrfach geschehen, zwei, drei Monate anhalten können. Aber auch den Winter über gehören staubige Feldwege oft mehr noch zum Alltag als zäher Schlamm.
Neben dem aus langjährigen Beobachtungen ermittelten niederschlagsreichsten Monat Juni liegt das zweihöchste Maximum der Regenfälle im November. Ausnahmen treten freilich immer wieder auf: so brachte der November 2020 an der Meßstation in Hegykő nur 12 mm. Zu allen Jahreszeiten und nun auch mitten im Frühling fehlende Niederschläge scheinen derzeit immer mehr zum Problem zu werden. Im März 2021 gab es in Hegykő insgesamt nur 1,6 mm Niederschlag (nach eigene Messungen) und viele Naturteiche hatten einen niedrigen Wasserstand wie sonst nur nach trockenen Sommern im September zu sehen.
Schnee liegt (vgl. Bidló in Kárpáti / Fally 20212) an durchschnittlich 30-40 Tagen im Jahr und die Schneedecke erreicht dabei 18-15 cm. Doch dies kann sicher nicht mehr für die vergangenen zwanzig Jahre gelten. Nur noch selten liegt in Hegykő Schnee. In diesem Falle mißt die Schneedecke zumeist nur wenige Zentimeter, um noch am selben Tag oder spätestens nach einigen Tagen wieder zu verschwinden - sei es entweder durch wärmere Temperaturen oder die hohe Einstrahlung der Sonne auch im Winter. Dies deutet in Richtung auf den vieldiskutierten Klimawandel und eine Erwärmung. Der Winter 2020 / 21 brachte so gut wie keinen Schnee, und auch im bisherigen Winter 2021 / 22 ist bisher nur dreimal unergiebig Schnee gefallen. Der Silvestertag 2021 war mit einem Maximum von 17,1°C im Schatten (Messung durch den Autor in Hegykő) vielleicht der wärmste seit in der Gegend Wetter aufgezeichnet wird.
Wenn auch den Winter über nicht so viele Besucher nach Hegykő kommen wie im Sommerhalbjahr, so enthüllt gleichwohl die Landschaft zu dieser Jahreszeit doch oft ganz besondere Reize: wenn etwa die tiefstehende Sonne das verdorrte Schilf in bronzefarbenes Licht taucht, der föhnige Himmel über dem weiten Horizont zur Dämmerstunde feuerrot aufglüht oder, bei Schneelage, alles in bläulichen und rosa Farben zu verschwimmen scheint. Bei klarer Luft herrscht Alpenblick. Dann ist der bereits erwähnte, mächtige Schneeberg zu sehen - die letzte, große Bastion der östlichen Kalkalpen. Eine stramme Wanderung durch den steifen und frischen Steppenwind und ein anschließendes Entspannen im wohltuenden Thermalbad können Körper und Seele nur empfohlen werden. Kommen Sie auch im Winter!
Während des gesamten Jahres werden zwischen 1800 und 2000 Sonnenscheinstunden erreicht; im Mittel sind es 1889.
Nebel herrscht in Hegykő weniger oft, als man dies aufgrund der Seenähe annehmen möchte. Aufs Gemüt drückende, wochenlange Novembertristesse kann zwar manchmal – wie in dem ohnehin schon traurigen Jahr 2020 - vorkommen, ist aber insgesamt gesehen nicht die Regel. Im Herbst und Frühling wandern zwar häufiger Nebelbänke vom See hinauf ins Dorf, doch lösen sie sich normalerweise bereits während des Vormittags wieder auf, was an den häufig einsetzenden Winden liegen mag.
Die stärksten Winde blasen in den Monaten März und April. Wind tritt häufig auch mit dem Ende kürzerer Regenperioden auf, um dann etwa zwei bis drei Tage oft sehr lebhaft anzudauern. Die vorherrschende Windrichtung liegt in 53 % aller Fälle zwischen Nord und West; 32 % wehen direkt aus Nordwest. Hin und wieder bläst der Wind auch einige Tage lang aus Süd-Südost, was dann warme und feuchte Luft von der Adria bringen kann. Generell kann man am See immer mit Wind rechnen, was ihn für Segler attraktiv macht. Vom 10.-20. Mai 2006 fanden auf dem Neusiedler See gar die World Sailing Games statt. Auch bei dieser Segel-WM mußten die Teilnehmer über fehlenden Wind nicht klagen; die Veranstalter hingegen über fehlende Finanzmittel…
Während es in unserer Gegend noch keine Windkraftanlagen gibt, kann man bei klaren Wetterlagen und von erhöhten Standpunkten – etwa der Gloriette bei Fertőboz oder dem Csillaghegy oberhalb von Hidegség - die ausgedehnten Windparks der österreichischen Seite auf der Parndorfer Platte sehen. Sportbegeisterte nutzen den Wind auch zum Eissegeln und Kitesurfen am See.
1.3. Auf dem Boden der Tatsachen: aus Geologie und Erdgeschichte
Geologen vermuten, daß bis vor etwa 20 Millionen Jahren die Alpen mit den Karpaten einen zusammenhängenden Gebirgszug bildeten. Als sich die Gebirge trennten, wurde das Land entlang der Bruchlinie bis zu 150 Meter hoch mit Schottersedimenten bedeckt. Durch eine weitere Absenkung konnte dann das Meer eindringen, während höhere Partien wie das nördlich vom Neusiedler See gelegene Leithagebirge und das Ruster Hügelland westlich des Sees als korallenriffumsäumte Inseln aus dem Wasser ragten.
Das sog. Pannonische Meer, ein Ausläufer des Tethys-Urmeeres, bedeckte vor 16 Mio. Jahren unter tropischen bis subtropischen Klimaverhältnissen noch die Kleine Ungarische Tiefebene (ung. Kisalföld) und das Wiener Becken. Diese Beckenlagen weisen Sedimentablagerungen von bis zu zweitausend Metern Mächtigkeit auf. Vor ca. 13-14 Mio. Jahren zog sich das Meer nach und nach zurück, bis schließlich ab 11,5 Mio. Jahren zwei Binnenmeere übrigblieben: das Pannonmeer und das Pontmeer, die sich aufgrund trockener Klimaverhältnisse stetig verkleinerten. Als das Klima wieder feuchter wurde, süßten die Binnenmeere schließlich aus und verlandeten vor ca. 5 Mio. Jahren. Früher glaubte man auch, daß der Neusiedler See ein Rest des Pannon- und Pontmeeres wäre.
Im Zusammenhang mit der Alpenauffaltung bildeten sich weitere Bruchzonen und Einsenkungen, in denen der Neusiedler See entstand. Den heutigen See gibt es seit Ende der letzten Eiszeit (Würm-Eiszeit) und er ist vermutlich maximal 10 - 20 000 Jahre alt. Häufiger wird konkreter das Alter von 13.000 Jahren genannt. Seit 1520 hat der Neusiedler See, mit den o.g. Schwankungen in den einzelnen Jahren und Jahrzehnten, etwa die heutigen Ausmaße beibehalten (vgl. u.a. Geschnatter 4/1996).
Aufgrund des flachen Reliefs trifft man in der Umgebung auf keine geologischen Kuriosa wie etwa am Balaton-See. Normalerweise bleibt dem Betrachter in der hiesigen Gegend die Geologie eher verborgen - abgesehen von Baugruben der Neubaugebiete oder beim Straßenbau. Und auch diese geben uns lediglich Einblick in das, was wir ohnehin vermuten: mächtige Sedimentschichten und Ablagerungen von Löß. Letztere, wie man sie etwa in Deutschland auch im Kaiserstuhl findet, sind Feinsedimente, die aus eiszeitlichen Schotter- und Sanderflächen ausgeblasen und anderswo im Windschatten abgelagert wurden. Aufschlüsse im Löß sind zum Beispiel entlang der Seestraße bei Hidegség und noch besser in Fertőboz zu sehen. Die 40 m mächtigen Lößablagerungen sind dort noch erhalten, weil sie offenbar von darüberliegenden, widerstandsfähigeren Sedimenten vor Abtragung geschützt wurden. Lößablagerungen gibt es in vielen Teilen Ungarns und oft dient das weiche, aber dennoch standhafte Material der Anlage von Weinkellern.
Geologischer Aufschluß an einem Lößabbruch bei Fertőboz. Foto: O. Meiser (2021)
Sandablagerungen in einer Linie von Hidegség über Hegykő bis Fertőd sollen hingegen (vgl. Bidló in Kárpáti / Fally 2012) von einem alten Donaulauf stammen.
gute Böden und große Flächen – ideal für die Landwirtschaft. Foto: O.Meiser (2001)
Erst unter den ganzen Sedimentschichten steht kristalliner Schiefer an, wie man ihn bei Sopron dann auch oberflächlich im Soproner Gebirge, welches geologisch gesehen der östlichste Ausläufer der Alpen ist, antreffen kann.
So langweilig die Landschaft demjenigen erscheinen mag, der durch den mineraliengesegneten Schwarzwald oder die fossilienreiche Schwäbische Alb interessanteres kennt, so günstig ist sie für die Landwirtschaft. Gute, steinarme Böden und große Wirtschaftsflächen bieten den Bauern vorteilhafte Voraussetzungen.
Nie vergesse ich, wie vor Jahren ein alter Landwirt aus meiner Verwandtschaft einmal nach Hegykő kam. Für ihn, der sein Leben lang einen Bauernhof im klimatisch ungünstigen und steinigen Oberfranken bewirtschaftet hatte, war die Reise nach Ungarn die erste und einzige seines ganzen Lebens gewesen. Als wir mit dem alten Mann über die Felder hinter dem Dorf spazierten, kniete er plötzlich auf einem Acker nieder, nahm die Erde, als ob es das Heiligste vom Heiligen wäre und sagte ungläubig: „Ich habe vor langer Zeit mal davon gehört, daß es so etwas geben soll. Gesehen habe ich es bisher noch nie: eine Erde, die durch und durch fruchtbar ist - und ohne einen einzigen Stein!…“.
Im Gebiet um Hegykő trifft man immer wieder auf tiefschwarze Böden. Dabei handelt es sich um Schwarzerdeböden (genannt auch: Tschernoseme; aus russ.), die aus Sand und Löß zusammengesetzt sind und deren wichtigstes Merkmal der mächtige, humusreiche Oberboden ist. Schwarzerdeböden sind sehr fruchtbar und bedingen u.a. den intensiven Gemüseanbau in Hegykő.
Dichter zum See hin finden sich sog. Solonetz- und Solontschak-Böden (beide Bezeichnungen aus russ. / kirg.). Während Solonetze schwere, tonige und kalkarme Salzböden sind, handelt es sich bei letzterem um sandige, leichte Böden mit hohem Grundwasserstand, die aufgrund des kapillaren Aufstiegs der gelösten Stoffe Ausblühungen zeigen. Auf ihnen wachsen nur Halophyten, d.h. solche Pflanzen, die an das Leben unter hohen Salzkonzentrationen ihrer Umwelt angepaßt sind, wie etwa der Queller (Salicornia europaea), den manche vielleicht auch von Meeresstränden kennen. Immer wieder stößt er Blätter ab und bildet neue, um sich seiner Salzanreicherungen zu entledigen.
In den Böden kommt, neben Kochsalz (NaCl), auch Soda (Na2CO3), Bittersalz (MgSO4), Glaubersalz (Na2SO4) und Natriumkarbonat (Na2CO3) vor. Sodahaltige oder alkalische Böden werden im Ungarischen mit szik bezeichnet; daher die vielen Flur- und Ortsnamen auch auf der österreichischen Seite, die mit „Zick-“ beginnen, wie z.B. der Zicksee bei St. Andrä.
Viele Böden zum See hin sind sog. hydromorphe Böden, d.h. sie sind durch Grund- oder Stauwassereinflüsse geprägt.
Wer den Landwirten ihre guten Böden und den Salzpflanzen ihre Anpassungsfähigkeit gönnt, aber dennoch eine interessantere Geologie in der Nähe sucht, findet diese in den Leithakalken (sog. Rákos-Formation) im nahen Fertőrákos, wo ein Steinbruch, der noch bis 1948 in Betrieb war und nun als Konzertbühne dient, guten Aufschluß gibt. Die fossilienführenden Sedimente – gefunden werden können u.a. die Reste von Seeigeln, Muscheln der Gattung Pecten oder Haifischzähne - setzen sich jenseits der Grenze im Ruster Hügelland über St. Margarethen mit seinem Römersteinbruch hin bis zum Leithagebirge hin fort. Sie waren seit der Antike wichtige Baustofflieferanten für Sopron, aber auch für zahlreiche, bekannte Gebäude in Wien und Bratislava. Auch die in Ungarn bekannte romanische Basilika von Lébény bei Győr wurde aus Leithakalk gebaut.
Ebenfalls in Fertőrákos können Mineralienfreunde eine beeindruckende Sammlung von Kalzitkristallen besuchen, während es in Sopron ein interessantes Bergbaumuseum gibt, da in Brennbergbánya (im Ödenburger Gebirge) bis 1959 auch Steinkohle abgebaut wurde.
1.4. Heilsames Wasser - die Thermalbäder
Ein positiver Aspekt der lokalen Geologie sind auch die Thermalzonen mit ihren Bädern beiderseits der Grenze. 1955 entdeckte man, daß sich unter dem Neusiedler See die größten Mineralwasservorkommen Europas (ca. 250 km2 Fläche) befinden. Beim Bau des Seehotels in Mörbisch wurde eine Süßwasserbohrung durchgeführt (vgl. Geschnatter 3/1999).
Bedingt durch die relative Nähe zum Erdmantel, herrscht am Neusiedler See und im Pannonischen Becken in der Erdkruste ein erhöhter Wärmefluß, wobei tektonische Bruchlinien die Thermenzonen noch besonders kennzeichnen.
Dabei gibt es zwei Mineralwasser-„Stockwerke“, von denen das obere in eine Tiefe von bis zu ca. 150 m reicht. Dieses obere Stockwerk wird auch von einigen Hausbrunnen genutzt und das Wasser bleibt in diesen Schichten zwischen hundert bis über 30.000 Jahre lang. Im unteren Stockwerk ab 800-1200 m Tiefe finden sich ehemalige Meereswässer unter artesischem Druck (vgl. Geschnatter 3/1999).
Insgesamt sind weite Teile Ungarns reich mit Thermalwasser gesegnet und das Baden erfreut sich seit der Römerzeit einer langen, fast ununterbrochenen Tradition, die zwischendurch auch noch einmal während der Türkenherrschaft (1526-1686) wieder neu belebt wurde. Das gilt besonders für die Hauptstadt Budapest, in dessen römischer Vorläufersiedlung Aquincum es bereits große Thermen gab, deren Reste dort noch besichtigt werden können. Aber auch in den übrigen Landesteilen wurden in der jüngeren Zeit viele Thermalwässer erschlossen, teilweise als positives Nebenprodukt der damaligen sowjetischen Erdölprospektion. Kaum ein Ort in Ungarn liegt weiter als fünfzig Kilometer von einer Therme entfernt!
Thermalbad Hegykő, Eingangsbereich. Foto: O. Meiser (2022)
Hegykő ist Teil einer ausgedehnten Thermalzone, die geologisch gesehen in Verbindung mit der Thermenwelt Burgenland steht. Zu dieser Thermenregion gehören auch andere bekannte Badeorte wie das nahe Balf mit seinem Kurbad und einer Mineralwasser-Fabrik, aber auch Bük oder Sárvár und auf der österreichischen Seite z.B. Bad Tatzmannsdorf oder Bad Sauerbrunn. Im Seewinkel ist die Martinstherme bei Frauenkirchen bekannt.
Hegykő ist als Bade- und Kurort zwar noch sehr jung, doch die Heilkräfte der Natur waren schon seit eh und je bekannt.
Thermalbad Hegykő, Außen-Badebereich. Foto: O. Meiser (2022)
Allein schon das „gewöhnliche“ Wasser und der Schlamm des Neusiedler Sees haben, wie die ortsansässige Bevölkerung lange weiß, eine heilende Wirkung. Darauf machte bereits József Kis, ein Arzt, im Jahre 1797 aufmerksam. Er schrieb damals:
„Im Neusiedler See baden im Sommer Hunderte; einige kommen aus großer Entfernung. Fragt man diese Menschen, warum sie einen langen Weg für das Baden zurücklegen, antworten sie: Baden im Neusiedler See ist nützlicher als in jedem anderen Wasser. Was die Erklärung dafür ist, können sie nicht sagen. Daß der Mensch jedoch gerne zum See fährt, muß einen Grund haben. Der gute Beobachter erklärt es mit der Erleichterung, Reinigung und sogar Heilung des Körpers nach dem Baden im Neusiedler See. Ich bin der Meinung, daß es daher in aller Munde ist.“
Die Mineralwässer des nahen Balf hingegen wurden offenbar schon in römischer Zeit unter dem Philosophenkaiser Marcus Aurelius (121-180) genutzt. Aus dieser Zeit fand man im Jahr 1900 unweit des Sauerbrunnens Reste einer Quellfassung und eines Bades. Vermutlich haben aber vor den Römern schon die Kelten in Balf gebadet. Um die Mitte des 16. Jahrhunderts machte der Ort dann wieder von sich reden. 1550 ließ man einen Sachverständigen von Wien kommen, so daß Balf 1560 durch Kaiser Ferdinand I. (1503-1564) den Titel eines Bades erhalten konnte. 1631 wurde es durch Schriften weiter bekanntgemacht und erfreute sich im 18. Jh. unter Kaiserin Maria Theresia (1717-1780) zunehmender Beliebtheit. 1876 brachte der Bahnanschluß einen weiteren Aufschwung.
Thermalbad Hegykő, Innenbereich. Foto: O. Meiser (2022)
Zu jener Zeit fuhren die Leute, die sich das Kuren damals leisten konnten, allerdings eher in berühmte Bäder wie etwa das böhmische Karlsbad. So ist sogar im Karlsbader Wochenblatt von 1878 unter der Rubrik „angekommene Curgäste“ ein Herr Ladislaus Vaszary, seines Zeichens Ökonom und Verwalter aus Heiligenstein (= Hegykő!) in Ungarn vermerkt.
Die Geschichte der gezielten fachkundig-technischen Erschließung der Thermalwässer der hiesigen Region beginnt erst nach dem Krieg. Zunehmend erkundete man die Heilwasserbestände in der Tiefe. Dabei stellte man fest, daß viele der erschlossenen Wässer - zieht man Inhaltsstoffe wie Glaubersalz zum Vergleich heran - sich spielend mit berühmten Quellen wie z.B. dem erwähnten Karlsbad messen können. Zunächst hatte man in Kapuvár und Csorna Brunnen gebohrt. Sechs LPGs im Komitat bekamen einen Brunnen. 1965 teufte die Ungarische Hydrologische Gesellschaft einige Bohrungen in der Umgebung ab, bei denen sich herausstellte, daß es sich lohnen würde, bei Balf und Hegykő Brunnen zu bohren, da sich dort in der Tiefe unter Druck stehendes Thermalwasser befände. Dieses Thermalwasser wäre am besten genutzt, wenn in Hegykő ein Bad gebaut würde. Schon 1966 forderte die mit dem Thema betraute Gemeindekommission bei den zuständigen Behörden entsprechende Hilfe an. Beim Bohren kam dann 60°C heißes Wasser. Offenbar ging es aber erst einmal um die Nutzung des Thermalwassers für das Beheizen von Gewächshäusern wie es beispielsweise ja auch in Island seit langem praktiziert wird. Für diesen Zweck allerdings schien der LPG die geförderte Wassermenge zu gering und sie wollten ihren Anteil von 75 000 Forint am Ausbau des Brunnens nicht übernehmen. Am Ende wurde das ganze Projekt vom Finanzministerium und vom Staat finanziert, was über 4,5 Millionen Forint kostete. Außer dem Brunnen wurden auch Gewächshäuser gebaut, in denen das Thermalwasser so genutzt wurde, wie die LPG es vorgesehen hatte. Zu diesen Zweck bekam die Gemeinde 12 000 m2 Glasscheiben. Auch die Verwirklichung der Thermalbäder von Kapuvár und Csorna war Teil dieses landesweiten Plans. Aufgrund des Drucks und seiner Temperatur war klar, daß man das Wasser auch anderweitig würde nutzen können. Nachdem sich der Landwirtschaftsminister, der Finanzminister und der Chef des nationalen Wasserwirtschaftsamts beratschlagt hatten, erhielt Hegykő dann das Recht und die Möglichkeit, ein Thermalbad zu bauen. Im Sommer 1968 begann man mit dem Bau des Brunnens, während neuere Untersuchungen des Wassers auch dessen Heilwirkung bestätigten. Der Brunnen kam in die Hände der Gemeinde, die auch den Bau des Bades in die Wege leitete. Finanziell gesehen kamen 800 000 Forint von der Gemeinde und später noch einmal 300 000 Ft., während die LPG 110 000 Ft. beisteuerte. Mit Hilfe von Gemeinschaftsarbeit durch Arbeitsbrigaden der kommunistischen Jugend sowie des ungarischen Militärs wurde das erste, 180 m2 große Schwimmbecken gebaut. Begonnen wurde im Frühling. Bereits im Juli konnte gebadet werden. In den ersten zwei Monaten kamen schon 16 000 Gäste, darunter viele ausländische. 1971 erweiterte man das Bad um ein zweites Sitzbecken und ein Kinderbecken. Auch die Grünanlagengestaltung wurde in Angriff genommen und 1972 über einen Entwicklungsplan für eine Erholungsregion Neusiedler See beratschlagt. Dieser Perspektive folgend, verkaufte die Gemeinde Grundstücke und Ferienhäuschen, die überwiegend von Interessenten aus Städten, darunter natürlich v.a. Sopron nachgefragt wurden.
neben dem Thermalbad Hegykő: ein neues Hotel entsteht. Foto: O. Meiser (2021)
1974 wurde das dritte Schwimmbecken gebaut, was annähernd eine Million Forint kostete. Dieses Becken erfüllte auch die Normen für Sportwettkämpfe und konnte von den Schulen der umliegenden Gemeinden für den Schwimmunterricht genutzt werden.
Das Thermalwasser von Hegykő kommt aus 1434 Metern - ein Fluor-Thermalwasser mit Alkali-Hydrocarbonat-Gehalt, einer niedrigen Wasserhärte und reich an Salzen. Das Wasser, das 2004 als Heilwasser eingestuft wurde, enthält nach Angaben der Homepage der Sá-Ra Termál Kft. (2021) folgende Bestandteile (in mg/l):
Natrium (Na
+
)
3.170
Kalium (K
+
)
65
Ammonium (NH
4
)
30,8
Kalzium (Ca
2
+
)
24,8
Magnesium (Mg
2
+
)
8,8
Lithium (Li
+
)
1,8
Sulfid (S2
-
)
1,6
Jodid (I
-
)
0,8
Chlorid (Cl
-
)
900
Bromid (Br
-
)
1,7
Sulfat (SO
4
+
)
144
Fluorid (F
-
)
8,7
Hydrogenkarbonat (HCO
3
-
)
7110
Metaborsäure (HBO
2
)
7,8
Metakieselsäure (H
2
SiO
3
)
28
Kohlensäure (CO
2
)
457
Mineralgehalt insgesamt
11.816
Die tägliche Fördermenge beträgt ca. 380-400 m3 pro Tag. 1977 wurde ein Kaltwasserbrunnen (22,5°C) mit einer Tiefe von 357 m gebohrt, aus dem täglich 600-850 m3sprudeln. Das Mineralwasser hat Trinkwasserqualität.
Das Gelände des Thermalbads erstreckt sich aktuell über eine Fläche von 6 Hektar. Dabei verfügt es über sechs Außen- und zwei Innenbecken. In den letzten Jahren wurde das Bad immer wieder umgestaltet und weiter ausgebaut, wobei die Entwicklung von Hegykő zum Kur- und Fremdenverkehrsort noch lange nicht abgeschlossen ist. Derzeit entsteht neben dem Bad ein Dreisternehotel mit 28 Zimmern, eigenem Sauna- und Wellnessbereich.
Das Wasser der Hegykőer Heilbecken innen und außen hat eine Temperatur von 36-38° C. Daneben gibt es im Innenbereich auch ein größeres Mehrzweck-Schwimmbecken.
Das Thermalwasser der Sitzbecken eignet sich – laut Homepage und Broschüren von Sá-Rá - hervorragend für die Rehabilitation von Muskelverzerrungen, Verrenkungen, Verstauchungen und verheilten Knochenbrüchen. Es wirkt auch entzündungshemmend und hilft bei Gelenk-Beschwerden, Problemen mit der Haut oder solchen gynäkologischer und urologischer Art.
Regelmäßiges Baden entspannt den Körper nach anstrengender Arbeit oder intensiver sportlicher Betätigung. Das Inhalieren des Wasserdampfes wirkt heilend bei Atemwegserkrankungen. Als Trinkkur eingenommen, hilft es auch, Magenbeschwerden zu lindern.
Neben dem eigentlichen Baden werden als Therapiemöglichkeiten angeboten:
Fangobehandlungen (mit Heilschlamm aus Hévíz)
medizinische Heilmassagen
Unterwassermassage
Wassergymnastik
Bioptron-Lichttherapie
Fußzonen-Reflexmassagen
Lymphdrainagen-Massage
Mineralwasser aus der Gegend zum Trinken kann man in kleiner Menge für den privaten Gebrauch von den Quellen der Mineralwasserfabriken von Balf oder Deutschkreutz holen. Das Mineralwasser aus Balf ist seit 2004 in ganz Ungarn auch überall im Getränkehandel erhältlich.
Insgesamt gibt es in der Region Neusiedler See zwanzig Mineralwasserquellen.
Es ist zu hoffen, daß die Thermalwässer der Region in der Zukunft auch für die Privathaushalte verstärkt als umweltschonende und klimafreundliche Alternativ-Energiequelle zu dem vergleichsweise teuren und von autoritär regierten Ländern abhängig machenden Erdgas entdeckt werden.
Ebenfalls bleibt zu hoffen, daß der momentan hart getroffene Tourismus sich nach dem Ende der Corona-Krise schnell wieder erholt und möglichst rasch auf das wirtschaftliche Niveau von 2019 zurückkehren kann.
1.5. Reiche Lebewelt - von Tieren und Pflanzen
Bitte nicht anfassen! – Rehkitz bei Hegykő Foto: O. Meiser (2019)
Die Gemarkung Hegykő wies schon früher beachtliche Wildbestände auf. Jagdbeschreibungen gibt u.a. auch der ungarische Ornithologe István Chernel (18651922), der Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder im Gebiet unterwegs war.
An Kleinwild wären diesbezüglich Hase, Fasan und Rebhuhn zu nennen, an Großwild Hirsch, Reh und Wildschwein. Die Jäger kümmern sich um die Bestandsregulierung und Winterfütterung. Rebhuhn und Fasan stehen unter Schutz. Abschuß des Wildes ist nur organisiert und zu bestimmten Zeiten zugelassen. Der hiesige Jagdbezirk des Hegykőer Falken-, Jäger- und Naturschutzvereins umfaßt – neben der Gemarkung Hegykő - auch Teile der Gemarkungen von Fertőhomok, Fertőszéplak, Fertőd, Sarród und Fertőszentmiklós.
Das Gebiet des ungarischen Nationalparkteils hingegen besteht aus drei Jagdbezirken. Dort findet Sportjagd nicht statt. Die Jäger des Nationalparks regeln dort v.a. die Bestände von Wildschwein, Fuchs und Raubzeug. In früherer Zeit lag das Jagdrecht bei den Grundherren.
Wer etwa Rotwild beobachten möchte, streife zur Morgen- oder Abenddämmerung über die Felder rund um Hegykő. Dann sieht man häufig Hasen umherspringen oder Rehe äsen. Bei letztgenannten waren es bei einer Beobachtung im März 2021 sogar um die dreißig auf einmal!
Auch ein Spaziergang durch den Haraszt-Wald jenseits der Hauptstraße Nr. 85 ermöglicht zahlreiche Begegnungen mit Tieren. Man beachte jedoch, daß zu bestimmten Jahreszeiten die Waldwege in den Abendstunden wegen stattfindender Jagdaktivitäten gesperrt sind!
Ebenfalls lohnend kann ein Spaziergang zum Angelteich sein. Zu dessen Fauna sollen eine Familie Bisamratten (Ondathra zibethicus), sowie der streng geschützte Fischotter (Lutra lutra) gehören. Von letzterem gibt es in Ungarn schätzungsweise um die 1500. Insgesamt leben um den Neusiedler See 40 Säugetierarten. Hier befindet sich auch das westlichste europäische Vorkommen des Europäischen Ziesel (Spermophilus citellus) - ein Steppenbewohner, den man z.B. häufig bei Fertőújlak beobachten kann. Die Tiere, die sich hauptsächlich vegetarisch, aber auch von Insekten ernähren, graben unterirdische Gänge und Kammern, in denen sie zwar einzeln leben, aber dabei dennoch Kolonien bilden. Die Ziesel sind wichtige Beutetiere für Greifvögel und größere Säuger.
Weitere Säuger, die man woanders nicht oder kaum antrifft, sind der Steppeniltis (Mustela eversmannii), der etwas größer und heller als der Europäische Iltis (Mustela putorius) ist, sowie der Feldhamster (Cricetus cricetus). Selten und noch seltener zu sehen (in diesem Falle wäre man von ihrer Häßlichkeit entsetzt!), aber bei Vorhandensein manchmal ein Ärgernis für Gartenbesitzer ist die eigentümliche West-Blindmaus (Spalax leucodon), die Auswürfe ähnlich denen des Maulwurfs hinterläßt. Wie der Maulwurf auch, steht sie unter Naturschutz. Die Art gräbt sich in Extremfällen bis zu vier Meter tief ein und ist ein Steppenbewohner; hat daher am Neusiedler See ihre westlichste Verbreitung.
Der Goldschakal (Canis aureus) tauchte, nachdem er offenbar seit Beginn des 20. Jahrhunderts als ausgerottet galt, erstmalig in den achtziger Jahren im Hanság und am Neusiedler See sporadisch wieder auf. Über die von Nordafrika bis Asien und einige Teile Europas verbreitete Art gab es 2007 im Nationalpark auch einen Reproduktionsnachweis (siehe u.a. Hartlauf 2018).
Im Sommerhalbjahr beobachtet man in der langen Abenddämmerung immer noch sehr viele Fledermäuse. Obwohl alte Häuser und Scheunen weniger geworden sind, finden einige Arten wie etwa die Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) offenbar auch an modernen Gebäuden Schlaf- und Kinderstuben, vor allem dann, wenn die dazugehörigen Gärten natürlich belassen und ohne Chemie bleiben. Oft in der Dämmerung zu sehen ist dort auch der Abendsegler (Nyctalus noctula), die in Ungarn häufigste Fledermausart. Daneben gibt es noch 3-4 andere Arten.
Fledermäuse sorgen dafür, daß schädliche und lästige Insekten nicht überhand nehmen, und es besteht kein Grund, sich vor ihnen zu fürchten. Bitte töten Sie die Tiere auf gar keinen Fall! Europäische Arten saugen weder Blut, und wenn man sie nicht anfaßt, besteht auch keine Gefahr von Krankheitsübertragungen.
Sollten sie in Hegykő oder einem der anderen Dörfer ein altes Haus umbauen und eine Fledermauskolonie entdecken, wenden Sie sich bitte unbedingt an das Nationalparkzentrum in Fertőújlak, das Rat gibt und ggf. einen Fledermausexperten kommen läßt!
Größere Sympathieträger als Blind- und Fledermäuse sind hingegen für die meisten Menschen die Vögel, und Vogelfreunde kommen hier in der Region voll und ganz auf ihre Kosten.
Der Neusiedler See spielt eine wichtige Rolle für den internationalen Vogelzug. Er ist ein europaweit bedeutendes Rast- und Überwinterungsgebiet für Zugvögel. Hier lassen sich 320 Vogelarten beobachten; 120 davon als Brutvögel. Manchmal finden sich mehr als zweihundert verschiedene Arten gleichzeitig ein. Eine ähnlich reiche Vogelwelt ist innerhalb Europas nur noch im Donau-Delta, in der Camargue in Süd-Frankreich oder dem Doñana-Nationalpark im spanischen Andalusien anzutreffen. Nur einige wenige der Arten, die besonders häufig oder charakteristisch sind, seien an dieser Stelle herausgegriffen.
Viele Besucher verbinden ja die Seeregion erst einmal mit den Weißstörchen (Ciconia ciconia), für die v.a. das auf der österreichischen Seite liegende Rust sehr bekannt ist. Aber auch auf der ungarischen Seite hat fast jedes Dorf ein bis zwei Brutpaare Weißstörche, von denen die ersten zumeist gegen Ende März aus ihren Winterquartieren eintreffen. In Hegykő brütet ein Paar regelmäßig auf einem Strommasten am Ortsausgang in Richtung Fertőszéplak.
Eine Storchenfamilie benötigt (vgl. www.storchenverein.at) für ihre Ernährung von 4-6 kg pro Tag – u.a. fressen die Adebare Kleinsäuger, Reptilien, Fischen und Insekten – rund 20.000 m2 Feuchtwiesen. Die Jungstörche sind nach zwei Monaten flügge. Die Störche machen sich in der zweiten Augusthälfte auf den Weg nach Zentral- und Südafrika und legen dabei auf einer Strecke bis zu 10.000 km zurück! Dazu benötigen sie drei Monate. Auf dem Rückweg stehen für sie die Winde günstiger, so daß sie denselben Weg in zwei Monaten bewältigen können. Aufgrund des Klimawandels ziehen jedoch viele Störche inzwischen kürzere Strecken und überwintern bereits im Mittelmeergebiet.
Brütende Weißstörche in Hegykő Foto: O. Meiser (2020)
Andere bemerkenswerte und daher streng geschützte Arten der Gegend sind der in Afrika überwinternde Purpurreiher (Ardea purpurea), der mit den Reihern nur weitläufiger verwandte Löffler (Platalea leucorodia), der von Natur aus seltene und auf Baumkronen brütende Schwarzstorch (Ciconia nigra), der im Herbst und Frühling durchziehende Fischadler (Pandion haliaetus) oder der Seeadler (Haliaetus albicilla), der eine Flügelspannweite von zwei Metern hat und damit der größte Greifvogel des Karpatenbeckens ist. Letzterer, der auch entlang der Donau vorkommt, brütet im Nationalpark seit 1998 wieder.
Der Würg-oder Sakerfalke (Falco cherrug) ist ein Steppenfalke, der einzeln zu allen Jahreszeiten angetroffen werden kann und häufig mit dem mythischen Vogel Turul der Ungarn in Verbindung gebracht wird. Er soll das Volk auf ihrem Weg aus ihrer zentralasiatischen Urheimat durch die Steppen ins Karpatenbecken begleitet haben. Sein Verbreitungsgebiet deckt sich ziemlich mit dem historisch bekannten Wanderweg des ungarischen Volkes. Der Vogel ziert die 50-Forint-Münze. Der Neusiedler See als westlichster Steppensee ist auch sein westlichstes Vorkommen. Früher wurde er in der Falknerei, die in Ungarn Tradition hat und daher auch in die Liste der für das Land typischen Hungarica aufgenommen wurde, häufig eingesetzt.
Der Schilfgürtel des Neusiedler Sees ist an einigen Stellen 4-6 km breit und bedeckt den See zu über dessen Hälfte! Ein Kanalnetz von insgesamt 240 km Länge macht die Schilfgebiete des ungarischen Seeteils zumindest teilweise mit Kähnen zugänglich. Erkundungstouren werden angeboten.
Hier brütet mit 700-800 Paaren die größte Silberreiherkolonie Mitteleuropas. Der Silberreiher (Egretta alba), der früher wegen seiner Federn intensivst bejagt wurde, ist der Wappenvogel der Region, der übrigens auch auf der Fünf-Forint-Münze abgebildet ist. Überdies finden auch Haubentaucher (Podiceps cristatus) oder die Rohrweihe (Circus aeruginosus) hier Nahrung und Bleibe. Schwimmvögel der Schilfgebiete sind Taucher, Rallen und die Moorente (Aythya nyroca). Der sich mit seinem „Karre-kiet“ lautstark äußernde Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus), sowie Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus), Rohrschwirl (Locustella luscinoides) und Bartmeise (Panurus biarmicus) sind kleinere Vogelarten dieser Zonen. Auch ein großer Teil der Graugänse (Anser anser) brütet hier.
Vom See weg werden mit abnehmendem Grundwasserstand die Schilfgebiete von Feuchtwiesen abgelöst, die von dem selten brütenden Großen Brachvogel (Numenius arquata) bevorzugt werden, sowie dem durchziehenden Kampfläufer (Philomachus pugnax), der bis 1955 auch noch Brutvogel war.
Große, schilfige Feuchtwiesen, den Schilfgürtelrand und das Schilf mag auch der Höckerschwan (Cygnus olor), dessen Junge in früherer Zeit von Kleinfischern an den Bauernhäusern aufgezogen wurden. Nach vielen Jahrzehnten Unterbrechung brütete er erstmalig wieder ab 1970 bei Fertőrákos und hat sich seitdem stärker verbreitet. Die 15 kg schweren, zwei Meter Spannweite messenden Schwäne verteidigen kämpferisch ihren Nachwuchs und versuchen, den wirklichen oder vermeintlichen Feind mit Zischen und Schnabelhieben abzuwehren.
Mit etwas Glück ist in einigen Teilen des Nationalparks die Großtrappe (Otis tarda) zu beobachten. Die scheuen Vögel, manchmal auch scherzhaft als „Europäischer Strauß“ bezeichnet, sind die schwersten fliegenden Vögel der Welt. Die Hähne erreichen bis zu 18 kg Gewicht; die Hennen 6 kg. Ihre Flügelspannweite beträgt bis zu 2 m. Beeindruckend ist die Balz der Großtrappen im April und Mai. Die Art brütet am Boden und benötigt daher ungestörte Wiesenflächen. Sie ist insbesondere im Hanság anzutreffen.
In der sommerlichen Hitze umgürten Krusten von Sodasalz die schrumpfenden Tümpel und Lacken, an welchen sich alljährlich zahlreiche Kiebitze (Vanellus vanellus) und Säbelschnäbler (Recurvirostra avosetta) einfinden. Die Salzsteppen sind Gebiete, in denen früher die altungarischen Nutztierrassen wie Graurind (genannt auch Steppenrind; ung. szürke marha) oder Zackelschaf (genannt auch Reitzenschaf; ung. rác birka) gehalten wurden.
In Gebüschen oder Windschutzgürteln entlang von Gräben trifft man im Frühling und frühen Sommer auf zwei Vogelarten, die anderswo kaum noch ein Kind kennt: Es ist dies die unauffällig-braune und daher schwer auszumachende Nachtigall (Luscinia megarhynchos), die man mit ihren schluchzenden und perlenden Strophen aber um so häufiger hört und die im Ungarischen sehr lautmalerisch fülemüle heißt. Und dann ist da der Pirol (Oriolus oriolus), den man ebenfalls nur selten sieht, aber dafür oft hören kann: Man erkennt ihn an seinem eigentümlich und melancholisch flötenden Lied. Bekommt man doch einmal selten die prächtigen goldgelben Männchen zu Gesicht, versteht man den ungarischen Namen des Vogels: sárgarigó – viel in Volksliedern besungen - bedeutet „Gelbamsel“.
Auf Brachflächen begegnet man Arten, die anderswo längst ausgestorben oder extrem selten sind. Dazu gehören Schwarzkehlchen (Saxicola torquata), Braunkehlchen (Saxicola rubetra) oder der seine Beute auf Dornen aufspießende Neuntöter (Lanius collurio). Wer einen naturnahen Garten am Rande des Dorfes besitzt, mag den einen oder anderen der genannten Vögel zuweilen von dort aus beobachten, doch sind es auch da in den letzten Jahren deutlich weniger geworden.
Graugänse neben dem Einser-Kanal bei Fertőújlak. Foto: O. Meiser (2019)
Im Sommerhalbjahr ist manchmal ein farbenprächtiger Vogel zu sehen, der oft zu mehreren herumschwirrt und dabei eigentümlich girrende Laute von sich gibt. Es ist der türkisblau und orange gefärbte Bienenfresser (Merops apiaster; ung. gyurgyalag), der an lehmigen oder erdigen Steilabbrüchen in Höhlen brütet. Ein solcher Brutplatz befindet sich in Hegykő unweit des Angelteiches, sowie in einer aufgelassenen Sandgrube hinter der Nachbargemeinde Röjtökmuzsáj. Sollte man die Vögel bei ihren Bruthöhlen entdecken, verhalte man sich still und störe sie nach Möglichkeit nicht! Den Winter verbringen diese Vögel in Afrika, südlich der Sahara.
Unvergessen wird einem jeden Besucher im Herbst der „Ganslstrich“ bleiben, wenn Scharen von Wildgänsen, in bizarren Keilformationen fliegend, den Himmel verdunkeln. Dann denken wir an die Römer, die das Schicksal und die Zukunft aus dem Flug der Vögel, der „Vogelschau“, dem auspicium, zu deuten versuchten. Die Wildgänse suchen auf den weiten Feldern nach Nahrung. Über den Winter kommen sie aus nördlicheren Gebieten zum Neusiedler See.
Am häufigsten gibt es u.a. Graugänse (Anser anser), Saatgänse (Anser fabalis) und Bläßgänse (Anser albifrons).