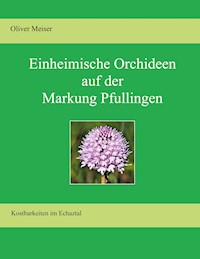
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die in Baden-Württemberg am Fuße der Schwäbischen Alb und am Eingang des Echaztals gelegene Stadt Pfullingen beherbergt auf ihrer großen und geographisch äußerst vielgestaltigen Markungsfläche besondere Schätze botanischer Art: mindestens zwanzig Arten von heimischen Orchideen. Welche Orchideen wachsen wo und weshalb? Welche Arten sind im Untersuchungsgebiet bereits ausgestorben und was sind die Gründe dafür? Diesen Fragen geht der in Pfullingen aufgewachsene Autor, der 1996 mit einer Kartierungsarbeit zum Thema Orchideen seinen Diplomabschluß im Fach Geographie erlangte, nach. Das Buch mit seinen 87 farbigen Abbildungen ist ein Heimatbuch für Naturfreunde in Pfullingen und Umgebung, sowie ein Leitfaden für Fachleute und Interessierte von außerhalb. Gleichzeitig soll es den mit Naturschutz betrauten Vereinen, Ämtern und Behörden helfen, die botanischen Raritäten weiterhin zu schützen, um sie so zur Freude nachfolgender Generationen zu bewahren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„…mit tausend Blumen reichgeschmückt, glänzt deine grüne Au.“
Johannes Schänzlin im Heimatlied „Mein Echaztal“
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Das Untersuchungsgebiet
1.1. naturräumliche Gegebenheiten
1.1.1. Das Relief in seiner strukturellen Abhängigkeit
1.1.2. Das Klima des Untersuchungsgebiets
1.1.2.1. Temperatur
1.1.2.2. Niederschlag
1.1.2.3. Wind und Wolken
1.1.3. Eine Übersicht über die Böden der Markung Pfullingen
1.1.4. Die Vegetation
1.1.4.1. Vegetationsgeschichte
1.1.4.2. Pflanzengesellschaften auf der Markung Pfullingen
a) Waldgesellschaften
b) Wiesen- und Rasengesellschaften
c) Gebüschformationen
d) Felsspalten und unbewaldete Kalkschutthänge
1.2. Pfullingen als Kulturraum - die Nutzung der Markung
1.2.1. Entwicklung der Kulturlandschaft und Nutzung der Markung
1.2.2. Die heutige Nutzung der Markung Pfullingen
1.3. Naturschutz auf der Markung Pfullingen
Das Untersuchungsobjekt: heimischen Orchideen und ihr Schutz
2.1. Gruppierung und systematische Einordnung der Orchideen
2.2. Verbreitung
2.3. Evolution
2.4. Variabilität
2.5. Bastardbildung
2.6. Vermehrung, Bestäubung und Fortpflanzung
2.7. Pilzsymbiosen
2.8. Gründe für den Schutz heimischer Orchideen
2.8.1. Zeigerwert für den Naturschutz
2.8.2. Artenschutz und andere Aspekte
2.8.3. rechtliche Grundlagen
Gefährdungspotentiale auf der Markung Pfullingen
3.1. natürliche Ursachen des Rückgangs heimischer Orchideen
3.1.1. Eingeschränkte Vermehrung
3.1.2. Sukzession
3.2. anthropogen bedingte Ursachen
3.2.1. Flächenverbrauch und Zersiedlung der Landschaft
3.2.2. Landwirtschaft als Gefahrenfaktor
3.2.3. Gefährdungspotential Forstwirtschaft
3.2.4. Das Freizeitverhalten des Menschen
3.2.5. Andere Gefährdungspotentiale
3.3. Wechselwirkungen
Definitionen und Hinweise zur Methodik der Kartierung von 1996
4.1. Exemplar, Exemplarzahl
4.2. Population; Begriffe für Orchideenvorkommen
4.3. Die Abgrenzung des Untersuchungsgebiets
4.4. Pflanzenbestimmung und Geländebegehung
4.5. Karte und Wahl des Kartierungsrasters
4.6. Hinweise zum Quellenmaterial
Flächen mit Orchideenvorkommen im Untersuchungsgebiet
5.1. Der Pfullinger Gielsberg
5.2. Die Lache im Kaltenbronnen
5.3. Rutschung auf den Hangenden Wiesen
5.4. Der Georgenberg
5.5. Die Kleine Wanne
5.6. Ahlsberg, unterer Sportpfad
5.7. Kleine Wanne II
5.8. Lindenallee
5.9. Volkmarsteich, Reitplatz
5.10 Roßwag
5.11. Lippental
5.12. Die Wanne
5.13. Der Schönberg
5.14. Der Wasen
5.16. Der Sonnenbau
5.17. Vor Buch, große und kleine Wiese
5.18. Die Ursulahochberg-Wiese
Diskussion der einzelnen Arten
6.1. Gattung Frauenschuh (
Cypripedium
)
6.1.1. Gelber Frauenschuh (
Cypripedium calceolus
)
6.2. Gattung Waldvöglein (
Cephalanthera
)
6.2.1. Rotes Waldvöglein (
Cephalanthera rubra
)
6.2.2. Weißes Waldvöglein (
Cephalanthera damasonium
)
6.2.3. Schwertblättriges Waldvöglein (
Cephalanthera longifolia
)
6.3. Stendelwurz (
Epipactis)
6.3.1. Sumpf-Stendelwurz (
Epipactis palustris
)
6.3.2. Braunrote Stendelwurz (
Epipactis atrorubens
)
6.3.3. Breitblättrige Stendelwurz (
Epipactis helleborine
)
6.3.4. Violette Stendelwurz (
Epipactis purpurata
)
6.4. Gattung Zweiblatt (
Listera
)
6.4.1. Großes Zweiblatt (
Listera ovata
)
6.5. Gattung Nestwurz (
Neottia
)
6.5.1. Vogel-Nestwurz (
Neottia nidus-avis
)
6.6. Drehwurz (
Spiranthes
)
6.6.1. Herbst-Drehwurz (
Spiranthes spiralis
)
6.7. Gattung Netzblatt (
Goodyera
)
6.7.1. Kriechendes Netzblatt (
Goodyera repens
)
6.8. Gattung Widerbart (
Epipogium
)
6.8.1. Blattloser Widerbart (
Epipogium aphyllum
)
6.9. Gattung Waldhyazinthe (
Platanthera
)
6.9.1. Zweiblättrige Waldhyazinthe (
Platanthera bifolia
)
6.9.2. Grünliche Waldhyazinthe (
Platanthera chlorantha)
6.10. Gattung Hohlzunge (
Coeloglossum
)
6.10.1. Grüne Hohlzunge (
Coeloglossum viride
)
6.11. Gattung Händelwurz (
Gymnadenia
)
6.11.1. Mücken-Händelwurz (
Gymnadenia conopsea
)
6.11.2. Wohlriechende Händelwurz (
Gymnadenia odoratissima
)
6.12. Gattung Fingerwurz (
Dactylorhiza
)
6.12.1. Holunder-Fingerwurz (
Dactylorhiza sambucina)
6.12.2. Fleischfarbene Fingerwurz (
Dactylorhiza incarnata
)
6.12.3. Gefleckte Fingerwurz (
Dactylorhiza maculata
)
6.12.4. Breitblättrige Fingerwurz (
Dactylorhiza majalis
)
6.13. Gattung Einknolle (
Herminium
)
6.13.1. Einknollige Honigorchis (
Herminium monorchis
)
6.14. Gattung Ragwurz (
Ophrys)
6.14.1. Fliegen-Ragwurz (
Ophrys insectifera)
6.14.2. Spinnen-Ragwurz (
Ophrys sphegodes
)
6.14.3. Hummel-Ragwurz (
Ophrys holoserica
)
6.14.4. Bienen-Ragwurz (
Ophrys apifera
)
6.15. Kugel-Orchis (
Traunsteinera
)
6.15.1. Rosa Kugel-Orchis (
Traunsteinera globosa
)
6.16. Gattung Knabenkraut (
Orchis
)
6.16.1. Kleines Knabenkraut (
Orchis morio
)
6.16.2. Brand-Knabenkraut (
Orchis ustulata
)
6.16.3. Affen-Knabenkraut (
Orchis simia
)
6.16.4. Purpur-Knabenkraut (
Orchis purpurea
)
6.16.5. Blasses Knabenkraut (
Orchis pallens
)
6.16.6. Männliches Knabenkraut (
Orchis mascula
)
6.16.7. Ohnhorn
6.17. Gattung Hundswurz (
Anacamptis
)
6.17.1. Pyramiden-Hundswurz (
Anacamptis pyramidalis
)
6.17.2. Wanzen-Knabenkraut (
Anacamptis coriophora
)
6.18. Gattung Riemenzunge, Bocksorchis (
Himantoglossum
)
6.18.1. Bocks-Riemenzunge (
Himantoglossum hircinum
)
6.19. Gattung Korallenwurz
6.19.1.
Corallorhiza trifida
Zusammenfassung
Anhang
I. Im Text und den Tabellen verwendete Abkürzungen
II. Orchideen und Regelhaftigkeiten bei der Verbreitung
III. Häufigkeit der 1996 erfaßten Arten
IV. Arten, die 1996 nicht (mehr) angetroffen wurden
VI. Vom Autor aufgefundene Orchideenstandorte 1986 - 1996
VII. Vom Naturkundemuseum Stuttgart angegebene Fundorte
VIII. Bei Biotopkartierungen festgestellte Orchideenvorkommen
IX. Bei der AHO-Kartierung 2010 vermerkte Orchideenfundorte
X. Beobachtungen auf der Internet-Plattform Naturgucker
XI. Samenreifezeiten einiger Orchideenarten (nach Nitsche 1994)
XII. Orchideenfunde – zeitliche Einordnung und Herbarbelege
XIII. Im Text oder in den Tabellen genannte Beobachtende
Quellenverzeichnis
Abbildungsnachweis
Über den Autor
Einführung
Orchideen sind als Sympathieträger wichtige Flaggschiffe der Natur, die letzterer in ihrer Gesamtheit helfen können, vom Menschen beschützt zu werden.
Das hier vorliegende Buch über die Orchideen von Pfullingen basiert auf einer Diplomarbeit, die ich 1996 zum Abschluß meines Studiums der Geographie an der Universität Tübingen mit dem Schwerpunkt physische Geographie angefertigt habe. Titel damals:
„Die einheimischen Orchideenbestände der Markung Pfullingen und Vorschläge zu ihrem Schutz“
Die Arbeit wurde zu jener Zeit von Prof. Dr. Christian Hannß (1937-2015) betreut. Unterstützt wurde ich dabei auch von dem inzwischen ebenfalls verstorbenen Pfullinger Oberstudiendirektor Helmut Ilg (1926-2018), sowie der Stadt Pfullingen, dem Landratsamt Reutlingen und der Bezirksstelle für Naturschutz im Regierungspräsidium Tübingen.
Dennoch war das Interesse an den Ergebnissen der Untersuchung letztendlich damals leider sehr gering. Die Zeit war vielleicht noch nicht ganz reif; Baden-Württemberg – auch politisch - noch nicht so „grün“ wie heute. Auch ich mußte mich schließlich anderen Dingen zuwenden und habe dann alsbald Pfullingen und seine Umgebung verlassen. So blieb die interessante Diplomarbeit im Elfenbeinturm der Universität nur einem sehr beschränkten Personenkreis zugänglich, was allerdings auch seinen guten Grund hatte, sollte doch verhindert werden, daß „falsche“ Pflanzenfreunde das Werk als „Reiseführer zum Ausgraben von Orchideen“ mißbrauchen.
Wenngleich es vielleicht auch heute noch einige „Unverbesserliche“ geben mag, so ist ja doch inzwischen ein Vierteljahrhundert vergangen und die Gesellschaft hat sich stark verändert; ist doch zu einem guten Stück achtsamer geworden. Viele Menschen – vielleicht sind es all jene, die damals allwochenendlich mit ihren Eltern auf der Alb wanderten - sind umweltbewußter geworden. Parteien, die sich für Natur- und Umweltschutz einsetzen, gestalten die Politik immer stärker mit oder führen sie sogar an. Teile der Alb wurden Biosphärenreservat, an dem auch die Markung Pfullingen Anteile hat, und ein großer Erfolg ist sicher, daß die noch verbliebene Echazaue zwischen Pfullingen und Unterhausen unter Naturschutz gestellt wurde – Erfolge, die in meiner „Pfullinger Zeit“, als ich Schüler und Student war, ferner Traum schienen. Viele naturbegeisterte Bürger, auch wenn sie sich nicht alle in entsprechenden Vereinen engagieren, sind über soziale Medien vernetzt und teilen über Plattformen wie etwa naturgucker.de ihre Beobachtungen auf Spaziergängen und Wanderungen. Über „citizen science“ unterstützen viele die Anstrengungen der Wissenschaft, so daß der Nutzen, diese Arbeit einer größeren Allgemeinheit zugänglich zu machen, eventuelle Risiken deutlich übersteigen dürfte. Man kann die Natur vor dem Menschen schützen und versuchen, letzteren dabei konsequent auszusperren. Das ist eine Strategie. Die andere jedoch ist jene, die Natur gemeinsam mit dem Menschen zu schützen, denn der Mensch und seine Mitgeschöpfe müssen sich nun einmal diese Welt teilen, was insbesondere für das dichtbesiedelte Mitteleuropa gilt.
Artenschutz kann mittel- und langfristig nur mit einer breiten Aufklärung und Akzeptanz durch jeden Einzelnen funktionieren. Begeistert schützen wird man letztendlich nur das, was man kennen- und dadurch liebengelernt hat. Und schließlich ist auch der Mensch ein Teil der Natur, weshalb man ihn, so er sich nur einigermaßen ordentlich verhält, auch nicht dauerhaft von ihr ausschließen kann und soll.
Was das Erscheinen dieses Buches noch erleichtern konnte, sind Verlagskonzepte wie Books on Demand, welche nun auch die Herausgabe von Büchern zu Regionalthemen mit kleinerem Leserkreis lohnenswert machen. Dies animiert, in der Schublade liegende Arbeiten wieder herauszuholen und einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Nachdem ich als Diplom-Geograph eigentlich in der sonst so stark boomenden Branche Tourismus beschäftigt bin und mir die Corona-Krise eine heftige und unerwartet lange Zwangspause verordnet hatte, konnte ich diese Zeit nun anderweitig kreativ nutzen und im Frühjahr 2021 bereits mein altes Buch über die Pfullinger Flurnamen in Neuauflage anbieten. Das unerwartet rege Interesse und der Erfolg haben mich danach bewegt, auch das Thema heimische Orchideen noch einmal anzugehen und für jedermann herauszugeben, so daß interessierte Laien, Schulen, Vereine und die Stadtverwaltung mit diesem Buch arbeiten können. Andere Gemeinden mögen es sich vielleicht ebenfalls ansehen, um für ihre Gemarkungen oder Regionen ähnliche Studien zu treiben.
Der Stand dieser Arbeit beruht, da ich ja 1997 die Region verlassen habe, hauptsächlich auf Beobachtungen, die ich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre und in der ersten Hälfte der neunziger Jahre in meiner sehr aktiven „Pfullinger Zeit“ gemacht habe, vor allem aber natürlich auf den konkreten und intensiven Kartierarbeiten im Rahmen meiner Diplomarbeit 1996. Wenngleich seitdem geraume Zeit verstrichen ist und sich gewiß vieles verändert hat, ist es sicherlich interessant, die Situation heute mit damals zu vergleichen, und vieles von früher mag weiterhin aktuell sein. Da und dort wurden, soweit ich ohne größere Mühe aus der räumlichen Distanz Zugang dazu hatte, auch für die Zeit von 1996 – 2023, insbes. die Orchideenfundorte, betreffend, etliche Aktualisierungen angebracht. Dabei halfen mir sehr viel gebündeltes Wissen bzw. Datenbanken im Internet, die mir im Rahmen meiner Diplomarbeit damals noch nicht zur Verfügung standen (ich gehörte auch zu einer „letzten Generation“, nämlich jener, die noch ohne Internet studieren durfte / mußte). Angesichts der Fülle des vorhandenen Wissens kann eine solche Arbeit freilich nie vollständig sein. Die Möglichkeit der computerisierten Textverarbeitung birgt zudem die große Gefahr, daß man niemals fertig wird, immer noch hinzuschreibt oder umändert. Dies im Hinterkopf behaltend, halte ich mich an eine Redensart, die ich von meiner Zeit in Brasilien mitgenommen habe: „melhor feito do que perfeito!“ – „Besser (endlich) getan als perfekt!“
Zu tiefergehenden, wissenschaftlichen Studien verweise ich nach wie vor auch auf das Original meiner alten Diplomarbeit, das zudem mit zahlreichen Karten versehen ist, die aufgrund ihres A3-Formats aus (kosten-)technischen Gründen nicht in diese Ausgabe aufgenommen werden konnten und die ich damals noch mit viel Fleißarbeit am Zeichenbrett von Hand gezeichnet habe. Die alte Arbeit enthält zudem neben der Beschreibung der wichtigsten Gebiete mit Orchideenvorkommen auch eine Liste mit exakten Fundortbestimmungen nach dem Gauß-Krüger-Koordinatensystem der topographischen Karten, das freilich im Vergleich zu den heutigen digitalen Möglichkeiten antiquiert anmutet. Wer damit arbeiten möchte oder muß, findet im Internet Programme, welche die Gauß-Krüger-Lokalisierungen in GPS-Koordinaten umrechnen. Viele meiner früheren Orchideenfunde habe ich inzwischen auch beim Naturgucker eingegeben bzw. über einige Meldeformulare dem Arbeitskreis Heimische Orchideen Baden-Württemberg zukommen lassen, wo sie z.T. von Interessierten abgerufen werden können. Sie sind jedoch auch noch einmal in einer der Tabellen am Ende dieses Buches zusammengefaßt. Anders als bei meinem Buch zum Thema Flurnamen habe ich mich in dieser Veröffentlichung diesmal für Abbildungen entschieden. Freilich gibt es professionelle Naturfotografen, mit denen ich nicht mithalten kann und auch nicht muß, soll dieses Werk ja weder ein Fotobildband, noch ein Bild-Bestimmungsführer sein. Alle, die sich intensiver mit dem Thema beschäftigen, werden – was ich empfehle - ohnehin auch zusätzliche Pflanzen- bzw. Orchideenbestimmungsführer mit entsprechenden Abbildungen zu Rate ziehen, während richtige Profis allein ihrem Bestimmungsschlüssel vertrauen. Daneben leisten heutzutage auch Bestimmungs-Apps für Handys wie etwa Plantnet immer bessere Dienste und sind vor allem für jene, die sich bereits etwas besser auskennen, eine Hilfe.
Vielleicht bewegt dieses Buch auch wieder einmal junge Menschen entsprechender Studienfachrichtungen zu einer neuen Diplomarbeit mit einer Aktualisierung der Orchideen-Bestandserfassung nach modernsten Methoden oder es animiert sie auch sonst dazu, sich anderweitig für die Sache einzusetzen. Eine engagierte Jugendgruppe wie damals zu meiner Schul- und Studienzeit, scheint es allerdings derzeit in Pfullingen, wie ich mir habe sagen lassen, leider nicht mehr zu geben. Junge Leute heute scheinen sich zwar sehr um die Umwelt zu sorgen, verbringen ihre Zeit dann aber ganz offensichtlich doch lieber mit anderen Dingen. Einige wenige wiederum sorgen gerade u.a. durch das Beschädigen von Kunst für Aufsehen, verprellen dabei jedoch viele andere Menschen, die an sich ein offenes Ohr für Umwelt- und Naturschutzfragen hätten. Neben sinnvolleren Aktionen wäre beispielsweise der Natur- und Artenschutz direkt vor der Haustüre sicher ein Bereich, sich sinnvoll zu engagieren – gerade in einem Städtchen wie Pfullingen, das immer noch von so wunderbarer Landschaft umgeben ist, die es weiterhin zu bewahren gilt. Im Zuge der allgegenwärtigen Diskussion um den Klimaschutz ist leider ein wenig in Vergessenheit geraten, daß Umweltschutz ja sehr viele Facetten hat und daher auch für junge Leute verschiedenste Möglichkeiten des Engagements bietet.
Die Pandemie hat uns durch die Reise- und Mobilitätsbeschränkungen der Jahre 2020-22 auch wieder stärker auf das Lokale zurückgeworfen, uns vielleicht aber auch gezeigt: Nicht nur gewaltige und spektakuläre Naturlandschaften in fernen exotischen Weltengegenden verdienen Begeisterung und Schutz, sondern auch die oft unscheinbaren und kleinen blühenden Kostbarkeiten unserer heimatlichen Wälder und Trockenrasen. Sich mit heimischen Orchideen zu beschäftigen, heißt auch wieder das Innehalten und Sehen zu lernen! Es ist eine Art Entdeckung der Langsamkeit.
Dieses Buch kann auf zweierlei Arten verwendet werden: Zunächst kann man es freilich von Anfang bis Ende durchlesen. Gleichzeitig läßt sich aber auch gezielt Interessantes und Wissenswertes zu den einzelnen, im Gebiet vorkommenden Orchideenarten anhand der entsprechenden Kapitel schnell nachschlagen.
Ein Lektorat habe ich mir auch bei diesem Buch erspart – einmal aus Gründen der eigenen Wirtschaftlichkeit, aber auch, um dieses Buch somit wiederum Ihnen – gerade jetzt in Krisenzeiten – möglichst günstig anbieten zu können. Ich hoffe, daß mir bei der eigenen Korrekturarbeit nicht zu viele Fehler entgangen sind und bitte, wo etwa doch welche auftauchen sollten, um entsprechende Nachsicht.
Um auch andere aktuelle Diskussionen aufzugreifen, möchte ich eingangs noch einmal betonen, daß ich in diesem Buch - auch wenn der Text der Einfachheit halber überwiegend nicht „gegendert“ wurde - ganz ausdrücklich alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft etc. ansprechen möchte. In den letzten Jahren sind ja nicht nur Menschen aus anderen Teilen Deutschlands, sondern auch aus anderen Ländern oder Regionen der Welt nach Pfullingen gekommen, unter denen es vielleicht und hoffentlich ebenfalls Naturbegeisterte gibt.
Gerade der Natur- und Umweltschutzgedanke setzt für eine erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben, vor denen wir stehen, zuerst einmal auch ein freigeistiges, harmonisches und friedliches gesellschaftliches Miteinander voraus. Vor allem letzteres kann in Anbetracht der jüngsten, schrecklichen Ereignisse im Osten Europas nicht oft genug betont werden. Vielleicht mag auch die schöne Natur des Echaztals und am Rande der Schwäbischen Alb dem einen oder anderen geflüchteten Menschen einige Trostmomente schenken. Fest steht jedenfalls: Ohne eine intakte Umwelt, zu der nicht nur das Klima, sondern auch die Artenvielfalt gehört, können wir alle nicht leben!
In diesem Sinne grüße ich alle Leser*innen, insbesondere natürlich jene im Echaztal und in meiner ehemaligen Heimatstadt Pfullingen!
Im Frühjahr 2023,
Oliver Meiser
1. Das Untersuchungsgebiet
Vieles, was zu Beginn dieses Buches angeführt ist, mag für Ortsansässige nicht neu sein. Für Auswärtige jedoch - insbesondere solche, die sich auch stärker wissenschaftlich mit dem Echaztal beschäftigen - bleibt eine nähere Beschreibung des Untersuchungsgebiets dennoch unabdingbar. Vielleicht aber stoßen dennoch auch alteingesessene Einwohner auf interessante Fakten, die in Vergessenheit geraten sind oder gar völlig unbekannt waren.
Die Stadt Pfullingen liegt in unmittelbarer Nähe der Kreisstadt Reutlingen in der Region Neckar-Alb und im Regierungsbezirk Südwürttemberg, dreißig Kilometer südlich von der Landeshauptstadt Stuttgart entfernt.
Großräumlich gesehen befindet sich Pfullingen inmitten der südwestdeutschen Schichtstufenlandschaft, kleinräumlich betrachtet direkt an der Grenze zwischen der mittleren Schwäbischen Alb und dem Albvorland (vgl. Borcherdt 1991, 1992).
Pfullingen besitzt Pfortenlage am Eingang des in die Schwäbische Alb eingeschnittenen Tales der Echaz, die ein 24 km langer Nebenfluß des Neckars ist.
Die Lage des Untersuchungsgebiets am Fuße der Schwäbischen Alb läßt die 3013 Hektar große Gemarkungsfläche äußerst vielgestaltig erscheinen. Die Höhenlagen zwischen 399 und 833 Metern über dem Meeresspiegel, die Hänge mit ihren unterschiedlichen Expositionen, die Geologie mit ihren verschiedenen Ausprägungen des Braunen und Weißen Jura, die unterschiedlichen hydrologischen Verhältnisse dieser beiden geologischen Abteilungen, sowie auch die aus den Wechselwirkungen der einzelnen Geofaktoren entstandenen Böden bringen ein reichhaltiges Mosaik an Pflanzenstandorten mit sich. Beeinflußt wird die Pflanzenwelt auch ganz besonders vom Klima, das u.a. wiederum von Höhenlage und Exposition gesteuert wird und so auf engem Raum für dennoch sehr heterogene Bedingungen sorgt.
Zu allem kommt als weiterer, wichtiger Faktorenkomplex die Wirtschaftsweise des Menschen, der hier ohne Unterbrechung seit der Jungsteinzeit siedelt. Seine bäuerliche Kultur, sowie andere Eingriffe haben die Landschaft und deren Vegetationsdecke entscheidend mitgestaltet und verändern sie immer noch. Auch einzelne Pflanzenarten wie die Orchideen unterliegen den Einflüssen des Menschen und werden in ihrer räumlichen Verbreitung durch sie bestimmt.
Im folgenden Teil geht es also zunächst um eine Übersicht über einige physische und kulturelle Geofaktoren, deren Kenntnis für ein besseres Verständnis der Kartierungsergebnisse hilfreich, wenn nicht sogar unbedingt notwendig ist.
1.1. naturräumliche Gegebenheiten
1.1.1. Das Relief in seiner strukturellen Abhängigkeit
Die Pfullinger Markung wird von der südwestdeutschen Schichtstufenlandschaft mit dem gesamten dafür typischen Formenschatz geprägt. Geologisch gliedert sich die Markungsfläche in solche Gebiete, in denen der Braune Jura (Dogger, Mittlerer Jura) und solche, in denen der Weiße Jura (Malm, Oberer Jura) ansteht. Vulkanische Schlotfüllungen und Kalktufflager bereichern das Bild (vgl. geologische Karte 1988, Ziegler in Neske 1982).
Die Geländeformen nehmen, da sie u.a. das Kleinklima bzw. die Nutzung durch den Menschen mitbestimmen, auch mehr oder weniger direkt Einfluß auf die Verbreitung der Orchideen.
Hauptschichtstufe ist die des Weißen Jura. Sie bildet den Aufstieg vom Albvorland zur Albhochfläche. Auf der Markung Pfullingen gliedert sich dieser Anstieg in zwei markantere Stufen: Die erste wird von den Wohlgeschichteten Kalken (nach F. A. Quenstedt: Weißjura Beta, internat. Bez.: Oxford-Kalke) gebildet. Ihr gehören die Verebnungen von Wanne, Ursulaberg, Scheibenberg und Pfullinger Gielsberg an. Eine zweite Stufe, bei der die Unteren Felsenkalke (Weißjura Delta, Kimmeridge-Kalke) Stufenbildner sind, führt schließlich auf die Schichtflächenalb. Teil dieser zweiten Stufe sind Auchtert, Schönberg, Lippentaler Hochberg, Ursulahochberg und Übersberg. An der zusammenhängenden Schichtflächenalb selbst hat die Markung Pfullingen jedoch keinen nennenswerten Anteil (vgl. geolog. Karte 1988, Geyer / Gwinner 1991).
Einige wichtige geologische und geomorphologische Erscheinungen auf der Markung Pfullingen (Entwurf: O. Meiser 1996, nach geolog. Karte 1988)
Ein wichtiger Stufenbildner des Weißen Jura sind die Wohlgebankten Kalk (Weißjura Beta), hier an der Alten Steig am Ursulaberg.
Die Stufenbildner formen die steilen Oberhänge der Schichtstufen. Diese Oberhänge sind, da schwer nutzbar, naturnahe Lebensräume, in denen sich seltenere Pflanzen wie Orchideen ungestört entwickeln können. Die weniger steilen Unterhänge, die häufig von würmeiszeitlichen Weißjura-Schuttmanteln überdeckt sind, stellen die Sockel der Schichtstufen dar. Sie werden von weniger widerstandsfähigen Gesteinen gebildet: die Impressamergel (Weißjura Alpha, Oxford-Mergel) sind Basis für die darüber liegenden Wohlgeschichteten Kalke; Sockelbildner für die Unteren Felsenkalke sind die Mittleren Weißjuramergel (Weißjura Gamma, Kimmeridge-Mergel; vgl. geolog. Karte 1988, Ohmert 1988).
Die Gesteine des Weißen Jura sind verkarstungsfähig und weisen daher Karstformen auf. Mehrere Dolinen sind auf dem hinteren Schönberg zu sehen. An der Traufkante der Won, südlich des Wackersteins, befindet sich die Hanneshöhle, eine Tropfsteinhöhle (vgl. Binder 1989).
Der verkarstete Untergrund führt das Niederschlagswasser schnell ab, so daß vor allem auf den gerodeten Flächen der Beta- und Delta-Stufen relativ trokkene Bedingungen herrschen, die - in Verbindung mit der Nutzung durch den Menschen - das Entstehen von Trockenrasen fördern. Die Trockenrasengesellschaften sind wiederum wertvolle Lebensräume für die heimischen Orchideen.
Freistehende Felsen wie Wackerstein und Mädlesfels sind ehemalige Schwammriffe, die den Weißjura Delta durchsetzen (vgl. Ziegler in Neske 1982).
Die ebeneren Markungsteile im Tal sind Stufenflächen der Braunjura-Schichtstufen. Diese treten aber - im Vergleich zu der mächtigen Weißjura-Schichtstufe - im Gelände meist weniger auffällig hervor und sind aufgrund ihrer intensiveren Nutzung durch den Menschen als landwirtschaftliche Nutzfläche oder Siedlungsfläche weniger orchideenreich. Auch die bodensaueren Standortverhältnisse bedingen ein weitgehendes Fehlen der Orchideenflora (vgl. geolog. Karte 1988, Ilg in Neske 1982).
Einen wichtigen Stufenbildner des Braunjura stellen die sog. Blaukalke dar, die Teil des Braunjura Gamma (Kalksandige Braunjuratone, Sonninienschichten) sind (vgl. Geyer / Gwinner 1991). Sie sind geologischer Untergrund der vorwiegend landwirtschaftlich genutzten Fläche der Röt, deren Stufenhang nach Norden zur Markung Reutlingen hin abfällt (vgl. geolog. Karte 1988).
Die Grenze zwischen der obersten Schicht des Braunen Jura, den Ornatentonen, und der untersten Schicht des Weißen Jura, den Impressamergeln, ist in mehrfacher Hinsicht von Bedeutung: Sie fällt im Untersuchungsgebiet zumeist mit dem Übergang vom sanfter geneigten Unterhang zum steileren Oberhang der Weißjura-Beta-Stufe zusammen; ist daher oft auch Grenze zwischen der Grünlandwirtschaft im Tal und forstwirtschaftlicher Nutzung an den steileren Hangpartien. Neben der Schichtgrenze Impressamergel - Wohlgeschichtete Kalke, ist sie ein Quellhorizont, auf dem viele Fließgewässer der Markung wie Eierbach, Lindentalbach oder Breitenbach zumindest einen Teil ihrer Quellen haben (vgl. geolog. Karte 1988).
All diese kleineren Fließgewässer wie auch die größere Echaz gehören zum gefällereichen rheinischen Flußsystem. Sie haben Schichtflächenalb und Schichtstufen der Markung Pfullingen zerschnitten und immer weiter zurückverlegt. Dabei wurden widerstandsfähigere Teile der Schichtstufe inselartig isoliert und als Zeugenberg stehengelassen. Die Achalm auf der benachbarten Reutlinger Markung ist so ein Zeugenberg. Die meisten Berge der Pfullinger Markung sind sogenannte Ausliegerberge, die nur noch über ihren Sockel bis maximal in den Mittelhangbereich hinein mit der eigentlichen Albhochfläche verbunden sind.
Der kegelförmige Georgenberg hingegen – ebenfalls ein wichtiger Orchideenstandort - ist eine durch das Zurückweichen der Schichtstufen freigelegte Schlotfüllung aus Basalttuff. Sie gehört zu den westlichen Ausläufern des sogenannten Schwäbischen Vulkans. Dieser Schwäbische Vulkan mit seinen 350 Schloten und einem Zentrum um Bad Urach und Kirchheim hatte seine aktive Phase im Miozän, einer Abteilung des Tertiärs, vor ca. 10 - 20 Millionen Jahren. Der Georgenberg besteht aus Melilithit, einer Schlotbrekzie mit Trümmern der durchschlagenen Jura-Schichten, die sich zur Ausbruchszeit noch bis in die Stuttgarter Gegend erstreckt haben (vgl. Ziegler in Neske 1982, Geyer / Gwinner 1991).
Das Zurückweichen der Schichtstufen geht allmählich, aber auch durch plötzliche Ereignisse wie z.B. dem Mössinger Bergsturz vonstatten. Dort bewegte sich am 12.4.1983 ein großer Teil des Hirschkopfs talwärts (Geyer / Gwinner 1991).
An den Weißjura-Schichtstufen trifft man eher auf Bergrutsche, die durch schollenartiges Abgleiten entstanden sind, während die Hänge im Bereich des Braunjuras, insbesondere in den Opalinustonen (Braunjura Alpha) und Ornatentonen (Braunjura Zeta) eher durch allmähliches Nachrutschen geprägt sind. 1939 wurden durch solche Massenverlagerungen am Georgenberg Häuser beschädigt (geolog. Karte 1988, Ziegler in Neske 1982).
Erfolgt nicht gerade eine unvernünftige Bebauung, bleiben Nutzungsansprüche durch den Menschen an diesen steileren Braunjura-Hängen meist aus. Einige Orchideenstandorte befinden sich gerade in solchen Rutschungsgebieten.
Die Talsohlen selbst wurden ab ca. 5000 v. Chr. mit mächtigen Kalktufflagern ausgekleidet. Der Kalktuff, der bis vor einigen Jahrzehnten für Bauzwecke gewonnen wurde, ist eine Folgeerscheinung des Karstes, eine sekundäre Karsterscheinung. Er entsteht, wenn der im Untergrund der Karstgebiete durch kohlensaures Wasser gelöste Kalk über die Gewässer im Tal wieder ausgeschieden wird. So wenig die intensiv grünlandwirtschaftlich genutzten Talsohlen als Orchideenstandorte eine Rolle spielen, so wichtig sind sie jedoch für pollenanalytische Datierungen, die wiederum (siehe 1.1.3.1.) eine Rekonstruktion der nacheiszeitlichen Vegetationsgeschichte zulassen (vgl. Ziegler in Neske 1982, geologische Karte 1988).
1.1.2. Das Klima des Untersuchungsgebiets
Für das Gedeihen von Pflanzen sind die klimatischen Verhältnisse von entscheidender Bedeutung. In unseren Breiten können die Lebensprozesse der Pflanzen erst dann optimal ablaufen, wenn die Temperatur-Tagesmittel über plus 5° C bleiben. Diese Zeit wird als Vegetationsperiode verstanden. Eine Rolle spielt insbesondere das bodennahe Klima, das extremer als die üblichen, in zwei Metern Höhe gemessenen Werte ist. Klimatisch entscheidend sind auch Hangneigung und Exposition des Standorts (vgl. Schmidt 1969).
Südwestdeutschland liegt im Bereich der gemäßigten und feuchten Westwindzone Mitteleuropas. Es wird sowohl von maritimen als auch kontinentalen Einflüssen geprägt, die sich - bedingt durch das reich gegliederte Relief - überlagern und auf engem Raum miteinander verzahnen. Schon Robert Gradmann (1931, I, S.50) sprach von einem schachbrettartigen Wechsel ozeanischen und kontinentalen Klimas in Südwestdeutschland (vgl. auch Huttenlocher 1968, Kullen 1983, Borcherdt 1991).
Die Markung Pfullingen liegt an der Grenze zwischen der kontinental getönten Albhochfläche und dem milderen, eher ozeanisch geprägten Albvorland, so daß - je nach Höhenlage - beide Einflüsse jeweils mehr oder minder zum Ausdruck kommen. Exposition bzw. Luv- und Leelagen wandeln das Großraumklima in eine Vielzahl von Mikro- und Mesoklimaten ab.
Inwiefern die Klimaerwärmung, wie sie sicher auch im Untersuchungsgebiet zwischen 1996, dem Jahr der Diplomarbeit, und 2022, dem Jahr des Erscheinen dieses Buches weiter fortgeschritten ist, die vielfach wärmeliebenden Orchideen in ihrer Verbreitung weiter begünstigt hat, könnte mit Sicherheit ein interessantes Thema neuer Studien sein. Standorte von Orchideen sind allerdings sehr komplexe Gefüge verschiedener Faktoren. So kann das immer häufigere Fehlen einer Schneedecke im Zusammenhang mit einer Klimaerwärmung oder auch einer Zunahme von Stürmen (Verblasen von Schnee) dazu führen, daß Standorte dennoch verstärkt unter Frost leiden. Zunehmende Trockenheit und die sich dadurch verändernden Zusammensetzungen von Wäldern könnten vielen Arten ebenfalls Probleme bereiten. Der Trend der Erwärmung geht offenbar - zur großen Sorge von uns allen und v.a. der jüngeren und nachfolgenden Generationen - weiter.
Mehr zu diesem Thema ist für unsere Region in einem Bericht vom Landkreis Reutlingen auch im Internet für jedermann einsehbar (vgl. Lkr. Reutlingen 2016).
Station
Höhenlage [ mNN ]
Jahresmittel [°C]
Tübingen (V)
333
9,3
Metzingen (V)
346
8,9
Reutlingen (V)
381
9,2
Pfullingen (V)
425
8,3
St. Johann (T)
765
6,9
Münsingen (H)
721
6,4
Trochtelfingen (H)
700
6,0
1.1.2.1. Temperatur
Höhenunterschiede, die vom tiefstgelegen Punkt der Markung bis zur höchsten Erhebung 435 m betragen, lassen die Temperaturabnahme mit der Höhe, wie auch Kondensationsniveaus bei Niederschlägen, deutlich in Erscheinung treten.
Während in den Tälern ein Temperatur-Jahresmittel von 8,5° C herrscht, sind es auf der Albhochfläche nurmehr 6-7° C - ein Unterschied, der zunächst nicht nennenswert erscheint, aber beispielsweise darüber entscheiden kann, ob bei winterlichen Niederschlägen im Tal noch Schnee fällt oder nicht.
2001-2010 gab es am Albrand des Lkr. Reutlingen im Mittel 30-45 Schneetage, d.h. Tage mit Schneehöhen von über 10 cm (vgl. Lkr. Reutlingen 2016).
Der Unterschied von 1,5 – 2° C im Temperatur-Jahresmittel zwischen Berg- und Tallagen verzögert den Frühling und die Blütezeiten von Pflanzen auf der Albhochfläche, verglichen mit denen im Tal, im Schnitt um zwei Wochen. Beginnt beispielsweise die Hauptblüte der Echten Schlüsselblume (Primula veris) im Tal Anfang April, liegen die Hochwiesen von Schönberg und Ursulahochberg oft noch in winterlichem Braun. Die Hauptblüte von Primula veris setzt dort erst Mitte April, in ungünstigen Jahren sogar später ein.
Das Vorhandensein des ausgeprägten Reliefs macht sich thermisch nicht nur in einer vertikalen Abnahme des Temperaturgradienten bemerkbar, sondern sorgt im Traufbereich auch für die Begünstigung sonnenexponierter Hänge, die auch bei niedrigem Sonnenstand im zeitigen Frühjahr und im späten Herbst noch reichlich bestrahlt werden.
Südhänge erhalten schon im März um ein Drittel mehr Sonnenstrahlung als horizontale Flächen, und sogar noch mehr Sonnenstrahlung als Nordhänge im Juli (vgl. Heyer 1993).
Wie auch der Flurname vermuten läßt, ist der südwestexponierte Sonnenbau am Ursulaberg eine der wärmsten Hanglagen der Markung. Hier zieht schon Mitte März der Frühling mit der Blüte der Küchenschelle (Pulsatilla vulgaris) ein, wenn an den schattigen Osthängen des Schönbergs und in den Tobeln, den steilen Kerbtälern der Breitenbach-Zuflüsse, manchmal noch Schnee liegt.
Sommerliche Temperaturmaxima können auf solchen südexponierten Halbtrockenrasen in Bodennähe mit 50° C doppelt so hoch liegen wie in den durch das Kronendach der Bäume geschützten, benachbarten Wäldern. Örtlich werden am Boden sogar 70° C erreicht. Nachts jedoch fallen die Werte bis auf 10° C, da die Strahlung nicht zurückgehalten wird (vgl. Projektgruppe Universität Paderborn 1991, Jedicke et alii 1993).
So ist der Sonnenbau im Naturschutzgebiet Kugelberg aufgrund des Wärmeanspruchs vieler Orchideenarten einer der wichtigsten Standorte dieser Pflanzen auf der Pfullinger Markung. Hier leitet das Helm-Knabenkraut (Orchis militaris) Anfang Mai die Orchideenblüte im Tal ein (vgl. Ilg in Neske 1982).
Winterliche Inversionswetterlage vor dem Albtrauf bei Pfullingen und Eningen. Die Kaltluft fließt in die Talsohlen ab, während die mittleren und oberen Hangbereiche, wo sich die Mehrzahl der Orchideenstandort befindet, weitgehend vor Frost geschützt bleiben.
Insgesamt sind am Albrand im Durchschnitt knapp 2000 Sonnenscheinstunden zu erwarten (so etwa in Metzingen 1949; nach Deutschem Wetterdienst 5/2016 – 4/2021).
Im Winter treten (siehe Bild) häufig Inversionswetterlagen und damit eine Temperaturumkehr auf: In windstillen, kalten und klaren Nächten kühlt die Oberfläche des Bodens und mit ihr die bodennahe Luft stark ab. Die kalte Luft sammelt sich dann in Tälern und Senken, während Hänge wie der Sonnenbau oder die Hochflächen vom Frost weniger betroffen werden (vgl. Ilg in Neske 1982, Heideker 1990 / 91, Borcherdt 1991). Auch dies wirkt sich günstig für die wärmeliebenden und spätfrostempfindlichen Orchideen aus.
1.1.2.2. Niederschlag
Auch der Niederschlag ist für die Pflanzen ein sehr entscheidender Standortfaktor. Die Orchideen benötigen vor allem im Frühjahr ausreichende Niederschläge (Presser 1995).
Der Albtrauf und die Albhochfläche erhalten weniger Niederschlag als der Schwarzwald, weil sie in dessen Regenschatten liegen, d.h. bei vorwiegenden westlich-nordwestlichen Wetterlagen ein großer Teil des Niederschlags bereits dort fällt. Trotzdem erreichen die Niederschläge am Albtrauf aufgrund der Luv-Wirkung noch einmal ein sekundäres Maximum, einen gegenüber dem Vorland deutlich erhöhten Wert. Auf der Albhochfläche ist wiederum weniger Niederschlag als am Albtrauf zu verzeichnen, da hier ebenfalls wieder die Lee-Wirkung zum Tragen kommt (siehe Tabelle, vgl. Schirmer u. Vent-Schmidt 1979, Kullen 1984, Borcherdt 1991).
Auch kleinräumig macht sich - reliefbedingt durch die Nord-Süd-Ausrichtung der Albauslieger wie Ursulaberg oder Wanne/Schönberg - eine Gliederung in niederschlagsreichere Luv- und niederschlagsärmere Leelagen bemerkbar, was sich letztendlich auch in der Anordnung der Pflanzengesellschaften wiederspiegelt (vgl. vegetationskundliche Karte 1958).
In fast allen Jahreszeiten dominieren in Mitteleuropa die Westwetterlagen. Westlagen machen 27,5 %, Nordwestlagen 9,2 % und Nordlagen 16,2 % aller Wetterlagen aus (vgl. Lauer 1993).
Bei diesem Vorherrschen der Winde aus Westen und nordwestlichen Richtungen erhalten die west- und nordwestexponierten Hänge der Albauslieger mehr Niederschlag als die windabgewandten Ostseiten. Andererseits trocknen diese West- und Nordwestseiten bei strahlungsreichen Wetterlagen auch schneller wieder aus.
Bestimmte Schlechtwetterlagen lassen das Kondensationsniveau als Wolken- oder Nebelgrenze deutlich erkennen.
Bei der Verteilung der Niederschläge liegt das Maximum im Sommerhalbjahr, was schon deutlich auf kontinentalere Einflüsse hinweist (vgl. Schirmer u. Vent-Schmidt 1979, Borcherdt 1991).
Station
Höhenlage [ mNN ]
Jahresniederschlag [mm]
Tübingen (V)
333
932
Metzingen (V)
346
934
Reutlingen (V)
358
778
Pfullingen (V)
425
840
RT-Gönningen (V)
538
850
Sonnenbühl-Genkingen (T)
741
947
St. Johann (T)
765
1025
Münsingen (H)
721
888
Trochtelfingen (H)
700
789
Von den insgesamt 934 mm Niederschlag der Klimastation im benachbarten Reutlingen fällt mit gut 500 mm über die Hälfte in den Monaten von Mai bis Oktober. In den Monaten Mai bis Juli, der Hauptblütezeit der Orchideen ist es fast ein Drittel des Gesamtniederschlags (vgl. www.climate-data.org).
Die Blüte der Orchideen liegt somit in einem Zeitraum, der einerseits mit genügend Feuchtigkeit versorgt ist, andererseits auch durch günstige thermische Verhältnisse den Orchideen gute Wachstumsbedingungen bietet.
Bei winterlichen Niederschlägen liegt der Übergang vom Regen zum Schnee meist bei einer Höhe von 500 – 600 Metern Meereshöhe. Längere Perioden mit Schneelagen in Tal und Stadtgebiet sind in den letzten Jahren seltener geworden. Schnee spielt aber für die wärmeliebenden Orchideen eine entscheidende Rolle. Eine Schneedecke schützt die Pflanzen vor Frost. In schneearmen Wintern kann auch Reif diesen Schutz bieten (vgl. Haber 1972).
1.1.2.3. Wind und Wolken
Bei den Winden herrschen, wie bereits angesprochen, solche aus westlichen und nordwestlichen Richtungen vor (vgl. Lauer 1993).
Sie führen Wolken und Niederschläge an den Albtrauf heran. Ostwinde treten seltener auf und wirken sich am Albtrauf und im Albvorland kaum niederschlagsauslösend aus. Der sich von Süden nach Norden erstreckende, vordere Ursulaberg, der alten Legenden folgend wie eine schlafende Frau vor der Stadt liegt, schützt weite Teile der Markung vor den kalten Ostwinden.
Je nach Stärke und Feuchtigkeitsgehalt des Windes werden die Feuchtigkeit des Bodens und die Transpiration der Pflanzen beeinflußt. Insbesondere an den luvseitigen Traufkanten herrschen besondere Extreme zwischen starker Austrocknung durch Winde einerseits und einer intensiven Durchfeuchtung durch niederschlagsreiche Luftmassen aus westlichen Richtungen andererseits (vgl. Heideker 1990/91).
Bei Süd- und Südostwindlagen, wenn die Luftmassen die Alb überqueren und am Albtrauf 300 - 400 m absteigen, kommt es sogar zu einer Föhnwirkung, was sich in einer leicht erhöhten Temperatur und einer Wolken- bzw. Nebelauflösung gegenüber Albvorland und Albhochfläche bemerkbar macht. Daher ist das Zentrum der Stadt Pfullingen sehr nebelarm (Ilg in Neske 1982).
Lediglich die am tiefsten gelegenen Lagen der Markung - die Stadtteile Steinge und Burgweg - werden noch von dem großräumigen Talnebelgebiet des Neckartals erfaßt, während die höchsten Erhebungen des Untersuchungsgebietes der Hoch- und Wolkennebelzone der Schwäbischen Alb angehören (vgl. Kalb und Schirmer 1992 ).
Kleinräumige Nebelbildungszonen treten – „wo die Hasen kochen“, wie der Volksmund sagt - in feucht-kühlen Hangmulden wie am Lippentaler Hochberg, im Gewann Küche oder am Scheibenberg bzw. dem Hang des Genkinger Gielsbergs auf (Ilg in Neske 1982).
Haber (1972) bemerkt, daß gute Wuchsorte von Orchideen immer windgeschützt liegen. Er stützt diese Behauptung auf die Beobachtung anderer Autoren, denen aufgefallen war, daß auf Flächen, die hinsichtlich übriger Standortfaktoren gleiche Bedingungen boten, die Orchideen nur an windruhigen, oft scharf abgegrenzten Stellen wuchsen. An solchen Standorten hält sich eine höhere Schneedecke, die, wie bereits erwähnt, einen Schutz vor Frost bietet. Auch die Tatsache, daß die Pflanzen an solchen Stellen rein mechanisch weniger beansprucht werden, mag eine Rolle spielen.
Dennoch ist der Faktor Wind für die Verbreitung der Orchideen (siehe Kapitel 2.6.) sehr wichtig. Die winzigen Samen werden über große Distanz vom Wind verbreitet, so daß an klimatisch günstigen Stellen des Albtraufs Samen von Arten aus dem noch wärmeren Kaiserstuhl keimen können. Solche Vorkommen erlöschen jedoch meist nach wenigen Jahren, da die Bedingungen des Albtraufs den thermischen Ansprüchen mancher Arten schon nicht mehr genügen (Ilg, nach mündl. Mitteilung 1996).
1.1.3. Eine Übersicht über die Böden der Markung Pfullingen
„Boden ist das mit Wasser, Luft und Lebewesen durchsetzte, unter dem Einfluß der Umweltfaktoren an der Erdoberfläche entstandene [... ] Umwandlungsprodukt mineralischer und organischer Substanzen, das in der Lage ist, höheren Pflanzen als Standort zu dienen“.
(nach D. Schroeder 1969 ).
Somit ist der Boden für die Pflanzen von großer Bedeutung. Dennoch lassen die Bodentypen nicht unbedingt Rückschlüsse auf Pflanzenstandorte zu (vgl. Kaule 1986).
Im Fall der Orchideen zeigt sich, daß diese bevorzugt auf kalkreichem Bodensubstrat zu finden sind. Dies bedeutet aber keineswegs, daß die Orchideen auf große Kalkmengen im Boden angewiesen sind. Sie weichen unter dem natürlichen Konkurrenzdruck offenbar lediglich dorthin aus und zeigen mit ihrem Vorkommen kalkreiche Standorte an (vgl. Ellenberg 1992).
Hinsichtlich ihrer Bodentypen ist die Markung Pfullingen, bedingt u.a. durch Relief und geologischen Untergrund, ebenfalls äußerst vielgestaltig. Im folgenden sollen nur die wichtigsten Bodentypen im Untersuchungsgebiet kurz beschrieben werden, um eine Vorstellung von den Bodenverhältnissen auf der Markung Pfullingen zu vermitteln. Daß es bei den Böden natürlich Zwischenformen und Subtypen gibt, sei an dieser Stelle erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt. Einen sehr detaillierten Einblick in die Bodenverhältnisse gibt die Bodenkarte von Baden-Württemberg 1 : 25 000, Blatt 7521 Reutlingen, aus dem Jahr 1990.
Der im Untersuchungsgebiet am häufigsten auftretende Bodentyp ist die Rendzina, die in Süddeutschland auch unter dem Namen Fleinserde bekannt ist (vgl. Bodenkarte 1990).
Der Bodentyp entsteht auf kalkhaltigen Locker- oder Festgesteinen über das initiale Entwicklungsstadium eines Syrosems. Der Oberboden liegt dem anstehenden oder angewitterten Gestein direkt auf. Die Rendzina ist flachgründig und nur wenig tief durchwurzelbar. Sie trocknet wegen dieser Flachgründigkeit schnell aus, erwärmt sich aber aufgrund ihrer dunklen Farbe rasch. Der Boden besitzt, wo nicht Kälte oder Trockenheit einschränkend wirken, eine hohe biologische Aktivität (vgl. Mückenhausen 1985).
Im Untersuchungsgebiet haben sich die Rendzinen insbesondere auf den kalkhaltigen Gesteinen bzw. dem Gesteinsschutt der Weißjura-Schichtstufe entwikkelt (vgl. Bodenkarte 1990, geologische Karte 1988). An solchen Standorten sind als Orchideenarten insbesondere die Vogel-Nestwurz (Neottia nidus-avis) oder das Weiße Waldvöglein (Cephalanthera damasonium) anzutreffen.
In den bewaldeten, steilen Hangbereichen des Untersuchungsgebiets überwiegen Rendzinen-Böden von geringer Mächtigkeit. Sie werden von den Bäumen nur flach durchwurzelt.
Pelosole sind tonige Böden mit über 50 % Anteil an Feinsubstanz (vgl. Mükkenhausen 1985). Sie entstehen aus tonreichen Gesteinen, die in ihrem oberen Teil durch Quellung und Schrumpfung geprägt sind (vgl. Semmel 1993). Pelosole besitzen zwischen ihrem Oberboden und dem anstehenden Gestein tonreiche Horizonte (mind. 45 % Ton). In ihnen ist das Schichtgefüge des Ausgangsgesteins aufgelöst. Die Pelosole unterliegen durch ihre Quellung und Schrumpfung einem starken Wechsel zwischen hohem Wassergehalt und Austrocknung. Deshalb werden sie kaum ackerbaulich genutzt (vgl. Scheffer, Schachtschabel 1982).
Im Untersuchungsgebiet treten sie im untersten Sockelbereich der Alb-Hauptschichtstufen auf; dort, wo noch Brauner Jura ansteht. Des weiteren finden sie sich an den Stufenhängen auf Braunjura Gamma und an den Hängen des Selchentals mit seinen Nebentälern (vgl. Bodenkarte Reutlingen 1990).
Braunerden entstehen im warmgemäßigt-feuchten Klima bei Jahresniederschlägen von 500 - 800 mm, hoher Verdunstung, nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit und einer Jahresmitteltemperatur von 7-10° C. Sie können sich aus verschiedenen Bodentypen entwickeln und vielerlei Ausprägungen annehmen. Übergänge zu anderen Bodentypen sind häufig. Die Braunerde besteht aus einem humosen Oberboden, und einem durch Verwitterung verbraunten, und verlehmten mineralischen Unterboden. Durch die sandig-lehmige Textur und das lockere, poröse Gefüge können Niederschlagswasser, Luft und Wurzeln gut in den Boden eindringen, so daß die Braunerde normalerweise für die Landwirtschaft günstig ist (vgl. Mückenhausen 1985). Daher wird im Bereich der Braunerdevorkommen auf der Schichtfläche des Braunjura Gamma (Gewann Röt) das Gelände ackerbaulich genutzt. Orchideen kommen dort - aufgrund dieser intensiven landwirtschaftlichen Nutzung, aber auch aufgrund fehlenden Kalkgehalts - nicht vor (vgl. Bodenkarte Reutlingen 1990).
Eine größere Verbreitung im Untersuchungsgebiet haben noch die braunen Auenböden, die auch nach einer Bezeichnung aus dem Spanischen Vegas genannt werden (vgl. Bodenkarte Reutlingen 1990). Sie sind aus verlagertem, mehr oder minder humosem Bodenmaterial entstanden (vgl. Kuntze et alii 1994) und werden durch den Einfluß des Grundwassers, das mit dem Wasserstand des Flusses stark schwankt, geprägt (vgl. Semmel 1993). Die Braunen Auenböden sind entkalkt, verbraunt und verlehmt (vgl. Schlichting 1986). Die gut durchlüfteten Böden ergeben gutes bis sehr gutes Ackerland (vgl. Kuntze et alii 1994).
Braune Auenböden finden sich in der Talaue entlang der Echaz zwischen Pfullingen und Unterhausen (vgl. Bodenkarte Reutlingen 1990). Sie sind intensiv grünlandwirtschaftlich, aber im Bereich geringerer Überschwemmungsgefahr auch stellenweise ackerbaulich genutzt und bieten daher kaum Lebensbedingungen für die heimischen Orchideen.
Gleye sind nasse, zumeist durch Grundwasser vernäßte Böden. Sie entstehen meist bei einem Grundwasserstand zwischen 40 und 80 cm unter der Oberfläche. Unter einem humosen Oberboden liegt, im Schwankungsbereich des Grundwassers, ein Oxidationshorizont; darunter, wo ständig Wasser steht, ein Reduktionshorizont.
Gleye werden aufgrund ihrer ungünstigen Vernässung meist als Grünland genutzt (vgl. Mückenhausen 1985).
Die Gleye im Untersuchungsgebiet sind jedoch meist räumlich engbegrenzte Waldstandorte entlang von kleinen Fließgewässern, die auf den Quellhorizonten entspringen (Bodenkarte Reutlingen 1990).
In geringerem Ausmaß finden sich noch Kalkstein-Braunlehme (Terrae fuscae), die aus Rendzinen entstehen, wenn silikatische, tonreiche Lösungsrückstände eines Kalksteins (oder anderer Gesteine) versauern und gleichzeitig 10-30 cm Mächtigkeit erreicht haben (vgl. Scheffer / Schachtschabel 1982). Sie bilden sich bevorzugt in muldigen Lagen, wo eine gewisse Feuchte im Verwitterungsmilieu gegeben ist. Diese Feuchte kann auch das Vorhandensein von Mergel im geologischen Untergrund anzeigen (vgl. Mückenhausen 1985). Im Profil ist der Bodentyp an seinem leuchtend gelb- bis rotbraun gefärbten Unterboden zu erkennen. Die Kalkstein-Braunlehme werden wegen der schweren Bearbeitbarkeit vorwiegend als Wald oder Weideland genutzt (vgl. Scheffer/ Schachtschabel 1982).
Im Untersuchungsgebiet finden sie sich meist unter Wald auf den Schichtflächen der Weißjura-Stufe (Bodenkarte Reutlingen 1990).
1.1.4. Die Vegetation
„Die Vegetation [...] kennzeichnet die Gesamtheit der in einem Erdraum verbreiteten Pflanzengemeinschaften, also die Pflanzendecke, die sich wieder aus der Vergesellschaftung der einzelnen [Pflanzen-] Sippen zusammensetzt.“
( Klink / Mayer 1983, S.8 ).
Da sich diese Arbeit mit dem Schutz und der Verbreitung einer ganz bestimmten Pflanzenfamilie beschäftigt, muß auf die Vegetation des Untersuchungsgebietes logischerweise etwas ausführlicher als auf die übrigen Geofaktoren eingegangen werden.
1.1.4.1. Vegetationsgeschichte
Um die heutige Vegetation, ihre Artenzusammensetzung und Dynamik besser zu verstehen, ist es wichtig, einen Einblick in die spät- und nacheiszeitliche Vegetationsgeschichte des Echaztals zu geben. Eigene Entdeckungen des Autors, sowie pollenanalytische Untersuchungen, die 1960 in einer Tuffsandgrube gemacht wurden, ermöglichen dies.
Am Ende des letzten Würm-Hauptstadials, des letzten großen Eisvorstoßes der Würm-Eiszeit, herrschte in unserem Gebiet zunächst eine baumfreie Tundra, wie man sie heute in den hohen, nördlichen Breiten findet. Die Temperaturen lagen damals etwa um 6 – 8° C unter dem heutigen Jahresmittel und der Mensch durchstreifte die Landschaft als Altsteinzeit-Jäger.





























