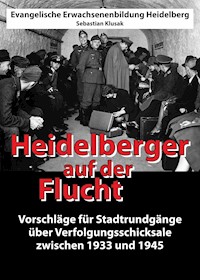
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Heidelberg zwischen 1939 und 1945: Jüdische Bürger werden deportiert, Kriegsgefangene in die Stadt gebracht. Intellektuelle, Künstler und politisch Andersdenkende fliehen ins Exil. Junge Heidelberger werden als Soldaten an die Front geschickt ... All diese Menschen sehnen sich nach Heimat. Sie wissen nicht, ob sie sie jemals wiedersehen. Und sie spüren, wie die Fremde sie verändert. Die Evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg hat die Schicksale einige dieser Menschen recherchiert und nach den Häusern gesucht, in denen sie einst lebten. Aus diesen Schicksalen können sich LeiterInnen von Jugend- oder Erwachsenengruppen individuelle Rundgänge zusammenstellen, die sie mit Jugendlichen oder Erwachsenen durchführen. Aber auch Einzelpersonen können sich anhand dieser Informationen eigene Routen erarbeiten, die sie dann alleine oder mit anderen abgehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Heidelberger auf der Flucht
Vorschläge für Stadtrundgänge über Verfolgungsschicksale zwischen 1933 und 1945
© 2020 Evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg
Autor: Sebastian Klusak
Lektorat, Korrektorat: Maren Klingelhöfer
Satz & Umschlag: Erik Kinting
Coverfoto: Luftschutzraum unter dem Heidelberger Hauptbahnhof (Lossen-Fotografie Heidelberg, Nr. 280HR)
Weitere Mitwirkende: Claudia Pauli-Magnus
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-347-18676-7 (Paperback)
978-3-347-18677-4 (Hardcover)
978-3-347-18678-1 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Erster Teil
Unbekannte Verfolgungsschicksale
Seminarstraße 3: Alfred Stiendel und Günther Pollacks
Philosophenweg 16: Bodo Strehlow
Marktplatz, Rathaus: Rolf Magener
Obere Neckarstraße 9: Barbara Sevin
Ziegelhäuser Landstraße 17 a: Roswitha Fröhlich
Heumarkt 8: Gilbert Thiery
Friedrichstraße 9: Katharina Freifrau von Künßberg
Friedrich-Ebert-Anlage 45: Erich Killinger
Zweiter Teil
Bekannte Verfolgungsschicksale
Hauptstraße 138: Heidelberger im spanischen Bürgerkrieg
Universitätsplatz, Alte Universität: Emil Julius Gumbel
Große Mantelgasse 22: Fritz Bauer
Steingasse 9: Vinzenz Rose
Klingenteichstraße 6: Alfred Mombert
Stiftsweg 2, Kloster Neuburg: Abt Adalbert von Neipperg OSB
Schlossberg 16: Hannah Arendt
Schlossberg 49: Raymond Klibansky
Ecke Plöck/Akademiestraße: Heidelberger Juden in Shanghai
Ecke Sophienstraße 21/Plöck: Hellmuth Plessner
Schwanenteichanlage, Mahnmal für die deportierten jüdischen Mitbürger: Hans Oppenheimer
Schwanenteichanlage, Gedenkstein an die Ankunft von Heimatvertriebenen aus Odrau: Walther Mann
Dritter Teil
Führungsvorschlag Heidelberg im Nationalsozialismus
Schlossberg 1: Ursachen des Nationalsozialismus
Kettengasse 12: Albert Speer
Universitätsplatz, Alte Universität: Joseph Goebbels und Gustav Adolf Scheel
Alter Synagogenplatz: Die Reichspogromnacht
Alte Brücke: Das Kriegsende in Heidelberg
Vierter Teil
Führungsvorschlag „Hermann Maas“
Heiliggeiststraße 17: Hermann Maas und das Schmitthennerhaus
Pfaffengasse 18: Hermann Maas, die soziale Not und die Jugend
Marktplatz, Heiliggeistkirche: Hermann Maas und die Juden
Friesenberg 1: Hermann Maas und seine HelferInnen
Meinen Eltern
Vorwort
Heidelberg zwischen 1939 und 1945: Jüdische Bürger werden deportiert, Kriegsgefangene in die Stadt gebracht. Intellektuelle, Künstler und politisch Andersdenkende fliehen ins Exil. Junge Heidelberger werden als Soldaten an die Front geschickt … All diese Menschen sehnen sich nach Heimat. Sie wissen nicht, ob sie sie jemals wiedersehen. Und sie spüren, wie die Fremde sie verändert.
Die Evangelische Erwachsenenbildung Heidelberg hat die Schicksale einige dieser Menschen recherchiert und nach den Häusern gesucht, wo sie einst lebten. Aus diesen Schicksalen können sich LeiterInnen von Jugend- oder Erwachsenengruppen individuelle Rundgänge zusammenstellen, die sie mit Jugendlichen oder Erwachsenen durchführen. Aber auch Einzelpersonen können sich anhand dieser Informationen eigene Routen erarbeiten, die sie dann alleine oder mit anderen abgehen.
Der erste Teil dieses Buches besteht aus Einzelschicksalen, von denen die meisten – gemessen an der Reichweite der erschienenen Publikationen – einer größeren Öffentlichkeit noch unbekannt sein dürften und daher ausführlich dargestellt sind. Darunter ist auch eine Geschichte aus dem Ersten Weltkrieg und eine Geschichte aus der ehemaligen DDR. Danach schließen sich eine Reihe von Einzelschicksalen an, die wesentlich bekannter sind und daher nicht so ausführlich dargestellt werden. Der dritte und vierte Teil bestehen aus zwei Vorschlägen für vorgefertigte, in sich geschlossene Führungen: Die erste Führung zum Thema „Heidelberg im Nationalsozialismus“ enthält wieder einige Informationen, die den meisten Heidelbergern nicht so geläufig sein dürften. Die zweite Führung zum Thema Hermann Maas, dessen 50. Todestag in diesem Jahr begangen wird, greift hingegen auf in der Regel altbekannte Tatsachen zurück. Maas selbst musste zwar nie fliehen, sondern wurde nur für kurze Zeit zur Zwangsarbeit im Elsass verpflichtet. Sein Schicksal wurde trotzdem in diese Veröffentlichung aufgenommen, weil er vielen Menschen, die fliehen mussten oder wollten, geholfen hat.
Dieses Buch ist kein wissenschaftliches Werk, sondern eine Materialsammlung für Pädagogen. Wir bitten trotzdem, uns möglicherweise vorhandene wissenschaftliche Fehler mitzuteilen. Die meisten der als Quellen aufgeführten Bücher sind in der kleinen stadtgeschichtlichen Bibliothek der Evangelischen Erwachsenenbildung einsehbar.
Stadtrundgänge sind ein wirksames didaktisches Instrument der Erinnerungskultur – insbesondere, wenn es um Einzelschicksale geht. Das konkrete, sinnliche Erleben des Gebäudes, in dem die jeweilige Person gelebt hat oder ihr etwas widerfahren ist, bewirkt, dass aus abstrakten Worten eigene Erfahrungen werden, von denen viele im Herzen bleiben. Das ist wichtig, weil die Tendenzen, die einst zu Nationalsozialismus und dem Zweitem Weltkrieg geführt haben – Populismus, Rassismus, Nationalismus und die Bereitschaft, Konflikte zwischen Staaten militärisch zu lösen –, heute wieder spürbar sind.
Mein besonderer Dank gilt dem Leitungskreis der Evangelischen Erwachsenenbildung Heidelberg, der mich ermutigt hat, dieses Buch zu schreiben. Danken möchte ich auch den Kollegen aus der Landesstelle für Evangelische Erwachsenenbildung in Baden, die uns dabei unterstützt haben, Stadtgeschichte zu einem Schwerpunkt zu machen. Dieses Buch ist im Buchhandel zum Selbstkostenpreis erhältlich.
Heidelberg, im September 2020
Sebastian Klusak (Leiter der Evangelischen Erwachsenenbildung Heidelberg)
PS: Sollten Sie RechteinhaberIn eines Bildes und mit der Verwendung auf dieser Seite nicht einverstanden sein, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Erster Teil:
Unbekannte Verfolgungsschicksale
Seminarstraße 3:
Alfred Stiendel und Günther Pollacks
In diesem Gebäude befindet sich heute das Romanische Seminar der Universität Heidelberg. Bis 1968 diente das Gebäude als Amtsgericht. Während des Krieges war es zudem Sitz des Militärgerichts des Kommandeurs der Panzertruppen XII.
Am 24.03.1945 hatte sich die deutsche Front auf dem linken Rheinufer aufgelöst. Die Truppenteile zogen sich zwischen Mainz und Speyer auf die andere Rheinseite zurück. Das bedeutete: Die Gegner Deutschlands marschierten jetzt in das Kerngebiet des Reichs. Die Nationalsozialisten reagierten darauf mit Durchhalteparolen und Drohungen, auch gegenüber den eigenen Soldaten. Sie glaubten, dass die Angst vor Bestrafung ihre Kampfkraft stärken und dies doch noch dazu führen würde, dass Deutschland den Krieg gewinne. Ein Befehl Adolf Hitlers vom 18.01.1945 bestimmte, dass Soldaten, die getrennt von ihrer Einheit angetroffen wurden, sofort erschossen werden konnten. Gegen Kriegsende gab es viele solcher Soldaten. Einige davon waren desertiert, andere hatten ihre Einheit verloren oder waren auf ihrem Posten „vergessen“ worden, wieder andere waren auf dem Weg an die Front oder aus der gegnerischen Kriegsgefangenschaft geflohen. In einer Publikation, bei der es um Menschen geht, die aus oder nach Heidelberg geflohen sind, muss auch auf ihr Schicksal hingewiesen werden. Die von Hitler angeordnete Erschießung solcher Soldaten konnte durch die ordentlichen Militärgerichte, aber auch durch „fliegende Standgerichte“ geschehen. Dies waren kleine Einheiten von Soldaten, die meist auf dem Motorrad unterwegs und von einem Offizier angeführt wurden. Sie konnten Menschen zum Tod verurteilen – ohne ordentliche Beweisführung, Verteidigung oder ein Recht auf Berufung. Die Verurteilten wurden meist an Ort und Stelle erschossen und danach aufgehängt. Diese Gerichte konnten natürlich nicht überall sein, und deshalb wurden viele Verfahren auch vor ordentlichen Militärgerichten durchgeführt. Diese fällten jedoch oft mildere Urteile. Ein solches Militärgericht befand sich in dem Gebäude, das auf dem folgenden Bild1 zu sehen ist – im selben Gebäude befand sich damals auch das Amtsgericht Heidelberg.
Das Militärgericht bekam am Abend des 24.03.1945 Besuch von Generalrichter Dr. Hans Boetticher. Das war der oberste Militärrichter der Heeresgruppe „G“, in deren Bereich Heidelberg damals lag. Das folgende Bild stammt aus dem Bundesarchiv.
Einer der Richter, die hier arbeiteten, berichtete später:
„Der Generalrichter eröffnete uns, dass er von der Heeresgruppe mit der Überwachung der Gerichte beauftragt ist. Er rügte die Milde unserer Rechtsprechung und erklärte, die Auflösung der deutschen Wehrmacht könne nur durch drastische Maßnahmen verhindert werden. Die Gerichte müssten rücksichtslos Todesstrafen gegen Fahnenflüchtige verhängen. Im Osten habe man Fahnenflüchtige an den Oderbrücken zur Warnung für die zurückflutenden Soldaten aufgehängt und habe damit gute Erfahrungen gemacht. Das müsse nun auch im Westen und auch hier in Heidelberg geschehen. Wir wiesen demgegenüber auf die Empfindungen der Zivilbevölkerung in der vom Krieg verschonten Stadt hin. Unser Einwand wurde aber zurückgewiesen. Der Generalrichter ließ sich unsere Akten vorlegen, beanstandete im Einzelnen unser Verfahren und nahm eine Anzahl von Akten mit. Wir hörten dabei, dass er ein fliegendes Standgericht mitgebracht habe, dem er die Fälle aushändigen wolle.“2
Am Abend des 24.03., also von Samstag auf Sonntag, berief Boetticher eine Sitzung aller Militärrichter der Region in die Gaststätte Auerhahn in der Römerstraße 76 ein. Ein Bild dieser Gaststätte, so wie sie heute aussieht, befindet sich auf einer der folgenden Seiten. Dabei drohte er den Richtern erneut. Am Morgen des 25.03. verurteilte sein Standgericht mehrere Soldaten (wahrscheinlich nicht die, denen die Akten gewidmet waren, sondern andere zufällig aufgegriffene) zum Tod. Einer davon war der 25-jährige Obergefreite Alfred Stiendel aus Peggau bei Graz. Ihn hängte man am Eingang des Bergfriedhof in der Rohrbacher Straße auf. Ein anderer war der wahrscheinlich erheblich jüngere Soldat Günther Pollacks aus Plauen im Vogtland. Ihn hängte man an der Dossenheimer Landstraße am Ortsausgang von Handschuhsheim auf. Beide wurden vorher mit Schüssen an die Schläfe getötet. Wie der Verwalter des Bergfriedhofes aussagte, wurde Stiendel nach zwei Tagen von Unbekannten in der Nacht „an Ort und Stelle auf dem Gehweg“ vor dem Bergfriedhof beerdigt; er selbst habe dann Mitte April die Leiche in einen Sarg gebettet und im „Massengrab Nr. 1“ auf dem Bergfriedhof beigesetzt. Günther Pollacks wurde zuerst auf dem Handschuhsheimer Friedhof beerdigt. Seit dem Jahre 1953 haben beide auf dem Ehrenfriedhof in Heidelberg ihre letzte Ruhestätte gefunden.3 Auf den folgenden Seiten ist auch ein Bild des Ehrenfriedhofs4 und der Grabplatte Pollacks5 abgebildet. Trotzdem entzog ein Militärrichter, der an der Besprechung beteiligt war, schon am 27.03. den Fall eines aufgegriffenen Soldaten der Zuständigkeit des fliegenden Standgerichts, wies die Anklage auf Feigheit vor dem Feind zurück und setzte die Verhandlung bis Kriegsende aus. Dr. Boetticher gab nach dem Krieg an, er sei vom Stabschef des Befehlshabers der Heeresgruppe „G“, Generaloberst der Waffen-SS Paul Hausser und Sturmbannführer Stedtke (beide hatten ihr Quartier in Eberbach) mit folgenden Worten bedroht worden: „Es wird nicht eher anders, als bis nicht ein Jurist oder ein Gerichtsherr baumelt, und wenn Sie es sind.“ Boetticher arbeitete nach dem Krieg als Rechtsanwalt in München, wo er 1988 starb.6
Ehem. Gaststätte Auerhahn
Grab G. Pollacks (auf dem Ehrenfriedhof)
1 Bild: Sebastian Klusak, EEB Heidelberg
2 Moraw, F. (1996, 02.04.). Diese Morde sind noch nicht bestraft. Rhein-Neckar-Zeitung, S. 5
3 Moraw, F. (1996, 02.04.). Diese Morde sind noch nicht bestraft. Rhein-Neckar-Zeitung, S. 5
4 Bild: Sebastian Klusak, EEB Heidelberg
5 Bild: Sebastian Klusak, EEB Heidelberg
6 Moraw, F. (1995, 24.03.). Warum der Terror bis zum letzten Tag funktionierte. Rhein-Neckar-Zeitung, S. 21
Philosophenweg 16, Physikalisches Institut
Bodo Strehlow
Der folgende Text stammt aus dem Buch von Jürgen Aretz und Wolfgang Stock „Die vergessenen Opfer der DDR.“ 7 Wir danken den beiden Autoren herzlich für die Abdruckerlaubnis.
Über den Hafen Peenemünde auf der Insel Usedom, im östlichsten Zipfel des wiedervereinigten Deutschland, pfeift im Frühjahr 1993 der kalte Wind. Im heutigen Hafen der Bundesmarine dümpeln die ausgemusterten Schiffe der Nationalen Volksarmee der DDR. Graue Wolken jagen am Himmel, als Bodo Strehlow suchend an den Schnellbooten, U-Boot-Jägern und Minensuchern vorbeigeht. „Das da, das müßte es sein!“
Und dann steht er an Deck der „Graal-Müritz“ 8, berührt die eingerosteten Hebel im Führerstand – und denkt mit Schaudern an einen Sommermorgen vor mehr als 13 Jahren, an den 5. August 1979. Damals lag er blutüberströmt und von einer Handgranate schwerverletzt auf diesen Planken und hatte mit seinem jungen Leben bereits abgeschlossen.
„Laßt den da man liegen. Der liegt da gut. Der wird sowieso nicht mehr!“ Der Kapitän der „Graal-Müritz“, Jürgen Herrmann, sprach es aus wie ein Todesurteil, und so war es auch gemeint. Der Kapitän sollte später von der DDR-Führung den „Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland“ erhalten. Denn er hatte es in letzter Minute verhindert, dass sein Obermaat (Stabsunteroffizier) Strehlow, damals 22 Jahre alt, mit dem NVA-Schiff in einen bundesdeutschen Hafen flüchtete.
Strehlow hatte nachts die kleine Wachmannschaft auf seinem in der Kühlungsborner Bucht ankernden Schiff der „Kondor“-Klasse mit vorgehaltener Schusswaffe unter Deck getrieben und eingeschlossen. Dann wurden die Hebel im Führerstand auf „Volle Kraft voraus“ gestellt und Kurs auf den Westen genommen, auf den Leuchtturm Dahmeshöved in der Lübecker Bucht. Strehlow wollte das gleiche erreichen wie jene 5000 Flüchtlinge vor und nach ihm, die über die Ostsee in die Freiheit schwimmen wollten. Strehlow, der als Soldat bisher selbst geholfen hatte, flüchtende Landsleute zu jagen, hatte mit dem DDR-Regime gebrochen. Doch ebenso wie 90 Prozent der Flüchtlinge scheiterte auch er. Nachdem er miterleben musste, wie vor der dänischen Küste zwei Flüchtlinge von seinem Boot aufgebracht und wie Vieh behandelt wurden, hatte Strehlow aus Protest sein Amt als FDJ-Sekretär des Schiffes niedergelegt. Als er auch dagegen protestierte, dass auf Befehl des Politoffiziers wieder die Werke Josef Stalins gelesen werden mussten, wurde das Verfahren zum Ausschluss aus der SED eingeleitet. Damit war auch seine letzte Hoffnung auf ein Physikstudium zerstört.
Für Strehlow war mit diesen Erlebnissen die heile Welt eines bis dahin sorglos in der DDR aufgewachsenen jungen Mannes zerstört worden. Sein Vater war SED-Mitglied und Schiffsbauingenieur gewesen, Teil der Nomenklatura also, der Familie fehlte nichts. Selbst ein Auto hatten sie schon, als er ein Kind war. Über Politik sprach man zu Hause nicht. Das Leben im real existierenden Sozialismus war unter diesen Umständen für Bodo, der gut schwamm und in der Bezirksliga Handball spielte, ein Traum, der erst in der Realität des Sozialismus, wie er ihn bei der Volksmarine erlebte, zerplatzte.
Küstenwachschiff P 30 Bild: Eugenio Castillo Pert (Wikipedia, CC BY 3.0)
Die acht Seemeien bis zur Grenze waren schnell bewältigt. Als sich Bodo Strehlow mit dem Schiff bereits in westdeutschen Gewässern befand, riß ihn eine Explosion aus seiner Freude über die geglückte Flucht: Der Kapitän hatte mit einer Handgranate den Aufgang an Deck freigesprengt und stürzte mit seinen Soldaten an Deck. Strehlow wurde unter Feuer genommen, eine zweite Handgranate explodierte nur zwei Meter von ihm entfernt: Sie zerstörte sein linkes Auge, seine beiden Trommelfelle, zertrümmerte Arme und Beine. Blutüberströmt und übersät mit Granatsplittern brach Strehlow zusammen. Die Wirkung einer Handgranatenxplosion aus dieser geringen Entfernung gilt als garantiert tödlich – doch als die „Graal-Müritz“ im DDR-Hafen ankam, wurde festgestellt, dass er noch lebte.
Obwohl schwerverletzt und fast taub, marterten ihn die Stasi-Vernehmer wochenlang, machten ihn mit Spritzen vor jeder Vernehmung gefügig. Eltern und Freunde wurden verhört, ein Schulfreund wurde verurteilt, weil er angeblich oppsitionelle Äußerungen Strehlows nicht sofort der Stasi gemeldet hatte. Selbst in Westdeutschland wurden die Verwandten beschattet, weil die Stasi eine Verschwörung und Spionage konstruieren wollte. So begann für den jungen Unteroffizier ein Leidensweg, der in Worte kaum zu fassen ist. Erst 3791 Tage später, sechs Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer, konnte Strehlow seine Kerkerzelle Nr. 35 im vierten Stock des berüchtigten Zuchthauses Bautzen II9 schließlich kurz vor Weihnachten 1989 als einer der letzten politischen Häftlinge der DDR verlassen.
Nach der Logik der DDR durfte Strehlow doppelt froh sein, dass er noch am Leben war: „Nur wegen seiner Jugendlichkeit“ hatte das Militärobergericht in Neubrandenburg in einem Geheimprozess 1980 von der Verhängung der Todesstrafe abgesehen. Nicht wegen seines Fluchtversuches, sondern wegen angeblicher „Spionage, Terrors, elffachen Mordversuches und Fahnenflucht im schweren Fall“ wurde er zu lebenslangem Freiheitsentzug verurteilt. Den „elffachen Mordversuch“ sah das Gericht als erwiesen an, weil er seine elf Kameraden der Nachtwache mit der Dienstwaffe bedroht hatte – obwohl er keine einzigen Schuss abgegeben hatte.
Der Strehlow von der Stasi zugeteilte Verteidiger hatte mit seinem Mandanten nur einmal kurz gesprochen, dann ebenso wie der Militärstaatsanwalt auf „Lebenslang“ plädiert – die Eltern Strehlows mussten dafür eine Rechnung über mehr als 2000 Mark, das zweieinhalbfache eines durchschnittlichen Monatsgehaltes, zahlen. Mehr als zehn Jahre verbrachte Strehlow im Zuchthaus Bautzen II, fast die ganze Zeit hat er in absoluter Isolationshaft auf weniger als sechs Quadratmetern in der „verbotenen Zone“ verbringen müssen, die nur von Offizieren betreten werden durfte. In den fast 500 Wochen hinter Gittern durte er nur 17 andere Gefangene sehen, sah keinen Sonnenstrahl. Strehlow ist davon überzheugt, dass die Stasi sogar versucht hat, zwei Haftkameraden und ihn zu vergiften: „Uns wurde vergifteter Grapefruitsaft gegeben. Mithäftlinge starben, ich schwebte zwei Wochen in Lebensgefahr“. Zwischen 1980 und 1988 starben die Häftlinge Arno Schumann, Arno Heine und Horst Garau in Bautzen II. Strehlow hält es für möglich, dass sie von der Stasi ermordet wurden.
So unvorstellbar die Isolationshaft in Bautzen war – Strehlow konnte sich Gehör im Westen verschaffen. Ein winziges Kassiber, verfasst auf Zigarettenpapier, konnte von einem Mithäftling bei seinem Freikauf in den Westen geschmuggelt werden. Es war an Franz Josef Strauß, die letzte Hoffnung vieler politischer Häftlinge in der DDR, gerichtet.
Strehlow beschwor den bayerischen Ministerpräsidenten: „Ich versichere Ihnen, dass ich kein Terrorist bin und niemals versucht hätte, gewaltsam zu flüchten, wenn ich nicht im Lauf meiner Dienstzeit bei der Marine Augenzeuge geworden wäre, wie Flüchtlinge auf hoher See unter Drohung mit Schußwaffen an der Flucht gehindert und verhaftet wurden.“ Doch auch Strauß, der
Marktplatz, Rathaus:
Rolf Magener
Im rückwärtigen Teil des Erdgeschosses des Rathauses befindet sich die Statue „Der Heimkehrer“. Sie wurde von Georg Kretz, einem Heidelberger Bildhauer und Musiker, der 1948 aus russischer Kriegsgefangenschaft nach Heidelberg heimgekehrt war, erschaffen.10 Das Kunstwerk stammt aus dem Jahr 1952.11 Es erinnert an die über 11 Millionen deutschen Kriegsgefangenen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in mehreren Ländern der Welt in Lagern interniert waren. An diese Menschen erinnert auch die oft übersehene, nachfolgend ebenfalls abgebildete12 Gedenktafel an der Ostwand der Providenzkirche in der Hauptstraße. Von diesen Gefangenen starben über 1,2 Millionen während der Gefangenschaft.13 Ihre Behandlung war sehr unterschiedlich. In vielen Lagern in Russland dominierten Hunger, schwerste körperliche Arbeit, mangelnde medizinische Versorgung und Gewalt, während es in den Lagern in England und USA eine bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln herrschte und Ärzte, weniger Gewalt sowie leichtere Arbeit gab. Viele Gefangene versuchten, aus den Lagern zu fliehen. Einer von ihnen war Rolf Magener. Seine Geschichte ist kaum bekannt.
Rolf Magener
Obere Neckarstraße 9:
Barbara Sevin
Wie war die Stimmung im sogenannten Dritten Reich aus? Bei der Beantwortung dieser Frage muss man klar zwischen der Zeit 1933 bis 1940 und 1940 bis 1945 unterscheiden. Nach der sogenannten Machtübernahme waren viele Menschen zunächst froh, dass die ständigen Demonstrationen und Straßenschlachten, die die Weimarer Republik geprägt hatten, aufhörten. Deutschland schien eine stabile Regierung zu haben, und das freute viele Bürger. Sie akzeptierten, dass nach und nach alle politischen Parteien verboten, Rundfunk und Presse gleichgeschaltet, Kommunisten und Sozialdemokraten in Arbeitslager gesteckt wurden etc., da es wirtschaftlich aufwärts zu gehen schien.
Die Arbeitslosigkeit sank, und zwar aus mehreren Gründen: Es gab ein staatlich finanziertes Beschäftigungsprogramm in der Landwirtschaft, im Straßenbau und Wohnungsbau. Einige Branchen (Landarbeiter, Fischereiarbeiter, Forstarbeiter, Dienstboten) wurden aus der Arbeitslosenversicherung herausgenommen; ein zusätzlicher Effekt wurde erzielt, indem Frauenarbeit verpönt wurde. Außerdem wurden 1935 die Wehrpflicht und der zwangsverpflichtende Reichsarbeitsdienst für junge Menschen eingeführt. Allerdings merkten die Leute, dass man nicht mehr offen seine Meinung sagen konnte. Immer mehr Menschen wurden zeitweise verhaftet oder verschwanden in den Lagern. Gewerkschaften, Arbeitnehmerorganisationen, Künstlervereinigungen, Sportvereine wurden durch NS-Organisationen ersetzt. Etwa ein Drittel der Hochschulangehörigen, städtischen und staatlichen Bediensteten wurden aus dem Dienst entfernt, weil sie Juden, Sozialdemokraten, Kommunisten, Zeugen Jehovas, regierungstreue Kirchenbedienstete o. Ä. waren. Das merkten die Leute schon. Trotzdem herrscht noch großer Jubel, als 1939 Polen und die Tschechoslowakei erobert und 1940 der „Erzfeind“ Frankreich besiegt wurde. Hinzu kam, dass die meisten Deutschen dazu erzogen waren, Befehlen zu gehorchen, auch wenn sie sie selbst nicht einsahen. Als Hitler 1940 aber die Sowjetunion angriff, 1941 die USA Deutschland den Krieg erklärte, deutsche Städte fast täglich bombardiert wurden, die Zeitungen voll von Todesanzeigen der Bombenopfer und gefallener Soldaten waren und es immer weniger Essen zu kaufen gab, drehte sich die Stimmung. Dann war es aber zu spät.
In dem auf diesem Foto abgebildeten Haus in der Oberen Neckarstraße 9 wohnte 1933 die Studentin Barbara Sevin. Ihr Vater war 1921 an den Folgen einer Kriegsverletzung gestorben, und sie lebte mit ihren beiden Geschwistern bei ihrer Mutter in Berlin, bevor sie zum Studium nach Heidelberg kam. Dort wohnte sie zunächst bei ihrer Tante und ihrem Onkel. Ihre Mutter konnte ihr kein Geld für den Lebensunterhalt zahlen, aber Barbara Sevin gab schon früh Nachhilfe und bekam ein Stipendium. Sie pflegte in Heidelberg engen Kontakt mit Professoren, die ihre Ablehnung gegen das NS-Regime äußerten und spottete öffentlich über den Nationalsozialismus. Nachdem sie den Hitlergruß verweigerte, zwang sie ihre Tante, auszuziehen, weil sie in ihr eine Gefahr für sich sah. Deshalb zog sie in dieses Haus, wo sie bei einer pensionierten Lehrerin wohnte. Während ihres Studiums nahm Barbara Sevin an einem Lager des Reichsarbeitsdienstes teil. Das waren offiziell freiwillige, meist 10-wöchige Arbeitseinsätze junger Menschen zwischen 18 und 25 Jahren. Lager waren nach Ansicht der Nationalsozialisten besonders gut dafür geeignet, den Charakter junger Menschen in ihrem Sinn zu „formen“. Dadurch, dass die meisten Lager in ländlichen Gebieten waren, wurde außerdem die vom Nationalsozialismus propagierte Einheit zwischen „Blut und Boden“, also der sogenannten „germanischen Rasse“ und ihrem Siedlungsgebiet, gestärkt. In ihren Lebenserinnerungen schreibt Barbara Sevin über ihre Zeit in einem Lager des Reichsarbeitsdiensts in Neckarbischofsheim:
„Man kann sich als Außenstehende wohl kaum vorstellen, welch eine byzantinische Unterwürfigkeit herrschte. Das Wort der Führerin (des Lagers, ergänzt vom Verf.) war alles, der Mensch war ein Staub, ein Nichts (…) Jeder versuchte, der Führerin alle ihre Wünsche und Gedanken abzulesen, um ja einen guten Eindruck zu machen. Nur Arbeitsdienst, nur Körper, nur Volksgemeinschaft galt. Während dieser ganzen Zeit wurde das Wort Geist nicht erwähnt.“
Und:
„Lange Tafeln standen parallel zu den Wänden, also im Viereck. Ich hatte gleich im Anfang das Essen wegzutragen und kam deshalb etwas später hinzu. Gleich bei der Tür saßen Ruth Pagel (die Leiterin des Lagers, ergänzt vom Verf.) und ihre Clique. Sie führte die Unterhaltung, anscheinend leicht und liebenswürdig, auf persönliche Verhältnisse und Gedanken eingehend. Eine von ihrem Stabe, fiel mir auf, hatte den Kopf gesenkt. Es fiel mir auf, weil die ,Führerinnen‘ ihn im Allgemeinen stolz erhaben tragen. Oder fürchtete sie sich vor Ruth? Ich schaute genauer hin, wie es mich interessierte und bemerkte zuerst, dass sie unter dem Tisch etwas auf dem Schosse hielt und dann sah ich zu meinem restlosen Entsetzen, dass sie mitschrieb. Da lotste also Ruth die Mädchen bewusst aufs Glatteis, unter hinterher setzte sie sich mit denanderen Nazis hin und hechelte diese harmlosen Aussagen ,vom gemütlichen Beisammensein‘ aus. Natürlich tat ich alles zur Verbreitung dieser Tatsache.“48
In ihrem letzten Studienjahr wechselte Barbara Levin nach München. Dort fertigte sie oppositionelle Flugblätter an. Dies brachte sie in Gefahr. Deshalb floh sie 1935 nach England und von dort in die USA. Das folgende Bild zeigt Angehörige des Reichsarbeitsdienstes 1936 beim Straßenbau.49
48





























