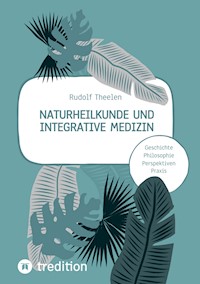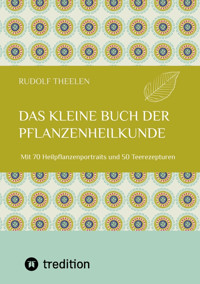29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Ratgeber
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Heil durch die Prüfung – nun können Sie als Heilpraktiker tätig werden
Sie haben Ihre medizinische Grundausbildung zum Heilpraktiker fast abgeschlossen? Sie wollen sich nun auf die schriftliche und mündliche Prüfung vorbereiten? Für Ihre Prüfung ist es wichtig, das erlernte Wissen aus Ihrer Heilpraktikerausbildung zu verknüpfen, nach Symptomen zu ordnen und die pathologischen Hintergründe übergreifend zu verstehen. In diesem Buch finden Sie zahlreiche typische Prüfungsfragen und passende Herangehensweisen. So vorbereitet werden Sie die Fragen schnell und richtig beantworten können.
Sie erfahren
- wie Sie schnell und sicher die schriftlichen Prüfungsfragen beantworten
- wie Sie die medizinische Fachsprache leichter erlernen
- welche Erkrankungen und Differenzialdiagnosen besonders prüfungsrelevant sind
- wie Sie zuverlässig diagnostizieren
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 777
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Heilpraktikerprüfung für Dummies
Schummelseite
Heilpraktikerprüfung für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This book is published by arrangement with John Wiley and Sons, Inc.
Alle Rechte vorbehalten inklusive des Rechtes auf Reproduktion im Ganzen oder in Teilen und in jeglicher Form. Dieses Buch wird mit Genehmigung von John Wiley and Sons, Inc. publiziert.
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: Sebastian Kaulitzki - stock.adobe.comKorrektur: Claudia Lötschert
Print ISBN: 978-3-527-72173-3ePub ISBN: 978-3-527-84681-8
Über den Autor
Rudolf Theelen ist Heilpraktiker und leitet als Inhaber eine renommierte Heilpraktikerschule in München. Er studierte Philosophie und Medizingeschichte an der LMU München und hat als Autor Bücher zu verschiedenen naturheilkundlichen Themen veröffentlicht. Vor seiner Tätigkeit als Schulleiter hat er viele Jahre als Heilpraktiker in eigener Praxis gearbeitet und als Dozent an Heilpraktikerschulen medizinische Grundlagen unterrichtet. Sein Lehrinstitut bietet seit mehr als 40 Jahren fundierte Heilpraktiker-Ausbildungen und Prüfungsvorbereitungskurse an: https://www.hpl-lotz.de.
Danksagung
An dieser Stelle möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die mich während der Anfertigung dieses Buchs unterstützt und motiviert haben.
Mein größter Dank gilt meiner Lebensgefährtin Annett, die bereit war, auf viele Stunden gemeinsamer Zeit zu verzichten, und die mich immer wieder in dem Gefühl bestärkt hat, das Richtige zu tun.
Mein Dank gebührt auch Andrea Baulig, die als Lektorin mein Buchprojekt aufmerksam betreut und begutachtet hat. Für die hilfreichen Anregungen und die konstruktive Kritik bei der Erstellung des Texts möchte ich mich herzlich bedanken.
Cordula und Heiko Rippel danke ich für ihre umsichtige Fachkorrektur und die detaillierten Hinweise, die für ein medizinisches Fachbuch so wertvoll sind.
Ich bedanke mich ebenfalls beim Wiley-VCH-Verlag, der mir die wunderbare Möglichkeit gegeben hat, mein Fachwissen in Buchform zu bringen und an all jene weiterzugeben, die sich erfolgreich auf die Heilpraktikerprüfung vorbereiten möchten.
Ein besonderer Dank gilt den Dozentinnen und Dozenten an meiner Schule, ohne deren Expertise in verschiedenen Teilbereichen der Medizin und der Prüfungsvorbereitung dieses Buch nicht hätte entstehen können.
Abschließend möchte ich mich bei den Schülerinnen und Schülern an meiner Schule bedanken, die durch ihre konstruktiven Fragen und Anregungen den Unterricht lebendig und abwechslungsreich machen und die uns immer wieder motivieren, unser Bestes zu geben.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Danksagung
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Was Sie nicht lesen müssen
Törichte Annahmen über den Leser
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Wie es weitergeht
Teil I: Ihr Weg zum Glück: Die Heilpraktikerprüfung
Kapitel 1: Allgemeines zur Heilpraktikerprüfung
Wo und wie melde ich mich zur Prüfung an?
Wie läuft die Prüfung ab?
Wie geht es dann weiter?
Über die Prüfungsrelevanz einzelner Themen
Über die Ansprüche in der Heilpraktikerprüfung
Kapitel 2: Wir sind alle nur Menschen: Über Amtsärzte, Beisitzer und HPAs
Lampenfieber & Co.
Die Prüfung als Persönlichkeitstest
Gesprächsführung in der Prüfung
Kapitel 3: Keine Angst vor leeren Kästchen: Die schriftliche Prüfung
Tipps rund um das Ankreuzen
Schriftliche Fragen verstehen
Checkliste
Multiple-Choice-Fragen trainieren
Kapitel 4: Ihr Auftritt bitte: Die mündliche Prüfung
Ablauf und Besonderheiten der mündlichen Prüfung
Tipps für die mündliche Prüfung
Die vier typischen Prüfungsformate
Empathie und Aufmerksamkeit
Checkliste mündliche Prüfung
Kapitel 5: Nicht nur Theorie: Die praktische Prüfung
Keine Diagnose durch Hemd und Hose
Das IPPAF-Schema
Bildgebende Verfahren
Labordiagnostik
Hygienestandards
Checkliste körperliche Untersuchung
Kapitel 6: Kurz vor dem Ziel: Die Abschlussfrage
Fragen zu Pflichten und Einschränkungen
Fragen zum Infektionsschutzgesetz
Fragen zu Prävention und Hygiene
Checkliste Gesetzesfragen
Teil II: Besser verstehen: Wissenswerte Grundlagen
Kapitel 7: Ein bisschen Fachchinesisch muss sein
Medizinische Fachsprache für Anfänger
Beispiele für Wortstämme und Bedeutungen
Über Vorsilben, Nachsilben und Richtungen
Seien Sie ruhig schlau!
Kapitel 8: Zelle und Gewebe: Wie es keimt und wächst
Aufbau der menschlichen Zelle
Formen der Zellteilung und des Transports
Der Stoff, aus dem wir Menschen sind
Kapitel 9: Winzige Lebewesen mit großer Wirkung
Von Mikroorganismen und Menschen
Medizinische Mikrobiologie
Grundbegriffe der Epidemiologie
Kapitel 10: Wenn es nicht rund läuft
Definitionen von Gesundheit und Krankheit
Krankheitsursachen und Krankheitsverläufe
Die Entzündung als pathophysiologischer Vorgang
Teil III: Crashkurs Prüfungswissen: Innere Medizin
Kapitel 11: Pumpen, was das Zeug hält: Das Herz-Kreislauf-System
Aufbau und Funktionen des Herzens
Die wichtigsten Herz-Kreislauf-Erkrankungen
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Kapitel 12: Bitte gut lüften: Das Atmungssystem
Aufbau und Funktionen des Atmungssystems
Die wichtigsten Erkrankungen der Atemwege und der Lunge
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Kapitel 13: Gut gekaut ist halb verdaut: Das Verdauungssystem
Aufbau und Funktionen des Verdauungssystems
Die wichtigsten Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts
Die wichtigsten Erkrankungen von Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Kapitel 14: Wasser kann brennen: Das Harnsystem
Aufbau und Funktionen von Niere und Harnwegen
Die wichtigsten Erkrankungen von Niere und Harnwegen
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Kapitel 15: Klein aber fein: Das Hormonsystem
Aufbau und Funktionen des Hormonsystems
Die wichtigsten endokrinologischen Erkrankungen
Die wichtigsten Stoffwechselerkrankungen
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Kapitel 16: Wenn die Säfte fließen: Blut und lymphatisches System
Anatomie und Physiologie des Bluts und des Lymphsystems
Die wichtigsten hämatologischen und lymphatischen Erkrankungen
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Kapitel 17: Schnupfen, Husten, Heiserkeit: Die Infektionskrankheiten
Grundlagen der Infektiologie
Infektionskrankheiten nach § 6 IfSG
Die wichtigsten Infektionskrankheiten nach § 7 und § 34 IfSG
Weitere Infektionskrankheiten
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Teil IV: Crashkurs Prüfungswissen: Die Nebenfächer
Kapitel 18: Zwei Quadratmeter Schutz: Die Haut
Aufbau und Funktionen der Haut
Die wichtigsten dermatologischen Erkrankungen
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Kapitel 19: Fortpflanzung ahoi: Die Geschlechtsorgane
Strukturen und Aufgaben der Geschlechtsorgane
Übersicht und Zuordnung der Genitaltrakt-Erkrankungen
Die wichtigsten Erkrankungen des männlichen Genitaltrakts
Die wichtigsten gynäkologischen Erkrankungen
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Kapitel 20: Immer schön locker bleiben: Der Bewegungsapparat
Aufbau und Funktionen des Bewegungsapparats
Die wichtigsten orthopädischen und rheumatischen Erkrankungen
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Kapitel 21: Ein echter Drahtseilakt: Das Nervensystem
Aufbau und Funktionen des Nervensystems
Die wichtigsten neurologischen Erkrankungen
Die wichtigsten Erkrankungen von Auge und Ohr
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Kapitel 22: Seelisch aus dem Gleichgewicht: Die Psychiatrie
Grundlagen der Psychiatrie
Die wichtigsten psychischen Erkrankungen
Multiple-Choice-Fragen zum Üben
Teil V: Sicher praktizieren: Der Heilpraktiker in der Praxis
Kapitel 23: Vom Symptom zum Verdacht: Die Differenzialdiagnose
Beschwerden im Kopfbereich
Beschwerden im Hals- und Brustbereich
Beschwerden im Ober- und Unterbauch
Beschwerden im Bereich des Skeletts und der Haut
Generalisierte Beschwerden
Gegenüberstellung ähnlicher Erkrankungen
Kapitel 24: Gut vorbereitet: Labor, Hygiene, Notfall
Labormedizin
Hygiene
Notfallmedizin
Kapitel 25: Grundlagen der Berufsausübung: Berufs- und Gesetzeskunde
Heilpraktikergesetz
Durchführungsverordnung
Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz, IfSG)
Weitere Gesetze und Verordnungen
Berufsordnung für Heilpraktiker und Berufsbild
Kapitel 26: Das Behandlungskonzept: Therapeutische Grundlagen
Schulmedizinische Basisversorgung
Naturheilkundliche Diagnostik
Klassische naturheilkundliche Therapiemethoden
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 27: Zehn hilfreiche Tipps für effektives Lernen
Geeignete Lernumgebung
Klare Ziele
Verschiedene Lernmethoden
Pausen machen
Aktives Lernen
Wiederholung und Übung
Priorisierung
Gesunde Lebensweise
Zeitmanagement
Belohnungen
Kapitel 28: Zehn nützliche Internetadressen rund um das Thema Heilpraktiker
Fakten rund um das Thema Heilpraktiker
Über das Berufsbild des Heilpraktikers
Wichtige Aspekte des Heilpraktiker-Berufs
Informationen zu naturheilkundlichen Verfahren
Qualitätssicherung für Heilpraktikerschulen
Heilpraktiker-Ausbildung
Gesundheitsämter in Deutschland
Robert-Koch-Institut
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Bundesgesundheitsministerium
Lösungsschlüssel zu den MC-Fragen
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 7
Tabelle 7.1: Wortstämme
Tabelle 7.2: Präfixe (Vorsilben)
Tabelle 7.3: Suffixe (Nachsilben)
Tabelle 7.4: Richtungsangaben
Kapitel 11
Tabelle 11.1: Hypertonie Klassifikation nach WHO
Kapitel 23
Tabelle 23.1: Typische Merkmale für Linksherz- und Rechtsherzinsuffizienz
Tabelle 23.2: Typische Merkmale von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa
Tabelle 23.3: Typische Merkmale der Hyper- und Hypothyreose
Tabelle 23.4: Typische Merkmale von M. Parkinson und Multipler Sklerose
Tabelle 23.5: Typische Merkmale von Arthritis und Arthrose
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Lösungsschlüssel zu den MC-Fragen
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
5
6
7
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
505
506
507
508
509
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
Einführung
Dieses Buch soll Sie gezielt auf die Heilpraktikerprüfung vorbereiten. Steigen Sie ein und kommen Sie mit auf eine spannende Reise quer durch die Welt der Medizin. Sie werden sehen, es ist kein Hexenwerk und schon gar nichts, wovor man Angst haben muss!
Sicher haben Sie schon davon gehört, dass die Anforderungen in der schriftlichen und der mündlichen Prüfung »mörderisch« und die Durchfallquoten deutschlandweit atemberaubend sind. Aber auch das lasse ich nicht als Grund für schlechte Laune gelten. Denn in den allermeisten Fällen sind die »Durchfaller« schlecht vorbereitet gewesen: entweder weil sie sich die Vorbereitung ganz allein ohne fremde Unterstützung zugetraut haben oder weil sie Unterricht in Anspruch genommen haben, der suboptimal war.
Ich möchte Sie gerne davon überzeugen, dass die Kombination aus einer fundierten medizinischen Grundausbildung einerseits und einer motivierenden und das Selbstbewusstsein stärkenden Prüfungsvorbereitung andererseits der »Goldstandard« für das Bestehen der Prüfung ist. Ich kann Ihnen zwar nicht garantieren, dass Sie »quietschen« werden vor Vergnügen, aber ich möchte Ihnen zeigen, dass man auch mit Freude am Lernen zum Erfolg kommen kann.
Sie halten also ein Buch in den Händen, das ausführlich auf die besonderen Ansprüche einer Heilpraktikerprüfung eingeht. Das Bestehen der amtsärztlichen Überprüfung vor dem Gesundheitsamt ist der entscheidende Schritt in die freiberufliche Selbstständigkeit und in der Regel auch der Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Denn der Beruf des Heilpraktikers ist nicht irgendein beliebiger »Job«, sondern eine echte Berufung: Anderen Menschen bei der Gesunderhaltung oder Gesundung zu helfen, ist eine Herzensangelegenheit. Sind Sie bereit für das Abenteuer? Dann lassen Sie uns gemeinsam diesen Weg beschreiten.
Wahrscheinlich befinden Sie sich in einer Ausbildung zum Heilpraktiker oder haben diese schon abgeschlossen und wahrscheinlich wissen Sie auch schon einiges über den Beruf des Heilpraktikers. Es könnte aber auch sein, dass Sie sich auf die amtsärztliche Überprüfung vorbereiten auf der Basis eines medizinischen Berufs, den Sie ausüben. In diesem Fall sind Sie mit den Besonderheiten des Heilpraktikerberufs möglicherweise noch nicht sehr vertraut. Deswegen möchte ich Ihnen an dieser Stelle vorab einige Hintergrundinformationen dazu geben.
Heilpraktiker haben in erster Linie die Aufgabe, die individuellen gesundheitlichen Bedürfnisse der Bürger – über das Angebot der offiziellen medizinischen Bedarfsdeckung des Gesundheitswesens hinaus – ergänzend und alternativ zu erfüllen, so heißt es in der Berufsordnung für Heilpraktiker. Wenn man über die Tätigkeit von Heilpraktikern liest, taucht häufig das Wort »Ganzheitlichkeit« auf. Damit ist gemeint, dass Heilpraktiker Körper, Geist und Seele als ein ganzheitliches System betrachten, dessen Harmonie aufrechterhalten werden muss, um gesund zu bleiben. Die Hauptaufgabe, die Heilpraktikern zukommt, ist die ganzheitliche Behandlung von körperlichen, geistigen und seelischen Leiden, die dann entstehen, wenn in der physisch-psychischen Verfassung des Patienten eine Störung vorliegt.
Die Arbeit als Heilpraktiker beginnt in der Regel mit einer Erstuntersuchung, bei der ein Patient von seinen Leiden berichtet, von Symptomen und von möglichen Vorerkrankungen. Zu dieser Anamnese kann bei Bedarf, wie bei einem Schulmediziner auch, zum Beispiel das Abklopfen (Perkussion) und Abhören (Auskultation) des Brust- oder Bauchraums oder eine Blutuntersuchung hinzugezogen werden. Anhand dieser ersten Untersuchung folgt dann die Diagnose mit einer anschließenden Ausarbeitung einer geeigneten Therapie. Bekannte Therapiemöglichkeiten sind zum Beispiel Ernährungsberatung, Pflanzenheilkunde, Massagen, Chiropraktik, Blutegeltherapie, Aromatherapie, Akupunktur, Kinesiologie, Osteopathie, Bioresonanztherapie und klassische Homöopathie.
Die Tätigkeit eines Heilpraktikers kann sehr abwechslungsreich sein, da es viele verschiedene alternative Heilmethoden und Arbeitsfelder gibt. Die meisten Heilpraktiker arbeiten in eigenen Praxen, während andere in Kliniken oder Gesundheitszentren tätig sind. Zum Alltag eines Heilpraktikers gehören aber auch organisatorische Aufgaben wie das Erstellen von Honorarrechnungen, das Führen von Behandlungsprotokollen und die Buchhaltung im Allgemeinen. Dieser Bereich des Praxismanagements sollte in seiner Bedeutung nicht unterschätzt werden.
Ich halte den Beruf des Heilpraktikers für einen der schönsten, den es gibt, und kann nur jeden beglückwünschen, der sich dazu entschließt, seinen Traum einer selbstständigen, freiberuflichen und helfenden Tätigkeit zu verwirklichen. Damit dieser Traum in Erfüllung gehen kann, müssen die schriftliche und die mündlich-praktische Prüfung bestanden werden. Genau darauf bereite ich Sie mit diesem Buch vor. Zwar kann ein Buch den professionellen Unterricht an einer Heilpraktikerschule nicht ersetzen, aber es bietet einen systematischen Überblick über die wichtigsten Themen und einen roten Leitfaden, der Ihnen dabei hilft, sich voller Energie und ohne unnötigen Zeitverlust auf diese Themen zu konzentrieren.
Ich wünsche Ihnen viel Freude an der Materie, jede Menge Spaß beim Lernen und noch mehr Erfolg bei der Umsetzung!
Über dieses Buch
In diesem Buch finden Sie alle wichtigen Informationen zur Heilpraktikerprüfung und die entscheidenden Hilfestellungen, um die Prüfung möglichst gleich beim ersten Anlauf zu bestehen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem mündlich-praktischen Teil, der in der Regel anspruchsvoller und schwieriger zu bestehen ist als der schriftliche Teil. Natürlich kommt auch die Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung nicht zu kurz, deswegen finden Sie am Ende der Kapitel in Teil III und Teil IV jeweils eine Auswahl an Multiple-Choice-Fragen zum Üben.
Schritt für Schritt begleite ich Sie durch Ihre persönliche Vorbereitung und zeige Ihnen, worauf es ankommt und was wirklich wichtig ist. Besondere Aufmerksamkeit in Teil V des Buchs erhält die Differenzialdiagnose, also die Kunst, anhand bestimmter Symptome die Erkrankung des Patienten schnell, sicher und korrekt zu bestimmen. Dafür benötigen Sie eine gute Struktur in der Anamnese, Sie müssen die richtigen Fragen stellen und systematisch vorgehen, zum Beispiel nach dem Kopf-bis-Fuß-Schema.
In vielen …für-Dummies-Büchern ist die Reihenfolge der einzelnen Kapitel nicht so entscheidend, das bedeutet, dass Sie mit einem beliebigen Kapitel beginnen und auch hin und her springen können. In diesem Buch sind die Kapitel systematisch aufeinander aufgebaut, sodass ich Ihnen ans Herz lege, die Reihenfolge beim Lesen einzuhalten. So sind zum Beispiel viele Erkrankungen, die ich in Teil III und Teil IV beschreibe, ohne die Erläuterungen zur allgemeinen Krankheitslehre oder zur Mikrobiologie in Teil II nicht gut zu verstehen.
Dieses Buch lässt sich übrigens auch hervorragend als Nachschlagewerk nutzen. Alle wichtigen Schlüsselwörter und Fachbegriffe finden Sie am Ende des Buchs im Stichwortverzeichnis.
Bücher im medizinischen Bereich sind üblicherweise gespickt mit lateinischen Fachbegriffen, für deren Übersetzung ein eigenes Lexikon benötigt wird. Solche Standardwerke sind unentbehrlich für das Studium der Humanmedizin und in kleineren Ausgaben auch für die Ausbildung zum Heilpraktiker. Auch in diesem Buch kann auf die Verwendung von medizinisch-wissenschaftlichen Fachbegriffen nicht verzichtet werden. Trotzdem versuche ich, die Sachverhalte so einfach wie möglich darzustellen und wo es möglich und sinnvoll ist, die Alltagssprache zu verwenden. Denn eines ist klar: Der Patient wird in seiner eigenen Sprache über seine Beschwerden berichten und wenn überhaupt, dann nur vereinzelt Fachbegriffe nutzen, die er vielleicht im Arztbrief gelesen oder im Internet gegoogelt hat.
Dem prüfenden Amtsarzt gegenüber müssen Sie in medizinischer Fachsprache argumentieren und erläutern können, aber das ist wie Vokabeln lernen in einer Fremdsprache. Letztendlich ist entscheidend, dass Sie wichtige Zusammenhänge Ihrem Patienten erklären können, sodass dieser auf Anhieb versteht, worum es bei seiner Erkrankung geht und welche Maßnahmen notwendig sind.
Konventionen in diesem Buch
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich in unserem Buch für die bessere Lesbarkeit die männliche Schreibform verwende, aber grundsätzlich und gleichberechtigt alle Geschlechter und Identifikationen meine.
Was Sie nicht lesen müssen
Nicht jedes Wort in einem Buch ist gleich wichtig, das gilt auch für das vorliegende Werk. Ich habe zwar darauf geachtet, nichts »Überflüssiges« zu schreiben, aber es wird eventuell einzelne Passagen geben, deren Inhalt Ihnen so vertraut ist, dass Sie diese überfliegen, querlesen oder überspringen können. Dies gilt vor allem für die Kapitel in Teil II des Buchs.
Törichte Annahmen über den Leser
Ich gehe davon aus, dass Sie zu einer der folgenden Personengruppen gehören:
ein Schüler, der sich am Ende einer Heilpraktiker-Ausbildung befindet oder diese abgeschlossen hat
ein Autodidakt, der sich den prüfungsrelevanten Stoff selbst erarbeitet hat
ein Student, der eine Osteopathie-Ausbildung inklusive medizinischer Grundausbildung absolviert hat
ein Erwachsener, der als Physiotherapeut, Krankenpfleger, medizinischer Fachangestellter, Zahnarzt oder in einem vergleichbaren Beruf arbeitet
Ich gehe außerdem davon aus, dass Sie sich in einer soliden und umfangreichen Ausbildung alle notwendigen Grundlagen im Bereich der Anatomie, Physiologie und Pathologie erarbeitet haben und nur noch Lücken schließen, den Stoff für die Prüfung aufbereiten und das eine oder andere Thema nochmals anschauen müssen.
Aber auch wenn dies nicht der Fall sein sollte oder Sie zu keiner der oben genannten Personengruppen gehören und sich trotzdem angesprochen fühlen, sind Sie genauso herzlich willkommen! Vielleicht sind Sie auch nur neugierig, was ein Heilpraktiker so alles lernen muss, oder Sie verspüren Lust, sich auf eine Prüfung vorzubereiten, ohne diese abzulegen. Ganz gleich, welche Motivation Sie mitbringen, genießen Sie die Lektüre!
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Im Verlauf des Buchs werden Sie immer wieder bestimmten Symbolen begegnen. Diese gehören zum Standard der …für-Dummies-Bücher und machen zum Beispiel auf wichtige Inhalte oder gesundheitliche Gefahren aufmerksam.
Hier finden Sie nützliche Hintergrundinformationen.
Informationen mit diesem Symbol sind eine Wiederholung.
Mit diesem Symbol sind Textpassagen gekennzeichnet, die besondere Aufmerksamkeit verdienen.
Wenn Sie dieses Symbol sehen, wissen Sie, dass es ernst wird und es zum Beispiel um eine lebensbedrohliche Situation im Rahmen einer bestimmten Erkrankung geht.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Der Anspruch der …für-Dummies-Bücher ist es, einfach aufgebaut zu sein, dies trifft auch für das vorliegende Buch zu. Immerhin geht es darum, Ihnen einen guten und hilfreichen Überblick über die prüfungsrelevanten Inhalte zu vermitteln. Da der Umfang der Lerninhalte enorm ist und der Lernstoff viele verschiedene Fachbereiche, Themen und Aspekte beinhaltet, besitzt das Buch eine große Kompaktheit und hohe Inhaltsdichte. Im Folgenden erfahren Sie, was Sie in den einzelnen Teilen erwartet.
Teil I: Ihr Weg zum Glück: Die Heilpraktikerprüfung
Teil I des Buchs beschäftigt sich mit dem Ablauf, den Besonderheiten und den Formalia der Heilpraktikerprüfung. Bevor Sie sich in das Studium der prüfungsrelevanten Inhalte stürzen, erscheint es mir sinnvoll, dass Sie sich mit den Anmeldemodalitäten und der Prüfungssituation vertraut machen. Das soll Ihnen Sicherheit geben für Ihre Planung und Ihre allgemeine Vorbereitung auf die Prüfung. Dazu gehört auch eine realistische Einschätzung der Ansprüche, die in der Prüfung an Sie als Heilpraktikeranwärter gestellt werden.
Teil II: Besser verstehen: Medizinische Grundlagen
Teil II des Buchs ist den medizinischen Grundlagen gewidmet. Das mag in einem Buch zum Thema Heilpraktikerprüfung überraschen, hat aber einen ganz pragmatischen Grund: Nach meiner Erfahrung wird die Bedeutung des naturwissenschaftlichen Basiswissens häufig unterschätzt. Zwar stehen die in diesem Teil dargestellten Inhalte nicht im Vordergrund der amtsärztlichen Überprüfung, aber für das Verständnis und für das Erläutern pathophysiologischer Vorgänge, das vor allem in der mündlichen Prüfung verlangt wird, sind sie unverzichtbar. Angefangen bei der medizinischen Terminologie, die wir für die Kommunikation mit Fachleuten und für das Verstehen von ärztlichen Informationen benötigen, über Zytologie, Histologie und Genetik bis hin zu den allgemeinen Ursachen und Verlaufsformen von Erkrankungen, profitieren wir als Heilpraktiker ungemein von medizinisch korrektem Sprechen, Denken, Verstehen, Analysieren und Diagnostizieren.
Teil III: Crashkurs Prüfungswissen: Innere Medizin
In Teil III geht es so richtig los mit den prüfungsrelevanten Inhalten. In den Kapiteln 11 bis 17 werden alle Organsysteme und Fachgebiete der sogenannten Inneren Medizin dargestellt, vom Herz-Kreislauf-System bis zu den Infektionskrankheiten. Die Darstellung folgt dabei einem einheitlichen Schema: Zunächst werden die wichtigsten anatomischen und physiologischen Hintergründe skizziert, die – je nach Prüfungsamt – mehr oder weniger häufig abgefragt werden. Dies dient der Vorbereitung auf die Pathologie, das heißt auf die wichtigsten Erkrankungen des jeweiligen Systems oder Fachgebiets. Jedes Kapitel schließt mit einer Auswahl an Multiple-Choice-Fragen ab, mit deren Hilfe Sie Ihr Wissen überprüfen können. Die Lösungen dazu finden Sie am Ende des Buchs.
Am Anfang von Teil III finden Sie eine Hierarchie der Themen, die sich aus der Auswertung der vergangenen 28 Prüfungen ergeben hat. Es ist sicher kein Zufall, dass die Innere Medizin die höchste Prüfungsrelevanz hat. Der Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass die am häufigsten vorkommenden Volkskrankheiten, die unser Gesundheitssystem belasten und für die Patienten ein hohes Sterberisiko darstellen, vor allem die inneren Organe betreffen. Neben den großen »Zivilisationskrankheiten« wie Arteriosklerose, Diabetes mellitus oder Adipositas sind aber auch unbekanntere und weniger häufig auftretende Krankheiten zu lernen.
Teil IV: Crashkurs Prüfungswissen: Nebenfächer
Teil IV des Buchs setzt Teil III fort, allerdings mit dem Schwerpunkt auf anderen Organsystemen und Fachgebieten. Die sogenannten Nebenfächer sind nicht weniger wichtig als die Innere Medizin, haben aber im Rahmen der universitären Ausbildung eine andere Zuordnung bekommen. Dazu gehören die Organsysteme der Haut, des Bewegungsapparats, des Genitaltrakts, des Nervensystems mit Sinnesorganen und das Fachgebiet der Psychiatrie.
Auch in diesem Teil geht es um die besonders prüfungsrelevanten Inhalte zum Aufbau, zu den Funktionen und zu den Erkrankungen. Die Fokussierung auf die wesentlichen Fakten und die systematische Darstellung der Krankheitsbilder sollen Ihnen helfen, nicht den roten Faden zu verlieren und Ihre Kräfte zu bündeln im Sinne eines effektiven Lernens. Wie in Teil III finden Sie auch hier am Ende jedes Kapitels ausgewählte MC-Fragen zum Üben.
Teil V: Sicher praktizieren: Der Heilpraktiker in der Praxis
In Teil V des Buchs steht zunächst die Differenzialdiagnose im Vordergrund. Das Ziel der Differenzialdiagnose ist es, durch Ausschlussverfahren die wahrscheinlichste Ursache für die Symptome des Patienten zu identifizieren. Dafür müssen die infrage kommenden Erkrankungen gut gelernt worden sein. Die sogenannte DD ist sehr wichtig für die Prüfungsvorbereitung und gleichzeitig die entscheidende Grundlage für eine sichere Diagnose.
Zusätzlich finden Sie in Teil V die Themen Labormedizin, Hygiene, Notfallmaßnahmen sowie Gesetzes- und Berufskunde für Heilpraktiker. Kenntnisse in diesen Bereichen sind Voraussetzung für eine professionelle und erfolgreiche Praxistätigkeit und werden regelmäßig in der Prüfung thematisiert.
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Der Top-Ten-Teil am Ende des Buchs liefert Ihnen Informationen darüber, welche Strategien für effektives Lernen sinnvoll sind, und listet eine Reihe interessanter Internetadressen rund um das Heilpraktikerwesen auf.
Wie es weitergeht
Nun wünsche Ihnen viel Freude an der Materie und immer wieder kleine und große Aha-Erlebnisse. Der menschliche Organismus ist und bleibt ein Wunderwerk der Natur, ganz unabhängig davon, wie viel wir über ihn wissen und in Zukunft noch erfahren werden. Deswegen mein abschließender Tipp an dieser Stelle: Genießen Sie die Funktionalität Ihres Körpers und bleiben Sie neugierig!
Teil I
Ihr Weg zum Glück: Die Heilpraktikerprüfung
IN DIESEM TEIL …
erhalten Sie wichtige Hinweise zum Ablauf und zu den Besonderheiten der Heilpraktikerprüfunglernen Sie zu verstehen, wie schriftliche Prüfungsfragen aufgebaut sind, um sie schnell und effizient beantworten zu könnenerfahren Sie alles Wissenswerte über den gelungenen Auftritt in der mündlichen PrüfungKapitel 1
Allgemeines zur Heilpraktikerprüfung
IN DIESEM KAPITEL
Gesetzliche Grundlagen der HeilpraktikerprüfungWie Sie sich für die amtsärztliche Überprüfung anmeldenWas Sie über den Ablauf und die Modalitäten der Prüfung wissen müssenBevor wir uns gemeinsam die prüfungsrelevanten Themen anschauen, sollen zunächst die gesetzlichen Vorgaben zur Prüfungszulassung erläutert werden, denn Sie müssen sich ja regelkonform für die amtsärztliche Überprüfung anmelden. Grundlage für die Regelung der Heilpraktikerprüfung sind das Heilpraktikergesetz (HPG) und die dazugehörige Durchführungsverordnung (DVO) der einzelnen Bundesländer. Beides wird in Kapitel 25 vorgestellt, sodass wir uns an dieser Stelle ganz auf die Prüfungsformalia konzentrieren können.
Zentrales Anliegen des Heilpraktikergesetzes war seit Beginn seiner Inkraftsetzung in der Zeit des Nationalsozialismus die Abwendung der »Gefahr für die Volksgesundheit«. Im originalen Wortlaut heißt es dort: »Die Überprüfung hat sich darauf zu erstrecken, ob die antragstellende Person so viele heilkundliche Kenntnisse und Fähigkeiten besitzt, dass die Ausübung der Heilkunde durch sie nicht zu einer Gefahr für die Volksgesundheit wird.« Aus diesem Grund muss jeder, der den Beruf des Heilpraktikers ausüben möchte, eine Überprüfung vor einem Amtsarzt einer Gesundheitsbehörde ablegen. Wichtig ist, dass für einen Antrag auf Prüfungszulassung bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Ein Antragsteller wird zur Prüfung zugelassen, wenn
das 25. Lebensjahr vollendet ist (mit der Heilpraktikerausbildung können Sie aber schon vorher beginnen),
mindestens eine abgeschlossene Hauptschulausbildung vorliegt (in manchen Bundesländern auch Berufsreife oder Berufsbildungsreife genannt),
ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis vorliegt (bestätigt die »sittliche Reife« und darf nicht älter als drei Monate sein),
ein ärztliches Attest vorliegt, dass der Prüfungsanwärter frei von geistigen und körperlichen Krankheiten und Sucht ist, die ihn an der Berufsausübung hindern würden (darf bei Antragstellung ebenfalls nicht älter als drei Monate sein).
Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und Sie sich umfangreich und qualifiziert auf die Prüfung vorbereitet haben, stellen Sie sich wahrscheinlich folgende Fragen, auf die Sie gleich im Anschluss eine Antwort erhalten:
Wo und wie melde ich mich zur Prüfung an?
Dies kann je nach Bundesland und Regierungsbezirk variieren, meist bei den Gesundheitsämtern, dem Landratsamt oder der Kreisverwaltung. Bitte informieren Sie sich frühzeitig bei dem für Sie zuständigen Gesundheitsamt. Für die Anmeldung werden Antrags- und Merkblätter zur Verfügung gestellt, die Sie im Internet auf der Website der zuständigen Behörde finden.
Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Prüfung dort abgelegt werden muss, wo der Heilpraktikeranwärter (HPA) seinen ersten Wohnsitz hat oder wo er seine Niederlassung, also seinen Praxisstandort plant. Manchen Prüfungsämtern reicht ein Nachweis des Einwohnermeldeamts, andere möchten einen Beleg für die Niederlassungsabsicht, falls diese bereits vom HPA anvisiert wird.
Die Auswahl ist durch die gesetzlichen Vorgaben stark eingeschränkt, wie wir soeben gesehen haben. Der Aufwand, einen neuen ersten Wohnsitz anzumelden oder in einem anderen Ort vorab einen Praxisraum zu mieten, nur um in den Zuständigkeitsbereich eines anderen Amts zu gelangen, lohnt sich ganz sicher nicht. Es ist ratsam, die Prüfungsvorbereitung an einer Heilpraktikerschule zu absolvieren, die mit den Besonderheiten Ihres Prüfungsamts vertraut ist. Damit schaffen Sie schon die besten Voraussetzungen.
Wie läuft die Prüfung ab?
Die Prüfungsämter bieten zweimal pro Jahr Prüfungstermine an: am dritten Mittwoch im März und am zweiten Mittwoch im Oktober. Dabei ist zu beachten, dass es sich hierbei jeweils um den schriftlichen Teil der Prüfung handelt. Erst wenn Sie diesen bestanden haben, werden Sie zu der mündlichen Prüfung eingeladen, die eventuell erst mehrere Wochen später stattfindet. Über diesen Termin werden Sie vom Prüfungsamt separat informiert. Haben Sie die mündliche Prüfung nicht bestanden, so müssen beide Prüfungsteile (schriftlich und mündlich) erneut abgelegt werden.
Nach erfolgreicher Anmeldung und Zulassung zur Prüfung wird Ihnen zeitnah vor Prüfungsantritt der genaue Termin und Ort der schriftlichen Prüfung mitgeteilt. Diese findet in der Regel in der Zeit von 09:00 bis 11:00 Uhr am Vormittag statt.
Planen Sie genügend Zeit für die Anreise zum Prüfungsort ein, es kann immer mal etwas dazwischenkommen. Die Bahn, der Bus, die U-Bahn oder Straßenbahn kann sich verspäten, oder Sie stehen unvermutet in einem Stau. Wenn Sie frühzeitig am Prüfungsort eingetroffen sind, gehen Sie noch eine kleine Runde spazieren, um sich zu beruhigen und Ihre Gedanken zu ordnen.
Im Prüfungsraum wird Ihnen in der Regel ein Platz zugewiesen, und Sie erhalten eine Auswahl von 60 Multiple-Choice-Fragen, die häufig in zwei oder drei Gruppen eingeteilt sind (Gruppe A, Gruppe B, manchmal auch Gruppe C) und verschiedenfarbig ausgedruckt sind (zum Beispiel Gruppe A hellblau, Gruppe B rosa, Gruppe C gelb). Anhand dieser Farben lassen sich die Gruppen sehr schnell zuordnen. Für die Beantwortung der 60 Fragen und die Übertragung der Lösungen auf einen Lösungsbogen haben Sie zwei Stunden Zeit, also zwei Minuten pro Frage inklusive Übertragung. Am Ende der schriftlichen Prüfung geben Sie nur den Lösungsbogen ab und behalten den Prüfungsbogen mit den Fragen, Ihren Bearbeitungen und Lösungsvorschlägen, den Sie dann mit nach Hause nehmen können.
Besonders engagierte Heilpraktikerschulen bearbeiten direkt nach der schriftlichen Prüfung die MC-Fragen, werten diese aus und stellen ihre eigenen Lösungsvorschläge im Internet zur Verfügung. Diese schulinternen Lösungsvorschläge sind zwar mit Vorsicht zu genießen, denn sie müssen ja keineswegs mit den offiziellen Lösungen des Prüfungsamts übereinstimmen, aber es gibt Schulen, die eine (nahezu) hundertprozentige Trefferquote haben. Leider gibt es hin und wieder Fragen, die nicht eindeutig zu beantworten sind.
Anhand Ihres Prüfungsbogens können Sie nun Ihre Antworten mit den Lösungsvorschlägen der Schule vergleichen und haben dadurch schon einen sehr guten Anhaltspunkt für Ihr Abschneiden. Sie brauchen mindestens 45 richtige Antworten. Den offiziellen Bescheid, dass Sie die schriftliche Prüfung bestanden haben, erhalten Sie in der Regel zehn Tage nach dem Prüfungstermin. Da die Prüfung an einem Mittwoch stattfindet, erhalten Sie den Bescheid wahrscheinlich am Montag der übernächsten Woche. Es gibt aber auch Prüfungsämter, die bereits in den ersten Tagen nach der Prüfung Bescheid geben; bei anderen wiederum kann es zwei oder drei Wochen dauern. Am besten fragen Sie gleich bei der Anmeldung zur Prüfung, wie die Gepflogenheiten Ihres zuständigen Amts sind. Bitte erfragen Sie das Ergebnis telefonisch nur dann, wenn das Amt ausdrücklich dieses Angebot macht!
Die Terminvergabe für die mündliche Prüfung ist nicht einheitlich geregelt. Wenn Sie den schriftlichen Teil bestanden haben, werden Sie von Ihrem zuständigen Amt zur mündlichen Prüfung eingeladen.
Die mündliche Prüfung kann bereits einige Tage nach der schriftlichen Prüfung oder auch erst viele Wochen später sein. Manche Ämter gehen alphabetisch vor, manche geben in der Reihenfolge der Anmeldungen Bescheid, bei anderen lässt sich keine Systematik erkennen. Berücksichtigen Sie diese Tatsache bei Ihrer Urlaubsplanung!
Wichtig ist, dass Sie Ihre Prüfungsspannung bis zur mündlichen Prüfung aufrechthalten, denn auch diesen Teil müssen Sie – zusätzlich zum schriftlichen Teil – bestehen. Idealerweise bietet Ihre Schule spezielle Kurse für diese schwierige Zeitspanne an.
Das Ergebnis Ihrer mündlichen Prüfung erhalten Sie gleich im Anschluss vor Ort, darauf müssen Sie also nicht noch Tage oder Wochen warten.
Wie geht es dann weiter?
Wenn Sie auch den mündlich-praktischen Teil der Prüfung bestanden haben, dürfen Sie sich einmal selbst sehr herzlich gratulieren! Denn dann müssen Sie vieles richtig gemacht haben. Das Erfolgserlebnis wird noch gekrönt von dem Bescheid Ihres Gesundheitsamts, dass Sie nun die »Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde« besitzen. Jetzt kann es losgehen mit der »Kür«, also mit der naturheilkundlichen Ausbildung und mit dem Erlernen all jener Therapieformen, die Ihnen am Herzen liegen.
Rein theoretisch können Sie gleich nach dem Erhalt der Heilpraktiker-Erlaubnis eine Praxis eröffnen, aber ohne eine therapeutische Qualifikation rate ich Ihnen dringend davon ab. Das schulmedizinische Wissen und diagnostische Können, das Sie erlangt haben, ist eine hervorragende Basis für Ihre Praxistätigkeit, aber das zweite Standbein in Form der Behandlungsmethoden ist genauso wichtig. Wenn Sie zum Beispiel gerne Massagen anbieten möchten, dann suchen Sie sich eine gute Ausbildungsmöglichkeit und starten mit dieser Qualifikation in den Praxisalltag. Nach und nach nehmen Sie weitere Therapien hinzu und erweitern organisch Ihr Behandlungsangebot.
Wenn Sie dann noch an das Praxismanagement denken (Wie gründe ich eine Praxis? Welchen Standort wähle ich? Habe ich einen Businessplan? Welche Kooperationsmöglichkeiten gibt es? Wie rechne ich nach dem Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker ab? Wie führe ich Patientenkarteien?), dann steht einer erfolgreichen Praxis und einer erfüllenden Tätigkeit als Heilpraktiker quasi nichts mehr im Wege.
Über die Prüfungsrelevanz einzelner Themen
Der Schwerpunkt liegt eindeutig im Bereich der Inneren Medizin, vor allem die Fachgebiete Kardiologie und Infektiologie sind sehr prominent vertreten. Hier spiegelt sich ein Hauptanliegen der Gesundheitsämter wider: die Sicherung der Volksgesundheit und der Schutz der Gemeinschaft vor übertragbaren Erkrankungen unter seuchenrechtlichen Gesichtspunkten. Auch Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus oder Rheuma spielen eine wichtige Rolle. Das entspricht den Leitlinien für die Überprüfung, die vom Bundesministerium für Gesundheit am 22.12.2017 veröffentlicht wurden.
Die Auswertung aus 28 schriftlichen Prüfungsklausuren ergibt folgende Hierarchie in der Relevanz:
Herz, Kreislauf, Gefäße (Kardiologie, Innere Medizin)
Infektionskrankheiten (Infektiologie, Innere Medizin)
Magen und Darm (Gastroenterologie, Innere Medizin)
Psychische Erkrankungen (Psychiatrie, Nebenfach)
Blut (Hämatologie, Innere Medizin)
Nervensystem (Neurologie, Nebenfach)
Leber, Gallenblase, Pankreas (Gastroenterologie, Innere Medizin)
Niere (Urologie/Nephrologie, Innere Medizin)
Bewegungsapparat (Orthopädie, Nebenfach)
Atmungssystem (Pneumologie/Pulmologie, Innere Medizin)
Haut (Dermatologie, Nebenfach)
Hormonsystem (Endokrinologie, Innere Medizin)
Genitaltrakt, Schwangerschaft, Geburt (Urologie/Gynäkologie, Nebenfach)
Notfall (Nebenfach)
Ohr (HNO, Nebenfach)
Auge (Ophthalmologie, Nebenfach)
Kinderheilkunde (Pädiatrie, Nebenfach)
Krebserkrankungen (Onkologie, Nebenfach)
Arzneimittellehre (Pharmakologie, Nebenfach)
Über die Ansprüche in der Heilpraktikerprüfung
In meiner Tätigkeit als Schulleiter werde ich regelmäßig mit den Sorgen, Nöten und Ängsten der Schülerinnen und Schüler konfrontiert, und es ist mir eine echte Herzensangelegenheit, ihre Fragen umfassend zu beantworten und ihnen dabei das Gefühl zu geben, dass letztendlich alles (oder doch das meiste) machbar und schaffbar ist. In den vergangenen fünf Jahrzehnten sind Tausende von Schülern an unserer Schule zur Prüfungsreife gelangt und die weitaus meisten von ihnen haben die Heilpraktikerprüfung auf Anhieb bestanden.
Das ist beruhigend, sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Ansprüche an die Heilpraktikeranwärter in den letzten Jahren stark gestiegen sind. War die amtsärztliche Überprüfung früher eindeutig darauf ausgerichtet, herauszufinden, ob der zu Prüfende eine Gefahr für die Volksgesundheit darstellt, werden spätestens seit der Veröffentlichung der neuen Prüfungsrichtlinien im Jahr 2017 Kenntnisse und Fähigkeiten im medizinischen Bereich abgefragt, vergleichbar mit einer Prüfungssituation im Studium der Humanmedizin.
Ich betrachte das allmähliche Ansteigen der Ansprüche als positive Entwicklung, da der Beruf des Heilpraktikers dadurch aufgewertet wird. Wer diese Prüfung besteht, ist nicht nur keine Gefahr für die Volksgesundheit, er hat darüber hinaus ein solides schulmedizinisches Fundament erworben, auf dem er guten Gewissens und mit ebenso guten Erfolgsaussichten seine Praxistätigkeit aufbauen kann.
In den folgenden Kapiteln ist es mir nun eine Freude, Sie mit den Besonderheiten der Heilpraktikerprüfung vertraut zu machen und Ihnen zum Beispiel anhand von Multiple-Choice-Fragen die Prüfungssituation vorzustellen. Lehnen Sie sich innerlich entspannt zurück, Sie werden Stück für Stück durch die Prüfungsvorbereitung geführt.
Kapitel 2
Wir sind alle nur Menschen: Über Amtsärzte, Beisitzer und HPAs
IN DIESEM KAPITEL
Was Sie über das Thema Lampenfieber wissen solltenWarum die Heilpraktikerprüfung auch ein Persönlichkeitstest istWie Sie angemessen und zielführend mit Ihrem Prüfer kommunizierenNehmen wir an, Sie wären Amtsarzt beim Gesundheitsamt und hätten die Aufgabe, einen ganzen Tag lang Heilpraktikeranwärter daraufhin zu überprüfen, ob diese eine Gefahr für die Volksgesundheit darstellen oder nicht. Und es stellen sich Ihnen Kandidaten vor, die sich sehr unterschiedlich auf die mündliche Prüfung vorbereitet haben: manche sehr unzureichend zum Beispiel im Eigenstudium, manche mehr schlecht als recht zum Beispiel mit einem mehrmonatigen Onlinekurs ohne praktische Ausbildung, manche mit großem Wissen, aber wenig prüfungsorientierter Übung und manche mit einer soliden Heilpraktikerausbildung einschließlich klinischer Praxis und guter Prüfungsvorbereitung. Die Bandbreite an Wissen und Fähigkeiten bei den Prüflingen ist enorm, da es keine einheitliche Regelung zur Ausbildung von Heilpraktikern gibt.
Können Sie nachempfinden, wie es Ihnen als Prüfer ergehen würde, wenn Sie mit ständig wechselnden Voraussetzungen bei den Prüflingen konfrontiert werden? Ich könnte mir vorstellen, dass dies eine frustrierende Erfahrung sein kann und das Nervenkostüm im Laufe eines Prüfungstages erheblich leidet. Nicht selten berichten uns HPAs, dass sich der Amtsarzt oder ein Beisitzer unfreundlich bis abweisend verhalten hätten und die Prüfungssituation dadurch belastet war. Das soll sicher nicht so sein und ist auch nicht zu rechtfertigen. Wenn man sich als Prüfer aber immer wieder mit ungenügenden Kenntnissen und Fähigkeiten auseinandersetzen muss, kann das die Stimmung sicher negativ beeinflussen.
Hier spielt das Thema Respekt eine große Rolle, bitte unterschätzen Sie diesen Faktor nicht. Amtsärzte und Beisitzer mögen es wie alle Menschen, dass man ihnen mit Wertschätzung und Achtung begegnet, und sie empfinden es berechtigterweise als ziemlich respektlos, wenn sich der zu Prüfende mangelhaft auf die Prüfung vorbereitet hat und seine Kenntnisse und Fähigkeiten zu wünschen übriglassen. Solche Situationen sind keine einmaligen Ereignisse; im Laufe einer Prüfungseinheit können es gut die Hälfte der Kandidaten sein, die aus den genannten Gründen keine Erlaubnis zur Ausübung der Heilkunde erhalten.
Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, wie überaus wichtig es ist, über den gesamten Zeitraum der Prüfung hinweg freundlich, höflich und zugewandt zu sein. Gerade dann, wenn Sie den Eindruck haben, dass Ihnen Prüfer oder Beisitzer nicht mit dem nötigen Respekt begegnen, sollten Sie an Ihrer Maxime festhalten und nicht »ins gleiche Horn blasen«. Denken Sie bitte immer daran, dass sich die Atmosphäre auch ändern kann und Sie es mit in der Hand haben, in welche Richtung sich die Prüfungssituation entwickelt.
Wenn Sie bereit sind, den Prüfern verständnisvoll zu begegnen und mit einem gewissen Maß an Demut (im positiven Sinne!) an die Sache heranzugehen, wird sich Ihr Verhalten günstig auf den Ausgang der Prüfung auswirken. Würdigen Sie das Wissen und Können des Prüfers und seien Sie offen für neue Erkenntnisse, die Sie aus der Prüfung mitnehmen können. Die Gesundheitsämter tragen eine Verantwortung für die sachgerechte Ausübung des Heilpraktiker-Berufs und wir als Heilpraktiker sollten sie darin unterstützen.
Lampenfieber & Co.
Wer kennt es nicht, das berühmte Lampenfieber vor einem Auftritt in der Öffentlichkeit, angefangen bei einem Referat, das vor der Klasse gehalten werden soll, bis hin zu Bühnenshows mit vielen Tausend Zuschauern im Stadion oder mehreren Millionen vor dem Bildschirm. Letztendlich ist das Phänomen immer das gleiche: unangenehme Gefühle wie nervöse Anspannung, Unsicherheit, Angst und körperliche Symptome wie Herzklopfen, Schweißausbruch, zittrige Hände, trockener Mund, Übelkeit, Durchfall oder sogar komplette Blackouts.
Lampenfieber kann sowohl bei Anfängern als auch bei erfahrenen Personen auftreten und die Leistungsfähigkeit stark beeinflussen. Sich diesen Situationen immer wieder bewusst auszusetzen, hilft in jedem Fall, sie zu meistern. Auch deswegen ist das Training für die mündliche Prüfung so außerordentlich wichtig, denn nur hier haben Sie die Gelegenheit, in einer Prüfungssimulation Ihre Angst zu überwinden und trotz Lampenfieber ins Reden zu kommen.
Nicht nur Prüflinge, auch Prüfer können Lampenfieber haben und aufgeregt sein. Sie dürfen in der Prüfung also ruhig zugeben, dass Sie nervös sind und sich sammeln müssen, dafür haben alle Anwesenden Verständnis. Versuchen Sie nicht, möglichst »cool rüberzukommen«, wenn Sie in Wirklichkeit innerlich maximal angespannt sind. Das wirkt nicht authentisch und würde Sie als Mensch unglaubwürdig machen.
Bitte denken Sie immer daran, dass Lampenfieber eine normale Reaktion ist und Sie damit umgehen müssen, weil Sie ein Mensch und keine Maschine sind. Lampenfieber kann jedoch durch verschiedene Techniken und Strategien reduziert werden, wie zum Beispiel durch gezielte Vorbereitung, Entspannungsübungen, positive Selbstgespräche und das Akzeptieren von Fehlern als Teil des Lernprozesses.
Wenn Sie den Eindruck haben, dass Lampenfieber ein ernsthaftes Problem für Sie darstellt, das Sie nicht selbst in den Griff bekommen können und einen öffentlichen Auftritt wie die Prüfung vor einer Kommission unmöglich macht, rate ich Ihnen, sich entsprechende Unterstützung zu holen, zum Beispiel bei einem Coach. Sie müssen das nicht allein und aus eigener Kraft bewältigen, lassen Sie sich von einem Profi begleiten. Schließlich geht es nicht nur darum, eine Prüfung zu bestehen, auch Ihr Stehvermögen im Beruf wird davon profitieren.
Biologisch betrachtet helfen uns die sogenannten Stresshormone Adrenalin und Cortisol, eine gute Leistung zu erbringen. Adrenalin wird vom Nebennierenmark freigesetzt und bewirkt eine erhöhte Herzfrequenz, gesteigerte Atmung und eine erhöhte Bereitschaft zur Flucht oder zum Kampf (Fight-or-Flight-Reaktion). Cortisol wird von der Nebennierenrinde produziert und hat verschiedene Auswirkungen auf den Körper, wie die Erhöhung des Blutzuckerspiegels und die Steigerung der Aufmerksamkeit. Diese Hormone helfen unserem Körper, mit herausfordernden Situationen umzugehen, können jedoch bei chronischem Stress negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Deswegen ist es so wichtig, aus der Anspannung wieder in die Entspannung zu kommen und sein eigenes Gleichgewicht zu finden.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu entspannen, wie zum Beispiel Meditation, Yoga, Atemübungen, Massagen, Spaziergänge in der Natur oder das Lesen eines Buchs. Durch regelmäßige Entspannung können Sie Ihre Konzentrationsfähigkeit verbessern und Ihre Produktivität steigern. Wenn Ihr Geist entspannt ist, können Sie also auch konzentrierter und effektiver lernen. Alle Erfahrungen, die Sie in der Zeit Ihrer Ausbildung und Prüfungsvorbereitung machen, können Sie später in der Praxis an Ihre Patienten weitergeben.
Die Prüfung als Persönlichkeitstest
Sie haben nun schon einiges über die Prüfungssituation erfahren und wahrscheinlich auch vorher schon so manches darüber gehört. Über die Anforderungen in der mündlichen Prüfung hinsichtlich des medizinischen Wissens und differenzialdiagnostischen Könnens hinaus kann man sich die Heilpraktikerprüfung auch als einen Persönlichkeitstest vorstellen. Wie ist Ihr Auftreten? Wie wirkt Ihre Gesamterscheinung? Wie meistern Sie schwierige Situationen? Wie verhalten Sie sich in Notfällen? Wie gut sind Ihre kommunikativen Fähigkeiten?
Ich stelle immer wieder fest, dass das Bestehen einer Prüfung auch an einzelnen Persönlichkeitsmerkmalen und nicht immer am Wissen oder Können scheitert. Deswegen ist es sinnvoll, über die eigene Persönlichkeit nachzudenken und im Austausch mit anderen Menschen zusätzliche Informationen über sich selbst zu erhalten. Auf der einen Seite ist jeder Mensch als Person viel zu komplex und vielfältig, um auf einige wenige Merkmale reduziert zu werden, so wie es in den sogenannten Persönlichkeitstests meist der Fall ist. Auf der anderen Seite benötigen wir konkrete Anhaltspunkte und Aussagen, um Erkenntnisse über uns selbst zu gewinnen. Was eine Person ausmacht, ist eine zutiefst philosophische Frage, die wir an dieser Stelle nicht erörtern können.
Jeder Mensch hat seine eigenen Stärken und Schwächen, und es ist wichtig, sich auf die Entwicklung und Verbesserung der eigenen Fähigkeiten zu konzentrieren, um persönliches Wachstum und Erfolg zu erreichen. So betrachtet kann es durchaus sinnvoll sein, dass Sie sich während der Heilpraktikerausbildung oder in der Zeit der Prüfungsvorbereitung psychologisch begleiten oder von einem Coach unterstützen lassen. Die Entfaltung und Stärkung Ihrer Persönlichkeit kann nicht nur Ihre Erfolgschancen in der Prüfung erhöhen, sie wird sich mit Sicherheit auch positiv auf Ihre Praxistätigkeit auswirken.
Gesprächsführung in der Prüfung
Die Fähigkeit der Kommunikation ist von so zentraler Bedeutung, dass wir diese noch genauer betrachten sollten. Es ist wichtig, dass Sie in der mündlichen Prüfung ins Reden kommen. Letztendlich spielt es für die Prüfer keine Rolle, welcher Typ Mensch oder wie geübt Sie in Auftritten vor Publikum sind. Vielleicht sind Sie ein Freund weniger Worte und schätzen das Schweigen mehr als das Geschwätzigsein, aber in der mündlichen Prüfung müssen Sie reden, und zwar von Anfang an und bis zum Schluss. Und dabei spielt nicht nur das Reden an und für sich eine entscheidende Rolle, sondern auch die Art und Weise, wie Sie mit den Prüfern kommunizieren.
Allgemeine Regeln einer guten Gesprächsführung
Eine gute Gesprächsführung kann durch verschiedene Fähigkeiten und Techniken erreicht werden. Das übergeordnete Ziel ist, effektiv zu kommunizieren und die positive Interaktion mit anderen zu fördern. Hier sind einige wichtige Aspekte:
Aktives Zuhören
:
Zeigen Sie Interesse an dem, was der Prüfer sagt, indem Sie ihm Ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Vermeiden Sie Ablenkungen und Unterbrechungen und zeigen Sie durch nonverbale Signale wie Nicken oder Blickkontakt, dass Sie zuhören.
Offene Fragen stellen
:
Stellen Sie offene Fragen, die mehr als nur eine Ja- oder Nein-Antwort erfordern. Dies fördert eine tiefere Konversation und ermöglicht es der anderen Person, ihre Gedanken und Gefühle auszudrücken.
Empathie zeigen
:
Versuchen Sie, sich in die Lage der anderen Person zu versetzen und ihre Perspektive zu verstehen. Zeigen Sie Mitgefühl und Verständnis für ihre Gefühle und Äußerungen, auch wenn Sie anderer Meinung sind.
Klar und präzise kommunizieren
:
Drücken Sie Ihre Gedanken und Ideen klar und verständlich aus. Vermeiden Sie eine komplizierte Ausdrucksweise, die zu Missverständnissen führen könnte.
Feedback geben
:
Geben Sie konstruktives Feedback, um die Kommunikation zu verbessern und Missverständnisse zu klären. Seien Sie dabei respektvoll und achten Sie darauf, dass Ihr Feedback auf Fakten und Beobachtungen basiert und nicht auf Vermutungen.
Körpersprache beachten
:
Achten Sie auf Ihre eigene Körpersprache und die Körpersprache des Prüfers. Eine offene Körperhaltung, Augenkontakt und angemessenes Nicken können zeigen, dass Sie interessiert und engagiert sind.
Geduld haben
:
Geben Sie der anderen Person ausreichend Zeit, um ihre Gedanken zu sammeln und auszudrücken. Unterbrechen Sie nicht und drängen Sie nicht auf schnelle Antworten.
Respekt zeigen
:
Behandeln Sie den Prüfer mit Respekt und Höflichkeit, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Vermeiden Sie persönliche Angriffe oder abwertende Kommentare.
Zusammenfassen und klären
:
Fassen Sie das Gesagte zusammen, um sicherzustellen, dass Sie es richtig verstanden haben, und klären Sie eventuelle Missverständnisse. Dies zeigt, dass Sie aktiv zuhören und sich um eine klare Kommunikation bemühen.
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
:
Seien Sie bereit, Ihren Kommunikationsstil an die Bedürfnisse und Vorlieben der anderen Person anzupassen. Jeder hat einen unterschiedlichen Kommunikationsstil, und es ist wichtig, sich anzupassen, um eine effektive Kommunikation zu ermöglichen.
Das Reden vor Publikum will geübt werden, leider hat man in der Regel kaum Gelegenheit dazu. Ich möchte Sie auch nicht ermuntern, in öffentlichen Verkehrsmitteln große Reden zu schwingen oder den schweigsamen Benutzern einer Bibliothek einen gut hörbaren Vortrag über die Bibliotheksordnung zu halten. Suchen Sie sich passende Orte und Momente und das passende Publikum. Unseren Schülern zum Beispiel bieten wir an, frei gesprochene Referate über definierte medizinische Themen zu halten. Auch die eigene Familie oder der Freundeskreis könnte eine geeignete Zuhörerschaft sein.
Im Rahmen der Heilpraktikerausbildung und der Prüfungsvorbereitung empfehlen wir die Bildung von kleinen Lerngruppen. Lerngruppen haben den unschätzbaren Vorteil, dass es allen Beteiligten um das Gleiche geht und sich alle in etwa auf dem gleichen Wissensniveau befinden. Schaffen Sie sich gemeinsam ein Flipchart oder Whiteboard an und erklären Sie sich gegenseitig Zusammenhänge. Falls all diese Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen, könnten Sie einen freien Vortrag über ein selbst gestelltes Thema akustisch aufzeichnen, zum Beispiel mit Ihrem Handy, die Aufzeichnung hinterher anhören und selbst analysieren. Probieren Sie alles aus, was Ihnen sinnvoll erscheint, seien Sie kreativ und erwägen Sie auch Möglichkeiten, die Sie zuvor noch nicht versucht haben.
Die eigenen Fähigkeiten in Bezug auf öffentliche Vorträge zu trainieren, wirkt sich nicht nur positiv auf die mündliche Prüfung aus – sofern man die Selbstdarstellung nicht übertreibt –, sie können auch effektiv eingesetzt werden, um auf die eigene Praxistätigkeit aufmerksam zu machen. Manche Apotheken zum Beispiel stellen ihre Räumlichkeiten für Vorträge über naturheilkundliche Methoden oder biologische Präparate zur Verfügung. Auch an den Volkshochschulen gibt es die Möglichkeit, im Gesundheitsbereich Vorträge zu halten oder kleine Kurse anzubieten. Natürlich müssen Sie kein Redner werden, um die Prüfung zu bestehen. Aber Sie könnten Ihre beruflichen Perspektiven als Heilpraktiker zum Beispiel in Richtung Dozentur an einer Heilpraktikerschule erweitern. Auch ich habe so angefangen und möchte meine Erfahrungen als Dozent auf keinen Fall missen.
Die verschiedenen Kommunikationstypen
Die verschiedenen Typen der Kommunikation scheinen mir deswegen relevant zu sein, weil die Gesprächsführung mit bestimmten Typen sehr anspruchsvoll oder sogar frustrierend verlaufen kann, sodass Sie sich in der Prüfungssituation allein durch die Art der Kommunikation gestresst oder überfordert fühlen. Es macht einen großen Unterschied, ob mir mein Gegenüber aufmerksam und wohlwollend zuhört oder sich desinteressiert und abweisend verhält. Wie ein Prüfer oder Beisitzer mit Ihnen spricht, können Sie vorher nicht wissen, Sie werden diesem Menschen in der Prüfung zum ersten Mal begegnen.
Ich möchte auch an dieser Stelle nochmals betonen, dass die Kommunikation in der mündlichen Prüfung in den allermeisten Fällen positiv ist und es keinen Grund zur Beschwerde gibt. Es gibt aber auch Fälle, in denen die Gesprächsführung willkürlich erscheint oder die Verhaltensweisen der Prüfer nicht den allgemeinen Vorstellungen entsprechen. So wurde mir schon von Prüfungen berichtet, in denen weder Prüfer noch Beisitzer ein einziges Mal den Blickkontakt gesucht hätten oder der Prüfer sofort nach Betreten des Raums ohne jede Begrüßung ein Fallbeispiel geschildert hat und darüber hinaus dem Prüfling während seiner Anamnese ständig ins Wort gefallen ist.
Manche Prüfer betrachten es womöglich als ihre Aufgabe, den Prüfling nicht nur auf Wissen und Können hin zu befragen, sondern auch seine Stressfestigkeit zu testen. Das ist aus meiner Sicht grundsätzlich in Ordnung, sollte aber den Rahmen der Prüfungssituation nicht sprengen und die Intention der amtsärztlichen Überprüfung nicht in eine andere, nicht vorgesehene Richtung lenken. Sollten Sie in die unangenehme Situation geraten, einen Prüfer dieser Kategorie vor sich zu haben, brauchen Sie mehr als nur allgemeine Kommunikationsfähigkeiten.
In diesem Fall sind Sie besser vorbereitet, wenn Sie sich mit den folgenden Kommunikationstypen vertraut machen und diese Situation spielerisch vorwegnehmen. Suchen Sie sich Gesprächspartner, die Freude daran haben, Sie auflaufen zu lassen, Sie zu ignorieren, alles zu hinterfragen, Sie nicht ausreden zu lassen, Sie mit unpassenden Kommentaren zu verwirren, beleidigend oder aggressiv zu sein oder die ganze Zeit nur zu schweigen und keinerlei Reaktion zu zeigen. Vielleicht können Sie Ihre Lerngruppe zu einer Theatergruppe erweitern und auch die »unschönen« Kommunikationsarten üben. Dies stärkt nach meiner Erfahrung nicht nur die rhetorischen Fähigkeiten, sondern auch die soziale Kompetenz.
Es gibt verschiedene Ansätze zur Klassifizierung von Kommunikationstypen, die auf deren Merkmalen und Eigenschaften basieren.
Kommunikationstypen, die wir uns wünschen:
Assertiver Kommunikationstyp
:
Assertive Kommunikatoren sind in der Lage, ihre eigenen Bedürfnisse und Meinungen klar und respektvoll auszudrücken, während sie gleichzeitig die Bedürfnisse und Meinungen anderer berücksichtigen. Sie setzen sich für sich selbst ein, ohne andere zu dominieren oder zu manipulieren.
Empathischer Kommunikationstyp
:
Empathische Personen zeigen Mitgefühl und Verständnis für die Gefühle und Bedürfnisse anderer. Sie sind in der Lage, aktiv zuzuhören, sich in andere hineinzuversetzen und ihre Kommunikation auf die Bedürfnisse anderer abzustimmen.
Kommunikationstypen, die uns vor Probleme stellen:
Aggressiver Kommunikationstyp
:
Diese Art der Kommunikation ist durch Dominanz, Konfrontation und das Ignorieren der Bedürfnisse und Meinungen anderer gekennzeichnet. Aggressive Kommunikatoren setzen ihre eigenen Interessen oft über die anderer und können andere einschüchtern oder verletzen.
Passiv-aggressiver Kommunikationstyp
:
Personen mit passiv-aggressivem Kommunikationsstil drücken ihre Unzufriedenheit oder Wut indirekt aus. Sie können sarkastische Bemerkungen oder subtile Andeutungen machen oder absichtlich Dinge vergessen, um ihre Frustration zu zeigen.
Passiver Kommunikationstyp
:
Der passive Kommunikationstyp zeichnet sich durch Zurückhaltung, Unterwürfigkeit und das Vermeiden von Konflikten aus. Passiv kommunizierende Personen haben oft Schwierigkeiten, ihre eigenen Bedürfnisse und Meinungen auszudrücken und setzen die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen.
Manipulativer Kommunikationstyp
:
Manipulative Kommunikatoren versuchen, andere zu beeinflussen oder zu kontrollieren, indem sie subtile Taktiken wie Schmeichelei, Schuldzuweisungen oder Lügen einsetzen. Sie haben oft eigene Interessen im Blick und versuchen, ihre Ziele auf Kosten anderer zu erreichen.
Diese Kategorien sind nicht immer klar voneinander abgegrenzt, und Menschen nehmen in verschiedenen Situationen unterschiedliche Kommunikationstypen an. Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sind daher entscheidend für eine effektive Kommunikation mit anderen Personen. In der Prüfung wird erfahrungsgemäß meistens ein Kommunikationsstil stabil beibehalten. Auf die verschiedenen Kommunikationsebenen in der mündlichen Prüfung werde ich nun genauer eingehen.
Die verschiedenen Kommunikationsebenen
In der mündlichen Prüfung müssen Sie die besondere Herausforderung meistern, auf verschiedenen Ebenen mit mehreren Personen gleichzeitig zu kommunizieren. Und weil das noch nicht anspruchsvoll genug ist, gesellen sich zu den anwesenden ganz realen Prüfern und Beisitzern auch noch die fiktiven Patienten, um die es ja nun eigentlich geht. Hier ist nicht nur Struktur, sondern es sind auch Fantasie und Kommunikationsstrategie gefragt. Das ist nicht einfach, kann aber trainiert werden. Als Erstes sollten Sie sich bewusst machen, dass die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen abläuft: der verbalen, non- und paraverbalen Ebene.
Die
verbale Kommunikation
findet mit geschriebenen oder gesprochenen Worten und Sätzen statt.
Die
nonverbale Kommunikation
findet bewusst und unterbewusst durch Mimik, Gestik und Körperhaltung statt.
Die
paraverbale Kommunikation
findet durch die Art des Sprechens statt. Lautstärke, Tempo, Klang und Melodie spielen eine Rolle.